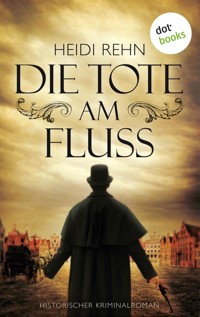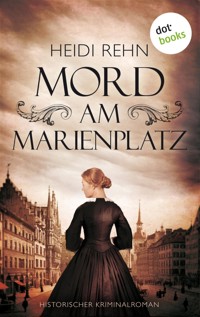6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frühling 1919: Die junge Lou will nach dem tragischen Tod ihres Verlobten in den Wirren der Münchner Räterepublik nur noch eines: vergessen! Um ihren Schmerz zu betäuben, stürzt sie sich in das Bohème-Leben der frühen Zwanzigerjahre. Doch wie ein schwarzer Schatten hängt die Vorstellung über ihr, allen Menschen, die ihr nahestehen, Unglück zu bringen. Als sich dieser Glaube ein weiteres Mal zu bewahrheiten scheint, bleibt ihr nur noch ein letzter Ausweg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Heidi Rehn
Tanz des Vergessens
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Frühling 1919: Die junge Lou will nach dem tragischen Tod ihres Verlobten in den Wirren der Münchner Räterepublik nur noch eines: vergessen! Um ihren Schmerz zu betäuben, stürzt sie sich in das Bohème-Leben der frühen Zwanzigerjahre. Doch wie ein schwarzer Schatten hängt die Vorstellung über ihr, allen Menschen, die ihr nahestehen, Unglück zu bringen. Als sich dieser Glaube ein weiteres Mal zu bewahrheiten scheint, bleibt ihr nur noch ein letzter Ausweg …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Glossar
Nachbemerkung
Für Eva und Jonas
Die Erinnerungen verschönern das Leben,
aber das Vergessen allein macht es erträglich.
(Honoré de Balzac, 1799–1850)
Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.
(aus der Operette »Die Fledermaus« von Johann Strauss, 1874)
Die kleinen Freuden aufpicken, bis das große Glück kommt. Und wenn es nicht kommt, dann hat man wenigstens die »kleinen Glücke« gehabt.
(Theodor Fontane, 1819–1898)
1
So also fühlte sich das Glück an. Lou hatte es geschafft. Die Dämonen waren besiegt, sie war zurück auf der Sonnenseite des Lebens. Endlich konnte sie vergessen. Von hinten schlang Curd ihr die Arme um die Taille, schmiegte sich eng gegen ihren Rücken und bettete das Kinn auf ihre Schulter. Ihm war in den letzten Wochen gelungen, worum sie monatelang verzweifelt gekämpft hatte: ihr wieder ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern und das lähmende Schuldgefühl niederzuringen. Ein warmer Sonnenstrahl kitzelte sie auf der Nasenspitze. Dennoch wollte sie die Augen nicht öffnen. So groß ihr Glück im Kleinen gerade war, so wenig waren die Umstände im Großen derzeit dafür bereit.
Obwohl der Mai längst begonnen hatte, fegte seit Tagen Schneeregen durch die Stadt. Das passte zwar bestens zu den chaotischen Zuständen, die seit der Ermordung Kurt Eisners und der Ausrufung der zweiten Räterepublik in der bayerischen Hauptstadt herrschten, zum ersten Nachkriegsfrühling passte das allerdings ebenso wenig wie zu ihren Hochzeitsplänen. Seit letztem Mittwoch ging wegen des Generalstreiks gar nichts mehr, seit Donnerstag tobte der Kampf der Weißgardisten gegen die Spartakisten offen in der Stadt. Freikorpsverbände und Truppen der Reichswehr hatten einen undurchlässigen Ring um München geschlossen. Der Zugverkehr war unterbrochen, die Telefonleitungen gekappt. Kein halbwegs vernünftiger Mensch wagte sich mehr vor die Tür. Im Zweifelsfall genügte ein falsches Wort, um auf offener Straße standrechtlich erschossen zu werden. Unter diesen Umständen zum Standesamt zu gehen wäre Wahnsinn. Dabei riskierte man, zur Witwe zu werden, noch ehe der Bund fürs Leben offiziell besiegelt war. Wie viel klüger war es dagegen, sich den lieben langen Tag mit seinem Liebsten im Bett zu verkriechen und einzig der Liebe zu frönen! Das ging auch ohne Trauschein.
In Lous Bauch rumorte es. Mit ihren achtzehneinhalb Jahren war ihr der Hunger in allen Varianten vertraut. Ihre Erinnerungen reichten kaum mehr in die Jahre vor dem Krieg zurück, als noch goldene Zeiten und Überfluss geherrscht hatten. Der frühe Tod der Eltern und der überstürzte Weggang aus ihrer Heimatstadt Augsburg im letzten Herbst hatten sie ohnehin in unsichere Verhältnisse gestürzt. Curd ging es mit seinen gerade vierundzwanzig Jahren kaum besser, zumal er einige davon in den Schützengräben verbracht hatte. Lou fiel ein hervorragendes Mittel ein, um die Leere im Bauch für eine Weile zu vergessen. Sie rollte sich zurück auf den Rücken, tastete mit dem Fuß nach Curds Bein und rieb die Hüfte aufreizend an seiner. Statt ihr Begehren zu erwidern, erhob er sich aus dem Bett.
»Was ist?« Sie setzte sich auf, fuhr sich mit beiden Händen durch die kastanienfarbenen, kinnlangen Haare und blinzelte in die blendende Helligkeit. Curd stand vor dem brusthohen Gaubenfenster des engen Mansardenzimmers und versuchte, einen Blick auf die Straße zu erhaschen. Im gleißenden Sonnenschein schimmerte sein nackter, ausgemergelter Leib jungfräulich weiß. Markant unterteilten die eckigen Kniegelenke die langen Beine. Die Pobacken hatten jegliche Rundung verloren, auf dem Rücken zeichneten sich die einzelnen Wirbel spitz ab. Der Anblick dauerte Lou. Entschlossen schlug sie die Decke zurück, schwang die Beine über die Bettkante und begann, den Refrain von Walter Kollos Lied Ach Jott, wat sind die Männer dumm zu summen, um Curds Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Statt sich umzudrehen, presste er die Nase jedoch nur fester gegen die Fensterscheibe.
»Hörst du das?« Mit erhobenem Zeigefinger wandte er sich nach einer gefühlten Ewigkeit wieder um.
»Da ist nichts.« Bedauernd zuckte sie mit den Schultern.
»Genau das ist es ja!« Curd kam zu ihr zurück und strahlte sie an. Seine grünbraunen Augen sprühten vor Übermut. »Da ist nichts mehr zu hören. Kein Schuss, kein Knall, kein gar nichts. Nicht einmal die Kirchenglocken läuten. Dabei ist Sonntag und außerdem der vierte Tag, an dem die Weißen versuchen, die Roten niederzuknüppeln und die Stadt zurückzuerobern.«
»Aber das heißt …«, setzte Lou an, um sofort von ihm unterbrochen zu werden: »Das heißt, es wird nicht mehr geschossen und gekämpft. Es ist vorbei, Lou! Wir können wieder auf die Straße. Lass uns feiern! Ich brauche frische Luft. Wir könnten zur Isar gehen oder in den Englischen Garten. Beim Monopteros lässt es sich wunderbar auf der Wiese tanzen.«
Neckend begann er zu singen: »Links geht der Ferdinand und rechts Luise …«
»Du sollst mich nicht Luise nennen!« Sie griff nach dem Kopfkissen, um ihm den Mund zu stopfen.
»Ist ja gut, mein Luischen, ich hör schon auf.« Frech grinsend wehrte er den Angriff ab. »Judith hat recht: Du bist eine richtig verruchte Lou, natürlich mit o und u. Wenn du nur nicht so viele Männer verschlingst wie deine berühmte Namensvetterin Lou-Andreas Salomé!«
»Lass dich überraschen.« Sie wollte ihn küssen, er aber wich ihr von neuem im letzten Moment aus.
»Wir müssen raus! Nach dem entsetzlichen Grau der letzten Tage ist mir nach frischem Grün. Bestimmt trauen sich auch die Spatzen wieder an die Luft. Lang schon habe ich keinen Vogel mehr zwitschern hören. Das Knurren unserer Mägen und das Schießen der Gewehre haben alles andere übertönt. Ach, ich freue mich so, dass es endlich vorbei ist.«
»Ist es dir völlig egal, wer gesiegt hat?« Sie musterte sein bartloses, fein gezeichnetes Gesicht, das durch die eingefallenen Wangen noch vornehmer wirkte. »Wer weiß, was uns blüht, wenn die Freikorpsler die Räteregierung zerschlagen haben?«
»Wir sind Theaterleute. Was kümmert uns die Politik? Als Österreicher muss ich mich sowieso nicht entscheiden. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre habe ich keine Lust mehr, mich auf eine bestimmte Seite zu schlagen. Egal, ob die Weißgardisten oder die Spartakisten gesiegt haben: Hauptsache, sie hören auf, wild um sich zu schießen! Lass uns den Frühlingstag genießen und unsere Liebe leben. Ab sofort sind wir nur noch glücklich!« Voller Übermut lief er zum Grammophon in der gegenüberliegenden Zimmerecke, wählte eine Platte aus, legte sie vorsichtig auf die Drehscheibe, kurbelte das Gerät an und setzte die Nadel auf. Erst drang nur Knistern und Rauschen an ihre Ohren, bis sich eine fröhliche Walzermelodie herauskristallisierte und das Orchester zu Paul Linckes O Frühling, wie bist du schön anhob. Sogleich begann Curd durch die enge Mansarde zu tanzen und die Melodie mitzusummen. Am Bett angelangt, verneigte er sich vor ihr. Lächelnd reichte sie ihm die Hand, erhob sich und folgte ihm ebenso splitterfasernackt wie er im Rausch des Dreivierteltakts durch die winzige Wohnung.
»Statt zum Englischen Garten könnten wir auch zum Marienplatz gehen und uns umhören, wann die Ämter wieder öffnen«, schlug sie vor, sobald er sie in einer schwungvollen Pirouette um die eigene Achse gewirbelt und exakt mit dem Schlussakkord zum Stehen gebracht hatte. »Dann können wir endlich beim Standesamt das Aufgebot bestellen. Verlobt sind wir lang genug. Jetzt wird geheiratet.«
»Du gibst wohl nie auf.« Er versetzte ihr einen kecken Nasenstüber.
»Ich erinnere dich nur an dein Versprechen.«
»Zuerst müssen wir etwas in den Magen kriegen, sonst schaffen wir den weiten Weg zum Standesamt nie, geschweige denn den zum Traualtar. Ich sterbe vor Hunger. Lass uns zum Theater in die Augustenstraße gehen. Theres Thalhammer hat mir letztens gesteckt, bei ihrem Bruder auf dem Land könne sie noch Speck und Rüben auftreiben. Wenn wir Glück haben, hat sie schon …«
»Gib zu, du kriegst kalte Füße«, unterbrach sie ihn.
»Natürlich kriege ich die. Ist das ein Wunder bei einer so zielstrebigen Braut wie dir?« Er versiegelte ihr mit einem langen Kuss den Mund.
»Um das Ganze zu beschleunigen, gehst du am besten allein in die Augustenstraße«, bestimmte sie, sobald er von ihr abließ. »Falckenberg schuldet dir noch den Lohn für deine letzten Entwürfe. Er soll dir gleich einen ganzen Sack Rüben dafür geben, schließlich hast du ihm die Skizzen für die neuen Bühnenbilder schon letzte Woche geliefert. Pasetti muss nie so lang auf seine Bezahlung warten.«
»Der ist auch fest bei den Kammerspielen angestellt.«
»Und er hat keine ungeduldige Verlobte zu Hause, die schnellstmöglich mit ihm zum Standesamt will.«
»Vielleicht ist das das Geheimnis seines Erfolgs.«
»Warte nur!« Spielerisch versetzte sie ihm eine Ohrfeige.
Im Treppenhaus erklangen fröhliche Stimmen, Schritte näherten sich der Wohnungstür. Judith und Max! Ehe Lou nach dem Hemd über der Stuhllehne greifen konnte, um ihre Blöße notdürftig zu bedecken, war Curd in seine Hosen gestiegen und halb nackt zur Tür geeilt. Erfreut riss er sie auf. »Hereinspaziert, meine Lieben! Wie schön, dass ihr euch auch wieder einmal hertraut.«
»Wir kommen wohl zu früh?«, stellte Max mit einem amüsierten Blick auf Curds unbekleideten Oberkörper und Lous nackten Leib fest, als er hinter Judith die Mansarde betrat. Eilig riss Lou sich wenigstens das Hemd vor die Brust und spürte voller Entsetzen, wie heiß ihre Wangen glühten. Ungeniert betrachtete Max sie. »Bleib so. In diesen trübseligen Zeiten bietest du einen wunderbar erfrischenden Anblick.«
»Der aber nicht dir gebührt.« Schützend breitete Curd die Arme vor ihr aus.
»Gib dir keine Mühe. Mit der schönen Lou kommst du leider nicht im Geringsten mit.« Judith trat vor die Kommode, öffnete eine der Schubladen und kramte ein frisches Hemd heraus, das sie ihm reichte.
»Zu Befehl, Oberst Lichtblau!« Er salutierte und streifte es gehorsam über. Dabei gewährte er Max erneut freie Sicht auf Lou. Grinsend lehnte der sich mit vor der Brust verschränkten Armen ans Bettende. »Mein alter Freund Curd hat wirklich Geschmack. Schade nur, dass er bei Lou schneller war als ich. Eigentlich fällt es mir schwer, ihm den Triumph zu gönnen. Trotz der schmächtigen Brust und der spitzen Beckenknochen muss er etwas haben, was ich nicht habe. Verrätst du es mir, Lou? Am besten unterhalten wir beide uns bei einem Tänzchen über die nicht vorhandenen Vorzüge meines angeblich besten Freundes.«
Er suchte eine Platte heraus, tauschte sie gegen den Walzer von vorhin und setzte das Grammophon in Bewegung. Artig verbeugte er sich erst vor Judith, dann vor Curd, um zuletzt Lou aufzufordern. Das Leuchten in seinen Augen gefiel ihr. Rasch zog sie das viel zu große Herrenhemd über und ergriff die dargebotene Hand.
Sobald sie Wange an Wange die ersten Schritte zu Walter Kollos Rheinländer Komm, hilf mir mal die Rolle drehn gesetzt hatten, hielt es auch Judith und Curd nicht mehr auf ihren Plätzen. Wie so oft in den letzten Wochen durchschritten sie alle vier zum Takt der Musik die kleine Wohnung, vollführten im Flur und in der Küche die erforderlichen Drehungen, tanzten zurück ins Vorderzimmer, stampften kräftiger als nötig mit den Füßen auf.
»Eure armen Nachbarn!«, mahnte Judith, als die Platte zu Ende war und sie außer Puste stehen blieben.
»Außer der Gruberin aus dem ersten Stock ist mir bislang noch keine der Herrschaften untergekommen, und die wohnt weit genug weg«, stellte Lou fest. Das Tanzen hatte sie erhitzt, das dünne Hemd klebte ihr auf der Haut. In dem Aufzug so nah bei Max zu stehen verunsicherte sie. Rasch flüchtete sie zu Curd.
»War ich ein so schlechter Tänzer, dass du vor mir wegrennst?« Max grinste.
»Sei ein guter Verlierer und trag es mit Fassung. Schließlich bin ich auch noch da.« Judith nahm seinen Kopf in beide Hände und gab ihm einen langen Kuss auf den Mund. Zunächst schien er protestieren zu wollen, dann ergab er sich seinem Schicksal.
»Genug!«, konstatierte sie schließlich. »Zeit, sich dem Alltag zu stellen.«
Rasch hatte sie auch für Lou frische Wäsche aus der Kommode gefischt und reichte sie ihr. Enttäuscht verzogen die beiden Männer das Gesicht. Sie waren nicht nur gleich alt, sondern auch gleich groß und von verblüffend ähnlicher Statur. Lediglich die Haarfarbe unterschied sie. Von weitem gingen sie deshalb oft als Zwillinge durch, was sie gern nutzten, um Verwirrung zu stiften.
»Du könntest etwas Sinnvolles tun und in der Küche Essbares auftreiben, Max. Lou dabei zuzugucken, wie sie sich anzieht, macht leider nicht satt.«
Energisch drängte Judith ihn zur Tür, kam schnell wieder zurück und sah nun ihrerseits Lou ebenso interessiert beim Anziehen zu wie Curd. Aus der kleinen Küche drangen das Klappern von Topfdeckeln und das Zuschlagen von Schranktüren. Ausnahmsweise schien Max Judiths Anweisung widerspruchslos zu befolgen. Curd lehnte sich lässig an den Türrahmen, Judith schmunzelte, allerdings war Lou sich nicht sicher, ob über Max’ vergebliche Suche oder über sie. Die drei Wiener Freunde umfing die beneidenswerte Vertrautheit, die Lou seit der ersten Begegnung in Bann gezogen hatte, ihr aber zugleich das Gefühl verlieh, niemals so ganz zu dem Kleeblatt dazuzugehören. Eifersucht beschlich sie. Mühsam rang sie sie nieder. Die Freundschaft zwischen den dreien war etwas ganz Eigenes und hatte mit Curds Liebe zu ihr nichts zu tun.
»Hier ist leider nichts.« Max kehrte in dem Moment aus der Küche zurück, als sie sich das dünne Wollkleid überstreifte, das Judith vom Haken neben der Tür genommen und ihr gereicht hatte. »Dafür habe ich das hier gefunden.«
Er schwenkte einen Rucksack in der Luft.
»Gib her!« Lou entriss ihn ihm energisch. Behutsam strich sie die Verschlusslasche glatt. Darauf hatte sie eine Applikation aus bunten Leder- und Stoffresten begonnen.
»Der sieht wunderschön aus. Was hast du damit vor?«
Neugierig besah sich Judith den Rucksack, auch Curd und Max betrachteten ihn interessiert. Eigentlich war es ein altes Stück aus abgewetztem Leder und zerschlissenem Kattun, das vermutlich einmal zart lindgrün eingefärbt gewesen war, nun aber speckig braun glänzte. Allein die Verschlusslasche hob sich dank des bunten Mosaiks auffällig ab.
Lou war es peinlich, wie aufmerksam die anderen die halbfertige Arbeit musterten. Rasch presste sie sich den Rucksack gegen die Brust. »Den will ich der Thalhammerin zum Tausch anbieten. Vielleicht kann sie uns dafür ein dickes Fresspaket besorgen.«
»Das muss aber ein sehr, sehr dickes Fresspaket sein.« Judiths Stimme verriet aufrichtige Bewunderung. »Hoffentlich weiß die Gute das Kunstwerk zu schätzen.«
»Ach, das ist doch nichts Besonderes«, wehrte Lou ab.
»Doch, das ist etwas ganz Besonderes«, widersprach Max.
»Ich habe dir gleich gesagt, dass du eine Künstlerin bist«, pflichtete Judith bei. »Als Aushilfsnäherin verkaufst du dich bei den Kammerspielen viel zu billig. Bist du nicht gelernte Täschnerin?«
»Was nutzt die hehre Kunst, wenn man nichts zu beißen hat?« Curd legte besitzergreifend den Arm um Lous Schultern. »Ich finde es eine hervorragende Idee, der Thalhammerin den Rucksack anzubieten. Dafür wird sie uns bei ihrer Verwandtschaft auf dem Land eine ordentliche Portion Eier, Speck und Würste organisieren. Und wir können uns endlich einmal wieder ordentlich satt essen.«
»Am besten bringen wir ihn heute Nachmittag zu ihrer Wohnung in die Heßstraße«, schlug Lou vor. »Es muss ja nicht gleich jeder im Theater sehen, was wir ihr …«
»Wie immer hast du recht.« Stolz sah Curd seine Freunde an, bevor er sie auf die Stirn küsste. »Ich schlage vor, wir drei kümmern uns jetzt um einige Bissen Brot für dich als Stärkung. Sonst kannst du vor lauter Hunger am Ende die Nadel nicht mehr halten, und der Rucksack wird nie fertig. Am Nachmittag gehen wir dann zur Thalhammerin, um sie mit dem Prachtstück zu überraschen.«
Er küsste Lou noch einmal auf die Wange, bevor er die letzten Knöpfe an seinem Hemd schloss, den Kragen um den Hals befestigte und die Hosenträger über die Schultern zog. Max nutzte die Gelegenheit, um Lou noch einmal zu umarmen und zu küssen. Sie fasste es als Scherz auf und ging lachend darauf ein. Triumphierend grinste Max Curd an.
»Beeilt euch lieber«, mahnte Lou. »Mein Magen hängt schon bis zum Boden durch. Bekomme ich nicht bald was zwischen die Zähne, kann ich den Rucksack tatsächlich nicht mehr fertignähen, und dann wird das nichts mit den Eiern und dem Speck vom Land. Weder für mich noch für Curd, und für euch zwei sowieso nicht.«
»Habe ich es nicht gewusst?« Wieder strahlte Curd übers ganze Gesicht. »Meine Lou ist einfach eine Wucht. Lasst uns losziehen und ihr schnell etwas zu essen besorgen. Wir müssen sie bei Laune halten, damit sie fleißig arbeiten kann.«
Entschlossen drängte er Judith und Max zur Tür. Als die beiden schon im Treppenhaus waren, kehrte er noch einmal um und verabschiedete sich von Lou mit einem neuerlichen Kuss. Trotz der aufgestauten Wärme in dem kleinen Dachzimmer fröstelte es sie. Sie klammerte sich an ihn.
»So wird das nie was mit dem Sattwerden.« Sanft schob er sie fort. »Dabei weißt du doch, dass du mich mit leerem Bauch nie zum Standesamt kriegst.«
»Hau endlich ab, du Schlawiner!« Ein dicker Kloß im Hals erschwerte ihr das Reden. Sie brachte es kaum fertig, ihm nachzusehen, wie er Stufe für Stufe hinter den anderen die ausgetretene Holztreppe nach unten stieg. Genau dasselbe hatte sie schon einmal erlebt. Auch den Bruder hatte sie an jenem verhängnisvollen Tag im März letzten Jahres nach lustigem Herumalbern allein in die Stadt geschickt, um Essen aufzutreiben, während sie noch etwas Dringendes erledigen wollte. Und dann war er unter die Elektrische geraten.
2
Bevor Lou mit der Arbeit begann, hielt sie den Rucksack noch einmal in die Höhe und musterte ihn. Judith hatte recht: Der sollte dem gutmütigen Landei von Thalhammerin aus der Theatergarderobe mindestens ein ganzes Huhn nebst einem Korb Eier und einiger weiterer Kostbarkeiten wert sein. Das würde eine Weile vorhalten. Danach wurde es allerdings eng. Die Schallplatten und das rote Koffergrammophon würde Curd niemals hergeben. Alles andere, was sich zum Tauschen eignete, war längst fort. Lediglich das, was sie auf dem Leib trugen, sowie mehrere Garnituren Unterwäsche nebst etwas Oberkleidung zum Wechseln und die Winterjacken besaßen sie noch. Und natürlich sich selbst, wie Curd in solchen Momenten schelmisch grinsend festzustellen pflegte, um sie voller Gier aufs Bett zu werfen. Die letzte Nacht kam ihr in den Sinn, und gleich stieg die vertraute Hitze in ihr auf. Curd lachte und liebte einfach alle Sorgen weg. Auch seine Freunde Judith und Max verstanden sich aufs Vergnügen, trotz der schrecklichen Kriegsjahre, die ihre Jugend überschattet hatten.
Kaum dachte sie an die beiden, wurde ihr erneut heiß. Vorhin, lediglich mit einem dünnen Hemd bekleidet, eng mit Max getanzt zu haben beunruhigte sie. So sollte sie nur empfinden, wenn Curd sie in den Armen hielt. Mit ihm war sie seit Februar verlobt, ihm hatte sie ewige Liebe geschworen. Genug! Bevor sie sich in verbotenen Träumereien erging, sollte sie sich lieber beeilen, um der Thalhammerin am Nachmittag den fertigen Rucksack bringen zu können. Dann hätten sie wenigstens etwas zu essen. War der Generalstreik erst einmal beendet und der Terror vorbei, bliebe Curd keine Ausrede mehr. Dann musste er mit ihr zum Standesamt, und damit hatte auch die Verwirrung mit Max ein Ende.
Von neuem betrachtete Lou den halbfertigen Rucksack. Es gab noch viel zu tun. Sie rückte den Schemel vors offene Fenster, um die warme Frühlingsluft zu genießen. Zaghaftes Vogelgezwitscher drang an ihr Ohr. Endlich hielten die wahren Frühlingsboten Einzug in der Stadt. Munter summte sie Im Prater blüh’n wieder die Bäume von Robert Stolz, einen von Curds Lieblingswalzern, griff nach der Nähahle, fädelte einen langen, gewachsten Leinfaden ein und begann mit der Arbeit.
Wie lang sie, tief über das Leder gebeugt, dagesessen und die Ahle mit aller Kraft durch die vorgestochenen Löcher in das dicke Leder geführt hatte, hätte Lou nicht zu sagen vermocht. War sie einmal in die Arbeit vertieft, vergaß sie darüber Raum und Zeit, nahm nur noch wahr, was unter ihren Händen entstand. Der intensive Geruch des Leders betäubte ihr die Sinne. Irgendwann aber schmerzten nicht nur die von rissiger Hornhaut überzogenen Fingerkuppen, auch der Rücken tat ihr weh. Sie richtete sich auf und streckte sich.
Ihr Blick fiel auf den wolkenlosen Himmel. Kaum zu glauben, dass am Tag zuvor noch Schnee gefallen war. In der letzten Aprilwoche war der Winter zurückgekehrt und hatte den in der Stadt herrschenden Ausnahmezustand durch heftiges Schneetreiben und eisige Kälte noch verschlimmert. Plötzlich fror Lou und hauchte sich in die kalten Hände. Die Sonne war um die westlich der Kaulbachstraße gelegene Häuserzeile gewandert, im Schatten wurde es rasch wieder empfindlich kühl. Lou schloss das Fenster.
Mittag musste vorüber sein. Wo Curd und die anderen nur steckten? Hätten sie den direkten Weg zur Augustenstraße genommen, hätten sie längst zurück sein müssen, selbst wenn sie sich mit Falckenberg auf eine längere Diskussion über die ausstehende Bezahlung eingelassen hatten. Lou wurde blümerant. Mit einem unheilvollen Rumoren meldete sich ihr leerer Magen. Dringend brauchte sie etwas zu essen. Sie sank zurück auf den Schemel, lauschte von neuem nach draußen.
Außer dem Vogelzwitschern war es nach wie vor ungewöhnlich still. Die Glocken von Sankt Ludwig läuteten immer noch nicht, ebenso wenig waren allerdings auch Schüsse zu vernehmen. Dafür drangen erstmals seit langem wieder menschliche Stimmen herauf, und zwar nicht als verzweifelte Schreie oder bellende Befehle, sondern eher so, als unterhielten sich Passanten in ganz normaler Lautstärke. Lou schöpfte Hoffnung. Vielleicht waren das die drei Wiener Freunde, die sich auf der Straße mit anderen über das Geschehen austauschten. Bestimmt erklangen bald ihre Schritte auf der Treppe, und Curd stürmte mit einem dicken Pack Essen in die Wohnung. Lous Finger zitterten, als sie die Ahle wieder aufnahm. Unter Mühen konzentrierte sie sich auf eine der letzten Nähte. Bald wäre der Rucksack fertig, Curd und die anderen kämen nach Hause und sie kochten gemeinsam. Für einen Moment schloss sie die Augen und meinte schon, den Geruch von frisch geschmortem Kohl oder Rüben in der Nase zu haben. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen.
Unter ihren geschickten Fingern nahm der neue alte Rucksack schnell Gestalt an. Es fehlte lediglich noch eine kleine Stickerei, dann war das gute Stück fertig. Geschafft! Stolz verknotete Lou das Garn, versorgte die Enden und schnitt den Faden ab. Sie stemmte die Hände in den schmerzenden Rücken und sah wieder zum Fenster hinaus. Dünne Schleierwolken zogen über das blaue Firmament. Auf dem Dachfirst der gegenüberliegenden Häuser schimmerte die Sonne. Es war Nachmittag! Und von Curd und den beiden anderen noch immer keine Spur.
Beunruhigt hängte Lou den Rucksack über den Bettpfosten und räumte das Werkzeug zusammen. Sie sollte zur Gruberin hinuntergehen. Gegen das Versprechen, ihr die Stiefel auszubessern, teilte die bestimmt ein Stück Brot mit ihr und versorgte sie mit Neuigkeiten. Gewiss war ihr Mann schon beim ersten Morgengrauen in der Stadt gewesen. Seit Tagen spielte Ludwig Gruber mit dem Gedanken, sich dem Freikorps anzuschließen. Solange allerdings nicht sicher war, wer letztlich die Oberhand gewann, die Weißen oder die Roten, zögerte er noch und schlich jeden Morgen um fünf nach Ende der nächtlichen Ausgangssperre aus dem Haus, um die aktuelle Lage abzuschätzen. Wenn einer also wusste, was die anhaltende Stille in den Straßen zu bedeuten hatte, dann die Gruberin. Lou ordnete sich das Haar, schnappte sich noch die Strickjacke sowie den rotgemusterten Schal vom Haken und verließ die Mansarde.
Auf dem Weg nach unten begann ihr Herz heftiger zu schlagen. Insgeheim fürchtete sie sich ein wenig vor der Gruberin. Ihr Gatte arbeitete in einem der Ministerien in der Ludwigstraße. Zwar schien er lediglich eine einfache Position zu bekleiden – Lou vermutete Schreiber oder Pedell oder dergleichen –, dennoch machte die Gruberin großes Gewese darum. Wahrscheinlich hielt sie Curd, Lou und die beiden anderen schon ihrer Tätigkeit beim Theater wegen für Revoluzzer, noch dazu, wo sie nicht verheiratet waren. Dass Curd wie seine Freunde gebürtiger Wiener und nach wie vor österreichischer Staatsangehöriger war, musste ihr noch verdächtiger erscheinen. Ganz schlimm würde es wohl, wenn sie erst erführe, dass er und Max schon ein knappes Jahr vor Kriegsende die Front verlassen und beim Burgtheater in Wien angefangen hatten. Von dort waren sie im letzten Herbst an die Kammerspiele nach München gewechselt. Wenigstens stammte Lou aus einer gutbürgerlichen bayerischen Familie und verstand sich aufs Lederhandwerk.
»Frau … äh … Fräulein …« Wie so oft geriet die stämmige Nachbarin mit dem strengen Dutt und dem aufgedunsenen Gesicht bei der Suche nach der richtigen Anrede erst einmal ins Stottern. »Wenn das mal keine Überraschung ist.«
Neugierig glitt ihr Blick über Lous zierliche Gestalt. Die Gruberin war gut einen Kopf größer und mindestens doppelt so breit. Fahrig strich sie sich die vom Kochen feuchten, stark geröteten Finger an der Schürze ab und hieß Lou in den dämmrigen Wohnungsflur eintreten. Aus der Küche zog ein verführerischer Geruch nach Suppe in den Flur.
»War Ihr Mann heute schon in der Stadt?«, erkundigte sich Lou vorsichtig. »Weiß er vielleicht, was die plötzliche Stille bedeutet? Sind die Kämpfe vorbei?«
»Is was passiert? Ganz blass schauen S’ aus.«
»Mein Verlobter ist in der Früh zum Theater in die Augustenstraße.« Nervös krallte Lou die Finger in den Stoff ihres Kleides. »Seine beiden Freunde sind mit. Eigentlich hätten sie schon längst zurück sein müssen. Weil Ihr Mann doch oft nachschauen geht, wie es draußen steht, dachte ich …«
»Jessesmaria!« Die Gruberin schlug sich die Hand vor den Mund. »Kommen S’ erst einmal mit. Der Ludwig soll’s Ihnen selbst erzählen.« Beim Betreten der Küche nahmen der Suppengeruch wie der Kochdunst Lou zunächst den Atem. Das Fenster war geschlossen. Dick schlug sich der Dampf an den Scheiben nieder. Der Ehemann der Gruberin hockte am hinteren Tischende, flankiert von dem halbwüchsigen Sohn Sepp und der zwölfjährigen Tochter Marie. Trotz der Nachmittagsstunde standen randvolle Teller vor ihnen. Auch der Bierkrug fehlte nicht. Neugierig blickten sie ihr entgegen. Lou nickte ihnen scheu zu.
»Setzen S’ Eahna und essen S’ erst einmal was. Ausschaun tun S’, als könnten S’ gut was vertragen.« Die Gruberin drückte sie auf den freien Stuhl und reichte ihr einen Löffel. Mit dem fleischigen Kinn wies sie aufmunternd zu einem Suppenteller, aus dem sie offenbar selbst hatte essen wollen. »Langen S’ ruhig zu. Wenn Ihnen der Bauch zwischen den Knien hängt, werden Sie’s wohl kaum schaffen, nach Ihrem Verlobten zu suchen. Mein Ludwig geht nachher mit. Nicht, dass Ihnen auch noch was passiert.«
Lou erschrak. Was sollte das heißen? Bevor die Gruberin sie beruhigen konnte, fragte ihr Mann erstaunt: »Was tu ich nachher?«
Die Gruberin winkte ab und erklärte wichtigtuerisch: »Einem Freikorps hat er sich angeschlossen, gleich heut in der Früh. Genau so, wie’s in dem Aufruf vom Ministerium heißt, dass man’s tun soll, um den Roten endgültig den Garaus zu machen. Schauen S’ nur die weiße Binde an seinem Arm. Das heißt, dass er jetzt zu den Regierungstruppen gehört. Schaut gut aus, was?«
»Also haben die Weißen gesiegt?«, hakte Lou leise nach, woraufhin die Gruberin bestätigend nickte.
»Das rote Gesindel ham s’ gestern Nacht niedergerungen. Fünfzig von den Spartakisten ham s’ draußen in Stadelheim erschossen, heißt’s. Am Stachus und am Stiglmaierplatz sollen s’ noch mehr derwischt ham. Dem Herrgott sei Dank! Damit ist der rote Spuk vorbei. Aber ausschauen tut’s in der Stadt, als wär Krieg gewesen. Allein gehen S’ da besser ned naus. Grad ned als junges Fräulein. Der Ludwig kommt mit. Der weiß, wie er mit die Leut zu reden hat.«
So hungrig Lou eben noch gewesen war, hatten ihr jetzt die Schilderungen der Gruberin den Appetit verdorben. Auf einen Schlag waren die düsteren Ahnungen wieder da. Sie hatte Karl geliebt und allein fortgehen lassen, sie liebte Curd und war am Morgen nicht mitgegangen. So durfte sie das Schicksal nicht herausfordern.
»Gemma.« Ludwig Gruber zwängte den dicken Leib zwischen Stuhl und Tischkante hervor, trank das Bier im Stehen und wischte sich den Mund. Ein Teil des Schaums blieb in seinem Bart hängen. Barsch wies er die Tochter an: »Hol mir mei Jackn!«
Noch während er sich hineinhelfen ließ, fragte er Lou: »Wo wollen S’ überhaupt hin?«
»Na zum Theater«, mischte sich die Gruberin ein und zupfte den weißen Stoffstreifen zurecht, der ihn auch an der Jacke als treuen Regierungsanhänger auswies. »Dort wird der Herr Verlobte mit den andern beim Bier ratschen, wie ihr Mannsleut’s gern tut, während wir Weibsleut daheim vergehn vor Angst.«
»Aber Curd hat mir …«, widersprach Lou zaghaft, doch von neuem kam ihr die Gruberin zuvor. »Gehen S’ nur zu mit meinem Ludwig. Wenn der Herr Verlobte mit seine Freund’ derweil hier auftaucht, sag ich ihm Bescheid, wo S’ hin san.«
»Bleima da ned besser glei da und warten, bis s’ eh widdakomma?« Ludwig Gruber schaute verständnislos zwischen seiner Frau und Lou hin und her.
»Schmarrn!«, erwiderte die Gruberin, reichte ihm seinen Hut und drängte ihn hinaus. »Siehst’s doch, wie’s ihr pressiert. Jetzt geh schon zu!«
»Danke« war alles, was Lou herausbrachte, bevor sie dem Mann mit der weißen Binde der Freikorpsler am Arm folgte.
Schweigend marschierte Ludwig Gruber durch die sonnigen Straßen der Maxvorstadt. Er hatte den typisch männlichen, weit ausholenden Schritt, der keine Rücksicht auf Begleiterinnen mit kürzeren Beinen nahm. Lou musste sich anstrengen, um sein Tempo zu halten. Bald stand ihr der Schweiß auf der Stirn. Selbst das dünne Wollkleid wie auch die Jacke waren ihr rasch zu warm, vom Wollschal ganz zu schweigen.
Ein aufdringlicher Geruch nach Verbranntem und Schießpulver hing über der Stadt. Auf der Ludwigstraße mit ihren beeindruckenden Regierungsgebäuden flanierten überraschend viele Münchner. So ängstlich sie sich in den letzten Tagen in die Häuser verkrochen hatten, so selbstbewusst zogen jetzt ganze Familien im besten Sonntagsstaat umher, um sich die Bescherung draußen anzusehen. Da die Elektrische nach wie vor nicht fuhr und auch kaum Autos oder Droschken unterwegs waren, stand ihnen die gesamte Straßenbreite zur Verfügung. Mit hochgereckten Köpfen, selbstbewusst durchgestreckten Rücken und weit ausholenden Schritten taten die braven Bürger, als hätten sie von Anfang an gewusst, wie der Kampf um die bayerische Hauptstadt ausgehen würde. Frisch gestärkt blitzten die weißen Binden an den linken Oberarmen.
Die meisten zog es zur Feldherrnhalle. Dort waren nach wie vor Barrikaden aus Fuhrwerken, Fässern und Steinen aufgeschichtet, streng bewacht von schwerbewaffneten Truppen, die ganz sicherlich nicht zu den Spartakisten gehörten. Über die gesamte Ludwigstraße lagen wild zerstreut umgekippte Karren sowie Reste von Fässern und Holzbalken. Leere Patronenhülsen auf dem Trottoir, Einschusslöcher an den Fassaden und zerschossene Fensterscheiben in den Häusern zeugten von den Gefechten, die hier getobt hatten. Sichtlich beeindruckt, begutachteten die Flaneure die Kampfspuren, nickten einander einvernehmlich zu und zollten den Weißgardisten beflissen Respekt.
An der Ecke zur Theresienstraße wies eine aus Holzkisten aufgeschichtete Straßensperre darauf hin, dass man nur auf Geheiß der Freikorpsler seines Wegs ziehen durfte. Gruber schien die Wachposten zu kennen. Leutselig scherzte er im Vorbeigehen mit ihnen, dennoch bedachten sie Lou mit einem misstrauischen Blick. In der schnurgeraden, nach Westen verlaufenden Theresienstraße verflüchtigten sich die Schaulustigen. Das Café Stefanie an der Ecke zur Amalienstraße, seit Jahrzehnten Treffpunkt der Boheme, war seit Tagen geschlossen.
Je näher Lou und Gruber der Türkenkaserne kamen, desto öfter fuhren offene Lastwagen an ihnen vorbei, auf denen Soldaten mit Gewehren hockten. Lou wurde unbehaglich, Gruber aber schenkte den Truppen keinerlei Beachtung, weil er sich mit der weißen Armbinde auf derselben Seite wusste wie sie. Im letzten November noch hatten die meisten Münchner wie auch die Soldaten auf Seiten Kurt Eisners und der Roten gestanden, die die bayerische Republik ausgerufen hatten. In den letzten Wochen aber hatte sich die Revolution verselbständigt, bis die Radikalen die Oberhand gewonnen und mit ihrer Politik viele ihrer früheren Befürworter verschreckt hatten. Lou und ihre Freunde waren allerdings wie die meisten Theaterleute viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, um das mitzuverfolgen. Das rächte sich jetzt wohl.
Endlich erreichten sie die Augustenstraße. Lou atmete auf, als sie das vertraute vierstöckige Gebäude erblickte, an dessen Mittelgiebel die Aufschrift »Kammerspiele« prangte. Von außen sah das Haus so friedlich aus wie eh und je, nicht eine Fensterscheibe schien zu Bruch gegangen zu sein.
»Ab hier komme ich allein klar.«
»San S’ sicher?«
»Ich will Sie nicht länger aufhalten.« Sie versuchte sich an einem Lächeln. »Hier ist ja auch alles ruhig.«
Nach einem prüfenden Blick erst zum Theater, dann zu ihr ließ Gruber es bewenden und tippte zum Abschied kurz an seinen Hut. Lou sah ihm nach, bis er um die Ecke zur Theresienstraße verschwunden war.
Niemand schenkte ihr Beachtung, als sie durch die schmucklose Kassenhalle in das Foyer im ersten Stock des Vorderhauses ging. Dort befand sich der mit weißem Holz ausgekleidete Erfrischungsraum, von dem aus der Balkon des Zuschauersaals betreten werden konnte. Tagsüber nutzten die Schauspieler, Bühnenarbeiter und Theaterbediensteten ihn als Aufenthaltsraum.
Wie erwartet hockten mehr als ein Dutzend Künstler in einer der abgeteilten Nischen vor den riesigen Doppelfenstern zusammen. Soweit Lou es zunächst erkennen konnte, waren es überwiegend Männer. Ihre breiten Rücken auf den schlichten Holzbänken dicht aneinander, hatten sie die Köpfe eng zusammengesteckt. Lou fasste sich ein Herz und fragte mitten in die Ausführungen eines der Männer hinein: »Sind Curd und seine Freunde hier gewesen?«
Einen Moment stutzte der Redner, auch die anderen brauchten etwas, bis sie die Frage verstanden hatten.
»Hat einer von euch sie heute schon gesehen?« Ihr Blick streifte die Anwesenden. Jetzt erst erkannte sie gleich links Traudl Wallner, die etwa vierzigjährige Souffleuse mit dem gemütlichen Vollmondgesicht und dem üppigen Dutt, auf der anderen Seite den aus Petersburg stammenden Bühnenbildner Leo Pasetti mit seinem wirren schwarzen Haar und dem nicht weniger wirren schwarzen Bart sowie das von nächtlichen Schreibstunden übermüdete Antlitz von Alfred Neumann, dem zweiten Dramaturgen, der ebenso alt war wie Curd und Max, im Gegensatz zu ihnen aber eine Festanstellung hatte. Die anderen Gesichter verschwammen vor ihrem Blick, der von aufsteigenden Tränen verschleiert wurde. Traudl fasste sie am Arm und zog sie auf die Bank.
»Curd war nur kurz hier«, hörte sie Pasetti in seiner harten Aussprache mit dem rollenden R erklären. Seine dunklen Augen starrten sie an, die Flügel seiner breiten Nase bebten. Rote Adern durchzogen die Haut, aus den Nasenlöchern ragten schwarze Haare. »Er wollte Geld oder Essen oder Lebensmittelkarten. Aber Falckenberg war nicht da, deshalb ist Curd gleich wieder fort.«
»Und Max? War der nicht dabei? Oder Judith? Ihr kennt doch auch Judith Lichtblau, die für Wiener Zeitungen schreibt.« Bang sah Lou in die Runde, meinte, ihr Herz zerspränge ihr, so heftig raste es auf einmal wieder.
»Stimmt, Max und Judith waren auch dabei«, sagte Neumann.
»Bestimmt versuchen sie, woanders was zu essen aufzutreiben«, ergänzte Traudl. »Die drei stecken doch immer zusammen. Unser Wiener Kleeblatt ist eben unzertrennlich.«
Kaum hatte sie das gesagt, merkte sie, dass Lou das falsch verstehen konnte, und fügte rasch hinzu: »Musst dir nichts dabei denken. Die drei hecken sicher aus, wo sie am ehesten einen fetten Braten herbekommen. Wirst schon sehen: Bestimmt werden sie dich nachher damit überraschen.«
Als wäre das das Stichwort gewesen, tauchte aus der leeren Garderobe Theres Thalhammer auf. »Wo gibt’s heut einen fetten Braten?«
Die Runde brach in schallendes Gelächter aus, auch Theres stimmte vergnügt mit ein.
»Ach, Reserl«, erklang vom anderen Ende der Bank der volltönende Bass des Bühnenarbeiters Leonhard. Aus dem vom Alkohol aufgedunsenen und von Sommersprossen besprenkelten Gesicht leuchteten die hellen Augen. »Wenn du’s nicht weißt, wer dann?«
Statt einer Antwort schenkte sie ihm nur ihr breites Grinsen. Jeder am Tisch hatte bereits seine Geschäfte mit der Garderobiere gemacht.
»Hätt mich auch gewundert«, gab sie endlich lachend zurück. »Schweine zum Schlachten gäb’s derzeit zwar genug in der Stadt, aber die richtigen scheinen s’ noch ned derwischt zu ham.«
»Wisst ihr’s schon?«, erklang im selben Moment eine sich vor Aufregung überschlagende Stimme von der Treppe her. Ein leichter französischer Akzent war erkennbar.
Alle fuhren herum. Am obersten Treppenabsatz tauchte Richard Lönsheim auf, Kunststudent aus dem elsässischen Straßburg, der inzwischen öfter an den Kammerspielen als im Malsaal der Akademie anzutreffen war. Sein Gesicht glühte, so schnell musste er nicht nur die Treppen heraufgestürmt, sondern vorher schon durch die Straßen gerannt sein. Bevor er weitersprach, beugte er den Oberkörper nach vorn, um Luft zu schöpfen. Die anderen wurden unruhig. Pasetti trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte, Neumann murmelte etwas vor sich hin. Traudl Wallner schnaufte, als suchte sie nach dem passenden Stichwort, um Richard zum Reden zu bringen. Lediglich die Thalhammerin behielt die Ruhe: »Wenn du’s nicht gleich verrätst, werden wir’s wohl nie erfahren.«
»Der Curd ist tot!«, stieß Richard im Aufrichten aus.
Für einen Moment kehrte unheilvolle Stille ein. Dann erklangen langsame, sehr verhaltene Schritte auf der Treppe. Fassungslos starrte Lou dorthin, ahnte dennoch, wer da noch kommen und Richards grausame Worte bestätigen würde.
Tatsächlich tauchten erst Judith und dann Max hinter dem Kunststudenten auf, blankes Entsetzen auf den Gesichtern.
Da erst begriff Lou.
»Nein!«, gellte ihr Schrei durch den Erfrischungsraum.
Judith, Max und Richard sahen sie an. Als sich ihre Blicke trafen, war Lou, als umklammerte eine eisige Hand ihr Herz.
Curd war tot. Und sie hatte ihn gehen lassen. Allein. Genau wie damals Karl. Die Dämonen in ihrem Kopf erwachten.
3
Ein weiterer Tag, der eigentlich viel zu schön war, um in Trauer zu versinken. Lou meinte ganz deutlich zu hören, wie Curd das zu ihr sagte oder vielmehr sagen würde, stünde er jetzt neben ihr auf dem Ostfriedhof. Trotz der Sommerhitze überlief sie ein kalter Schauer. Fröstelnd rieb sie sich die Arme und machte einen Schritt in den wärmenden Sonnenstrahl, der die Grabreihen und Marterln in verschwenderisch goldenes Licht tauchte. Wie jeden Tag seit Curds Tod vor dreieinhalb Monaten besuchte sie auch an diesem Augustvormittag sein Grab, legte einen Strauß selbstgepflückter Margeriten darauf und starrte das schlichte Holzkreuz an.
»Curd Walther«, verkündeten die goldgelben Lettern, »17.3.1895 Wien – 4.5.1919 München«. Noch immer sträubte sich alles in ihr, das zu begreifen. Nach allem, was er in den letzten Jahren seines viel zu kurzen Lebens durchlitten hatte, war es einfach unfassbar, dass er am ersten schönen Nachkriegsfrühlingstag mitten in München von einer verirrten Kugel niedergestreckt worden war. Lou stierte so gebannt auf die Inschrift, als könnte sie das Geschehene dadurch ungeschehen machen und Curd zu sich ins Leben zurückholen.
Je länger sie so dastand und die einzelnen Buchstaben fixierte, umso mehr verschwammen sie ihr vor Augen. Die Erinnerung an den letzten Walzer mit Curd übermannte sie. Die Melodie schwirrte ihr durch den Kopf, bis die Buchstaben auf dem Kreuz unruhig auf und ab zu tanzen begannen. Schon meinte sie, Curds Hand auf dem Rücken zu spüren, ihn auffordernd zwinkern zu sehen. Sie warf den Rucksack beiseite und tanzte einfach los. Zunächst nur verhalten auf der Stelle, dann etwas mutiger. Schließlich fühlte sie sich vom Fußende des Grabs fortgerissen und schwebte ausgelassen um das Geviert herum. Dabei sang sie leise den Refrain »Das ist die Liebe, die dumme Liebe …« aus Kálmáns Operette Die Csárdásfürstin, die Curd über alles geliebt hatte.
Mit jedem Takt wurden ihre Schritte sicherer, die dunklen Schatten verblassten. Zum ersten Mal konnte sie ohne Schuldgefühle an Curd denken. Nah sah sie sein geliebtes Gesicht vor sich, spürte seinen Atem auf den Wangen, schmeckte seine Lippen auf dem Mund. Es war, als führte er sie tatsächlich zum Walzer umher. Sie wiegte sich im Dreivierteltakt, der Strohhut rutschte zu Boden. Gleichgültig ließ sie ihn liegen und wirbelte ein-, zweimal um die eigene Achse, drehte sich in die andere Richtung, tanzte weiter. Schwungvoll flog der hellblaue Plisseerock auf.
»Oh, là, là, mein Fräulein, warum tanzen Sie so allein?« Wie aus dem Nichts tauchte Max neben ihr auf sowie einige Schritte hinter ihm Judith. Ehe sie ihn bewusst wahrnahm, fasste er sie um die Taille und wirbelte mit ihr um Curds Grab, als befänden sie sich nicht auf dem Friedhof, sondern auf dem Tanzparkett.
Zweimal schon waren sie um das kleine Geviert getanzt, da mischte sich eine dunkle Frauenstimme unter ihr Singen, und Lou erspähte aus dem Augenwinkel, wie Judith sich ebenfalls anschickte, um das Grab zu tanzen.
»Glaubt ma’s? Tanzen am helllichten Tag mitten aufm Friedhof wild umeinander. Dass ihr euch ned schamt, elendes Gschwerl! Wenn das unser Herrgott sieht. Oder der Herr Pfarrer«, krächzte eine Altweiberstimme erbost.
»Ganz recht. Das sieht er besser nicht«, rief Max der Alten zu. »Am Ende würde der Herr Pfarrer noch mittanzen wollen, so, wie man es in Russland bei Beerdigungen tut.«
Schon begann er, wie ein Kosak loszulegen und dazu laut in die Hände zu klatschen. Entrüstet schnappte die in tiefstes Schwarz gekleidete Alte nach Luft, schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr altmodischer Kapotthut auf die Nase rutschte. »Das ist doch … Rotes Gesindel! Verdorbenes Pack! Ausmerzen sollt ma euch, diesmal aber wirklich!« Wütend drehte sie sich um und watschelte zwischen den Grabfeldern dem Ausgang zu. Dabei schimpfte sie weiter vor sich hin, fügte den einen oder anderen Fluch hinzu, der dem Pfarrer besser auch nicht zu Ohren kam. Lou begann zu glucksen. Sie wollte es nicht, aber sie musste einfach laut lachen. Sie bückte sich nach dem Strohhut, setzte ihn auf und ging zum Fußende des Grabes zurück. Eine angenehme Ruhe erfüllte sie. »Curd hätte seinen Spaß gehabt.«
»Das denke ich auch.« Max kam zu ihr, nahm seinen Hut vom Kopf und betrachtete das Holzkreuz.
»Er hat einfach viel zu gern gelebt, um eine lange Trauerzeit zu wollen.« Auch Judith stellte sich zu ihnen. Wie selbstverständlich fasste sie Lou an der Hand, ebenso reichte Max ihr von der anderen Seite seine.
Lou schloss die Augen, streckte das Gesicht der wärmenden Sonne entgegen und malte sich aus, welchen Anblick sie drei vor dem schlichten Grab boten. Da war zum einen die elegante Judith, deren Aufmachung selbst an diesem heißen Hochsommertag perfekt durchkombiniert war. Die weiße Bluse mit dem großen Schalkragen passte hervorragend zu dem knöchellangen Faltenrock aus himmelblauem Taft. Auf dem Kopf trug sie einen maisgelben Strohhut, der genau den richtigen Kontrast zu dem schwarzen Bubikopf und den cremefarbenen Spangenschuhen bildete. Mit dem Sommeranzug aus leichter, heller Wolle, dem Seidenhemd und dem statt einer Krawatte locker um den Hals geschlungenen Schal sowie den feinen dunkelbraunen Budapestern schien Max rein äußerlich die Kriegsfolgen ebenso überwunden zu haben wie Judith. Lediglich Lou stach in ihrer langweilig geschnittenen, ärmellosen Tunika mit der schlichten weißen Kordel als Gürtel, dem wadenlangen Plisseerock sowie den abgetragenen Halbschuhen aus dem Trio heraus. Curd hätte das nichts ausgemacht. Anders als seine beiden Freunde hatte er nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Sogar im abgetragenen Anzug aus Kaiserzeiten hatte er noch schick gewirkt. Nun stiegen doch wieder bittere Tränen in ihr auf. Verlegen strich sie sich das kinnlange kastanienfarbene Haar aus dem runden Gesicht, sah von neuem auf das Kreuz.
»Nie haben wir einen Sommer miteinander gehabt. Keine einzige laue Sommernacht an der Isar war Curd und mir vergönnt. Unser erstes gemeinsames Frühlingserwachen war zugleich auch schon unser letztes. Ausgerechnet am selben Tag hat es ihn …« Ein heftiges Schluchzen übermannte sie. Judith und Max legten ihr von beiden Seiten die Arme um die Schultern, hielten sie fest.
»Stell dir einfach vor, er würde den Sommer jetzt hier mit dir genießen«, raunte Max ihr zu. »Der Platz unter den schattigen Bäumen hätte ihm bestimmt gefallen. Er liebte die Natur und war gern im Grünen. Nirgendwo sonst hätte er für alle Ewigkeiten ruhen wollen.«
»Bestimmt hat er nicht so früh im Leben schon hier landen wollen«, empörte sich Lou.
»Leider war er zur falschen Zeit am falschen Ort«, bemühte sich Judith, die Wogen zu glätten.
»Ausgerechnet, als er uns am meisten gebraucht hat, haben wir versagt«, ergänzte Max heiser.
»Was hättet ihr auch gegen eine irregeleitete Pistolenkugel ausrichten wollen?«, entgegnete Lou. »Ich allein bin schuld. Nie im Leben hätte ich ihn an jenem Morgen fortlassen dürfen. Wäre er bei mir geblieben, bis ich den Rucksack fertiggehabt hätte, wäre jetzt alles gut.«
»Hör auf, dir Vorwürfe zu machen.« Judith nahm sie in die Arme, wiegte sie zärtlich wie ein kleines Kind. »Niemand von uns trägt Schuld an Curds Tod. Es war ein tragisches Unglück. Die verirrte Kugel hätte genauso gut jeden anderen von uns erwischen können, wenn nicht am Stiglmaierplatz, dann sonst wo in der Stadt. In jenen Tagen war einfach keiner seines Lebens sicher.«
»Wer weiß, warum das alles geschehen ist?«, gab Max zu bedenken. »Curd hat immer daran geglaubt, dass alles im Leben einen höheren Sinn hat und wie im Theater auf ein vorherbestimmtes Ende zuläuft.«
»Warum sagst du das so? Du bist der Dramaturg, und er war der Bühnenbildner«, erwiderte Lou, wenig überzeugt von seinen Worten.
»Vor allem hätte er darauf bestanden, dass wir ebenso wie er unseren Rollen treu bleiben und uns auch ohne ihn weiter an unserem Dasein erfreuen«, überging Judith den Einwand.
»Er hat uns angehalten, für den Rest unseres Lebens fröhlich zu sein, gerade nach dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.« Das Glitzern in Max’ graublauen Augen verriet, wie schwer es ihm trotz Judiths Beistand fiel, die gebotene Zuversicht auszustrahlen. Hastig setzte er den Hut wieder auf und wandte sich ab.
Im Halbschatten der Hutkrempe traten die Linien von Stirn, Nase und Kinn markant hervor, der feingeschwungene Mund unter dem schmalen Oberlippenbart wurde leicht betont. Lou verlor sich in dem Anblick, der sie so sehr an Curd erinnerte. Nicht nur im Äußeren, auch im Wesen hatten sie vieles gemeinsam, nach allem, was gewesen war – vor allem den Übermut, die Lust am Leben.
Max ging in die Knie, betrachtete gedankenverloren die Gänseblümchen, die Männertreu und den Klee, der üppig auf dem Grab wucherte. Seine Finger strichen über das Grün, zupften zielsicher ein Kleeblatt heraus und reichten es Lou im Aufrichten. »Ein kleiner Gruß von Curd.«
»Danke.« Gerührt wollte sie es sich ins Haar stecken. Auf halber Strecke hielt sie inne, betrachtete es. Es hatte drei Blätter, wie üblich. Ein dicker Kloß steckte ihr im Hals. Kleeblätter bestanden nun einmal fast immer aus drei Blättern. Ein viertes war eine seltene Laune der Natur. So war auch das »Wiener Kleeblatt« Curd, Max und Judith längst vollzählig gewesen, bevor sie als Vierte dazugestoßen war. Die Versuchung war groß gewesen, das als besonderes Zeichen zu verstehen. Es hatte nicht funktioniert. Die Liebe zwischen Curd und ihr hatte die Freundschaft der drei letztlich auf eine harte Probe gestellt. Auch sie war sich viel zu oft ihrer wahren Gefühle nicht sicher gewesen. Gerade Max hatte sie verwirrt. Dabei war er Curds bester Freund. Niemals durfte er an Curds Stelle treten. Noch dazu, da sie schuld an Curds sinnlosem Tod war, wie sie überhaupt anscheinend allen männlichen Wesen, die sie liebte, Unheil brachte. Deshalb konnte sie jetzt auch nicht so tun, als bestünde das Kleeblatt weiter. Sie musste Max vor sich schützen. Mit zitternden Fingern gab sie Judith das Kleeblatt. »Zu dir passt es besser.«
»So ein Unsinn!« Judith weigerte sich, es zu nehmen. Erst auf Lous flehentliches Nicken hin steckte sie es sich ins oberste Knopfloch ihrer Bluse.
»Ihr seid das Wiener Kleeblatt, nicht ich. Künftig muss ich auf eigenen Beinen stehen«, sagte Lou. »Deshalb werde ich mich nach einer Arbeit als Täschnerin umsehen. Das wird mir helfen zu vergessen.«
»Vielleicht hast du recht«, stimmte Max zögernd zu. »Wieder in deinem erlernten Beruf zu arbeiten wird dir gewiss guttun.« Sie sah ihm an, wie stark es in ihm arbeitete. Er hatte genau verstanden, worum es ihr eigentlich ging. »Falls du etwas brauchst, sind wir immer für dich da. Curd wäre stolz auf dich.«
»Und auch auf euch«, erwiderte sie und fiel ihm um den Hals. Überrascht ließ er es geschehen, gestand sich sogar einen innigen Kuss mit ihr zu, den auch sie weitaus mehr genoss, als sie zugeben wollte.
»Dann sehen wir uns nachher nicht mehr im Theater?«, erkundigte sich Judith.
»Ich werde mich noch persönlich von Traudl, Theres und den anderen verabschieden«, erklärte Lou. »Zuerst aber suche ich mir in der Stadt etwas Neues. Bislang haben sie mir beim Theater doch nur aus Mitleid weiter etwas zum Ausbessern gegeben.«
»Ich wünsche dir viel Glück. Bestimmt wirst du schnell etwas finden.« Ein letztes Mal warf Max ihr einen sehnsüchtigen Blick zu, dann zog er sich den Hut in gewohnter Manier schräg in die Stirn, schob die Hände in die Hosentaschen und schlenderte davon.
Judith raunte ihm nur »Männer!« nach, bevor sie sich Lou noch einmal zuwandte: »Ich verstehe dich sehr gut. Doch vergiss nicht, dass Curd in meinen Armen lag, als er seine letzten Atemzüge tat. Hoch und heilig habe ich ihm versprochen, auf dich aufzupassen. So schnell wirst du mich nicht los.«
Ehe Lou widersprechen konnte, zog sie sie an sich und küsste sie auf den Mund. Erst wollte Lou aufbegehren, dann ließ sie es geschehen, bis Judith sich Kleidung und Hut richtete und Max zum Ausgang folgte.
»Du hast dir also gewünscht, dass Judith künftig weiter auf mich aufpasst«, sprach Lou leise, als sie sich zum Grab umdrehte. »Dabei hat sie nicht einmal dich vor dem Schlimmsten bewahren können.«
Sie rückte den Strauß Margeriten zurecht, den sie auf dem Grab abgelegt hatte. Verstohlen blinzelte sie auf das Grab zur Rechten. Äußerst feudal mit hellem Marmor eingefasst, wurde es am Kopfende feierlich von einem trauernden Engel bewacht. Zu allem Überfluss stand ein üppiger Strauß frischer Rosen darauf. Im Handumdrehen stibitzte Lou eine der langstieligen Rosen aus der Vase und drapierte sie quer über den Margeriten. Das dunkle Rot machte sich bestens auf dem makellosen Weiß.
»Wenigstens auf dem Friedhof dürfen die Roten noch über die Weißen triumphieren«, murmelte sie. Von neuem meinte sie, Curd vergnügt lachen zu hören. »Das gefällt dir wohl genauso gut wie das Tanzen! Das war noch nicht der letzte Walzer für dich. Ich werde weiter für dich tanzen. Bis in alle Ewigkeit. Versprochen.«
4
Die nächsten Tage besuchte Lou immer zuerst Curds Grab auf dem Ostfriedhof, bevor sie sich auf Arbeitssuche in die Stadt begab. Die Täschnereien in Schwabing und der Maxvorstadt hatte sie bereits erfolglos abgeklappert. An diesem Tag war die Gegend zwischen Sendlinger Tor und Marienplatz an der Reihe.
Sie saß in der Tram vom Nockherberg in die Innenstadt und sah ziellos nach draußen.
Nach dem Queren der Isar über die Reichenbachbrücke zuckelte der weiß-blaue Waggon der Siebener aufreizend langsam durch die Isarvorstadt. Fuhrwerke, Autos und Radler versperrten den Weg, ebenso kreuzten Fußgänger die Straße, ohne auf die Elektrische zu achten. Seit mehr als einer Woche war das Standrecht aufgehoben. Die willkürlichen Verhaftungsaktionen und die offenen Gefangenentransporte mitten durch die Stadt gehörten damit der Vergangenheit an. Neuerdings waren jedoch überall die bis zu den Zähnen bewaffneten Einwohnerwehren zu beobachten. Trotzdem kehrte allmählich so etwas wie Alltag ein. Die Barrikaden waren weggeräumt, die Bretter von den Schaufenstern verschwunden und die Läden wieder geöffnet. Die Auslagen aber blieben karg. Zwar besserte sich die Versorgungslage mit jedem Tag, die hohen Preise aber kürten selbst einfachste Lebensmittel wie Brot, Butter, Käse oder gar verschrumpelte Äpfel aus dem letzten Winter zu Luxuswaren. Alles in allem keine gute Zeit, um auf Stellungssuche zu gehen, erst recht nicht für eine alleinstehende junge Frau.
Auf einmal fiel Lou der Brief wieder ein. Den hätte sie fast vergessen, dabei war ihr die Gruberin am Morgen extra noch bis zur Haustür nachgerannt, um ihn ihr zu geben. Der Postbote hatte den Weg in den dritten Stock wieder einmal gescheut. Zwischen Notizheften, Lederetuis und Brieftaschen, die sie als Muster ihres Könnens in den Rucksack gesteckt hatte, zog Lou den Brief heraus und betrachtete ihn. Marke und Stempel stammten aus Wien. In akkurater Schrift waren auf der Vorderseite ihre Anschrift sowie ihr Name vermerkt, wobei »Lou« in ihren Taufnamen »Louise« zurückverwandelt war, fälschlicherweise allerdings mit ou. Die Absenderadresse von Curds Vater auf der Rückseite verriet seine angesehene Position in der Donaumetropole, residierte er doch innerhalb des Wiener Gürtels. Wie hatte Curd es gehasst, überall nur »der Sohn des erfolgreichen Architekten Walther« zu sein! Ihr zitterten die Finger, als sie das Kuvert öffnete und den Briefbogen auseinanderfaltete.
Die ersten Zeilen überflog sie beschämt. Nicht zu Unrecht warf Walther senior ihr vor, sich nicht längst bei ihm gemeldet und ihn über die genaueren Umstände von Curds Ableben in Kenntnis gesetzt zu haben. Statt des geringsten Anflugs von Bedauern, weil sie den Liebsten verloren hatte, erging er sich in Vorwürfen, dass »Curd noch immer nicht anständig begraben« sei, und verlangte die sofortige Überführung des Leichnams nach Wien, »damit der arme Junge nicht für alle Ewigkeit in fremder Erde fern der Heimat ruhen« müsse. In Lou regte sich Empörung. »Der arme Junge« hatte sich »fern der Heimat« viel wohler gefühlt als im Dunstkreis seines erfolgreichen Architektenvaters! Der hatte sich nämlich halsstarrig geweigert, zu akzeptieren, dass Curd lieber Bühnenbilder fürs Theater als herrschaftliche Stadtpalais für gelangweilte Ehefrauen gutbetuchter Honoratioren entwerfen wollte. Verärgert las sie den Brief noch einmal. Warum verlor Curds Vater kein Wort über ihre Verlobung, hatte keine Silbe des Mitleids für sie, die Curd geliebt und fast geheiratet hatte? Stattdessen gab es nur den brüsken Hinweis, er werde baldmöglichst »das Nötige für eine anständige Bestattung in Wien« veranlassen. Dabei war Curd längst anständig beerdigt! Jeden Tag besuchte sie sein Grab, legte frische Blumen darauf, tanzte für und weinte bitterlich um ihn. Niemals würde sie zulassen, dass man ihr nach dem lebenden nun auch den toten Curd entriss!
Wütend zerknüllte sie den Brief. Dabei kam ihr ein verstörender Gedanke: Curds Vater wusste gar nichts von der Verlobung! Deshalb erwähnte er sie mit keinem Wort. Warum hatte Curd ihm von ihr erzählt, die Verlobung aber verschwiegen? Hatte er sich für sie geschämt? Dann hätte er seinem Vater besser gar nichts von ihr gesagt.
Tränenverschleiert schweifte ihr Blick nach draußen. Hinter den in der Mittagssonne spiegelnden Fensterscheiben zogen die letzten Häuser der Müllerstraße vorbei. Mühsam quälte sich die Tram den Anstieg zum Sendlinger-Tor-Platz hinauf, bog scheppernd in die Haltestelle vor dem Kiosk ein. Hastig stopfte Lou den Brief in den Rucksack und drängte als eine der Ersten unter lautstarkem Protest des Schaffners aus dem Waggon, stürmte blindlings quer über den Platz durch das trutzige rote Backsteintor Richtung Marienplatz.
Das Laufen tat gut. Nach einer Weile wurde Lou ruhiger und schlenderte bald langsam die Sendlinger Straße auf der Suche nach einem Lederwarengeschäft entlang, das ihr Theres Thalhammer empfohlen hatte. Inständig sehnte sie sich danach, frisch gegerbtes Leder in Händen zu kneten, seinen derben Geruch einzuatmen, sich die Finger an den harten Stücken aufzureiben und eine knifflige Naht auszuführen. Vor allem aber wollte sie endlich wieder einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit. Kurz hinter der Asamkirche fand sie das Geschäft auf der linken Seite. Sie blieb stehen, richtete ihr Kleid und zupfte sich das Haar unter dem Hut zurecht. Erst dann drückte sie die Klinke. Die Ladenglocke bimmelte schrill.
»Grüß Gott!«, rief sie in das Halbdunkel des Ladens. Im staubigen Sonnenstrahl, der durch den schmalen Schacht der Schaufensterrückwand hereinfiel, nahmen die in den Regalen lagernden Taschen und Mappen Konturen an. In einem Glaskasten auf der Ladentheke fanden sich Geldbörsen, Brieftaschen und Geldkatzen, auf dem Boden reihten sich Koffer und Gepäckstücke aneinander. Lederjacken, -wämser und -hosen hingen in großer Auswahl auf einer Kleiderstange. Lou strich über die einzelnen Stücke und genoss es, das angerauhte Leder unter den Fingerkuppen zu spüren.
»Was kann ich für Sie tun?« Aus der Tür hinter der Ladentheke tauchte ein weißhaariger, freundlich aussehender älterer Herr auf. Vor wenigen Jahren noch hätte man ihn um seine Ähnlichkeit mit dem Prinzregenten beneidet, inzwischen wirkte er damit reichlich aus der Zeit gefallen.
»Gelernte Täschnerin bin ich. Meine Eltern haben ein Geschäft am Mittleren Lech in Augsburg gehabt und ich …«
»Und jetzt wollen S’ ausgerechnet bei mir eine Anstellung?«, unterbrach er sie in seinem milden Münchnerisch und ließ seine wachen, dunklen Augen an ihr herunterwandern. »Die Zeiten san schlecht. Ledersachen anfertigen lasst kaum einer mehr, auch mit dem Kaufen halten sich die Leut zurück. Kei Wunder, wo scho ein Laib Brot ein halbes Vermögen kost’.«
»Deshalb werden sie besonders viel zum Ausbessern bringen.« Mit erhobenem Kinn hielt Lou dem Blick des Lederwarenhändlers stand, der ungeachtet der revolutionären Stürme der letzten Monate auf dem Türschild stolz mit »Nepomuk Prantl. Königlich-bayerischer Hoflieferant« firmierte.
»Da ham S’ recht. Zum Ausbessern bringen s’ grad vui her.« Ihre prompte Erwiderung schien ihm zu gefallen. »Darauf muss sich einer aber gut verstehen, sonst sieht er die Kundschaft nimmer mehr, erst recht nicht, wann’s wieder bessere Zeiten gibt.«
»Vielleicht sollte ich Ihnen einmal zeigen, was ich kann?«
Überrascht zögerte er einen Moment, dann verzog sich sein Mund zu einem amüsierten Schmunzeln. »Auf’n Mund gefallen scheinen S’ jedenfalls ned. Kommen S’ mit.«
Er winkte sie zur Hintertür.
Die Werkstatt entsprach ihrer Erwartung. Durch ein schmales Hinterhoffenster fiel gerade so viel Licht, dass an der davorstehenden Schusternähmaschine gearbeitet werden konnte. Es war eine Adler mit dem typischen vorkragenden Näharm, einer tiefen Ausbuchtung unter dem Nähfuß und einer schmalen Auflage. Links davon erblickte Lou ein Nähross, auf dem eine Kiste mit Ahlen unterschiedlichster Größe und Ausführung stand, sowie auf dem Wandbord darüber mehrere Nähkolben. Ebenso fanden sich dort einige größere Spulen mit verschiedenfarbigen, gewachsten Garnen. Rechts über Eck zur Nähmaschine türmten sich auf einem Tisch Jacken, Westen, Hosen, Hosenträger und Gürtel. Sogar ein Paar Stiefel war darunter. An der Nähmaschine lag eine an der Seite halb aufgerissene Aktentasche, die Prantl dilettantisch zu flicken versucht hatte, wie die schiefe Naht und der mehrfach falsch verknotete Faden offenbarten. Lou hatte den richtigen Riecher gehabt. Zwar musste in den Werkzeugen erst einmal Ordnung geschaffen werden, zumindest aber schien alles vorhanden, was eine Täschnerin zum Arbeiten brauchte. Und genau die fehlte, wie deutlich zu sehen war. Sie stellte den Rucksack ab, setzte sich auf den Schemel vor der Maschine und prüfte Fadenstärke und Nadel. Dann richtete sie die Mappe auf dem Stichfeld unter dem Nähfuß schnurgerade aus. Behutsam begann sie das Pedal zu treten.
Das vertraute Surren der Nähmaschine klang ihr wie Musik in den Ohren. Viel zu schnell war die Naht geschlossen. Lou zog die Tasche unter dem Nähfuß heraus, schnitt Ober- und Unterfaden ab, versorgte die Enden und reichte Prantl die fertige Mappe. Zufrieden begutachtete er sie. Als Nächstes suchte Lou sich eine schwierigere Arbeit und griff nach einem Wams aus hellgrün eingefärbtem Veloursleder, dessen Knopflöcher eingerissen waren. Flink hatte sie auch das wieder gerichtet.
»Verstehen tun S’ sich tatsächlich gut aufs Handwerk.« Prantl nahm auch die ausgebesserte Weste nickend entgegen. »Nur wegen dem Lohn müss’ ma reden. Grad is’s ganz schwierig. Selbst wann S’ vorn im Geschäft noch als Ladnerin mit anpacken, werd’ ich Sie kaum zahlen können.«
»Zahlen kann einer seine Angestellten in solch einem Geschäft immer kaum, das weiß ich von meinem Vater«, erwiderte Lou. »Gerade jetzt nach dem Krieg muss jeder sein Geld zusammenhalten. Sie haben gesehen, was ich kann, und ich sehe, was Sie brauchen: jemanden, der sich aufs Ausbessern und Umändern versteht. Damit werden Sie bald genug verdienen, um mich zu bezahlen. Manch einer legt vielleicht eher einen Schinken oder stellt einen prall gefüllten Korb Eier und Käse neben die Kasse, aber auch das ist ein guter Lohn. In jedem Fall wird es sich herumsprechen, dass die Leute ihre Sachen zum Richten zu Ihnen bringen können.« Von neuem brummte Prantl nur.
»Und wenn es wieder aufwärtsgeht, kommen die Leute erst recht zu Ihnen, um sich was Neues nähen zu lassen«, setzte Lou nach.
»Ich mach Ihnen einen Vorschlag.« Umständlich verschränkte er die Hände hinter dem Rücken. »Solang noch ned klar is, ob’s tatsächlich aufgeht mit Ihnen, so lang zahl ich Ihnen nur das, was S’ tatsächlich an zusätzlichem Geld für mich bringen.«
»Aber dann sitze ich hier und warte …«, platzte sie voreilig heraus. Am Ende lief es doch wieder auf das hinaus, was sie beim Theater bekommen hatte: Almosen.