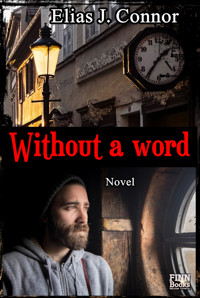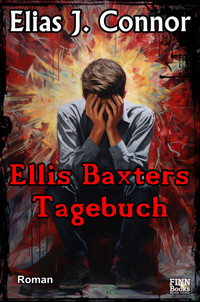3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FINN Books Edition FireFly
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es gibt immer eine Endstation. Aber höre nicht auf, zu suchen, wenn du sie findest. Denn mit jeder Endstation tun sich neue Wege auf, neue Herausforderungen, neue Endstationen." -Benjamin Foster TAUSEND WEGE BIS ZUR ENDSTATION ist die Geschichte über das bewegte, schwierige und dramatische Leben des Ex-Alkoholikers Benjamin Foster. Es ist die Geschichte über seine Patentochter Crystal, die Einzige, die ihn jahrelang auf seinem Weg begleitet und zu ihm steht. Es ist die Geschichte über seine Beziehung zu Jane, einer autistischen jungen Frau, die er im späteren Leben an seiner neuen Arbeitsstelle kennen und lieben lernt. Es ist die Geschichte über ein tiefes Geheimnis aus seiner Vergangenheit, an dem Benjamin fast zerbrochen wäre, hätte es diese beiden Menschen nicht gegeben. Mehr als einmal stößt Benjamin an Grenzen, die er zuvor nie kannte. Allen Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist wie Benjamin Foster, all denjenigen, die vielleicht noch unter dem Schatten ihrer dunklen Vergangenheit liegen und nicht heraus können, will der Autor sagen: Es gibt irgendwo da draußen noch so ehrliche, selbstlose und vertrauenswürdige Menschen wie Crystal und Jane. Sie glauben an euch. Sie wissen, dass ihr keine Angst haben müsst. Elias J. Connor ("Das Flüstern im Wind"; "Außenseiter"; "Die Kinder des Ghettos Blackwood") erzählt in dem Sozialdrama TAUSEND WEGE BIS ZUR ENDSTATION in Zusammenarbeit mit seiner Freundin und Co-Autorin Sweetie Willow eine auf Tatsachen beruhende Lebensgeschichte, wie sie spannender, dramatischer und packender nicht sein könnte. Es ist das schwierigste Buch, welches der Autor bislang geschrieben hat. Das wahre Leben des Benjamin Foster.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Elias J. Connor
Tausend Wege bis zur Endstation
Inhaltsverzeichnis
Widmung
PROLOG
KAPITEL 1 - MÄDCHEN, MÄDCHEN
KAPITEL 2 - DAS HEIMLICHE SPIEL
KAPITEL 3 - NACHTFAHRT
KAPITEL 4 - VERLOREN
KAPITEL 5 - BENJAMINS GESTÄNDNIS
KAPITEL 6 - KEINER SOLL MICH SEHEN
KAPITEL 7 - VERSUCHTER NEUANFANG
KAPITEL 8 - DIE SCHWESTER
KAPITEL 9 - SILVESTER
KAPITEL 10 - EINGESCHWOREN GEGEN ALLE
KAPITEL 11 - DAS GEHEIME TREFFEN
KAPITEL 12 - MUSS ICH WIEDER ZURÜCK?
KAPITEL 13 - BÖSE ERINNERUNGEN
KAPITEL 14 - DIE KLINIK
KAPITEL 15 - WENN DIE WAHRHEIT RAUSKOMMT
KAPITEL 16 - DIE WERKSTATT
KAPITEL 17 - FREUNDE AUF EWIG
KAPITEL 18 - DER TOD DER MUTTER
KAPITEL 19 - EINE UNERWARTETE NACHRICHT
KAPITEL 20 - DAS VERLORENE LEBEN
KAPITEL 21 - WOHNGEMEINSCHAFT
KAPITEL 22 - DIE GANG
KAPITEL 23 - WEGGESCHOSSEN
KAPITEL 24 - WARUM?
KAPITEL 25 - ENDSTATION
KAPITEL 26 – LEISE STIMMEN
KAPITEL 27 - WIR SIND WIE EISBLUMEN
KAPITEL 28 - WAS SOLL SEIN?
KAPITEL 29 - UNBEKANNTE WEGE
KAPITEL 30 - DER SCHREI IN DER DUNKELHEIT
KAPITEL 31 - WER IST JANE?
KAPITEL 32 - SIE KANN EUCH SEHEN
KAPITEL 33 - JANES GEBURTSTAG
KAPITEL 34 - EINER VON VIELEN
KAPITEL 35 - HEIMLICH ZUSAMMEN?
KAPITEL 36 - LEBENSWEISHEITEN UND ERINNERUNGEN
KAPITEL 37 - WEIT WEG VON MIR
KAPITEL 38 - DER ALBTRAUM
KAPITEL 39 - NACHTS UNTER DEM MOND
KAPITEL 40 - BENJAMINS GEBURTSTAG
KAPITEL 41 - KEINE WORTE
KAPITEL 42 - SIE IST WIEDER DA
KAPITEL 43 - NEUES LEBEN
KAPITEL 44 - DIE MAUERN
KAPITEL 45 - AMNESIA GEGEN LEROY
KAPITEL 46 - DAS UNERREICHBARE ERREICHEN
KAPITEL 47 - DER RUF DER EULE
KAPITEL 48 - SCHLEIER VOR DEN AUGEN
KAPITEL 49 - DAS ALLER ERSTE FOTO
KAPITEL 50 - TIEFE NACHT
KAPITEL 51 - DER AUSFLUG
KAPITEL 52 - HOFFNUNGSLOS
KAPITEL 53 - GIB ES AUF
KAPITEL 54 - LEROY UND LAURA
KAPITEL 55 - GOLDENER HERBST
EPILOG
NACHWORT DES AUTORS
BENJAMIN – DAS ONE MAN MUSICAL
Über den Autor
Impressum
Widmung
Für Nadja.
Meine beste Freundin, Ideenlieferin und Muse.
In einer schweren Stunde warst du für mich da. Ich danke dir von Herzen dafür.
Du bist diejenige, die durch ihren Zuspruch dieses Projekt ermöglicht hat.
Es ist mir das wichtigste Buch von allen, die ich bisher geschrieben habe, und ich habe es für dich geschrieben.
Schön, dass es dich gibt.
Dunkle Schatten vergangen, neue Lichter entdeckt.
Danke für den phantastischen Halt, danke, dass du da bist und ich da sein darf.
Für Jana.
Manche Wege sind zu weit, manche Mauern zu hoch und manche Grenzen zu unüberwindbar.
Wie konnte ich dich finden?
Für Liam-Elias.
Angekommen in unserer Welt.
Derjenige, dessen Leben unseres verändert hat und der uns die Kraft gibt, dort weiter zu machen wo wir unsere Endstationen gefunden haben.
Danke, dass du existierst.
PROLOG
Der nasse Regen plätscherte auf sein Gesicht. Seine Kleidung war dreckig und vom Wasser durchtränkt. In seiner Jeans war ein Riss, aus dem Blut austrat. Seine Jacke war offen, trotz der Kälte, und hing ihm halb vom Körper herunter.
Er lag da, mitten auf der Straße, regungslos und ohnmächtig. Sein Kopf befand sich mitten in einer großen Blutlache, die bereits auch schon seine Haare rot färbte. Das Blut lief langsam den Bordstein herunter, in einen nah gelegenen Kanal hinein.
Er bewegte sich nicht. Würde man genauer hinsehen, könnte man allerdings merken, dass seine Lippen leicht bebten.
Ein anderer Mann hechtete plötzlich aus einem Kiosk heraus, der keine zehn Schritte von der Stelle entfernt war, wo der Mann lag. Sofort packte er einen seiner Arme und versuchte, ihn anzuheben.
„Hallo?“, fragte er. „Können Sie mich hören?“ Der Mann reagierte nicht.
„Hallo“, sagte der andere Mann wieder, der offenbar in dem Kiosk arbeitete.
Dann nahm er das Handy aus seiner Tasche und wählte die Nummer des Notrufs.
„Ja“, sagte er schließlich ins Telefon. „Ich bin gerade vor meinem Kiosk in der Nähe vom Bahnhof. Hier liegt ein unbekannter Mann, vielleicht Mitte bis Ende 30, verletzt auf dem Bürgersteig. Er ist wahrscheinlich gestürzt und hat eine ziemlich schwere Kopfverletzung. Er reagiert nicht, wenn ich ihn anspreche.“
„Wo sind Sie genau?“, fragte die Frau am anderen Ende des Telefons.
„In der Buchenstraße 120 in Solingen“, antwortete der Kioskbesitzer.
Dann sendete die Frau einen Notruf aus und wandte sich schließlich wieder dem Mann zu.
„Okay“, meinte sie. „Liegt der Mann bereits in der stabilen Seitenlage?“
Daraufhin legte der Kioskbesitzer das Handy weg und drehte den Verletzten seitlich zu sich. Dann nahm er das Telefon wieder in die Hand.
„Atmet er?“, wollte die Frau wissen.
„Ja“, stellte der Kioskbesitzer fest. „Er ist zwar ohnmächtig, aber er atmet. Er blutet aber ziemlich stark, können Sie sich bitte beeilen?“
„Wir sind in zwei bis drei Minuten da, spätestens“, sagte die Frau.
Der Kioskbesitzer lief dann in sein Geschäft rein und holte ein Handtuch. Vorsichtig versuchte er damit die blutende Stirn des Mannes abzutupfen. Währenddessen probierte er immer wieder, ihn anzusprechen, aber der Mann zeigte keinerlei Reaktion.
Eine junge Frau kam vorbei, die die Szene beobachtet hatte.
„Haben Sie den Notarzt schon gerufen?“, fragte sie. „Was ist passiert?“
„Er muss gestürzt sein“, klärte der Kioskbesitzer sie auf. „Rettungswagen ist unterwegs.“
„Er riecht nach Alkohol“, sagte die Frau.
„Ja“, stellte der Kioskbesitzer fest. „Ich meine mich zu erinnern, dass er wenige Stunden vorher bei mir zwei Dosen Bier gekauft hatte.“
„Wissen Sie, wer er ist?“
„Er muss hier in der Nähe wohnen. Ich kenne ihn vom Sehen, er kauft manchmal in meinem Kiosk ein.“
Die Frau kramte daraufhin in der Tasche des Unbekannten und fand sein Portmonee. Aber die Geldbörse war völlig leer, keine Papiere, kein Ausweis und auch kein Geld.
„Ich vermute, er ist niedergeschlagen worden“, mutmaßte die Frau schließlich.
„Glaube ich nicht“, sagte der Kioskbesitzer. „Für mich sieht es eher danach aus, als wäre er aus der Kneipe gefallen. Vielleicht konnte er dort nicht bezahlen und die haben dann seine Papiere als Pfand einbehalten. Er schien schon angeheitert gewesen zu sein, als er vorhin bei mir Bier kaufte. Ich glaube, dass er gefallen ist.“
Die Frau versuchte dann, den Puls des Fremden zu messen.
„Puls ist vorhanden“, sagte sie. „Sehr schwach, aber er ist da.“
Wenig später kam der Rettungswagen mit Blaulicht angefahren. Kaum angekommen, stiegen gleich zwei Sanitäter aus.
„Hallo“, sagte der Eine. „Können Sie mich hören? Sind Sie ansprechbar?“
„Er reagiert nicht“, erklärte der Kioskbesitzer. „Ich habe es bereits versucht.“
Während einer der Sanitäter die Wunde versorgte und desinfizierte, kam der Notarzt schließlich mit einem separaten Auto an. Die Sanitäter bereiteten eine Trage vor. „Wir werden ihn ins
Krankenhaus mitnehmen“, sagte der Eine.
Der Notarzt setzte dem Fremden eine Infusion, und zeitgleich legten die Sanitäter ihn auf die Trage.
„Puls?“, sagte einer von ihnen.
„Schwach, aber ja“, sagte der Notarzt. „Sehr schwache Atmung. Weiß man, wer er ist oder wo er wohnt?“
„Nein, keinen Schimmer. Der Kioskbesitzer, der uns gerufen hatte, kennt ihn offenbar auch nur vom Sehen“, sagte der Sanitäter.
Als die Trage mit dem Verletzten im Wagen war, setzte sich der Notarzt wieder in sein Auto und fuhr bereits vor.
„Okay, wir werden Sie benachrichtigen, wenn wir mehr wissen“, verabschiedete sich der eine Sanitäter vom Kioskbesitzer und der Rettungswagen fuhr davon.
Im Krankenwagen schlossen die Sanitäter den Fremden an Kontrollgeräte an, die seinen Herzschlag und seinen Puls maßen. Noch immer schien der Patient nicht ansprechbar und regungslos zu sein.
Einer der Sanitäter notierte sich etwas auf einem Block: „12. Juli 2016. Name: Unbekannt. Status: Schwere Kopfverletzung, komatös durch Alkoholeinfluss. Möglicherweise innere Verletzungen“, konnte man dort lesen.
Die Fahrt ins Krankenhaus dauerte nur wenige Minuten. Kaum angekommen, wurde die Trage mit dem Unbekannten direkt auf die Intensivstation gebracht, in einen Raum, der nach einem OP-Saal aussah. Sofort kamen mehrere Ärzte und bereiteten sich darauf vor, die schwere Kopfverletzung zu behandeln. Die Maschine, an die der Patient angeschlossen war, zeigte, dass der Herzschlag leicht schwächer und langsamer wurde.
Schließlich kam auch der Oberarzt, den man zuvor gerufen hatte.
„Name?“, fragte er.
„Unbekannt“, antwortete einer der Ärzte. „Herzschlag unrhythmisch, wahrscheinlich ein Schock, hervorgerufen durch zu viel Alkohol.“
Der Narkosearzt setzte den Patienten unter Betäubung, und fast zeitgleich begann der Oberarzt, die Wunde mit mehreren Stichen zu nähen.
„Ich vermute, dass innere Verletzungen vorhanden sind“, stellte er fest. „Kann mir jemand sagen, was passiert ist?“
„Der Mann scheint auf der Straße zusammengebrochen zu sein“, klärte ihn einer der Ärzte auf. „Die Sanitäter sagen, ein Kioskbesitzer habe ihn gefunden, aber wir wissen nicht, wie lange er schon da lag.“
„Der Herzschlag ist unregelmäßig“, sagte der Oberarzt. „Möglicherweise müssen wir ihn in ein künstliches Koma versetzen.“
Zur gleichen Zeit betrat eine junge Frau, mittellange, dunkle Haare und eher zierlich, vielleicht achtzehn oder neunzehn Jahre alt, das Krankenhaus und lief aufgeregt zum Empfang. Ihr Körper schien zu zittern und einige Tränen liefen ihre Wangen herunter.
„Ist er hier? Ist er eingeliefert worden?“, fragte die Frau.
„Beruhigen Sie sich“, sagte die Dame am Empfang. „Wen genau suchen Sie?“
„Benjamin Foster“, sagte die junge Frau. „Er war nicht zu Hause, als ich heute Abend dort ankam. Ein Mann sagte mir, dass es vor seinem Haus einen Verletzten gab. Er lässt sein Handy nie zu Hause, aber es lag da, als ich kam…“
„Wie ist ihr Name?“, fragte die Mitarbeiterin des Krankenhauses.
„Jennings“, sagte die Frau. „Crystal Jennings. Benjamin ist mein Patenonkel.“
„Gut“, sagte die Frau. „Bleiben Sie ruhig. Ich sehe nach.“ Dann warf die Mitarbeiterin einen Blick in ihren Computer.
„Wir haben heute Abend nur zwei Einlieferungen. Eine ältere Frau und einen Mann, dessen Namen wir nicht kennen. Wo wohnt ihr Patenonkel?“
„In der Buchenstraße“, antwortete Crystal. „Nicht weit weg vom Bahnhof.“
„Also, der Unbekannte, der vorhin hier eingeliefert wurde…“, begann sie. „Der Notruf wurde tatsächlich von einem Kioskbesitzer in der Buchenstraße abgesetzt.“
„Oh, mein Gott“, wisperte Crystal. „Das muss er sein. Wo ist er? Wo ist er?“
„Sie können da jetzt nicht rein“, sagte die Angestellte. „Soweit ich informiert bin, befindet sich der Unbekannte mitten im OP.“
„Ich muss zu ihm“, sagte Crystal aufgeregt. „Kann ich mit jemandem sprechen?“
„Jetzt nicht“, antwortete die Mitarbeiterin fast unhöflich.
Aber Crystal ließ sich nicht davon abbringen, es zu versuchen. Ohne eine Genehmigung abzuwarten, lief sie den Flur entlang und ging in Richtung des Aufzugs.
Sie wusste nicht, wohin sie sollte, aber instinktiv drückte sie das Stockwerk an, in dem sich der OP befand.
„Herz?“, fragte der eine Arzt.
„Schwach“, sagte ein anderer.
Die Wunde war versorgt, aber es schien dem Unbekannten weitaus schlimmer zu gehen, als sie dachten.
„Ist die Blutuntersuchung fertig?“, fragte der Oberarzt.
Und zugleich kam ein Assistenzarzt mit einem Schreiben rein.
„Starker Alkoholkonsum, wahrscheinlich über drei Promille“, sagte er.
„Gott“, meinte der Oberarzt. „Das überlebt ja fast keiner. Wir werden ihn ins Koma versetzen müssen.“
„Doktor, draußen ist eine junge Frau“, begann der Assistenzarzt dann. „Sie vermutet, den Unbekannten zu kennen.“
„Sie soll warten“, sagte der Oberarzt, während er eine Infusion vorbereitete.
Plötzlich wurde der Herzton der Maschine immer unregelmäßiger.
„Herzrhythmus-Störungen“, stellte der Arzt fest. „Bereiten Sie den Defibrillator vor.“
Eilig machten sich zwei Ärzte daran, das Gerät anzuschalten.
„Geht das nicht schneller?“, fragte der Oberarzt.
Und dann auf einmal kam ein eintöniges Piepsen aus der Maschine.
„Wir verlieren ihn“, sagte der Oberarzt. „Herzstillstand. Schnell, den Defibrillator.“
Die beiden Assistenzärzte hielten die Enden der Maschine aneinander und legten sie dem Patienten auf die nackte Brust.
„Jetzt“, sagte der Oberarzt. Ein Stromschlag.
Nichts. Das Geräusch war nach wie vor monoton.
„Noch mal!“ Sie setzen das Gerät ein zweites Mal an.
Draußen kam ein Pfleger zu Crystal und setzte sich zu ihr.
„Was ist passiert? Ist er es?“, fragte sie aufgeregt.
„Nun“, sagte der Pfleger. „Wir wissen nicht, wer er ist. Und es sieht nicht gut aus. Sie beleben ihn gerade wieder.“
„Nein…“, hauchte Crystal. „Er darf nicht sterben.“
„Wir wissen ja nicht genau, ob es auch Ihr Bekannter ist.“
„Mein Onkel“, sagte Crystal. „Ich habe keine Familie mehr, nur noch ihn.“
„Sind Sie verwandt?“, wollte der Pfleger wissen.
„Nein“, antwortete Crystal. „Nicht blutsverwandt. Aber er ist mein Patenonkel.“ Sie holte das Handy, welches sie mitgebracht hatte, und welches ihm gehören musste, heraus und zeigte dem Pfleger ein Foto von ihrem Patenonkel. „Das ist er. Ist das der Mann, der eingeliefert wurde?“
Der Pfleger sah sich das Foto an.
„Ja“, sagte er schließlich. „Das Bild ist identisch mit dem Verletzten.“
„Ich muss zu ihm.“, stammelte Crystal.
Daraufhin kam der Oberarzt aus dem OP und ging auf Crystal zu…
KAPITEL 1 - MÄDCHEN, MÄDCHEN
Blöd. Alles doof.
Aber ich hielt meine Klappe. So wie immer. Ich stand einfach an dieser kargen, hellen Wand, meine Hände vor mein Gesicht haltend. Ich war stumm, weil ich es nicht anders kannte. Und weil ich nichts sagen wollte.
Die Rufe meiner Klassenkameraden hallten lauter. Sie kamen näher, und ich konnte ihr Lachen hören.
Still. Augen zu, Hände verdeckten mein Gesicht. Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen.
Was mir in diesem Moment durch den Kopf ging – ich wusste es nicht. Ich hatte Angst, ja. Aber ich wollte sie nicht zeigen. Nicht deswegen, damit ich mich stärker fühlen durfte, sondern deswegen, weil ich es nicht konnte. Weil ich auch einfach gehofft hatte, dass es niemand merkt.
Aber sie merkten es.
„Benjamin, das Mädchen!“
Die Rufe der Klassenkameraden – das waren auch noch die stärksten und beliebtesten Jungs in der Klasse – hörten nicht auf.
Wann würde es denn endlich zur ersten Stunde klingeln? Wann dürfte ich mich auf meinen Platz in der letzten Reihe am einzigen Einzeltisch setzen? Dort sah mich niemand. Dort nahm mich niemand wahr.
Sie kamen näher. Die Zeit musste still stehen. Ich wollte einen Blick auf die Uhr erhaschen, die über der Tafel hing, aber ich konnte mich nicht umdrehen. Ich war wie gelähmt, stand einfach da, unmerklich zitternd und bebend vor Angst.
„Benjamin, du Mädchen!“
„Schwul, oder?“
„Schwuchtel!“
„Guck sie dir an, die Arme Kleine...“
Das Gelächter wurde größer, wurde lauter. Die Klassenkameraden kamen näher. Sie haben es längst gesehen, das wusste ich. Man konnte es ja auch von hinten erkennen. Aber von vorne erst recht.
Plötzlich spürte ich forsch eine Hand auf meiner Schulter. Jemand packte mich. Jemand drehte mich um.
Meine Augen waren geschlossen, mein Gesicht verzerrt und ich sah nichts. Aber ich hörte dieses laut schallende Lachen. Ungefiltert drang es an mein Ohr und ließ mich meine Angst, meine Verzweiflung und meine Scham nur noch mehr spüren.
Der Blick dieses Jungen, der mir gegenüber stand, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, als ich meine Augen öffnete.
Da waren die anderen Kinder, die um ihn herum standen und mich anstarrten. Alle so in meinem Alter – 8 Jahre, manche von ihnen vielleicht 9.
Ich wollte raus laufen. Ich wollte wegrennen. Aber ich konnte nicht. Sie standen um mich und starrten auf meine weiße, mit Blumen verzierte Mädchenbluse, die ich gestern eigens gekauft bekommen habe – angeblich, weil ich sie unbedingt haben wollte.
„Bist du ein Junge oder ein Mädchen?“
Dieser Satz des einen Mädchen, die unmittelbar neben mir stand, ließ mich einige Tränen weinen.
Scheiße. Weinen wollte ich erst recht nicht. Jetzt hatten die es wieder geschafft. So oft haben sie mich schon zum Weinen gebracht – aber das jetzt, das war glaube ich der schlimmste Moment bisher.
Gott sei Dank – es klingelte, bevor irgendwer der anderen Klassenkameraden etwas sagen konnte. Und da kam auch schon die Lehrerin herein.
Ich lief zu meinem Platz in der letzten Reihe, wischte mir mit dem Handrücken die Tränen ab und setzte mich schweigend hin.
Die Lehrerin sah mich fragend an. Ich streifte mir durch meine schulterlangen, dunklen Haare und versuchte, mein Gesicht mit ihnen zu verdecken.
„Benjamin Foster“, sprach die Lehrerin. „Hast du noch etwas anderes zum Anziehen bei dir? Ein T-Shirt vielleicht?“
Stille. Alle starrten mich an.
Ich zitterte, brachte kein Wort heraus. Wie sehr hätte ich jetzt vor Scham im Erdboden versinken können.
Ich hörte, wie die Lehrerin den Klassenkameraden erklärte, dass es durchaus mal passieren kann, dass man morgens beim Anziehen versehentlich ein falsches Kleidungsstück aus dem Schrank nahm, das eigentlich der Schwester gehörte, und dass dies kein Grund sei, einen Mitschüler auszulachen. Ich verstand nicht genau, was sie sagte, aber ich wusste, die nächste Pause würde ich nicht überleben.
Die Zeit verging gar nicht. Immer wieder diese Blicke der anderen. Immer wieder das Tuscheln und Flüstern. Es hörte nicht mehr auf.
Schließlich klingelte es zur Pause. Alle liefen hinaus auf den Schulhof. Am Schluss war ich alleine in der Klasse, saß da und bewegte mich nicht.
„Du musst keine Angst haben“, hörte ich eine Stimme leise zu mir sagen.
Ich drehte mich um. Aber da war niemand.
„Hab keine Angst, Benjamin Foster“, hörte ich die helle Stimme.
Merkwürdig – eigentlich kannte ich die Meisten meiner Klassenkameraden und Klassenkameradinnen an der Stimme. Im Unterricht machte ich oft die Augen zu, und wenn jemand sprach, ordnete ich in meinen Gedanken heimlich die Stimme zu.
Aber diese Stimme – wahrscheinlich die eines Mädchens – habe ich noch nie gehört. Zumal sie sehr nett klang – denn eigentlich redete keiner meiner Mitschüler so nett zu mir.
Zögernd drehte ich mich um mich selbst und sah in alle Ecken, aber hier war niemand.
„Bejnamin“, hörte ich sie wieder sagen. Und kurz darauf erklang ein freundliches Lachen.
„Wo bist du?“, flüsterte ich. „Wer bist du?“
Das fremde, für mich noch immer unsichtbare Mädchen lachte wieder. Aber es war kein Auslachen, es war mehr das Lachen eines spielenden Kindes.
Plötzlich wurde es wieder ruhig.
Ich hörte Schritte. Die Türe des Klassenraums öffnete sich. Ich wollte mich verstecken, aber die Lehrerin sah mich und kam direkt zu mir neben den Tisch.
„Benjamin, wie ist das geschehe, dass du eine Mädchenbluse an hast?“
Ich hörte sie, aber ich antwortete nicht. Verschämt sah ich zu Boden.
„Du musst dich umziehen, Benjamin. Hast du wirklich nichts anderes dabei?“
Ich schüttelte verschämt mit dem Kopf, meinen Blick noch immer zu Boden gesenkt.
„Dann gehe bitte nach Hause“, bat mich die Lehrerin. „Hole dir ein vernünftiges T-Shirt, ziehe es an und komme anschließend wieder.“
Wie sollte ich das denn machen? Mutter war bestimmt zu Hause und würde merken, wenn ich zur Türe herein käme. Was sollte ich nur tun? Wegrennen? Aber wohin?
Ich war am Zittern vor Angst. Es darf niemand merken, dachte ich leise. Es darf bloß niemand merken.
Ich lief los.
Ich konnte es doch nicht sagen. Die Klamotten, die ich tragen sollte, wurden mir jeden Abend zurecht gelegt, und ich musste immer genau das anziehen, was mir abends zurecht gelegt wurde. So war es seit ich denken konnte. Und Mutter hatte sie ausgesucht, hatte sie für mich gekauft. Schon seit einiger Zeit kündigte sie immer wieder an, ich sähe als Mädchen viel besser aus. Und gestern hatte sie es wahr gemacht und eine der Blusen für mich heraus gelegt, die ich dann am nächsten Tag anziehen sollte.
Ich wollte ein Mädchen sein, hatte sie immer gesagt. Mein richtiger Name wäre Erika. Ich war eigentlich ein Mädchen.
Langsam lief ich in die Straße hinein, an dessen Ende unser Haus lag. Zitternd, bebend vor Angst, rot im Gesicht vor Scham, stumm, taub und blind.
KAPITEL 2 - DAS HEIMLICHE SPIEL
Das Licht hier im Raum war matt. Die große Klappe, die das Kellerfenster abdeckte, war nur auf kipp, da man sie gar nicht ganz aufmachen musste. Man hätte dafür die beiden großen Haken in der Wand öffnen müssen, und ich wusste nicht, wie das geht. Auch die Glühbirne erhellte den Raum nicht sonderlich, ein richtiges Licht oder eine Lampe gab es hier nicht.
Spielkeller nannte ich es. Meine Schwester sagte dazu immer Partykeller oder Hobbyraum – denn schon mehrfach feierte sie hier mit ihren Freunden und Freundinnen Feten, zu denen sie mich explizit niemals eingeladen hatte.
Ich feierte natürlich keine Feten. Das hätte ich mit knapp 11 Jahren eigentlich sowieso nicht gedurft.
Carina durfte es in jedem Fall. Und sie war zwei Jahre jünger als ich, also erst 9. Egal. Ich wollte eigentlich sowieso nie bei ihren Feten dabei sein. Was die da machten, das nervte mich irgendwie. Nicht, dass ich es wirklich gewusst hätte, aber Carina machte mehrmals solche Andeutungen, dass dort langsame Lieder laufen würden und dabei ganz eng getanzt würde. Sei man dann in der richtigen Stimmung, ginge es über zu irgendwelchen Spielchen wie Flaschendrehen oder so etwas. Und was die dabei dann machten, daran mochte ich nicht denken. Ich fand es eklig, so oder so.
Wenn ich alleine hier im Keller war – so wie fast jeden Nachmittag, wenn Carina Freunde bei sich hatte und ich die Wohnung verlassen sollte, um sie nicht zu nerven – dann war das MEIN Keller. Es war der Spielkeller, denn ich hatte hinter dem riesigen Vorhang versteckt im Regal all meine Spielsachen, meine Stofftiere, welche ich schon als ganz kleines Kind geschenkt bekam, einige elektronische kleine Konsolen und so weiter – eben all das Zeug, was modern war und was eigentlich alle hatten.
Der Großteil von den Spielsachen gehörte eigentlich meiner Schwester Carina. Aber schon mit 7 oder 8 Jahren änderte sie komplett ihre Interessen und behauptete standfest, keinerlei kindisches Spielzeug zu besitzen. Das sei alles meins, stellte sie irgendwann klar.
Statt mich zu beschweren, was das sollte, hielt ich meinen Mund. Zuerst wollte ich natürlich ihr Spielzeug nicht in Anspruch nehmen, aber nach einiger Zeit dachte ich: „Was ich hier unten mache, das bekommt sowieso niemand mit.“ Also begann ich irgendwann, mit ihren Sachen zu spielen. Nach einiger Zeit hatte ich eigentlich fast schon vergessen, dass die meisten Spielsachen ihr gehörten. Sogar das Puppenhaus nahm ich als Junge als mein Spielzeug an, und gerade das wurde irgendwann zu meiner Lieblingsspielsache. Eigentlich war es ja meins.
Ich schob den Vorhang zurück und kramte das viereckige, längliche altmodische Puppenhaus hervor. In der Kiste lagen die Puppen, in der Größe und Art zu den Möbeln passend.
Ich platzierte eine der Puppen am Esstisch. Die beiden anderen – eine Jungen- und eine Mädchenpuppe, legte ich in den Nachbarraum in das Bett. Akribisch deckte ich sie zu, nachdem ich sie entkleidet habe.
„Schlafenszeit“, hörte ich mich rufen.
Eine kleine Pause. Ich schnaufte aus.
„Ich will nicht schlafen“, sagte ich mit verstellter, sehr heller Stimme.
„Ich auch nicht“, warf ich nach.
Das Knarren der grauen Stahltür, die den Flur mit dem Keller verband, nahm ich in diesem Moment nicht wahr. Auch das anschließende leise Tapsen von Füßen auf dem Teppichboden musste ich überhört haben. Das matte Licht wurde plötzlich für eine Sekunde etwas verdunkelt, da ein Schatten über mich und das Puppenhaus geschlichen kam – aber auch diesen bemerkte ich nicht.
Ich war total vertieft in mein Spiel. Eine Weile sah ich die Puppen an. Der Puppenvater saß noch immer am Esstisch. Ich spielte, dass er etwas aß und daraufhin aufstand, um das kleine Geschirr wegzuräumen. Fein säuberlich stellte ich den Mini-Teller und die Mini-Tasse in den dafür vorgesehenen Schrank.
Daraufhin wandte ich mich wieder den beiden Puppen im Schlafzimmer zu.
„Ich bin nicht müde“, ließ ich das Puppenmädchen sagen. Und gleich darauf ließ ich sie davon hüpfen. Ich schmiss sie in die Ecke, aber ich spielte, dass sie einfach abgehauen wäre.
Ich ließ den Puppenjungen die Bettdecke ganz hochziehen, so dass er komplett bedeckt war.
Für einen Moment blickte ich in die neben mir liegende Kiste, wo noch andere Utensilien für das Puppenhaus aufbewahrt waren. Ich holte eine erwachsene weibliche Puppe hervor – die Puppenmutter dieser Familie, die ich jedoch sehr, sehr selten in meinem Spiel verwendete.
Ich legte ohne ein Wort die Puppenmutter in das Bett des Puppenjungen. Für einen Moment hielt ich inne.
„Was machst du da?“, hörte ich jemanden plötzlich sagen.
Ich erschrak. Schnell nahm ich die Puppen und warf sie in die Kiste neben mir.
Langsam drehte ich mich um, dorthin, wo die Stimme herkam. Voller Scham blickte ich in ihre Augen.
„Was machst du da?“, wiederholte das mir bekannte Mädchen daraufhin. „Spielst du mit deinem Puppenhaus?“
Claudia. Sie war die beste Freundin meiner Schwester Carina und war etwa ein Jahr älter als sie.
Sie war auch manchmal diejenige, die versuchte, mich in das Spielen mit meiner Schwester einzubinden, was jedoch meist darin ausartete, dass meine Schwester noch aggressiver mir gegenüber wurde. Claudia war okay, eigentlich noch diejenige der Freunde meiner Schwester, die am Ehesten noch okay waren. Sie war nicht so abgedreht wie Carina und nicht so cool wie ihre anderen Freunde. Das mochte ich irgendwie, denn cool sein war nichts für mich.
„Schon gut“, meinte Claudia, ohne eine Antwort von mir abzuwarten. „Ich sag's keinem, dass du mit dem Puppenhaus spielst.
Verschämt sah ich zur Seite.
„Ehrlich“, bekräftigte sie.
Ohne dass ich mich getraut hätte, ein Wort zu sagen, holte ich die Puppen wieder aus der Kiste. Ich setzte den Puppenvater wieder an den Esstisch und den Puppenjungen in das Bett im Nebenzimmer. Die Puppenmutter ließ ich weg. Aber das Puppenmädchen holte ich wieder hervor und stellte sie unten vor dem Haus auf.
„Sie ist vorhin weggelaufen“, erklärte ich leise. „Aber jetzt ist sie wieder da.“
Claudia setzte sich neben mich und nahm die Mädchenpuppe in die Hand.
„Wer sind die?“, wollte sie wissen.
„Nur irgendeine Familie“, sagte ich.
„Sicher?“, meinte Claudia.
Claudia tapste dann mit dem Puppenmädchen in das Zimmer des Jungen.
„Wir sind Geschwister“, meinte sie im Spiel. „Das da ist unser Vater“, ergänzte sie, auf den am Esstisch sitzenden Vater zeigend.
„Nein“, rief ich aus. „Lass uns lieber Freunde sein. Du bist meine Freundin, und du bist bei uns über Nacht.“
Claudia lachte. „Cool“, sagte sie. „Also – dann bist du der Junge, ich das Mädchen... und wer ist der Vater?“
Ich blickte den Puppenvater an. Dann nahm ich ihn und schmiss ihn in die Kiste.
„Egal“, stammelte ich daraufhin. „Wir haben keine Eltern. Wir wohnen alleine hier.“
„Na, gut“, meinte Claudia.
Es entstand ein Puppenspiel, das im Laufe der nächsten Minuten und Stunden immer intensiver wurde. Schon bald waren wir ganz in unseren Rollen drin. Ich war das irgendwie nicht gewohnt, mit jemandem so intensiv zu spielen, da ich ja keine Freunde hatte. Es wollte ja auch nie jemand mit mir spielen.
Aber das mit Claudia, das machte irgendwie Spaß. Es ließ mich für einen Moment meine Einsamkeit vergessen.
Während unseres Spiels legte Claudia dann plötzlich die Mädchenpuppe auf die Jungenpuppe drauf und begann, beide hin und her zu bewegen.
„Was machst du da?“, wollte ich wissen.
Claudia – noch tief ins Spiel vertieft – meinte dann: „Wir machen Sex.“
Mein starrer Blick ging Richtung Tür. Es fühlte sich auf einmal ganz komisch an, so als wäre ich bei etwas ertappt worden.
„Wie kannst du wissen, wie das geht?“, wollte ich von ihr wissen.
Ich hatte keine Ahnung, ob ich es wusste. Ich hatte auch noch nie in einem Film zum Beispiel so etwas gesehen. Aber Claudia grinste mich an. Sie schien es offenbar zu wissen, auch wenn sie erst knapp 10 war, knapp ein Jahr jünger als ich.
Dann schmiss sie die Puppen wieder in die Kiste und wich auf einmal auf ein ganz anderes Thema ab.
„Kennst du Jan? Den aus deiner Klasse?“, wollte sie wissen.
Ich nickte. „Warum? Was ist mit ihm?“
„Carina ist in ihn verliebt. Sie will ihn sich angeln, hat sie gesagt.“
„Oh“, machte ich eher desinteressiert.
„Ich bin auch in ihn verliebt. Aber ich glaube, dass ich ihn nicht bekomme. Hab einfach keine Chance gegen Carina.“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Sie weiß das nicht“, meinte Claudia zu mir. „Wenn sie es erfährt, will sie bestimmt nicht mehr meine Freundin sein.“
„Okay, ich sage nichts“, versprach ich Carinas bester Freundin. „Sie glaubt mir das wahrscheinlich sowieso nicht.“
Fragend blickte Claudia mich an.
„Ich meine, dass ich mit dir geredet habe. Das glaubt sie sicher nicht. Und dass ich mit dir gespielt habe, erst recht nicht.“
„Gut“, sagte Claudia.
„Ich wünschte sowieso, ich wäre gar nicht Carinas Bruder. Ich wünschte, ich wäre irgendjemand anderes. Vielleicht jemand mit einem ganz anderen Leben.
„Ja“, pflichtete Claudia mir bei. „Das habe ich auch oft, dass ich mir das wünsche.“
Ich zitterte. Keine Ahnung, warum, aber mir lief in diesem Moment ein kalter Schauer über den Rücken.
„Stimmt es, dass du in der Schule Mädchenklamotten tragen musstest?“, stellte sie mir dann die Frage.
Ich hielt mir die Augen zu.
„In der dritten und vierten Klasse war es so“, sagte ich leise. „Jetzt auf dem Gymnasium, wo ich seit diesem Jahr bin, ist es nicht mehr so.“
„Warum?“, hakte sie nach. „Wolltest du ein Mädchen sein?“
Ich schüttelte mit dem Kopf.
Langsam stand ich auf und setzte mich auf ein breites Sofa, das am Kellerfenster stand. Claudia kam schließlich zu mir. Sie merkte wohl, dass ich sehr nachdenklich zu sein schien, aber sie ging nicht darauf ein.
„Ich habe eine Idee“, begann sie daraufhin. „Lass uns spielen, wir wären jemand anderes.“
Fragend sah ich sie an.
„Wer magst du sein?“, ergänzte sie.
Wieder zuckte ich mit den Achseln.
„Okay“, setzte sie das Spiel fort. „Du bist Jan.“
„Und du? Wer bist du?“, wollte ich wissen.
„Ich bin deine Freundin“, antwortete sie. „Also, Jans Freundin. Du kannst dir einen Namen aussuchen, wie ich heißen soll.“
Ich musste nicht lange nachdenken. Warum mir gerade dieser eine Name in den Sinn kam, wusste ich nicht. Aber ich wusste, es sollte dieser Name sein und kein anderer.
„Natalie“, sprach ich leise.
„Okay“, sagte Claudia. „Du bist Jan, ich bin Natalie, deine Freundin.“
Auf einmal kuschelte Claudia sich an mich. Sie legte einen Arm um mich und bat mich daraufhin, es auch bei ihr zu machen. Dabei legte sie ihren Kopf in meine Schulter.
Berührungen.
Ich mochte niemals gerne Berührungen. Ein einziges Mal hatte ich es zugelassen, das war damals in der zweiten Klasse mit einer Klassenkameradin, zu der ich seinerzeit einen relativ engen Kontakt hatte. Wir besuchten uns ab und zu gegenseitig. Wir durften manchmal sogar zusammen mit dem Bus irgendwohin fahren. Ihre Eltern trauten ihr mit damals sieben Jahren schon einiges zu, und ab und zu nahm sie mich mit in den Nachbarort. Ich erinnerte mich dunkel, dass sie wahrscheinlich diejenige war, bei der ich es sogar zuließ, dass sie mich nicht nur umarmte, sondern sogar einmal küsste. Auf den Mund.
Aber daran hatte ich nicht mehr gedacht. Bis heute nicht.
„Jan“, flüsterte Claudia. „Sag, liebst du mich?“
Ich strengte mich an, das Spiel mitzuspielen, auch wenn es mir irgendwie schwer fiel.
„Ja“, antwortete ich ihr.
„Ich dich auch“, sagte sie im Spiel. „Ich habe mich nur die ganze Zeit nicht getraut, es zu sagen.“
Wir spielten dann, der Keller sei unsere Wohnung. Claudia – also, Natalie – sei bei mir, Jan, eingezogen. Ich hätte Abendessen gemacht, wir hätten dann gegessen und viel geredet. Am späten Abend hätten wir noch etwas fern gesehen – wobei unser Fernseher, so wie fast alle anderen Gegenstände, imaginär war – und anschließend seien wir ins Bett gegangen.
Nur in Unterhose bekleidet lagen wir jetzt auf dem Sofa. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir uns entkleidet hatten, so vertieft waren wir in unser Spiel. Das heimliche Spiel selbst begann ich auch nach einer Zeit zu mögen. Seltsam – mit Claudia spürte ich diese Abneigung zu Berührungen nicht, auch dann nicht, als wir unter einer realen Decke auf dem Sofa kuschelten.
„Jan, ich liebe dich und möchte dich heiraten“, sagte sie im Spiel.
Ich blickte sie an. „Ja, Natalie“, sagte ich. „Das möchte ich mit dir auch.“
Wir spielten noch so lange, bis wir sahen, dass es draußen dunkel wurde. Dann zogen wir uns wieder an, und Claudia lief nach Hause.
Unser heimliches Spiel, in denen wir in die Rollen von Jan und Natalie eintauchten, nahm in den folgenden Tagen immer mehr Form an. An jedem Nachmittag verkrümelte ich mich in den Keller – das merkte offenbar niemand von meiner Familie – und Claudia kam heimlich zu mir, und dann spielten wir unser heimliches Spiel. Es wurde nach einer Zeit sogar so intensiv, dass wir uns gar nicht mehr mit unseren realen Vornamen anredeten. Sobald sie zur Türe herein kam, war sie Natalie, und ich war Jan.
Es war kurz vor den Sommerferien, als es geschah. Unser Spiel dauerte mittlerweile schon beinahe vier Monate. Und an diesem Nachmittag – als wir wieder die abendliche Zu-Bett-Gehen-Szene spielten, entkleidete sich Claudia nicht nur bis auf die Unterhose, so wie sonst, sondern ganz.
„Du auch, Jan“, sagte sie. „Es wird Zeit, dass wir Kinder kriegen. Und heute machen wir eins.“
Ich verstand nicht ganz, was sie meinte. Und als sie mich dann aufforderte, sich auf sie zu rollen, nachdem ich ebenfalls vollkommen entkleidet war, bekam ich ein ganz merkwürdiges Gefühl. Plötzlich machte mir das Angst.
Aber Claudia hielt mich einfach sanft im Arm. Mein Zittern ließ nach einiger Zeit nach.
„Ich habe das bei meinen Eltern gesehen“, erzählte sie dann leise. „Als ich meinen Vater danach gefragt habe, hat er es mir ganz genau gezeigt.“
Ich erschrak. Ich wollte es mir nicht anmerken lassen, aber ich erschrak total. Warum, das wusste ich nicht.
„Natalie?“, fragte ich nur.
„Nein“, sagte Claudia. „Claudia hat das gesehen. Und Claudias Vater macht das mit ihr.“
Meine Lippen bebten.
„Benjamin muss das auch machen, nicht wahr?“, wollte Claudia wissen. „Sagst du mir, mit wem?“
Ich wusste nicht, ob Claudia mich weinen sah. Ich versuchte, die Tränen aus meinem Gesicht zu wischen. Aber Claudia sah es, und sie hielt mich einfach fest. Wir lagen einfach aufeinander und hielten uns fest.
Jan und Natalie zu sein, das war wie in einer anderen Welt. Dort gab es nichts Böses. Dort durften wir alles, denn wir gehörten nur uns und unserem heimlichen Spiel. Dinge, Personen aus dem realen Leben – nichts spielte mehr eine Rolle, wenn wir unser Spiel machten. Nichts konnte mehr Weh tun, alles fühlte sich gut an. Jan und Natalie – das war ein anderes Leben. Und wir tauchten in dieses Spiel noch so oft ein, wie wir es konnten. Es blieb geheim. Aber es war ein gutes Geheimnis, das wir damit teilten. Es war kein böses, so wie die anderen Geheimnisse, die sie und mich umgeben mussten.
Als ich 12 wurde, wanderte Claudia mit ihren Eltern nach Amerika aus. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Ob wir uns voneinander verabschiedeten, weiß ich nicht mehr.
Ich hatte daraufhin begonnen, alles aus dem realen Leben irgendwie von mir wegzustoßen. All die Dinge, von denen ich negative Gefühle bekam. Die Gedanken an unser heimliches Spiel bewirkten, dass ich mich weg träumen konnte. Irgendwie nahmen sie mir all die schlimmen Gedanken und vertrieben die Monster. Erklären konnte ich mir das damals nicht, aber ich wusste, es war so.
Die Augen zu machen und weg träumen. In meine eigene Welt flüchten und dort ein anderes Leben haben, jemand anderes sein als ich in Wahrheit war. Das konnte ich jetzt. Und ich glaube, das hatte damals mein Leben gerettet.
KAPITEL 3 - NACHTFAHRT
Wo war jetzt diese verfluchte Tasche?
Das Wichtigste hatte ich ja eigentlich schon zusammen. Der Fernseher, eine Riesenkiste, war bereits im Auto verstaut. Ein Wunder, dass ich es geschafft hatte, ihn alleine herunter zu tragen. Aber nachts um drei Uhr war ja keiner mehr wach, der mir hätte helfen können.
Der Koffer mit den wichtigsten Klamotten war ebenfalls bereits gepackt und verstaut. Das hatte ich heimlich gestern Abend schon gemacht. Ich hatte nicht viel eingepackt. Das Meiste würde dann sowieso am Samstag nachkommen. Von den Möbelpackern gebracht, die mein Vater engagiert hatte. Und Mutter würde mir dann alle Klamotten einpacken.
„Ha, die werden morgen gucken, wenn sie sehen, dass ich bereits weg bin“, sagte ich zu mir.
Jetzt fehlte noch die Tasche mit all meinem persönlichen Kram. Papiere, Geldbörse, Bücher und so weiter. Wo ich die hingelegt hatte, wusste ich im Moment aber nicht mehr. Gestern Abend hatte ich sie noch gehabt.
Ich suchte im Schlafzimmer. Persönlichen Kram bewahrte ich meistens im Schlafzimmer in der Schublade auf, von der ich immer hoffte, dass sie keiner aufmachte. Besonders nicht meine Mutter. In dieser Schublade hatte ich auch all die geheimen Liebesbriefe von Jenny. Keiner sollte sie sehen. Niemand.
Die Tasche war dort. Ein Aktenkoffer mit all meinem persönlichen Inhalt.
Hatte ich noch was vergessen?
Ach, du meine Güte… Natürlich. Joey. Meinen Beo. Der Vogel, der so wunderbar Geräusche nachmachen konnte. Er sah so schlicht aus, aber er konnte wundervoll singen und sogar pfeifen. Ihn wollte ich auf jeden Fall jetzt schon mitnehmen, mitsamt seinem Käfig.
Ich machte den oberen Teil des Käfiggestells vom Ständer ab und trug ihn ins Auto. Anschließend lief ich wieder hoch, holte meine persönliche Tasche und sah mich noch mal in meiner Wohnung um.
„Das war’s“, sagte ich. „Bielefeld, ich werde dich garantiert nicht vermissen.“
Nachdem ich das Licht ausmachte und die Türe abschloss, stapfte ich mit der Aktentasche zum Wagen und setzte mich rein.
Alles leer. Kein Mensch auf der Straße. Ich machte den Motor an und fuhr los.
Ich war ja eigentlich immer eher schüchtern. Zurückhaltend, ein Einzelgänger eben. Ich hatte auch nie viele Freunde, und die, die ich hatte, interessierten sich nur oberflächlich für mich. Waren wohl mit ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Karriere viel zu beschäftigt, um sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Es fiel mir nicht besonders schwer, das alles hinter mir zu lassen. Freunde. Familie. Mein Leben in Bielefeld.
Ob sie von Jenny wussten, konnte ich nur erahnen. Offiziell hatte ich einen Jobwechsel als Grund angegeben, aber eigentlich bin ich nur wegen Jenny umgezogen.
Als ich mit konstanten 130 Stundenkilometern über die fast leere Autobahn bretterte, geriet ich ins Grübeln. Heute war der 22. Dezember 2003, ein kalter Wintertag. Ich hatte es mit 25 Jahren endlich geschafft, von zu Hause wegzukommen. Endlich. Ich hätte es keine Sekunde länger mehr ausgehalten. Nicht in dieser Stadt. Nicht mit dieser Familie. Und nicht in diesem Leben.
Meine Gedanken schweiften zum gestrigen Abend. Es war eigentlich alles wie sonst. Ich saß im Keller in meinem kleinen Musikstudio, das mir mein Vater eigens eingerichtet hatte. Ich klimperte ein bisschen auf meinem Keyboard, aber etwas wirklich Schönes kam dabei nicht raus. Der Vater unterbrach dann mein Spielen ruckartig, als er – natürlich ohne anzuklopfen – in den Keller hereinkam.
„Na, Sohn, was machst du?“, wollte er wissen.
„Ich spiele“, antwortete ich. „Lässt du mich jetzt bitte alleine?“
„Wir müssen reden“, sagte er daraufhin, ohne auch nur einen Hauch Respekt an meinen Wunsch zu verschwenden.
Genervt drehte ich mich um und sah ihn an.
„Was ist?“, wollte ich wissen.
„Ich habe dir eine große Wohnung in Solingen gekauft, das weißt du“, begann er. „Eine Eigentumswohnung.“
„Ja“, sagte ich. „Wir waren vor einem Monat dort und haben den Kauf abgeschlossen. Stimmt was nicht damit?“
„Nun, mein Junge“, setzte er wieder an, „Ich bin mir nicht sicher, ob du das ganz alleine schaffst, in einer großen Stadt. Bedenke, du kennst dort niemanden.“
„Schon klar“, meinte ich. „Ich werde dort sicher Leute kennen lernen, Papa. Wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann?“
„Deine Mutter wäre sehr traurig, wenn du gehst“, sagte er. „Sie macht sich große Sorgen um dich. Und für dich ist es doch wichtig, dass sie in deiner Nähe ist.“
So ein Quatsch.
„Carina ist erst 23, und sie ist mit 19 bereits ausgezogen“, sagte ich.
„Du weißt, dass Carina mit ihrem Freund zusammenlebt. Sie haben sich eine gemeinsame Zukunft aufgebaut.“
Was mein Vater damit sagen wollte, war, dass er Carina in so vielen Dingen für so viel weiter hielt als mich. In Allem. Carina studierte – ich hatte nicht einmal einen vernünftigen Job. Carina hatte einen Freund, seit sie 18 war – ich hatte niemanden. Und wenn sie wüssten, dass ich seit einem halben Jahr Jenny hatte, hätten sie es mir nicht geglaubt. Ganz typisch meine Eltern.
Erst kürzlich sagte meine Schwester Carina zu mir, dass ich sicherlich nie von zu Hause ausziehen werde.
„Niemand hält mich für erwachsen. Meine Güte, ich bin 25. Wann soll ich denn sonst mein eigenes Leben beginnen? Ich will dieses Leben hier nicht mehr. Ich will weg von hier. Weg von euch“, wollte ich sagen.
Aber ich sagte nichts.
„Benjamin, ich kann morgen in Solingen anrufen und den Kauf der Wohnung rückgängig machen“, schlug mein Vater mir vor. „Es wäre wirklich viel, viel besser, du würdest hier in der Obhut von mir und deiner Mutter bleiben.“
Obhut. Mutter.
Vater war ja nie da. Der große, wichtige Alfred Foster hatte ja permanent Termine. Er kam immer erst spät abends vom Büro nach Hause. Und eigentlich wusste ich, dass er sich nie für meine persönlichen Belange interessierte.
Und Mutter?
Ich hatte mich nie gegen sie gewehrt. Ich wollte es so oft versuchen, aber es gelang mir nie. Sie war immer am längeren Hebel. Sie legte sich alles so zurecht, wie es ihr passte.
Ich wusste, dass sie mich nicht gehen lassen wollte. Ich wusste, dass sie nie zulassen würde, dass ich wegziehe. Weg von ihr, weg von der ganzen Scheiße.
„Ich werde umziehen!“, sagte ich zu meinem Vater. „Ich will es.“
„Nun, gut“, meinte er daraufhin. „Dann versuch dein Glück. Wenn du nicht zurechtkommst – und das wird mit Sicherheit keine drei Monate dauern – dann kannst du hierher zurückkommen. Dein Zimmer bleibt frei für dich, und die Eigentumswohnung in Solingen werde ich auf dem Markt als Verkaufsobjekt eingetragen lassen, damit ich sie auch schnell wieder verkaufen kann, wenn du zurückkommst.“
„Ich komme nicht zurück“, wollte ich sagen.
„Ja, gut“, sagte ich stattdessen. „Ich werde es trotzdem versuchen.“
„Du wirst nie ohne deine Mutter leben können“, machte mein Vater mir klar. „Du kommst wieder, das weiß ich.“
Dann ging er raus.
In der nächtlichen Dunkelheit auf der Autobahn, die nur durch das Scheinwerferlicht meines Ford Escorts unterbrochen wurde, sah ich schließlich ein Hinweisschild auf eine Raststätte. Ja, genau, das wär’s jetzt. Kurz Pause machen und einen Kaffee trinken. Vielleicht noch was Kleines essen.
Als ich auf den Parkplatz fuhr, sah ich eine Menge Trucks und Lastkraftwagen. Komischerweise schien dieser Rastplatz sehr besucht, obwohl die Straßen so leer waren.
Ich orderte schließlich an der Theke einen Kaffee, ein Glas Cola und ein Baguette mit Käse und Schinken. Mit dem Tablett setzte ich mich dann an einen freien Platz.
Kurze Zeit später – ich hatte die Cola bereits ausgetrunken – kam eine Frau an und setzte sich neben mich.
„Darf ich?“, fragte sie. Ich sah sie nur an.
Eine Frau sprach mich an. Wie ungewöhnlich war das denn?
„Sind Sie mit Ihrem LKW auf nächtlicher Tour?“, fragte sie dann.
Und sie wollte sogar ein Gespräch beginnen. Äußerst seltsam. Naja, sie kannte mich eben nicht. Sie konnte ja nicht wissen, dass ich zurückhaltend und scheu gegenüber Menschen war.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
„Man sieht kaum Autos, nur vereinzelt Lastkraftwagen auf der Straße“, sagte sie dann. „Ich bin mit meinem PKW unterwegs und komme gerade von einer Urlaubsreise zurück.“ Sie nippte dann an ihrem Getränk, das sie vor sich stehen hatte.
„Ich ziehe um“, antwortete ich ihr nur. „Ich habe meine Zelte in Bielefeld abgebrochen und ziehe nach Solingen.“
„Mitten in der Nacht?“, fragte sie ungläubig. Ich antwortete nichts darauf.
„Solingen ist eine schöne Stadt“, fügte sie hinzu. „Ich war schon ein paar Mal dort. Eine Freundin wohnt dort. Kennen Sie schon jemanden in Ihrer neuen Heimat?“
„Meine Freundin“, erklärte ich schließlich.
„Wie romantisch. Sie fahren mitten in der Nacht zu Ihrer Freundin und brechen alle Zelte zu Hause ab.“
„Ja, genau“, lächelte ich verlegen.
„Wie heißen Sie?“, fragte sie anschließend.
Warum sollte ich ihr das nicht sagen? Ich kannte sie nicht, und sie kannte mich nicht. Da war es doch eigentlich egal. Und bestimmt würde ich sie nicht wiedersehen, obwohl sie eigentlich ganz nett zu sein schien.
„Benjamin Foster“, antwortete ich.
„Ich heiße Simone Welter“, stellte sie sich vor. „Und warum ziehen Sie mitten in der Nacht um?“
„Na, ja“, begann ich. „Ich ziehe eigentlich erst am Samstag um. Meine neue Wohnung ist noch ganz leer. Ich habe nur ein paar Sachen mit, so das Wichtigste, aber ich bin dann doch schon heute losgefahren.“
„Och“, machte die Frau. „Sie können es nicht erwarten, mit Ihrer Freundin zusammen zu leben. Das ist süß.“
Ich sah sie fragend an.
„Wir sind seit einem halben Jahr in einer Fernbeziehung“, erklärte ich schließlich. „Jetzt habe ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten und musste endlich raus.“
„Ist ihre Freundin der einzige Grund, warum Sie umziehen?“, wollte die Frau dann wissen.
Ich schnaufte aus.
„Warum fragen Sie?“, wollte ich wissen.
„Nun, Sie machen mir einen eher sehr schüchternen Eindruck, fast niedergeschlagen.“
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Aus irgendeinem Grund interessierte sich diese Frau – eine fremde Frau – für meine Geschichte. Ich war das nicht gewohnt. Noch nie hat sich jemand, mal abgesehen von Jenny vielleicht, für meine Geschichte interessiert.
„Lief nie besonders gut in meiner Familie“, brachte ich nur heraus. „Ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe.“
Was hätte ich ihr erzählen können?
Meine Familie. Ein Vater, der versucht, mich unselbstständig zu halten, wo er nur konnte. Der mir das kaufte, was ich brauchte, und der glaubte, sich meine Achtung mit Geld erkaufen zu können. Eine Mutter, die mich behandelte wie ein kleines Kind und nie, nie, nie akzeptieren konnte, dass ich erwachsen war. Eine Schwester, die mich immer unterbuttert hatte, mir nie etwas zutraute und mir stets zeigte, dass sie, obwohl sie zwei Jahre jünger war, in allem weiter und reifer war als ich.
Ja, das war sicher meine Schuld. Ich ließ es ja auch jahrelang mit mir machen. Und irgendwann war es auch egal.
Aber jetzt – jetzt hatte ich meine Sachen gepackt und bin weg. Weg aus dem tristen Alltag. Weg aus meinem alten, schwachen Leben.
„Ich muss weiter“, verabschiedete ich mich dann von der Frau.
„War nett, mit Ihnen zu reden.“
Ich ging zu meinem Auto und machte mich wieder auf den Weg in das Morgengrauen, das bereits anfing, und fuhr die letzten 100 Kilometer bis zu meinem neuen Zuhause.
Unvergleichlich, dieser Moment, als ich meine Wohnung im fünften Stock aufschloss. Endlich.
Es waren noch keine Möbel drin. Egal. Nur eine Matratze lag im riesigen Wohnzimmer auf dem Boden. Aber das Licht ging schon, und Wasser lief auch.
Nachdem ich alles oben hatte, legte ich mich auf die Matratze und begann zu träumen.
Was mich wohl jetzt erwarten würde?
Die Frau in der Raststätte hatte Recht, ich kannte hier niemanden. Außer Jenny. Ich, Benjamin Foster, würde jetzt hier ein ganz neues Leben anfangen. Ich brauchte nicht mehr an mein früheres Leben zu denken. Es lag hinter mir, es war vorbei.
Verdammt. Plötzlich packten mich unvorbereitet Zweifel. Ich hatte keine Ahnung, wo sie herkamen. Wie ein Blitz schossen sie mir durch den Kopf. Verfluchter Mist.
Was wäre, wenn Vater Recht hätte? Wenn ich es wirklich nicht schaffte und vielleicht schon nächste Woche zurück nach Bielefeld gehen müsste, weil ich hier total gescheitert bin? Sollte ich jetzt schon gescheitert sein, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist?
Was waren das für Gedanken, die ich nicht haben wollte? War das normal, wenn man von zu Hause weggeht?
Ich wollte nicht mehr nach Hause zurück. Nie mehr.
Plötzlich klingelte es an meiner Tür, um neun Uhr morgens. Und ich wusste, wer das war.
Meine bösen Gedanken schienen von einer Sekunde auf die Andere wieder weg zu sein. Ich konnte mich freuen. Ja, und das tat ich auch.
Eilig hüpfte ich zu der großen, verglasten Eingangstüre meiner Wohnung, die auf den Laubengang führte und machte sie auf.
„Jenny“, hauchte ich lächelnd.
„Du bist da“, sagte sie leise, und dann nahm sie mich in ihre Arme. Sie wollte gar nicht mehr loslassen.
Ich brachte keinen Ton heraus. Voller Erleichterung legte ich einfach meinen Kopf in ihre Schulter und weinte.
„Ist ja gut“, sagte sie. „Du bist ja jetzt hier. Und ich bin jetzt bei dir.“
„Meine Wohnung“, stammelte ich. „Meine eigene Wohnung“
Wir gingen auf die Matratze – was Anderes zum Hinsetzen war ja noch nicht da – und ließen uns dort nieder, während wir einige Minuten stumm waren und den zarten Schneeflocken zusahen, die vom morgendlichen Himmel fielen und wunderschöne Eisblumen auf die Fenster zauberten.
„Jenny“, sagte ich schließlich.
„Ja, Benjamin?“
„Es ist so… so anders. Alles ist so anders.“
Jenny lächelte mich mit ihren süßen Lippen an. „Wir haben uns nur alle paar Wochen treffen können, als du noch in Bielefeld gewohnt hast. Jetzt können wir uns jeden Tag sehen.“
Ich streichelte durch ihre Haare.
„Du riechst gut“, bemerkte ich.
„Gefällt dir mein neues Parfum? Habe ich extra für dich gekauft.“ Sie grinste. „Du, Benjamin, ich muss dich was fragen“, fügte sie
dann hinzu.
Ich sah in ihre Augen.
„Willst du wirklich mein fester Freund sein?“
Warum fragte sie mich das? Enttäuscht drehte ich mich dann zum Fenster und betrachtete das Dach des gegenüberliegenden Hauses, was man von hier aus gut sehen konnte.
„Jenny, das weißt du“, sagte ich. „Für dich bin ich hierhergekommen, warum glaubst du mir nicht?“
„Ich glaube dir ja“, erklärte Jenny. „Aber ich bin zwölf Jahre älter als du. Ich bin 37 Jahre alt und verheiratet.“
„Ich weiß“, sagte ich. „Ich habe dir gesagt, es macht mir nichts. Ich möchte dein Geliebter sein. Ich kann mich damit anfreunden, dass du einen Mann hast. Und ich habe immer gefühlt, dass genug Platz für mich in deinem Herzen ist.“ Ich drehte mich wieder zu ihr. „Ich dachte, wir wären uns darin einig gewesen.“
„Ach, Benjamin“, meinte sie daraufhin. Und schließlich küsste sie mich auf den Mund.
„Was wird denn jetzt anders?“, fragte ich. „Ich bin jetzt nur immer hier. Ich muss nicht mehr alle drei oder vier Wochen so weit fahren, für einen Tag oder eine Nacht. Jetzt wohne ich hier. Oh, mein Gott, Jenny… ich wohne hier“
Ich stand auf.
Und dann machte ich zum ersten Mal etwas, was ich vor langer Zeit das letzte Mal getan hatte. Ich hüpfte durch die Wohnung. Und ich lachte. Ich wusste nicht mehr, wann ich das letzte Mal gelacht hatte. Aber jetzt packte es mich irgendwie. Ich schrie vor Lachen, so als wäre alles Negative, was ich je in mir trug, von einer auf die andere Sekunde von mir abgefallen.
Ich hoffte so sehr, dass das so war.
„Bist du glücklich?“, wollte Jenny wissen.
Ich unterbrach das Lachen und Tanzen und sah sie von der Ecke aus an.
Ich ging zu ihr, fasste ihren Arm und hob sie an. Dann tanzte ich mit ihr einen langsamen Stehblues ohne Musik. Wir brauchten dazu keine Klänge, denn das Lied, was gespielt wurde, war in unseren Herzen.
„Ja, ich bin glücklich“, sagte ich zu ihr.
„Vermisst du deine Familie? Dein altes Zuhause?“
„Bitte, Jenny“, flüsterte ich. „Mach’ diesen Moment, diesen unglaublich schönen Moment nicht mit einer Frage nach meiner Familie kaputt.“
„Verzeihe mir“, entgegnete sie nur.
„Ich möchte nicht darüber sprechen“, erklärte ich ihr. „Dass ich mich nie gut mit ihnen verstanden habe, das weißt du. Ich… ach, Jenny, ich bin jetzt einfach froh, dass ich hier bin. Nicht mehr dort, in meinem alten Zuhause. Können wir es nicht einfach dabei belassen?“
„Ich will nur, dass du weißt, wenn du mit jemandem reden willst, dann bin ich da. Und jetzt, wo du hier wohnst, bin ich auch ganz in deiner Nähe. Keine acht Kilometer entfernt.“
Ich lächelte. „Ja“, sagte ich.
Wieder küssten wir uns innig. Und während ihre Hand meine dunklen, schulterlangen Haare umspielten, streifte ich den Stoffgürtel von ihrem Kleid ab.
Es war uns egal, dass die Heizung noch nicht richtig an war, und dass es eigentlich in der Wohnung noch kühl war, was sich wahrscheinlich spätestens zum Abend hin ändern sollte. Wir zogen uns nackt aus und schliefen miteinander.
Es passierte schon mehrmals, immer dann, wenn ich sie heimlich besucht hatte. Drei oder vier Mal hatten wir bereits ein heimliches Erlebnis. Von meiner Familie wusste das keiner, weder Vater noch Mutter oder Schwester. Sie hätten mir das sowieso nie zugetraut. Benjamin Foster hat eine Freundin? Der Junge, der immer alleine ist, kaum Freunde hat und sich immer in seinem Zimmer verschanzt? Der?
Jennys Mann wusste es auch nicht. Irgendwie gelang es ihr ganz gut, mich vor ihm geheim zu halten. Wahrscheinlich wusste er nicht einmal, dass es mich gab.
Als wir heute miteinander intim wurden, war es anders als zuvor. Es war magisch, irgendwie noch geheimnisvoller und leidenschaftlicher, etwas ganz Besonderes. Ich wusste nicht, was anders war, aber vielleicht lag es daran, dass ich jetzt hier wohnte, und dass ich mich zum ersten Mal im Leben frei fühlte. Das konnte nicht falsch sein.
Ob ich glücklich war, hatte Jenny mich vorhin gefragt. In diesem Moment war ich es.
Nachdem ich dann am Nachmittag das Telefon angeschlossen hatte, das ich mitgebracht hatte, machte sich Jenny wieder auf den Weg nach Hause. Sie versprach mir aber, mich am Abend noch mal anzurufen.
So, nun war ich hier in der neuen Stadt. Ich musste an nichts Böses denken. Ich konnte einfach frei entscheiden, was ich machen wollte. Unglaublich. Ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen sollte.
Vielleicht sollte ich mich in der Umgebung schon mal ein bisschen umsehen. Ja, das wäre gut, dachte ich bei mir. Und so schnappte ich mein Geld und meine Schlüssel, huschte aus der Wohnung und lief los.
Der Wohnkomplex, in dem mein Vater mir diese große Eigentumswohnung gekauft hatte, lag etwas abseits in einem Vorort von Solingen. Eigentlich waren wir hier noch nicht richtig in einer Stadt, es war mehr ein Dorf, fast in sich abgeschlossen. Aber es gab Busse, die zur Innenstadt fuhren, und der Busbahnhof war nicht weit von hier.
Ich hatte eigentlich vor, nach Solingen rein zu fahren, aber dann sah ich am Busbahnhof dieses urige Lokal, eine Eckkneipe mit einem interessanten, alten Vorbau. Das Haus war eher im alten Stil gehalten, und die Reklametafel erschien mir gleich sympathisch. Boxer, stand in großen Lettern über einem neonfarbenen Cocktailglas. Das passte so gar nicht zum Haus.
Super, dachte ich.
Als ich hinein ging, waren an der langen Theke, in dem schmalen Raum, ein paar Leute, meist ältere Männer so um die 40, 50 Jahre. Ich kam mir ein bisschen verloren vor mit meinen 25, aber das spielte keine Rolle.
Ich setzte mich und bestellte mir ein Bier.
„Neu hier?“, fragte einer, der neben mir saß.
„Ja“, sagte ich schon etwas aufgelockert, nachdem ich den ersten Schluck getrunken hatte. Was für ein Glück wirkte der Alkohol immer sofort bei mir. „Bin heute zugezogen.“
„Ah“, meinte der Mann. „Woher kommst du?“
„Aus Bielefeld.“
„Dann bist du dort Student gewesen?“, wollte er wissen.
Es passierte meist nach dem ersten Glas schon. Ich wusste das. Sofort, wenn ich was getrunken hatte, merkte ich, dass in mir irgendetwas geschah. Und diese Verwandlung, diese Mutation, die dann mit mir passierte, war eigentlich das, wonach ich heimlich und seit Jahren immer wieder suchte. Ich genoss es jedes Mal, wenn ich es zu Hause heimlich getan hatte. Und wenn ich mich in der Nacht weggeschlichen habe, ohne dass Vater oder Mutter es merkten, war der Kick besonders groß. Ich tat ja nie was Verbotenes, hätte mir eh niemand zugetraut. Aber das – das war einfach meins. Und das wusste ich.
Und jetzt konnte ich es endlich unkontrolliert in Freiheit machen. Jetzt konnte ich trinken, was ich wollte und wie viel ich wollte. Keiner war da, der mir Vorhaltungen machen würde oder eine Moralpredigt halten würde.
Ich trank gerne. Schon früher. Es gab mir immer etwas Besonderes, wenn ich es tat. Es war jedes Mal ein angenehmer Moment, dann zu dem zu werden, der ich anschließend durch den Alkohol war.
„Student? Ich?“, fragte ich zurück. „Das ist lange her. Ich habe früh angefangen mit dem Studium. Ich bin Jungunternehmer.“
„So?“, fragte der Mann. „Was unternimmst du denn?“
Er lachte, während ich mir bereits das zweite Glas Bier reinzog.
„Geschäfte“, sagte ich, ohne näher darauf eingehen zu wollen. Ich war von Beruf Sohn. Ich hatte nichts gelernt und hatte bestenfalls einen möglichen Job hier in Solingen in Aussicht, für den ich eine Bewerbung geschrieben hatte, damit mir mein Vater die Wohnung kaufen würde.
Aber jetzt war ich jemand Anderes.
„Gut, Geschäftsmann“, meinte der auch schon halbwegs angeheiterte Mann zu mir. „Gibst du eine Runde aus?“
„Ja, sicher“, lachte ich. „Eine Lokalrunde auf mich“, rief ich dem Wirt zu.
Wird ja bei gerade mal acht Leuten sicher nicht so teuer, dachte ich mir. Aber das war mir auch egal. Ich hatte genug Geld bei mir, bestimmt einen Hunderter. Und würde mir am nächsten Morgen Geld fehlen, konnte ich ja Papa anrufen und nach neuem Geld fragen.
Ich hatte wirklich nie gelernt, für mich alleine zu sorgen. Mein Vater kaufte mir die Wohnung unter der Prämisse, dass er sich
weiterhin sicher sein konnte, die Kontrolle über mich zu haben. Er war sich ja sowieso davon überzeugt, dass ich nach einigen Wochen wieder in Bielefeld landen würde. Und er ließ mich gehen, aber nur, wenn er mich nicht aus seinem Abhängigkeitsverhältnis verlieren würde. Und damit, dass er mir immer Geld schickte, hatte er dafür gesorgt.
„Spielst du mit, eine Runde Poker?“, fragte dann ein dritter Mann.
„Der Verlierer gibt eine Runde.“
Wir spielten den ganzen Abend. Und je voller ich wurde, desto mehr verlor ich. Sieben, acht oder neun Runden hatte ich zu zahlen, verdammter Mist.
Aber was soll’s, dachte ich mir.
Ich hatte neue Freunde gefunden. Die Leute hier im Lokal waren ganz gut drauf, und je besoffener ich war, desto freundlicher erschienen sie mir.
„Gibst du eine Runde?“
„Komm, bestell noch einen, Kumpel.“
„Du bist Klasse, du kannst ja ganz schön viel in dich rein kippen.“ Ja, das konnte ich. Nach bestimmt zwölf Bier war mein Level noch lange nicht erreicht, und ich wollte weiter trinken. Jedoch machte der Wirt uns darauf aufmerksam, dass er in einigen Minuten die Kneipe für heute schließen würde und forderte uns auf, zu gehen und morgen wieder zu kommen.
„Klar, ich bin dabei“, lallte ich.
Ich hatte ja sowieso nichts zu tun. Der potentielle Job – wer weiß, ob ich den überhaupt kriegen würde – war ja noch weit hin. Deshalb konnte ich hier in meiner neuen Heimat erst einmal rumdümpeln.
„He, ich komme morgen wieder“, rief ich dann in die Runde rein.
„Ihr seid klasse, Leute. Wisst ihr was, ich bin auch klasse. Ich bin ein ganz Großer“, warf ich nach.
Die Leute lachten. Ob sie sich für mich freuten, mit mir lachten oder mich einfach auslachten, das war mir egal.
„Ich habe hier in Solingen eine Freundin“, rief ich. „Sie liebt mich.“
„Du bist voll“, stellte der Wirt fest.
„Sie liebt mich wirklich“, sagte ich. „Ich habe einen tollen Job. Ich bin Geschäftsmann. Wie mein Vater. Der ist auch Geschäftsmann. Wir haben viel Geld. Und wo das herkommt, da ist noch mehr.“
„Haha“, meinte einer der Gäste. „Dann kannst du es ja morgen wieder in die Kneipe tragen. Wir freuen uns.“
„Ja“, sagte ich zu ihm. „Was willst du?“, ging ich ihn plötzlich aggressiv an. „Bist du nicht zufrieden, wenn ich Runden schmeiße? Du kannst wohl keine Runden schmeißen.“
„He“, meinte der Mann. „Ich habe auch Runden geschmissen, weißt du?“ Er lachte und sah mich dann ernst an. „Mir gefällt deine Visage nicht“, sagte er schließlich.
„Und jetzt?“, meinte ich mutig. „Was willst du tun?“
„Hier ist man nicht frech.“
„Ich? Frech?“, sagte ich. „He, Mann, du machst mich an? Ich bin frech?“
„Hör mal“, sagte der Wirt schließlich zu mir. „Komm morgen wieder. Für heute hast du genug.“
„Ich habe nicht genug“, brüllte ich. „Ich weiß selbst, wann ich genug habe. Komm schon, mach mir noch ein Bier. Ihr seid doch meine neuen Freunde.“
„Morgen!“, brüllte der Wirt.
„Tolle Freunde“, schnaubte ich.
Dann wankte ich, nachdem ich fast vom Barhocker fiel, zu der Tür, die ich für den Ausgang hielt und prallte dagegen.
Verflixt, dachte ich mir. Aber das war mir egal. Ist mir
schließlich schon tausendmal passiert.
Irgendjemand half mir dann durch die Türe, und ich torkelte die Straße hinüber zu dem Hügel, wo der Weg war, der zu meinem Haus führte.