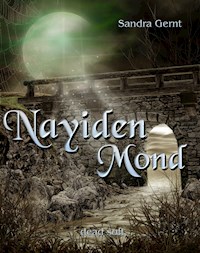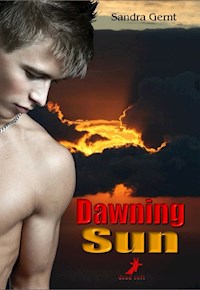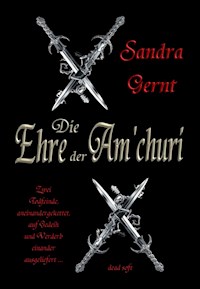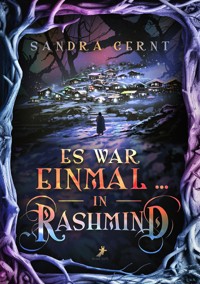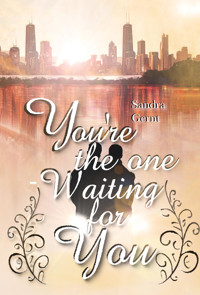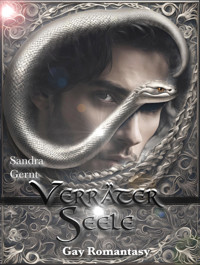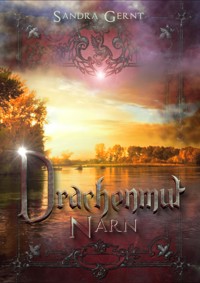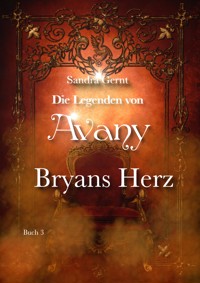4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Taten zeigen, wer wir sind, Worte, wer wir sein wollen.“ Keine Nacht vergeht, in der Marten nicht am Strand sitzt und sehnsüchtig auf das Meer hinausblickt, auf der Suche nach Freiheit. Freiheit von der Familie, die ihn wie einen Sklaven benutzt. Kein Tag vergeht, in der Tihuun nicht aus den Tiefen des Meeres hinaufblickt, zum Licht, das sich schwach an der Oberfläche spiegelt, auf der Suche nach Antworten. Antworten auf Fragen, die zu stellen ihm nicht erlaubt sind. Bis sie einander eines Tages im Zwiellicht der Dämmerung begegnen … Ein gayromantisches Märchen Ca. 50.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 245 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„Taten zeigen, wer wir sind, Worte, wer wir sein wollen.“
Keine Nacht vergeht, in der Marten nicht am Strand sitzt und sehnsüchtig auf das Meer hinausblickt, auf der Suche nach Freiheit. Freiheit von der Familie, die ihn wie einen Sklaven benutzt.
Kein Tag vergeht, in der Tihuun nicht aus den Tiefen des Meeres hinaufblickt, zum Licht, das sich schwach an der Oberfläche spiegelt, auf der Suche nach Antworten. Antworten auf Fragen, die zu stellen ihm nicht erlaubt sind.
Bis sie einander eines Tages im Zwiellicht der Dämmerung begegnen …
Ein gayromantisches Märchen
Ca. 50.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 245 Seiten.
von
Sandra Gernt
Das sanfte Rauschen der Wellen erfüllte Martens gesamte Wahrnehmung. Sein Dasein war begrenzt und befreit zugleich von dem ewigen Rhythmus, in dem Welle um Welle an den Ufergestaden brachen.
Es beruhigte ihn, erdete ihn, wenn er nachts vor dem Schlafengehen noch für einige Minuten hier draußen stehen konnte, sich gegen den ewigen Wind stemmte und der Welt beim Atmen lauschte. Ein und aus. Welle um Welle.
Er liebte das Meer in jeglicher Laune. Ob zart und behutsam oder zornig und stürmisch, hier war er zu Hause. Ob der Wind nun zärtlich über sein Gesicht streichelte oder wild fauchte oder ihn sogar brutal niederzuringen versuchte, er begrüßte seine Umarmung. Am Strand zu stehen, das Salz auf der Haut zu spüren, es zu riechen, im Sand zu versinken und Welle um Welle um Welle zu lauschen – das war der eine Moment, in dem er sich frei fühlte. Losgelöst von dem Leid, das sein alltägliches Leben bedeutete. In stürmischen Nächten wagte Marten es, barfuß über den Strand zu rennen und laut zu singen, zu schreien, vollkommen aus sich herauszugehen. So lange, bis er seine Kleidung von sich warf und nackt in die sprühende Gischt hineinlief, sich von der puren Gewalt des Wassers zu Fall bringen ließ, bis er halb erfroren und völlig erschöpft auf allen Vieren zurück an den Strand kroch.
Heute war es ruhig. Der Wind blies frostig kalt, wie es für den Übergang zwischen Winter und Frühling normal war, doch es blieb bei einzelnen Böen und ansonsten eher sanften Verwehungen. In solchen Nächten würde Marten niemals schreien oder ein Lied anstimmen. Die Gefahr, dass man ihn bis zum Haus hinauf hören könnte, auch wenn es rund dreihundert Schritt entfernt von hier hinter den Dünen und dem großen Schutzdamm stand, war ihm zu erdrückend. Niemand durfte ihn hören. Niemand sollte wissen, dass er sich Nacht um Nacht davonschlich, obgleich sie ihn sicher in seinem Keller eingeschlossen glaubten.
Seufzend blickte Marten zum Mond hinauf, der so weit fern zu sein schien heute Nacht. Winzig klein und fast gerundet. Er umfasste seinen Anhänger, den er seit seiner Geburt trug. Sein einziger Besitz, abgesehen von der Kleidung. Die erhielt er von seinen älteren Brüdern und musste sie auftragen, bis sie ihm in Fetzen vom Leib fielen. Das war in Ordnung, soweit. Er verstand, warum sein Leben so sein musste, wie es nun einmal war. Aus diesem Grund kam auch eine Flucht nicht für ihn infrage, obwohl es mit Leichtigkeit möglich wäre. Marten könnte jederzeit den Fängen seiner Familie entfliehen … Und war so gründlich mit unsichtbaren Ketten an das Haus gebunden, dass es schlichtweg unmöglich war. Keine Freiheit für ihn, außer jene gestohlenen Minuten einmal pro Nacht. Es half, um durchzuhalten.
Das man ihm seinen Anhänger beließ, war die größte Gnade überhaupt, auf die er hoffen konnte. Seine Mutter hatte es ihm geschenkt. Ein silberner Anhänger. Zwei fein stilisierte Fische, die in unterschiedliche Richtungen schwammen. Sie waren das perfekte Symbol für ihn. Ein Teil seiner Seele sehnte sich nach dem Meer und der Freiheit. Der andere Teil blieb freiwillig ein Gefangener.
Marten küsste den Anhänger, dankte Lourdra, der Göttin des Lebens, das er atmete und sein Herz schlug. Das zweite kurze Stoßgebet ging an Shanut, dem Gott des Todes.
Lass meine Mutter noch ein wenig in dieser Welt, o Herr. Ich bitte dich, nimm sie nicht jetzt schon zu dir.
Ein letzter Blick auf die Wellen. Dann ging Marten eilig zurück, den altvertrauten Weg. Ein weiterer langer, endloser, mühsamer Tag erwartete ihn nach viel zu kurzen Stunden des Schlafs. Er war sich sicher, dass er ihn würde durchstehen können.
„Tihuun! Nun komm endlich!“
Er schreckte zusammen, hatte nicht gehört, wie sich die anderen Jäger ihm genähert hatten. Es gefiel ihm nicht, die Vorstellung, heute schon wieder Fische jagen zu müssen. Natürlich war die Jagd wichtig und er wollte essen wie jeder andere auch. Aber warum musste es jetzt sein? Warum heute? Das Licht war wunderschön. Tihuun wollte sich viel lieber hinsetzen und dem Licht beim Wandern zuschauen.
Natürlich war es höchst gefährlich, sich in die flachen Wasserzonen zu begeben. Dort, wo man der Oberfläche nah genug war, um in der hellen Zeit, wenn der strahlende Feuerball durch das Himmelsmeer segelte – ohne zu verlöschen, man stelle sich das vor! – Um in diesen Stunden der Helligkeit Lichtstrahlen bis zum Grund des Meeres beobachten zu können. Wer so nah an der Grenze schwamm, lief durchaus Gefahr, Menschen zu begegnen. Die Zweibeiner mit ihren kleinen Booten, die genauso auf Fischjagd auszogen wie ihre Geschwister, die Meeresleute. Begegnungen zwischen den Völkern waren in der Vergangenheit häufig blutig ausgegangen, darum war es strikt verboten, sich den Zweibeinern zu nähern – außer in absoluten Notsituationen, die sich nicht planen ließen. Das wollte Tihuun ja auch gar nicht. Er interessierte sich nicht für dieses Volk, das auf Felsen und Sand lebte, statt sich in den unendlichen Weiten unter dem Meer anzusiedeln, wie es vernünftig wäre. Zweibeiner waren dumm und langweilig und hatten Angst vor dem Meer. Die meisten von ihnen konnten nicht einmal schwimmen!
Diesen Mangel glichen sie mit handwerklichem Geschick aus. Oh, Tihuun gehörte keineswegs zu jenen, die den Zweibeinern jegliche Art von Wissen, Können, Zivilisation und Kultur absprechen wollten wie so viele seiner Freunde. Auch wenn die Neridae, das Meeresvolk, höchste Kunstfertigkeit im Erschaffen von Gebrauchs- und Nutzgegenständen besaß, Waffen in magischem Feuer schmiedete, Gärten am Meeresgrund hegte und pflegte, so gab es deutliche Hinweise, dass die Menschen dies genauso taten. Die Boote, Netze, Speere und Angelhaken entstanden jedenfalls nicht im Meeresschaum, und wenn mancher Fischkopf noch so energisch darauf pochte: Zweibeiner waren nicht dumm. Sie ruhten sich auch nicht ausschließlich auf den Geschenken aus, die das Meeresvolk ihnen in der alten Zeit überbracht hatten. Das war eine weitere verbreitete Meinung.
Nun, das kümmerte Tihuun gerade nicht. Er konnte sich nicht länger zwischen Felsen und Korallen verstecken, also gab er sein schönes Versteck auf und schwamm auf die kleine Gruppe zu. Vier seiner Geschwister waren darunter. Antji, seine jüngste Schwester, durfte heute zum ersten Mal mit den Jägern hinaus schwimmen. Sein älterer Bruder Shkuur hingegen führte die Gruppe an, wie seit vielen Kaltzeiten schon.
Eine Unendlichkeit von beinahe dreihundertsiebzig Wechseln zwischen Tag und Nacht, so lange dauerte die Tragzeit und Wanderungen eines Grauwals. So lange dauerte es auch, bis die kalte Zeit, oder einfach Kaltzeit genannt, einmal gekommen, gegangen und zurückgekehrt war. Intensive Beobachtungen hatten ergeben, dass die Temperatur des Wassers mit dem Feuerball am Himmelsmeer eng zusammenhing. Die Neridae nannten diese Spanne abgekürzt ebenfalls einfach Kaltzeit.
„Endlich, Tihuun, wo bleibst du? Warum müssen wir immer auf dich warten?“, fragte Shkuur vorwurfsvoll. „Die Thunfische warten jedenfalls nicht auf uns.“
„Verzeih“, murmelte Tihuun beschämt. Weiter führte er seine Entschuldigung nicht aus. Man würde ihn wie bereits früher geschehen auslachen, wenn er von seiner Bewunderung für die Schönheit des Lichts sprach, oder seinem Verlangen nach Antworten auf viele, viele, viele Fragen. Es gab dringendere Probleme. Beispielsweise hatten sie vor Kurzem ihre größte Seegurkenfarm durch den Ausbruch eines Meeresvulkans verloren. Vulkanschlacke und Schwefel hatten hundertausende Meerestiere getötet, Korallen und Muschelbänke vernichtet, mehrere Meilen Meeresgrund auf Monate hinweg unbewohnbar gemacht. Sehr ärgerlich und mühsam, denn sie mussten dadurch häufiger auf die Jagd gehen. Die großen Fischschwärme lockten Haie, Delfine und andere gefährliche Räuber an, die mit ihnen konkurrierten. Die schlimmste Gefahr stellten dabei Menschen dar. Tihuun bevorzugte es darum sehr, ausgewachsene Seegurken vom Meeresboden zu sammeln. Diese Tiere gab es in praktisch unbegrenzt vielen Arten, viele davon in der Tiefsee. Man musste geschickt sein, um sie unverletzt einsammeln zu können, denn sie besaßen zumeist Stacheln und konnten einem unvorsichtigen Angreifer ein schleimig-klebriges, giftiges Sekret entgegenspucken. Dennoch war Tihuun das lieber, als mit der Harpune hinter Thunfischen herzujagen.
Doch für die Sippe war kein Opfer zu klein und er wollte nicht, dass die Kleinen hungern mussten.
„Bereit?“, fragte Antji aufgeregt, die mit ihrem hübschen hellgrün schimmernden Schwanz umherzappelte und ihr ebenso hellgrünes Haar frei tanzen ließ. Ihre Zwillingsschwester Antiri hatte schon bei der letzten Jagd teilgenommen und lachte nachsichtig über ihre Freude.
„Ich bin bereit.“ Tihuun warf einen letzten sehnsüchtigen Blick auf das Licht. Keinen Frieden, keine Ruhe für heute. Er umfasste seine Harpune fester und folgte seiner Gruppe. Noch zehn, höchstens zwanzig Kaltzeiten, dann würde er zu alt für die Jagd sein und konnte sich seinen Platz in der Sippe als Lehrmeister für die Jungen, als Handwerker oder Gärtner verdienen. Was freute er sich schon darauf!
Ein weiterer Tag war vergangen.
Marten legte Holz nach, damit die Glut im gusseisernen Küchenherd über Nacht ausreichend Nahrung erhielt. Menschen und Tiere waren versorgt.
Niemand hatte ihn heute geschlagen.
Ein guter Tag.
Jetzt musste er nur noch warten, bis er die schweren Schritte seines Stiefvaters über seinem Kopf hörte, die verrieten, dass dieser ins Bett ging. Erst danach konnte Marten sich auf den Weg zum Meer machen. Vorher bestand zu große Gefahr, dass jemand noch etwas einfiel, mit dem man ihn belästigen könnte.
Er legte sich auf das Bett und umfasste seinen Anhänger.
Die Fische … Es gab ein Sternzeichen, das Fische genannt wurde. Als Marten ein kleiner Junge war, hatte sein Halbbruder Vornek ihm das entsprechende Himmelsbild gezeigt. Für sie beide war es nichts weiter als ein Haufen Sterne gewesen, der eben zufällig dicht genug beieinander stand, dass man ihn für ein Abbild von irgendetwas halten konnte. Fische sah er tatsächlich beim besten Willen nicht darin. Das änderte nichts daran, dass er den Sternenhimmel für seine Schönheit liebte.
Martens Mutter gehörte zu denjenigen, die intensiv daran glaubten, dass Sterne Bedeutung für das menschliche Schicksal besaßen. Dementsprechend schöne Rituale und Glaubensstrukturen hatten sich die Leute in den alten Zeiten ausgedacht. Jeweils ein Sternzeichen regierte für einen Monat im Jahr. Das hatte etwas mit der Position der Bilder am Nachthimmel zu tun, deren Wanderungen Marten beim besten Willen nicht begriff.
Es ärgerte ihn sehr, dass er so viele Dinge nicht wusste und nicht verstand, einfach weil ihm weder Zeit noch Kraft blieb, sich häufiger als einmal pro Jahr ein Buch aus der großen Bibliothek seines Stiefvaters zu stehlen und gelegentlich eine halbe Seite darin zu lesen. Lesen und Schreiben und einfaches Rechnen hatte er erlernt, während er dem Privatunterricht seiner Brüder gelauscht hatte. Vornek und Bastian hatten ihm vor Jahren auch das eine oder andere erklärt, etwa die Geheimnisse des Subtrahierens. Das würden sie heute nicht mehr tun, dafür hatten sie zu sehr die Einstellung des Vaters zu Marten angenommen, die sich im Laufe der Zeit verschärft hatte. Je weiter er gereift war, desto schlimmer war es geworden. Und seit Mutter krank geworden war …
Nun – die Sterne. Marten war im Zeichen der Fische geboren und seine Mutter hatte das für wichtig genug befunden, um ihm diesen Anhänger anfertigen zu lassen. Auch seinem Vater und seinen Brüdern hatte sie solche Anhänger geschenkt. Marten teilte nicht ihren Glauben an die schicksalsträchtige Macht der Sterne. Eigentlich glaubte er nicht einmal so richtig an die Macht der Götter. Dafür hatte er dann doch zu viele Bücher gelesen. In der Sammlung seines Stiefvaters standen ausschließlich ledergebundene Werke über Wissenschaft, Mathematik, Philosphie und die allgemeine Aufklärung der Menschheit über das Wesen der Natur. Marten verstand das Wenigste davon, doch immer noch genug, um Religion und Sternenglauben weitläufig den Rücken zu kehren – im Sinne von eher nicht richtig, dieser Glaube auch wenn das eventuell ein Irrtum sein könnte.
Woran er hingegen unerschütterlich glaubte, war die Liebe seiner Mutter zu ihm, als er geboren wurde. Aus diesem Grund streichelte er mehrmals täglich seinen schönen Anhänger und erfreute sich an den Details der aufwändigen Silberschmiedearbeit.
Als er knarzendes Holz und schwere Schritte hörte, fuhr er erschrocken zusammen. Jemand kam zu ihm in den Keller hinab! Rasch sprang er aus dem Bett, zerrte sich das fadenscheinige Hemd über den Kopf und streifte die Schuhe ab, als wäre er gerade im Begriff, sich zum Schlafen umzuziehen. Schon drehte sich der Schlüssel, die Tür wurde geöffnet. Sein Stiefvater erschien in dem Raum, der nicht mehr als eine niedrige Kammer war, mit gerade noch genug Platz für sein Bett und einen Stuhl, auf dem die Waschschüssel bereitstand. Boden, Wände und Decke bestanden aus gestampften Lehm und Lehmziegelsteinen. Ein Fenster gab es nicht, das Licht stammte von einer Öllaterne.
„Warum bist du noch wach?“, fragte sein Stiefvater streng. Er war ein großer, breitschultriger Mann, der in letzten Jahren einiges an Masse zugelegt hatte – nichts davon an Muskeln. Doch Haar und Vollbart waren nach wie vor Schwarz, ohne einen Hauch von Frost, wie es bei einem Endvierziger sonst zu erwarten gewesen wäre. Gepflegt und stattlich präsentierte er sich Marten, selbst zu dieser späten Stunde.
„Verzeiht, Herr“, stammelte Marten. „Ich war übermüdet eingedöst und …“
„Schweig.“ Die harschen Worte wurden von einer energischen Geste unterstrichen. „Morgen Abend besucht mich ein Freund. Die Botschaft wurde gerade eben erst geliefert. Ich will ihm gebratenen Fisch servieren. Du weißt, was du zu tun hast.“
„Ja, Herr.“ Marten verneigte sich. Als er sich wieder aufrichtete, sah er gerade noch, wie sich die Tür schloss. Der Schlüssel wurde nicht gedreht, denn er musste morgen früh das Haus selbstständig verlassen können, statt wie sonst zu warten, dass man ihn befreite. Dieses Eingeschlossen werden hatte vermutlich noch nie darauf beruht, dass man fürchtete, er könnte davonlaufen. Es diente wohl einzig seiner Erniedrigung. Oder sein Stiefvater wollte nicht, dass Marten sich nachts zu seiner Mutter schlich, was er sowieso nicht tun würde. Es war gleichgültig.
Seufzend wusch er sich, zog sich um, reinigte seine Zähne. Sein Stiefvater stellte ihm tatsächlich ausgezeichnete Pflegeprodukte zur Verfügung und erwartete, dass Marten stets frisch gewaschen, gut rasiert und gekämmt war und sein dunkelbraunes Haar nicht länger als eine Handbreit wachsen ließ. Auch die Kleidung, die man ihm gab, musste immer gewaschen und geflickt sein. Sein Stiefvater hasste es, von üblen Gerüchen oder dem Anblick von faulenden Zähnen belästigt zu werden. Ein Bart und langes Haar stand seiner Meinung nach nur Männern der führenden Elite zu, während das dienstbare Volk schlichtweg keine Zeit hatte, sich angemessen um solchen Körperschmuck zu kümmern und ihn frei von Zotteln, Knoten, Schmutz und Ungeziefer zu halten. Nach kurzer Überlegung rasierte sich Marten bereits jetzt. Morgen würde er zwei Stunden vor Sonnenaufgang aufstehen und aufs Meer hinausfahren müssen, um das Abendessen zu angeln. Somit blieb keine Zeit für seinen sonst üblichen Nachtausflug, dafür umso mehr Gelegenheit, sich morgen früh in Freiheit zu wähnen. Ganz ohne sich fortstehlen zu müssen. Wie wundervoll!
Marten stellte seinen mechanischen Wecker. Auch das war nicht sein Eigentum, genauso wenig wie die Öllaterne, sondern der Besitz seines Stiefvaters, den er nutzen durfte, um seine Pflichten besser erfüllen zu können. Er löschte das Licht und ließ sich erschöpft auf die Matratze sinken. Was freute er sich auf morgen! Hoffentlich fing er reichlich Fische, dann könnte er sogar gelobt werden!
Kinder stellten Fragen.
Das war gut und richtig, denn sie mussten viel lernen, um in dieser schwierigen Welt überleben zu können. Ashanu, wie Tihuuns Sippe ihr Stück vom Meer nannten, in dem sie lebten, liebten, jagten und Nahrung am Boden züchteten. Ashanu war keineswegs ungefährlich, besonders für die Kleinen nicht. Haie griffen selten an – sie hatten über endlose Generationen hinweg gelernt, dass es eine schlechte Idee war, einen Neridae auffressen zu wollen. Doch wie leicht konnte man sich an scharfkantigen Felsen schneiden, den Fischschwanz in Korallen einklemmen, einen Rochen verärgern, der mit seinem langen, oft giftigen Stachel auch einen ausgewachsenen Meermann schwer verletzen oder töten könnte. Muränen konnten beachtliche Größe erreichen und unschön heftig zubeißen. Quallen stellten mit ihrem Nesselgift allerdings die größte Gefahr dar. Spielende Kinder übersahen sie zu leicht, zumal Haarquallen hauchfeine Tentakel von fünfzehn Manneslängen und mehr haben konnten.
Tihuun war darum zufrieden, wenn die Kleinen Fragen um Fragen stellten und nicht aufhörten nachzuhaken, bis sie irgendwann selbst vor Erschöpfung einschliefen. Was er oft weniger mochte waren die nachlässigen Antworten, die manche Erwachsene gaben.
„Ich verstehe immer noch nicht, was Schafe sind!“, rief Bachar mit hoher, quengeliger Stimme, wie es bei übermüdeten Kleinkindern häufiger vorkam. Bachar war noch keine vier Kaltzeiten alt, ein entzückendes kleines Mädchen. Tihuuns Nichte, um genau zu sein, die Erstgeborene seines Bruders Shkuur. Shkuur war es auch, der seiner Tochter gerade versuchte zu erklären, was für seltsame Tiere es in der Sand- und Felsenwelt gab, wo die Zweibeiner lebten.
„Ich sagte doch, Liebes, Schafe sind sehr, sehr gefährliche Raubtiere. Ähnlich wie Thunfische. Man kann sie essen und die Zweibeiner tun das auch, trotzdem sind Schafe gefährlich. Darum gehen wir Neridae auch niemals in der Sandwelt spazieren, obwohl wir uns ja, wenn wir das wollen, Beine wachsen lassen können. Da sind einfach viel zu viele Schafe. Manche von denen haben sogar Hörner wie die Narwale, bloß zwei davon. Die mit den Hörnern nennt man Widder. Das sind die männlichen Schafe.“
„Ich schwimm zu Mama“, verkündete Bachar ohne erkennbaren Grund, befreite sich aus Shkuurs Armen und schwamm so hastig davon, dass ihr hellblauer Fischschweif schneller als ein Wellenschlag außer Sicht verschwunden war.
„Warum erzählst du ihr diese dummen Lügen?“, fragte Tihuun leise. „Du weißt doch, wo das endet – die Kleinen werden neugierig, wenn sie älter werden und plötzlich ist das, was einst so gefährlich klang, spannend und aufregend.“
„Ach was.“ Shkuur lachte und winkte ab. „Wir alle sind mit den Märchen von den blutsaufenden Widdern aufgewachsen. Und? Noch bevor ich sechs Kaltzeiten alt war wusste ich, dass es kaum ein langweiligeres und harmloseres Geschöpf als ein Schaf gibt.“
„Ich verstehe trotzdem nicht, wozu diese Lüge nützlich sein soll.“
„Die Kleinen lernen dadurch“, erwiderte Shkuur, nun wieder ernst. „Sie lernen, dass alles, was mit der Welt der Zweibeiner zu tun hat, langweilig ist. Ein Ort, den anzuschauen sich nicht weiter lohnt. Eben weil es dort wenig mehr als Zweibeiner und Schafe gibt. Auf diese Weise bleiben wir Neridae freiwillig dort, wo wir hingehören. Es gibt nichts, was uns die Sandwelt bieten könnte. Nichts! Und fang nicht wieder mit deiner Goldscheibe an. Ich will diesen Unfug nicht hören! Deine schöne Scheibe wurde irgendwann vor vielen Kaltzeiten von einem Neridae geschmiedet, der einen seltsamen Geschmack bezüglich der Wahl seiner Motive hatte. Es ist kein Zweibeiner-Werk. Menschen besitzen nicht die Fähigkeit, etwas derartig Schönes herzustellen.“
Mit diesen Worten schwamm Shkuur energisch davon. Tihuun hingegen beschloss auf der Stelle, dass er seine Goldscheibe ansehen wollte. Das war riskant, denn der Weg war weit. Die Scheibe lag am nördlichen Rand von Ashanu, in Sichtweite einer Landzunge. Lediglich zehn Manneslängen unter der Oberfläche hatte sie ihren Platz am Meeresgrund gefunden. Ein großes Schiff war dort in der Nähe untergegangen, irgendwann, vor langer Zeit. Von dem Schiff war lediglich die ungefähre Form zu erahnen, der Rest war unter Muscheln und Algen und Wasserpflanzen verloren gegangen. Auch von menschlichen Überresten war nichts mehr zu sehen, dafür hatten die Raubfische gesorgt. Neben einer Reihe anderer Gegenstände, die wenig interessant gewesen waren, hatte Tihuun hier vor vielen Kaltzeiten eine große Truhe gefunden, in der die goldene Scheibe aufbewahrt wurde. Alle Mitglieder seiner Familie waren sich einig, dass die Scheibe von einem Neridae geschmiedet worden sein musste. Menschen konnten gut mit Holz umgehen, sie fertigten immerhin ihre schwimmenden Häuser damit an, um auf dem Meer herumzufahren. Sie konnten sich aus Schafswolle diese Umhänge erschaffen, mit denen sie ihre Körper einhüllten, oft genug von Kopf bis Fuß. Vermutlich schützte es sie vor dem Austrocknen, genau erforscht hatte man das Thema noch nicht. Dazu müsste man einem Zweibeiner nah genug kommen, um dessen Gedanken zu ergründen, und das verbot sich von selbst. Jedenfalls gab es keine Beweise, dass Menschen auch schöne Dinge erschufen, die nicht als Werkzeug dienten.
Tihuun glaubte dennoch, dass diese Goldscheibe aus menschlicher Hand stammen musste. Sie war fast so groß wie er selbst, rund wie die Perle am nächtlichen Himmelsmeer und mit einer Reihe von seltsamen Symbolen bestückt. Manche waren leicht zu erkennen. Zum Beispiel zwei Fische, die in entgegengesetzte Richtungen schwammen. Darunter war etwas eingraviert: zwei gebogene Linien, die mittig durch einen geraden Strich verbunden waren. Dieses Zeichen war deutlich kleiner als die goldenen Fische. Daneben konnte man einen Mensch sehen, der kniete und ein großes Gefäß mit Wasser ausschüttete. Auf der anderen Seite hingegen war ein Schafsbock oder auch Widder abgebildet. Es ging weiter mit einem Stier, zwei Kindern, die sich an den Händen hielten, ein Krebs, ein Löwe, eine Frau … Das meiste davon waren also menschliche Zeichen oder Landtiere. Diese zwölf Symbole waren auf einer runden Platte angeordnet, die sich mit etwas Druck im Kreis drehen ließ. Darunter, in der Mitte der Scheibe, war das Himmelsmeer abgebildet. In Dunkelblau gemalt konnte man die Nachtperle in ihren verschiedenen Phasen sehen. Die größten Denker unter den Neridae gingen davon aus, dass die Feuerkugel nachts, wenn ihr Licht verloschen war, die Perle immer wieder teilweise verdeckte, weil sie sich anscheinend schneller bewegte als die Perle. Ihr Gedanke dabei war: Auch wenn man etwas nicht sehen konnte, war es durchaus vorhanden und manchmal bemerkte man lediglich seinen Schatten. So musste das mit den Himmelsmeer-Gebilden sein! Neben der großen Perle waren auch Sterne auf die Scheibe gemalt worden. Sterne waren dem allgemeinen Verständnis nach weitere Feuerkugeln im Himmelsmeer, lediglich zu weit fort, um sie besser erkennen zu können. Das sah jedenfalls sehr hübsch aus.
Außen gab es eine weitere Platte, die sich drehen ließ. Zwölf Mal waren irgendwelche Striche darauf angeordnet worden, die für Tihuun keinerlei Sinn ergaben. Das alles war für ihn ein deutlicher Hinweis, dass dies Menschenwerk sein musste. Nur weil die Zweibeiner dumm genug waren, am Land zu leben, mussten sie nicht völlig unzivilisiert sein!
Tihuun schwamm schneller. Wenn er sich sehr beeilte, würde er die Scheibe erreichen, kurz bevor die Feuerkugel am Ostrand des Himmelsmeers erschien. Das wäre schön, denn dann konnte er mit der Goldscheibe die ersten Lichtstrahlen einfangen und damit spielen. Immer vorausgesetzt, dass keine Menschen draußen auf dem Meer waren, um Fische zu fangen. Er liebte Licht. Nichts liebte er mehr als Licht, das sich im Wasser brach!
Marten hatte Tintenfische an die Angelhaken gebunden, die Köder etwa zwei Schritt in die Tiefe abgelassen und wartete nun geduldig. Sein Vater erwartete von ihm, dass er Makrelen mit nach Hause brachte. Die bissen in der Regel gut an und waren gerne bei Tagesanbruch in Sichtweite der Küste in Schwärmen unterwegs, um zu jagen. Er erhoffte sich zwei, drei Fische mittlerer Größe. Vier Ruten hatte er bestückt. Netzfischerei wäre effektiver und kraftsparender, allerdings lohnte sich die Anschaffung eines guten Netzes nicht für seine Familie. Sie angelten bloß selten, meistens an Feiertagen oder wenn Besuch anstand. Es diente der Abwechslung auf dem Speisezettel. Ansonsten hielten sie Schafe, die auf den Deichen weideten, und bewirtschafteten eine Parzelle Farmland, die etwa eine Meile von der Küste entfernt lag und dort von Springfluten und Hochwasser verschont blieb. Die Erträge waren zusammen mit den Verkäufen der Schafswolle mehr als gut genug, um die Familie durchzubringen.
Marten summte leise ein Lied, während er es sich bestmöglich bequem machte, die Hand ins Wasser hielt und wartete. Noch war es zu früh, er schätzte, dass die Makrelen sich etwa in einer halben Stunde auf die Jagd begeben und dementsprechend anbeißen würden. Von seinem Platz aus konnte er die Angelruten gut beobachten, er würde es sofort bemerken, wenn sie sich bogen. Bis es soweit war, konnte er die friedliche Stille und Freiheit des Meeres genießen. Über ihm der endlose Himmel mit einer unendlich zarten Andeutung von herannahender Dämmerung im Osten, unter ihm nichts als Wasser … Kein Geschrei, keine Schläge, keine Verachtung oder Demütigung oder endlose Plackerei von früh bis spät …
Marten war nicht der Einzige, der in der Familie anpacken musste. Die Schafe, das Farmland, die Hühner, Kühe und Schweine, dazu Obstbäume und -sträucher für den Eigenbedarf. Das war mehr Arbeit, als ein einzelnes Paar Hände vollbringen konnte. Doch auf seinen Schultern ruhte die Hauptlast. Er musste die gesamte Hausarbeit vollbringen, für die Familie kochen, die Wäsche waschen, alles sauberhalten. Außerdem die Kühe und Schafe melken, die Ställe misten, Käse herstellen, Holz hacken, jedem Befehl Folge leisten – und seine Mutter pflegen.
Marten zwang seine Gedanken energisch fort. Er war frei. Für einige wenige, kostbare Stunden war er frei und musste nicht an sein tägliches Elend denken.
Schade, dass der Himmel bewölkt war. Er konnte weder den Mond noch die Sterne sehen. Nichts als Wolkengebirge, die sich langsam über ihn hinwegschoben. Dem Geruch nach, der in der Luft hing, würde es heute noch regnen. Marten mochte Regen. Er reinigte die Luft, tränkte Felder und Wiesen … Ja, er freute sich auf den kommenden freundlichen Frühlingsregenguss. Das durfte trotzdem gerne noch ein bisschen warten. Vorzugsweise, bis er zurückgerudert und in der heimischen Küche angekommen war, wo er an Angeltagen von der Pflicht befreit war, für die ganze Familie das Frühstück zuzubereiten. Falls er länger benötigte, wurde sogar akzeptiert, dass er nicht die Eier aus dem Hühnerstall geholt und die Tiere gemolken hatte. Dann allerdings war es besser, wenn er einen sehr reichlichen Fang heimbrachte oder zumindest ein Unwetter als Ausrede vorbringen konnte. Kehrte er ohne Fische heim, was besonders im Herbst durchaus vorkam, musste er sich auf heftigste Prügel einstellen …
Ach verdammt! Heute bekam er den Kopf nicht frei. Dabei war es schön hier draußen!
Tihuun ärgerte sich über das kleine Fischerboot. Warum musste dieser Mensch ausgerechnet in diesem Bereich angeln? Seine Pläne, mit der frühmorgendlich über das Himmelsmeer treibenden Feuerkugel zu spielen, konnte er vergessen. Zumal die dunklen Schaumberge heute recht dicht waren und wenig Licht durchlassen würden. Vielleicht fiel sogar Himmelswasser. Tihuun mochte es nicht, dieses herabströmende Wasser, genauso wenig wie jeder andere Neridae. Das Himmelswasser war leer und blank. Ihm fehlte das Salz, das Leben, das in jedem Tropfen Meereswasser steckte. Woran das lag, wussten nicht einmal die größten Denker unter ihnen. Man vermutete, dass die Feuerkugel das Leben aus dem Himmelsmeer an sich riss und dementsprechend leersaugte. Einig war man sich, dass das Himmelswasser keine Gefahr für sie darstellte, egal wie oft und ergiebig es auf sie herabströmte – es füllte sich sofort wieder mit Leben, sobald es sich mit dem Meereswasser mischte. Die größte Angst eines jeden Neridae war es allerdings, dass die himmlische Feuerkugel eines Tages auf ihre Welt hinabstürzen und fortan ihre Fluten durchqueren könnte. Einerseits würde es dann sehr viel heller werden, und das war ein Gedanke, den Tihuun mochte – mehr Licht wäre grundsätzlich gut. Andererseits brachte zu viel Licht auch Hitze und womöglich würde die Feuerkugel alles Leben an sich reißen? So lange, bis in ihrem Meer nichts mehr davon übrig war. Tihuun vermutete, dass die große Perle die Kugel auf irgendeine Weise anzog. Er durchschaute es keineswegs, doch er hatte durchaus das Gefühl, dass die beiden etwas miteinander verband.
Nun, es war müßig, sich darüber zu viele Gedanken zu machen. Stattdessen beugte er sich über die Truhe und holte seine Goldscheibe hervor. Es war dunkel, dementsprechend würde der Mensch, der zehn Manneslängen über ihm auf Fische wartete, nichts von ihm und seinem Tun bemerken.
Tihuun hatte sein magisches Siegel auf dieser Truhe hinterlassen. Jeder Neridae wusste dadurch, dass sie und der Inhalt sein Besitz waren. Außerdem sorgte das Siegel dafür, dass weder die Truhe noch die Goldscheibe darin vom Meer eingefordert werden konnte. Weder Algen noch Muscheln noch Korallen konnten darauf wachsen und egal wie lange die Scheibe im salzigen Wasser lag, sie würde niemals Schaden nehmen. Die erste Pflicht der Magie der Neridae war es, zu bewahren.
Seine Neridae-Augen nahmen jede Einzelheit der Scheibe wahr. Winzige Kratzer, kleinste Unebenheiten, kaum erkennbare Makel, die bewiesen, wie großartig der Künstler tatsächlich gewesen sein musste, der diesen Gegenstand erschaffen hatte. Es ließ jedes Mal Tihuuns Herz schneller schlagen, wenn er seine Goldscheibe betrachtete. Wenn er mit den Fingerspitzen sacht über jedes Symbol, jede eingravierte Linie strich und sich vorstellte, was jener unbekannte Mensch empfunden haben musste, als er – oder sie – zum ersten Mal auf das fertige Werk seiner Hände herabblickte. War er stolz gewesen? Hatte er geweint vor Glück, sicher, niemals etwas Großartigeres geschmiedet zu haben? Oder hatten die Selbstzweifel überwogen?
Ach, es war ärgerlich, dass dieser Fischer hier herumlungern musste! Tihuun wollte so gerne Lichtstrahlen mit seiner Goldscheibe einfangen und sie hinlenken, wo immer es ihm gefiel. Ein Spiel, dessen er niemals müde wurde. Natürlich könnte er einfach warten, bis der Mensch genug Fische gefangen hatte und fortruderte. Andererseits hatte Tihuun Pflichten. Er musste das Seine leisten, damit die Kleinen nicht hungerten.
Nun denn. Innerlich seufzend räumte er die Goldscheibe zurück in die Truhe. Ein anderes Mal würde er zurückkommen und seinem Licht nachjagen.
Tihuun blickte in die Höhe, um zu schauen, ob die Feuerkugel bereits am Rand des Himmelsmeeres erschienen war. Seinem Empfinden nach musste es bald soweit sein, und er konnte zudem hören, dass sich ein großer Fischschwarm näherte. Auch sonst war es belebter als eben noch. Der Meeresboden erwachte, wie stets, sobald sich die Rückkehr des Lichts ankündigte.
In diesem Moment sah er die Gefahr, die sich ohne Laut und Vorwarnung an ihn herangearbeitet hatte: Shiz’qua! Ein Geisternetz! Ein verlorenes Fischernetz, das durch das Meer trieb, bis sich etwas darin verfing und qualvoll verendete.