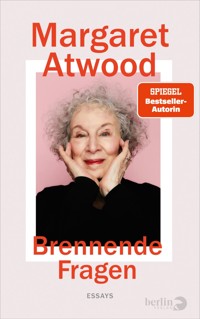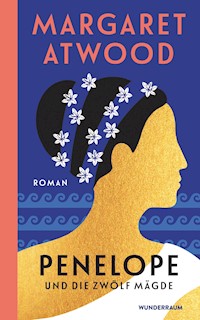11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In zehn Geschichten erzählt Margaret Atwood von Frauen am Wendepunkt ihres Lebens. Auf hochintelligente Weise arbeitet Margaret Atwood dabei mit der Zeit: Dinge, die im unmittelbaren Erleben eindeutig erscheinen, erweisen sich im Rückblick nach vielen Jahren als schillernd. Und wenn man im Nachhinein auf eine Karriere, auf ein Leben blickt, entfaltet sich erst die Ironie, die in einer Situation liegen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Charlotte Franke
ISBN 978-3-4929-7740-1© O. W. Toad Ltd. 1991Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Wilderness Tips«, Doubleday, New York 1991© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2003© der deutschen Übersetzung 1991: S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2016Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: RobwoodDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Wahrer Schund
Haarball
Isis in der Dunkelheit
Die Moorleiche
Tod durch Landschaft
Onkel
Das Bleizeitalter
Gewicht
Tipps für die Wildnis
Rübenmittwoch
Wahrer Schund
Die Kellnerinnen baden in der Sonne wie eine Herde gehäuteter Robben, ihre rosigbraunen Körper glänzen vom Öl. Sie haben ihre Badeanzüge an, weil es Nachmittag ist. Morgens und abends, in der Dämmerung, baden sie manchmal nackt, was das juckende Ausharren in dem von Moskitos heimgesuchten Buschwerk gegenüber ihres kleinen privaten Bootsstegs ein ganzes Stück lohnenswerter macht.
Donny hat das Fernglas, es gehört nicht ihm, sondern Monty. Montys Dad hat es ihm zum Vogelbeobachten geschenkt, aber Monty interessiert sich nicht für Vögel. Er hat für das Fernglas eine bessere Verwendung gefunden: Er vermietet es für maximal fünf Minuten an andere Jungen, für je einen Nickel, oder auch für einen Schokoladenriegel aus dem Kiosk, obwohl ihm Geld lieber ist. Er isst die Schokoladenriegel nicht; er verkauft sie auf dem schwarzen Markt – zum doppelten Preis; der Vorrat auf der Insel ist begrenzt, und so kommt er damit durch. Donny hat schon alles Sehenswerte betrachtet, aber er lässt sich Zeit mit dem Fernglas, trotz des heiseren Geflüsters und des Drängens derjenigen, die hinter ihm stehen. Er will kriegen, wofür er gezahlt hat.
»Jetzt seht euch das an«, sagt er mit, wie er hofft, die anderen auf die Folter spannender Stimme. »Sabber, sabber.« Direkt an der Stelle mit dem frischen Mückenstich bohrt sich ein Ast in seinen Magen, aber er kann ihn nicht wegschieben, ohne mit der einen Hand das Fernglas loszulassen. Er kennt die Flankenangriffe.
»Lass sehen«, sagt Richie und zieht an seinem Ellbogen.
»Verpiss dich«, sagt Donny. Er bewegt das Fernglas ein Stück weiter, erfasst ein glitschiges halb nacktes Gesäß, eine Brust in einem Badeanzug mit roten Punkten, eine lange herunterfallende Strähne gebleichter blonder Haare: Ronette, die Schärfste, Ronette, die Verbotenste. Wenn ihnen im Winter die Lehrer ihrer Highschool Vorträge halten, wie gefährlich es ist, sich mit den Stadtmädchen einzulassen, dann denken sie alle an solche wie Ronette: die vor dem einzigen Kino der Stadt herumhängen, Kaugummi kauend und mit den Lederjacken ihrer Freunde, die wiederkäuenden Lippen so glänzend und tiefrot wie zerquetschte Himbeeren. Wenn man pfeift oder auch nur hinsieht, starren sie mitten durch einen hindurch.
Ronette hat alles außer dem Blick. Im Unterschied zu den anderen lächelt sie sogar manchmal. Jeden Tag schließen Donny und seine Freunde Wetten ab, ob sie an ihrem Tisch sein wird. Wenn sie sich nach vorn beugt, um die Teller abzuräumen, versuchen sie, in ihre gesittete, aber mit einem V-Ausschnitt versehene Uniform zu linsen. Sie wenden ihr das Gesicht zu, atmen sie ein: Sie riecht nach Haarspray, Nagellack, etwas Künstlichem und zu Süßem. Billig, würde Donnys Mutter sagen. Das ist ein verlockendes Wort. Die meisten Dinge in seinem Leben sind teuer und nicht besonders interessant.
Ronette dreht sich auf dem Bootssteg um. Jetzt liegt sie auf dem Bauch, hat das Kinn in die Hände gestützt, ihre Brüste werden durch die Schwerkraft nach unten gezogen. Sie hat richtige mit einer Spalte dazwischen, nicht wie manche von ihnen. Aber über ihrem Badeanzug kann er ihr Schlüsselbein und ein paar Rippen sehen. Trotz der Brüste ist sie dünn, mager; sie hat Arme wie Stöcke und ein schmales, ein wenig hohles Gesicht. Ein Backenzahn fehlt, man sieht es, wenn sie lächelt, und das beunruhigt ihn. Er weiß, dass er eigentlich Verlangen nach ihr spüren sollte, aber das ist es nicht, was er empfindet.
Die Kellnerinnen wissen, dass sie beobachtet werden: Sie sehen, wie die Büsche sich bewegen. Die Jungen sind erst zwölf oder dreizehn, höchstens vierzehn, kleine Fische. Wenn es die Studenten wären, welche jeweils eine Jungengruppe beaufsichtigen, würden sie mehr kichern, sich mehr herausputzen, die Rücken durchdrücken. Jedenfalls manche von ihnen. Aber so verbringen sie ihre Nachmittagspause, als wäre niemand da. Sie reiben sich gegenseitig mit Sonnenöl ein, braten sich gleichmäßig, drehen sich faul von einer Seite auf die andere und bringen Richie, der jetzt das Fernglas hat, dazu, ein Stöhnen von sich zu geben, das die anderen Jungen verrückt machen soll und es auch tut. Es werden kleine Boxhiebe ausgeteilt, unterdrückte Ausrufe wie »dummer Hund« und »Arschloch« werden laut. Richie macht ein schlürfendes Geräusch, als liefe ihm der Speichel aus dem Mund, und grinst von einem Ohr zum anderen.
Die Kellnerinnen lesen sich laut etwas vor. Sie wechseln sich ab: Ihre Stimmen schweben über das Wasser, durch gelegentliches Prusten und Auflachen unterbrochen. Donny hätte gern gewusst, was sie mit einer solchen Versunkenheit, mit so viel Spaß lesen, aber es wäre gefährlich, das zuzugeben. Nur ihre Körper zählen. Wen interessiert schon, was sie lesen?
»Die Zeit ist um, Scheißer«, flüstert er Richie zu.
»Selber Scheißer«, sagt Richie. Die Büsche bewegen sich heftig.
Die Kellnerinnen lesen ein Wahre-Romanzen-Heft, einen Groschenroman. Tricia hat einen ganzen Stapel davon unter ihrer Matratze verstaut, und Sandy und Pat haben auch noch welche beigesteuert. Jedes dieser Hefte hat eine Frau auf der Titelseite, deren Kleid über der Schulter heruntergezogen ist, oder die eine Zigarette im Mund hat oder irgendein anderes Anzeichen unordentlichen Lebenswandels aufweist. Gewöhnlich haben diese Frauen Tränen in den Augen. Die Farben sind merkwürdig: leicht schmuddlig, etwas verschmiert wie die handgefärbten Ansichtskarten im Kaufhaus. Nichts von den fröhlichen weißen Zähnen und dem sauber strahlenden Lächeln der Filmmagazine: Dies sind keine Erfolgsstorys. Wahrer Schund, so nennt Hilary sie. Joanne nennt sie Heulbojen.
Im Augenblick liest Joanne vor. Sie liest mit ernster, theatralischer Stimme, wie jemand im Radio; in der Schule hat sie in einem Theaterstück mitgespielt: Unsere kleine Stadt. Sie hat ihre Sonnenbrille wie ein Lehrer auf die Nasenspitze geschoben. Aus Spaß liest sie mit englischem Akzent.
Die Geschichte handelt von einem Mädchen, das mit ihrer geschiedenen Mutter in einer engen, heruntergekommenen Wohnung über einem Schuhgeschäft wohnt. Ihr Name ist Marleen. Sie arbeitet nach der Schule und am Samstag in dem Geschäft, und zwei der Schuhverkäufer sind hinter ihr her. Der eine ist solide und langweilig und will sie heiraten. Der andere, der Dirk heißt, hat ein Motorrad und ein wissendes, unverschämtes Grinsen, von dem Marleen weiche Knie kriegt. Die Mutter sitzt sklavisch an der Nähmaschine. Sie macht Marleens Kleidung selbst, und sie verdient sich einen dürftigen Lebensunterhalt, indem sie für reiche Damen Kleider näht, die sie böse anfahren, wenn etwas nicht stimmt. Sie ermahnt Marleen ständig, sich den richtigen Mann auszusuchen und nicht einen schrecklichen Fehler zu machen, wie sie selbst. Das Mädchen hat vor, auf die Handelsschule zu gehen und sich für einen Verwaltungsjob ausbilden zu lassen, aber dazu reicht das Geld nicht. Sie ist im letzten Jahr der Highschool, und ihre Noten werden immer schlechter, weil sie entmutigt ist und auch weil sie sich zwischen den beiden Schuhverkäufern nicht entscheiden kann. Und jetzt sitzt ihr die Mutter auch noch wegen der schlechten Noten im Nacken.
»O Gott«, sagt Hilary. Sie feilt sich die Fingernägel mit einer Metallfeile anstatt mit Schmirgelpapier. Sie findet Schmirgelpapier nicht gut. »Jemand soll ihr sofort einen doppelten Scotch geben.«
»Vielleicht sollte sie die Mutter umbringen, die Versicherung kassieren und machen, dass sie da wegkommt«, sagt Sandy.
»Hast du auch nur ein Wort von einer Versicherung gehört?«, sagt Joanne und späht über ihre Brille.
»Du könntest es ja reinbringen«, sagt Pat.
»Vielleicht sollte sie beide ausprobieren, um zu sehen, welcher von beiden besser ist«, sagt Liz unverfroren.
»Wir wissen, welcher der Bessere ist«, sagt Tricia. »Hört zu, wenn jemand Dirk heißt. Was soll da schief gehen?«
»Die sind beide Stinktiere«, sagt Stephanie.
»Wenn sie das tut, wird sie eine GEFALLENE FRAU sein, in Großbuchstaben«, sagt Joanne. »Sie würde es BEREUEN müssen, in Großbuchstaben.«
Die andern johlen. Reue! Die Mädchen in den Geschichten sind so lächerlich. Sie sind so schwach. Sie verlieben sich hoffnungslos in die falschen Männer, sie geben nach, sie werden sitzen gelassen. Dann weinen sie.
»Moment«, sagt Joanne. »Hier kommt die große Nacht. Sie liest weiter, hauchend. »Meine Mutter war ausgegangen, um einer ihrer Kundinnen ein Cocktailkleid zu bringen. Ich war ganz allein in unserer schäbigen Wohnung.«
»Keuch, keuch«, sagt Liz.
»Nein, das kommt später. Ich war ganz allein in unserer schäbigen Wohnung. Der Abend war heiß und stickig. Ich wusste, dass ich eigentlich arbeiten sollte, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich ging unter die Dusche, um mich abzukühlen. Dann beschloss ich impulsiv, das Kleid für die Abschlussfeier anzuprobieren, über dem meine Mutter so viele Stunden bis in die Nacht hinein gesessen hatte.«
»So ist es recht, Schuldgefühle, Schuldgefühle«, sagt Hilary voller Befriedigung. »Ich an ihrer Stelle würd die Mutter mit der Axt erschlagen.«
»Es war ein Traum aus Rosa –«
»Ein Traum aus Rosa – was?«, sagt Tricia.
»Ein Traum aus Rosa, Punkt, und halt den Mund. Ich sah mich im winzigen Schlafzimmer meiner Mutter in dem hohen Spiegel an. Das Kleid war genau richtig für mich. Es passte vollkommen zu meinem reifen, aber schlanken Körper. Ich sah darin anders aus, älter, schön, wie ein Mädchen, das an jeden Luxus gewöhnt ist. Wie eine Prinzessin. Ich lächelte mich an. Ich war verwandelt.
Ich hatte gerade die Haken am Rücken aufgemacht und wollte das Kleid ausziehen und wieder aufhängen, als ich auf der Treppe Schritte hörte. Zu spät erinnerte ich mich daran, dass ich vergessen hatte, die Tür von innen zuzuschließen, nachdem meine Mutter gegangen war. Ich lief schnell zur Tür, hielt mein Kleid hoch – es konnte ein Einbrecher sein, oder Schlimmeres! Aber es war Dirk.«
»Dirk oder Schmirk«, sagt Alex unter ihrem Handtuch hervor.
»Schlaf weiter«, sagt Liz.
Joanne liest jetzt leiser weiter, mit schleppender Stimme. »›Dachte mir, ich komm mal rauf, um dir Gesellschaft zu leisten‹, sagte er mit seinem unverschämten Lächeln. ›Hab gesehen, wie deine Mom weg ist.‹ Er wusste, dass ich allein war! Ich wurde rot und zitterte. Das Blut klopfte mir in den Adern. Ich konnte nicht sprechen. Jeder Instinkt warnte mich vor ihm – jeder Instinkt, außer denen meines Körpers und meines Herzens.«
»Was gibt’s denn noch für welche?«, sagt Sandy. »Es gibt doch keine geistigen Instinkte.«
»Willst du weiterlesen?«, sagt Joanne. »Dann sei still. Ich hielt die wallende rosa Spitze wie einen Schild vor mich hin. ›He, du siehst toll darin aus‹, sagte Dirk. Seine Stimme war rau und zärtlich. ›Aber noch besser würdest du ohne aussehen.‹ Ich hatte Angst vor ihm. Seine Augen brannten vor Entschlossenheit. Er sah wie ein Tier aus, das sich an seine Beute heranpirscht.«
»Ganz schön schwül«, sagt Hilary.
»Was für ’n Tier?«, sagt Sandy.
»Ein Wiesel«, sagt Stephanie.
»Ein Stinktier«, sagt Tricia.
»Pst«, sagt Liz.
»Ich wich vor ihm zurück«, liest Joanne. »Noch nie hatte er mich so angesehen. Jetzt drückte er mich an die Wand und riss mich in seine Arme. Ich fühlte, wie das Kleid herunterrutschte …«
»Und das nach all der Näherei«, sagt Pat.
»… und seine Hand sich auf meine Brust legte und sein harter Mund meinen suchte. Ich wusste, dass er nicht der richtige Mann für mich war, aber ich konnte ihm nicht länger widerstehen. Mein ganzer Körper schrie nach ihm.«
»Was sagte er denn?«
»Er sagte: He, Körper, hierher!«
»Pst.«
»Ich spürte, wie ich hochgehoben wurde. Er trug mich zu dem Sofa. Dann fühlte ich, wie sich sein harter, sehniger Körper der Länge nach an mich presste. Schwach versuchte ich, seine Hände wegzustoßen, aber in Wirklichkeit wollte ich es gar nicht. Und dann – Punkt Punkt Punkt – waren wir EINS!, in Großbuchstaben, Ausrufungszeichen.«
Einen Augenblick lang ist es still. Dann lachen die Kellnerinnen. Ihr Lachen ist empört, ungläubig. EINS. Einfach so. Es musste doch noch mehr daran sein.
»Das Kleid ist hin«, sagt Joanne mit ihrer normalen Stimme. »Jetzt kommt die Mutter nach Hause.«
»Nicht heute, heute kommt sie nicht mehr«, sagt Hilary forsch. »Wir haben nur noch zehn Minuten. Ich geh schwimmen, um das Öl abzukriegen.« Sie steht auf, streicht ihr honigblondes Haar nach hinten, streckt ihren gebräunten athletischen Körper und springt mit einem perfekten Kopfsprung vom Ende des Stegs.
»Wer hat die Seife?«, sagt Stephanie.
Ronette hat während der Geschichte nichts gesagt. Wenn die anderen lachten, hat sie nur gelächelt. Jetzt lächelt sie auch. Es ist ein schiefes Lächeln, verwirrt, ein bisschen entschuldigend.
»Ja, aber«, sagt sie zu Joanne, »wieso ist das komisch?«
Mit gefalteten Händen und gebeugten Köpfen stehen die Kellnerinnen im Speisesaal an ihren Plätzen. Ihre königsblauen Uniformen reichen bis fast hinunter zu den Rändern ihrer weißen Söckchen, die mit weißen Mokassins oder schwarz-weißen Halbschuhen oder weißen Turnschuhen getragen werden. Über ihren Uniformen tragen sie einfache weiße Schürzen. Die rustikalen Schlafhütten aus Holz im Camp Adanaqui haben kein elektrisches Licht, und es gibt nur Außentoiletten. Die Jungen waschen ihre Sachen selbst, nicht einmal im Waschbecken, sondern im See; aber es gibt Kellnerinnen mit Uniformen und Schürzen. Das Leben in der Natur prägt den Charakter eines Jungen, aber nur bestimmte Arten von Naturleben.
Mr B. spricht das Tischgebet. Ihm gehört das Lager, und im Winter ist er auch Lehrer ihres Internats St. Jude’s. Er hat ein ledriges gut aussehendes Gesicht, mit dem grauen Haarschnitt eines Rechtsanwalts aus der Baystreet und den Augen eines Falken: Er sieht alles, stößt aber nur manchmal zu. Heute trägt er einen weißen Pulli mit V-Ausschnitt. Er könnte sehr gut einen Gin-Tonic trinken, tut es aber nicht.
Hinter ihm an der Wand, über seinem Kopf, ist ein verwittertes Brett mit einem Motto in schwarzer Groteskschrift darauf: Jung gewohnt, alt getan. Mit einem Stück ausgebleichten Treibholzes an jedem Ende geschmückt und darunter zwei gekreuzte Paddel und der riesige Kopf eines Hechts im Profil, mit offenem Maul, so dass seine nadelspitzen Zähne und sein eines Glasauge mit dem wilden starren Blick eines Wahnsinnigen zu sehen sind.
Links von Mr B. ist das Fenster der Stirnseite, und dahinter liegt die Georgian Bay, blau wie das Vergessen, bis ins Unendliche reichend. Daraus ragen wie die Rücken von Walen, wie runde Knie, wie die Waden und Schenkel riesiger dahintreibender Frauen mehrere Inseln aus rosa Felsgestein auf, das von Gletschern und schwappendem Wasser und endlosen Winden abgeschabt und abgerundet ist. An den Größeren klammern sich ein paar Kiefern mit ihren gewundenen Wurzeln fest. Durch dieses Archipel hindurch sind die Kellnerinnen von demselben klobigen Mahagonimotorboot, das auch die Post und die Lebensmittel und alles andere auf die Insel schafft, hierher gebracht worden, dreißig Kilometer vor der Küste. Es schafft heran und bringt fort. Aber die Kellnerinnen werden erst am Ende des Sommers wieder aufs Festland zurückgebracht: Für einen freien Tag ist es zu weit entfernt, und sie würden nie die Erlaubnis bekommen, über Nacht wegzubleiben. Und so sind sie die ganze Zeit hier. Außer Mrs B. und Miss Fisk, die den Essensplan aufstellt, sind sie die einzigen Frauen auf der Insel. Aber die beiden sind alt und zählen nicht.
Es gibt neun Kellnerinnen. Es sind immer neun. Nur die Namen und Gesichter ändern sich, denkt Donny, der, seit er acht ist, in dieses Camp kommt. Als er acht war, hat er sich nicht um die Kellnerinnen gekümmert, außer wenn er Heimweh hatte. Dann dachte er sich Entschuldigungen aus, um am Küchenfenster vorbeizugehen, wenn sie das Geschirr abwuschen. Da waren sie, sicher geschürzt, sicher hinter Glas: neun Mütter. Jetzt sieht er sie nicht mehr als Mütter an.
An diesem Abend ist Ronette an seinem Tisch. Hinter halb geschlossenen Augenlidern beobachtet Donny ihr schmales abgewandtes Gesicht. Er kann einen Ohrring sehen, einen kleinen goldenen Reifen. Er führt mitten durch ihr Ohrläppchen. Nur Italienerinnen und billige Mädchen haben durchbohrte Ohrläppchen, sagt seine Mutter. Es tat wahrscheinlich weh, wenn man ein Loch ins Ohr gemacht bekam. Es gehörte Mut dazu. Er überlegt, wie es wohl in Ronettes Zimmer aussieht, welche anderen billigen, faszinierenden Dinge sie noch dort hat. Bei jemandem wie Hilary braucht er nicht lange zu überlegen, weil er es schon kennt: die saubere Bettdecke, die Reihen Schuhe, den Kamm und die Bürste und die Maniküre auf dem Frisiertisch, wie Instrumente für eine Operation.
Hinter Ronettes gebeugtem Kopf ist die Haut einer Klapperschlange, einer großen, die an die Wand genagelt ist. Darauf muss man hier draußen achten: auf Klapperschlangen. Genauso auf Giftsumach, Gewitterstürme und Ertrinken. Letztes Jahr ist ein ganzes Kriegskanu voller Kinder ertrunken, aber die waren aus einem anderen Camp. Es war schon im Gespräch, dass alle weibische Schwimmwesten tragen müssten; die Mütter wollten es. Donny hätte gern eine eigene Klapperschlangenhaut, um sie über seinem Bett anzunageln; aber selbst wenn er die Schlange selber erlegte, sie mit den bloßen Händen erdrosselte, ihr den Kopf abbiss, würde man ihm nie erlauben, die Haut zu behalten.
Mr B. beendet das Tischgebet und setzt sich, und die Camper fangen wieder mit ihrem sich dreimal täglich wiederholenden Ritual des Brotgrabschens, Mundvollstopfens, Tretens unter den Tischen, leisen Fluchens an. Ronette kommt mit einem Teller aus der Küche: Makkaroni und Käse. »So, Jungs, jetzt kann’s losgehen«, sagt sie mit ihrem gutmütigen schiefen Lächeln.
»Ergebensten Dank, mein Fräulein«, sagt Darce, der Student, der ihre Gruppe beaufsichtigt, mit seinem verlogenen Charme. Darce genießt den Ruf eines Frauenhelden. Donny weiß, dass er hinter Ronette her ist. Das macht ihn traurig. Er fühlt sich traurig und zu jung. Er würde gern ein Weilchen aus seinem Körper schlüpfen; er würde gern jemand anders sein.
Die Kellnerinnen waschen das Geschirr ab. Zwei zum Abkratzen der Teller, eine zum Abwaschen, eine zum Spülen in dem brühendheißen Spülausguss, drei zum Abtrocknen. Die andern beiden fegen den Fußboden und wischen die Tische ab. Später wird sich die Zahl der Abtrocknerinnen wegen ihrer freien Tage ändern – sie werden beschließen, ihre freien Tage zu zweit zu nehmen, damit sie Doppelverabredungen mit den Studenten treffen können –, aber heute sind alle da. Die Saison hat gerade erst begonnen, die Dinge sind noch in Bewegung, die Territorien noch nicht abgesteckt.
Während sie arbeiten, singen sie. Sie vermissen das Meer von Musik, in dem sie während des Winters dahintreiben. Pat und Liz haben ihre Kofferradios mitgebracht, obwohl man hier draußen nicht viel reinkriegt. Es ist zu weit von der Küste entfernt. Im Aufenthaltsraum der Aufseher gibt es einen Plattenspieler, aber die Platten sind veraltet. Patti Page, The Singing Rage. How Much Is That Doggie In The Window. The Tennessee Waltz. Wer tanzt schon noch Walzer?
»Wake up, little Susie«, trillert Sandy. In diesem Sommer sind die Everly Brothers beliebt; oder waren es, auf dem Festland, als sie abgefahren sind.
»What ’re you gonna tell your mama, what ’re you gonna tell your pa«, singen die andern. Joanne kann die Altstimme improvisieren; dadurch hört es sich nicht so schrill an.
Hilary, Stephanie und Alex singen nicht mit. Sie gehen auf eine Privatschule, nur Mädchen, und sind besser im Kanon, wie Fire’s Burning und White Coral Bells. Aber im Tennisspielen und Segeln, Dinge, die die anderen nicht können, sind sie gut.
Es ist merkwürdig, dass Hilary und die anderen beiden überhaupt hier sind und im Camp Adanaqui als Kellnerinnen arbeiten; sicher nicht, weil sie das Geld brauchen. (Nicht wie ich, denkt Joanne, die jeden Mittag den Posttisch heimsucht, um zu sehen, ob sie ihr Stipendium bekommen hat.) Sondern es ist auf Betreiben ihrer Mütter. Alex zufolge haben sich die drei Mütter zusammengetan und Mrs B. auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung überfallen und ihr so lange zugesetzt, bis sie die Mädchen kommen ließ. Natürlich ging Mrs B. zu denselben Veranstaltungen und Partys wie die Mütter: Sie haben sie gesehen, mit ihrer Sonnenbrille ins Haar geschoben, mit einem Drink in der Hand, wie sie auf der Veranda von Mr B.s weißem Haus auf dem Hügel, das ein ganzes Stück von dem Campgrundstück entfernt ist, Gäste empfing. Sie haben die Gäste in ihren fleckenlosen gebügelten Segelsachen gesehen. Sie haben das Lachen gehört, die Stimmen, rau und beiläufig. O Gott, erzähl mir bloß nichts. Wie Hilary.
»Wir sind gekidnappt worden«, sagt Alex. »Sie fanden, dass es an der Zeit wär, ein paar Jungen kennen zu lernen.«
Joanne kann das bei Alex verstehen, die mollig und unbeholfen ist, und bei Stephanie, die wie ein Junge gebaut ist und auch so geht; aber Hilary? Hilary ist klassisch. Hilary ist wie eine Shampoo-Werbung. Hilary ist vollkommen. Hinter ihr müssten sie eigentlich alle her sein, komischerweise ist das hier aber nicht so.
Ronette kratzt und lässt einen Teller fallen. »Mann«, sagt sie. »Wie kann man so tollpatschig sein.« Niemand schnauzt sie an oder neckt sie auch nur, wie sie es bei jeder anderen getan hätten. Sie ist bei ihnen beliebt, obwohl sich schwer sagen lässt, warum. Nicht nur, weil sie so unbekümmert ist: das ist Liz auch, das ist Pat auch. Sie hat irgendeinen geheimnisvollen Sonderstatus. Zum Beispiel hat jede andere einen Spitznamen: Hilary ist Hil, Stephanie ist Steph, Alex ist Al; Joanne ist Jo, Tricia ist Trish, Sandy ist San. Pat und Liz, die sich nicht noch weiter verkürzen lassen, sind zu Pet und Lizard geworden. Nur Ronette hat man die Würde ihres vollen, unwahrscheinlichen Namens zugestanden.
In mancher Hinsicht ist sie erwachsener als alle anderen. Aber nicht, weil sie mehr weiß. Sie weiß weniger, oft hat sie Mühe, sich in dem Wortschatz der anderen zurechtzufinden, vor allem im lässigen Slang des Trios von der Privatschule. »Das versteh ich nicht«, sagt sie, und den anderen macht es Spaß, es ihr zu erklären, als wäre sie eine Ausländerin, eine geschätzte Besucherin aus irgendeinem anderen Land. Sie geht ins Kino und sieht fern, wie alle anderen auch, aber sie hat nur selten eine Meinung zu dem, was sie gesehen hat. Sie sagt höchstens mal »Mist« oder »nicht schlecht«. Obwohl sie freundlich ist, hütet sie sich, Beifall in Worten auszudrücken. Ihr höchstes Kompliment ist »okay«. Wenn die anderen davon reden, was sie gelesen haben oder welche Kurse sie im nächsten Jahr am College belegen werden, ist sie still.
Aber sie weiß andere Dinge, verborgene Dinge. Geheimnisse. Und diese anderen Dinge sind älter und in gewisser Hinsicht wichtiger. Fundamentaler. Hautnaher.
Jedenfalls denkt Joanne das, die die schlechte Angewohnheit hat, alles in Romanform zu bringen.
Hinter dem Fenster schlendern Darce und Perry vorbei, treiben eine Gruppe Camper zusammen. Joanne erkennt ein paar von ihnen: Donny, Monty. Es ist schwer, sich die Namen der Camper zu merken. Sie sind nichts als eine Horde kaum voneinander zu unterscheidender, meist schmutzstarrender Jungen, die dreimal täglich abgefüttert werden müssen, deren Krusten und Krümel und Rinden hinterher weggeputzt werden müssen. Die Aufseher nennen sie Schlampis.
Aber manche stechen heraus. Donny ist für sein Alter groß, nichts als Ellbogen und spitze Knie, mit riesigen tiefblauen Augen; selbst wenn er flucht – sie fluchen alle während der Mahlzeiten, verstohlen, aber doch laut genug, dass es die Kellnerinnen hören können –, dann ist es mehr wie eine Meditation, oder mehr wie eine Frage, als würde er die Wörter ausprobieren, sie kosten. Monty dagegen ist wie die Miniaturausgabe eines Fünfundvierzigjährigen: Er hat hängende Schultern wie ein Geschäftsmann und schon einen richtigen Bauch. Er stolziert in einem pompösen prahlerischen Gang daher. Joanne findet ihn zu komisch.
Gerade jetzt trägt er einen Besen mit fünf Rollen Klopapier vorbei, die auf den Stiel gesteckt sind. Alle Jungen tun das: Sie haben Lokusdienst, fegen die Klos, ersetzen das Papier. Joanne überlegt, was sie wohl mit den benutzten Monatsbinden in dem braunen Papierbeutel im Privatklo der Kellnerinnen tun. Sie kann sich die Bemerkungen vorstellen.
»Kompanie … halt!«, schreit Darce. Die Gruppe bleibt stolpernd vor dem Fenster stehen. »Präsentiert … das Gewehr!« Die Besen werden hochgehoben, die Enden der Klopapierrollen flattern wie Fahnen im Wind. Die Mädchen lachen und winken.
Montys Gruß ist halbherzig: Das hier ist weit unter seiner Würde. Er verleiht vielleicht sein Fernglas – diese Geschichte hat sich inzwischen im ganzen Camp herumgesprochen –, aber er hat kein Interesse, es selbst zu benutzen. Das hat er deutlich gemacht. Nicht bei diesen Mädchen, sagt er und lässt höhere Ansprüche durchblicken.
Darce macht die Parodie eines militärischen Grußes, dann marschiert er mit seinem Haufen weiter. Das Singen in der Küche ist verstummt, die Kellnerinnen haben jetzt ein Thema: die Jungen. Darce ist der Beste, der am meisten bewunderte, der attraktivste. Er hat die weißesten Zähne, das hellste Haar, das anziehendste Grinsen, er ist sexy. Im Aufenthaltsraum der Aufseher, wo sie jeden Abend hingehen, wenn das Geschirr abgewaschen ist, wenn sie ihre blauen Uniformen ausgezogen haben und in ihre Jeans und Pullover geschlüpft sind, wenn die Camper für die Nacht in ihre Betten gesteckt sind, hat er abwechselnd mit jeder von ihnen geflirtet. Wen hat er nun also wirklich gegrüßt?
»Mich«, sagt Pat scherzend. »Ich wollt, es wär so.«
»Träum weiter«, sagt Liz.
»Es war Hil«, sagt Stephanie loyal. Aber Joanne weiß, dass das nicht stimmt. Aber ihr selbst hat es auch nicht gegolten. Es war Ronette. Das vermuten alle. Aber keine sagt es.
»Perry mag Jo«, sagt Sandy.
»Tut er nicht«, sagt Joanne. Sie hat verbreitet, dass sie schon einen Freund hat und dass sie daher nicht im Rennen ist. Es ist zur Hälfte wahr: Sie hat einen Freund. Er hat diesen Sommer einen Job als Salatkoch auf dem Canadian National, der quer über den Kontinent hin- und herfährt. Sie stellt ihn sich vor, wie er zwischen den Salatschichten hinten im Zug steht, auf dem Bremswagen, eine Zigarette rauchend, zusieht, wie das Land vorbeigleitet, hinter ihm zurückbleibt. Er schreibt ihr Briefe mit blauem Kugelschreiber, auf liniertem Papier. Meine erste Nacht in der Prärie, schreibt er. Es ist prächtig – das weite Land und der Himmel. Die Sonnenuntergänge sind unglaublich. Dann ist ein Strich quer über die Seite gezogen, und es kommt ein neues Datum, er erreicht die Rockies. Joanne nimmt es ihm ein bisschen übel, dass er so von Orten schwärmt, an denen sie nie gewesen ist. Es kommt ihr vor wie eine Art männliche Prahlerei: Er ist ungebunden. Er schließt mit Wünschte, du wärst hier und mehreren X und O. Das hört sich förmlich an, wie ein Brief an deine Mutter. Wie ein flüchtiger Kuss auf die Wange.
Sie hat den ersten Brief unter ihr Kopfkissen gelegt, ist aber mit blauen Schmierflecken sowohl im Gesicht als auch auf dem Kopfkissenbezug aufgewacht. Jetzt hebt sie die Briefe in ihrem Koffer unter dem Bett auf. Sie kann sich nur mit Mühe daran erinnern, wie er aussieht. Ein Bild huscht vorbei, sein Gesicht aus der Nähe, bei Nacht, auf dem Vordersitz im Wagen seines Vaters. Das Rascheln von Kleidern. Der Geruch von Rauch.
Miss Fisk kommt in die Küche marschiert. Sie ist klein, plump, nervös; sie trägt immer ein Haarnetz über ihrem grauen Knoten, ausgetretene Wollpantoffeln – sie hat irgendwas mit den Zehen – und eine ausgeblichene knielange blaue Strickjacke, egal, wie heiß es ist. Sie betrachtet diesen Sommerjob als ihre Ferien. Gelegentlich sieht man sie in einem schlaff herunterhängenden Badeanzug und einer weißen Gummikappe mit hochgeklappten Ohrenklappen im Wasser. Sie macht sich nie den Kopf nass; weshalb sie also die Kappe trägt, weiß niemand.
»Na, Mädchen. Bald fertig?« Sie spricht die Kellnerinnen nie mit Namen an. Sie nennt sie Mädchen, und hinter ihrem Rücken meine Mädchen. Sie gibt ihnen die Schuld für alles, was schief geht. Das muss eins von den Mädchen gewesen sein. Außerdem dient sie als eine Art Anstandsdame: Ihre Hütte liegt an dem Pfad zu denen der Mädchen, und sie hat Radarohren, wie eine Fledermaus.
So alt werd ich nie, denkt Joanne. Ich werd sterben, bevor ich dreißig bin. Das weiß sie mit absoluter Sicherheit. Es ist ein tragischer, aber befriedigender Gedanke. Wenn nötig, falls sie nicht von irgendeiner verzehrenden Krankheit dahingerafft wird, wird sie es selbst tun, mit Pillen. Sie ist kein bisschen unglücklich, aber sie hat vor, es später zu werden. Das scheint eine Art Pflicht zu sein.
Dies ist kein Land für alte Männer, zitiert sie aus einem Gedicht, das sie behalten hat, obwohl es bei der Abschlussprüfung nicht vorkam. Änder das in alte Frauen um.
Als sie alle ihre Schlafanzüge anhaben, fertig fürs Bett, bietet sich Joanne an, ihnen die Wahre-Schund-Geschichte zu Ende vorzulesen. Aber sie sind alle zu müde, so dass sie sie, mit ihrer Taschenlampe, allein weiterliest, nachdem die einzige trübe Birne ausgegangen ist. Sie hat den Wunsch, immer alles zu Ende zu bringen. Manchmal fängt sie die Bücher hinten an.
Unnötig zu sagen, dass Marleen einen dicken Bauch kriegt und Dirk mit seinem Motorrad das Weite sucht, als er es erfährt. ›Ich bin nicht der sesshafte Typ, Baby. Mach’s gut.‹ Wruum. Die Mutter kriegt praktisch einen Nervenzusammenbruch, weil sie den gleichen Fehler gemacht hat, als sie jung war, und sich ihre Chancen verdorben hat; man braucht sie sich nur anzusehen. Marleen weint und bereut und betet sogar. Aber zum Glück will der andere Schuhverkäufer, der langweilige, sie noch immer heiraten. Und das geschieht dann auch. Die Mutter verzeiht ihr, und Marleen selbst lernt den wahren Wert stiller Hingabe kennen. Vielleicht ist ihr Leben nicht gerade aufregend, aber es ist ein gutes Leben für die drei in der Wohnwagenkolonie. Das Baby ist entzückend. Sie kaufen einen Hund. Es ist ein irischer Setter, und er jagt in der Dämmerung hinter Stöcken her, während das Baby lacht. Und so endet diese Geschichte – mit dem Hund.
Joanne stopft das Heft nach unten zwischen ihr schmales kleines Bett und die Wand. Sie muss fast weinen. Sie wird niemals einen solchen Hund haben und auch kein Baby. Sie will sie nicht, und sowieso, wie sollte sie dazu Zeit haben, wenn sie daran denkt, was sie alles schaffen muss? Sie hat eine lange, wenn auch vage Liste von Dingen, die sie in ihrem Leben machen will. Trotzdem fühlt sie sich beraubt.
Zwischen zwei ovalen Hügeln aus rosafarbenem Granitgestein liegt ein kleiner halbmondförmiger Strand. Die Jungen, die ihre Badehosen anhaben (wie sie es bei Kanufahrten nie tun, sondern nur im Camp, wo sie von Mädchen gesehen werden könnten), waschen ihre Wäsche; bis zu den Knien im Wasser stehend, schrubben sie ihre nassen T-Shirts und Unterhosen mit gelben Stückchen Sunlichtseife. Das geschieht nur, wenn sie nichts mehr anzuziehen haben oder wenn der Gestank der schmutzigen Socken in den Hütten zu durchdringend wird. Darce, der Aufseher, passt auf. Er liegt ausgestreckt auf einem Felsblock, lässt die Sonne auf seinen schon braunen Körper scheinen und raucht. Es ist verboten, vor den Jungen zu rauchen, aber er weiß, dass ihn dieser Haufen nicht verraten wird. Um ganz sicherzugehen, sieht er sich vor, hält die Zigarette dicht am Boden und macht heimlich schnelle und kurze Züge.
Irgendetwas landet an Donnys Kopf. Es sind Richies nasse Unterhosen, zu einem Ball zusammengedrückt. Donny wirft sie zurück, und gleich darauf ist ein Unterhosenkrieg ausgebrochen. Monty weigert sich, mitzumachen, und so wird er zum allgemeinen Ziel. »Haut ab!«, schreit er.
»Hört auf, ihr Hohlköpfe«, sagt Darce. Aber in Wirklichkeit achtet er gar nicht auf sie: Er hat etwas anderes gesehen, das Aufblitzen einer blauen Uniform oben zwischen den Bäumen. Auf dieser Seite der Insel haben die Kellnerinnen eigentlich gar nichts zu suchen. Sie sollten auf ihrem eigenen Badesteg sein, ihre Nachmittagspause abhalten.
Darce steht oben zwischen den Bäumen, stützt sich mit dem Arm an einen Baumstamm. Donny hört eine Unterhaltung, Gemurmel. Er weiß, dass es Ronette ist; er sieht es an ihrer Figur, an der Haarfarbe. Und hier ist er mit seinen Waschbrettrippen, seiner haarlosen Brust und wirft mit Unterhosen durch die Gegend wie ein kleines Kind. Er ist wütend auf sich selbst.
Monty, der gegen die Überzahl keine Chance hat, seine Niederlage aber nicht eingestehen will, sagt, dass er mal verschwinden muss, und geht in Richtung Klo. Inzwischen ist Darce nicht mehr zu sehen. Donny schnappt sich Montys Wäsche, die schon fertig gewaschen und ausgewrungen und schön ordentlich auf dem heißen Felsen zum Trocknen ausgebreitet ist. Er fängt an, sie nach oben in eine Kiefer zu werfen, ein Stück nach dem andern. Die anderen machen begeistert mit. Als Monty zurückkommt, ist der Baum mit seinen Unterhosen geschmückt, während die anderen Jungen mit Unschuldsmiene ihre Wäsche ausspülen.
Sie sind zu viert auf einer der rosafarbenen Granitinseln: Joanne und Ronette, Perry und Darce. Es ist eine Doppelverabredung. Die beiden Kanus sind halb aus dem Wasser gezogen und an den obligatorischen Strauchkiefern festgebunden, das Feuer ist schon fast heruntergebrannt und erlischt zu glühender Asche. Der Himmel ist noch immer pfirsichfarben und erleuchtet, und der weiche, reife, saftige Mond geht auf, die Abendluft ist warm und süß, die Wellen schlagen sanft an die Felsen. Es ist die Sommerausgabe, denkt Joanne. Entspannte Trägheit, Tipps zum Braunwerden. Schjffsromanze.
Joanne röstet ein Stück Marshmallow. Sie tut es auf eine besondere Art: Sie hält sie dicht an die Holzkohle, aber nicht so dicht, dass sie Feuer fängt, nur so dicht, dass sie sich wie ein Kissen aufbläht und sanft bräunt. Dann zieht sie die geröstete Haut herunter und isst sie. Und dann röstet sie den weißen inneren Teil ganz genauso, und immer so weiter bis zum Kern. Sie leckt den klebrigen Sirup von den Fingern und starrt nachdenklich in das wechselhafte rote Glühen der Holzkohle. All das dient dazu, das, was wirklich vor sich geht, zu ignorieren, oder so zu tun, als ignorierte sie es.
Es müsste eine Träne auf ihrer Wange sein, aufgemalt und starr. Darüber müsste eine Überschrift stehen: Gebrochenes Herz. Auf der ausgebreiteten Zeltplane direkt hinter ihr sitzt Perry, dessen Knie ihren Rücken berühren, und der sauer ist, weil sie nicht mit ihm knutschen will. Hinter den Felsbrocken, außerhalb des trüben Lichtkreises des Feuers, sind Ronette und Darce. Es ist die dritte Juliwoche, und sie sind inzwischen ein Paar, das weiß jeder. Im Aufenthaltsraum trägt sie sein Sweatshirt mit der St. Jude’s-Krone; sie lächelt jetzt häufiger und lacht sogar, wenn die anderen Mädchen sie necken. Hilary beteiligt sich nicht an diesen Neckereien. Ronettes Gesicht scheint runder, gesünder, seine Ecken und Kanten sind wie mit der Hand geglättet. Sie ist nicht mehr so auf der Hut, nicht mehr so scheu. Sie sollte auch eine Überschrift haben, denkt Joanne. War ich zu leicht zu haben?
Aus der Dunkelheit ist ein Rascheln zu hören, leises Gemurmel, Atemgeräusche. Es ist wie am Samstagabend im Kino. Gruppenfummeln. Möglicherweise, denkt Joanne, stören sie eine Klapperschlange.
Perry legt ihr zaghaft eine Hand auf die Schulter. »Soll ich dir ein Marshmallow rösten?«, sagt sie höflich zu ihm. Frostig. Dabei ist Perry kein Trostpreis. Er irritiert sie nur mit seiner sich schälenden sonnenverbrannten Haut und seinen bettelnden Spanielaugen. Ihr so genannter richtiger Freund ist auch keine Hilfe, wie er auf seinen Eisenbahnschienen hin und zurück durch die Prärien saust, seine inzwischen selteneren tintigen Briefe schreibt; das Bild seines Gesichts ist fast völlig verwischt, als wäre es in Wasser aufgeweicht.
Und es ist auch nicht Darce, den sie will, nicht wirklich. Was sie will, ist etwas, das Ronette hat: die Kraft, sich selbst aufzugeben, rückhaltlos und ohne Erklärung. Es ist diese Sinnlichkeit, dieses Sichzurücklehnen. Wollüstige Gedankenlosigkeit. Alles, was Joanne tut, ist von Anführungszeichen umgeben.
»Marshmallows. Mann«, sagt Perry mit verdrossener, betrogener Stimme. Die ganze Paddelei, und wofür? Warum, zum Teufel, ist sie mitgekommen, wenn sie es nicht wollte?
Joanne hat ein schlechtes Gewissen; sie hat das Gefühl, sich schlecht zu benehmen. Würde es denn schaden, ihn zu küssen?
Ja, das würde es.
Donny und Monty machen eine Kanufahrt, irgendwo vor der undurchdringlichen Wildnis des Festlandes. Camp Adanaqui ist für seine Wanderfahrten bekannt. Fünf Tage lang sind sie und die anderen, insgesamt zwölf Jungen, durch einen See nach dem andern gepaddelt, haben die Ausrüstung und die Kanus über wellengeglättete Felsbrocken gezogen oder durch den Sumpf und den Gestank flacher Schlickteiche vor den Portagen, haben sich stöhnend mit dem Gepäck und den Kanus die Hügel raufgeschleppt, haben die Mücken von ihren Beinen geschlagen. Monty hat Blasen sowohl an den Händen als auch an den Füßen. Darüber ist Donny nicht allzu traurig. Er selbst hat einen eiternden Holzsplitter. Vielleicht kriegt er eine Blutvergiftung, fällt ins Delirium, bricht zusammen und stirbt auf einer Portage, zwischen den Felsen und den Tannennadeln. Das würde irgendjemandem recht geschehen. Irgendjemand musste für die Schmerzen, die er erleidet, bezahlen.
Die Aufseher sind Darce und Perry. Tagsüber schwingen sie die Peitsche; nachts entspannen sie sich, mit dem Rücken an einen Felsblock oder Baum gelehnt, rauchen und beaufsichtigen die Jungen, die Feuer machen, das Wasser holen, das Essen kochen. Sie haben beide glatte dicke Muskeln, die sich unter der Bräune kräuseln, sie haben – inzwischen – beide stachlige Bärte. Wenn alle zusammen schwimmen gehen, wirft Donny verstohlene neidische Blicke auf das, was sich unter ihren Badehosen abzeichnet. Sie geben ihm das Gefühl, spindeldürr zu sein und kindisch in seinen Sehnsüchten.
Jetzt ist es Nacht. Perry und Darce sind noch auf, reden mit leisen Stimmen, stochern in der glühenden Asche des verlöschenden Feuers. Die Jungen sollten längst schlafen. Für den Fall, dass es regnet, gibt es Zelte, aber seit zwei Tagen hat niemand daran gedacht, sie aufzustellen. Der Geruch von Schmutz und Schweißfüßen und Holzrauch wird bei engen Quartieren zu stark; die Schlafsäcke sind überreif wie Käse. Es ist besser, draußen zu sein, in den Sack gerollt, für den Fall eines Schauers eine Plane neben sich, mit dem Kopf unter einem umgekippten Kanu.
Monty ist der Einzige, der für das Zelt gestimmt hat. Die Mücken machen sich über ihn her; er sagt, er sei allergisch. Er hasst Kanufahrten und macht kein Geheimnis daraus. Wenn er älter ist, sagt er, und endlich an den Familienzaster rankommt, wird er Mr B. den ganzen Laden abkaufen und ihn dichtmachen. »Generationen ungeborener Jungen werden es mir danken«, sagt er. »Sie werden mir ’nen Orden verleihen.« Manchmal kann ihn Donny fast leiden. Er macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er gern stinkreich wäre. Er ist kein bisschen scheinheilig, nicht wie manche von den anderen Millionärssprösslingen, die so tun, als wollten sie Wissenschaftler werden oder sonst irgendwas, womit sich nicht viel verdienen lässt.
Jetzt rückt Monty hin und her, kratzt sich seine Stiche. »He, Finley«, flüstert er.
»Schlaf jetzt«, sagt Donny.
»Ich wette, die haben ’nen Flachmann.«
»Was?«
»Ich wette, die trinken. Gestern hab ich’s an Perrys Atem gerochen.«
»Na und?«, sagt Donny.
»Na ja«, sagt Monty. »Das ist gegen die Regeln. Vielleicht können wir was aus ihnen rausholen.«
Das muss ihm Donny lassen. Er weiß genau, wie’s gemacht wird. Zumindest könnten sie sich die Beute teilen.
Die beiden schieben sich aus den Schlafsäcken und schlagen leise einen Kreis um das Feuer. Sie haben Übung darin, den Kellnerinnen nachzuspionieren, und das kommt ihnen zugute. Sie ducken sich hinter eine buschige Fichte, halten nach gehobenen Ellbogen oder den Umrissen von Flaschen Ausschau, spitzen die Ohren. Aber was sie hören, hat mit Schnaps nichts zu tun. Es geht um Ronette. Darce redet von ihr, als wäre sie ein Stück Fleisch. Nach dem, was er sagt, lässt sie ihn alles machen, was er will. »Sommerwurst«, nennt er sie. Das ist ein Wort, das Donny noch nie gehört hat, und normalerweise würde er es lustig finden.
Monty kichert unter angehaltenem Atem und stößt Donny den Ellbogen in die Rippen. Weiß er, wie weh es tut, will er es noch unterstreichen? Donny liebt Ronette. Die größte Beleidigung in der sechsten Klasse, wenn man beschuldigt wird, jemanden zu lieben. Donny hat das Gefühl, als wäre er es, den man mit den Worten beschmutzt, als wäre es sein Gesicht, das darin gerieben wird. Er weiß, dass Monty alles, was sie hören, den anderen Jungen weitererzählen wird. Er wird sagen, dass Darce Ronette besprungen hat. Jetzt verabscheut Donny dieses Wort, die Vorstellung von schwankenden stöhnenden Tierleibern, die sich damit verbindet, auch wenn er es gestern noch selbst benutzt und komisch gefunden hat.
Er kann schlecht aus den Büschen stürzen und Darce eins auf die Nase hauen. Er würde sich nicht nur lächerlich machen, Darce würde ihn plattwalzen.
Er tut das Einzige, was ihm einfällt. Am nächsten Morgen, als sie das Lager abbrechen, schnappt er sich Montys Fernglas und versenkt es im See.
Monty ahnt es und beschuldigt ihn. Irgendeine Art Stolz hält Donny davon ab, es zu leugnen. Und genauso wenig kann er sagen, warum er es getan hat. Als sie zur Insel zurückkommen, findet im Speisesaal eine unerfreuliche Unterhaltung mit Mr B. statt. Oder eigentlich keine Unterhaltung: Mr B. redet, Donny schweigt. Er sieht nicht Mr B. an, sondern den Hechtkopf an der Wand mit seinem voyeuristischen Glotzauge.
Beim nächsten Mal, als das Mahagonimotorboot ablegt, um in die Stadt zu fahren, ist Donny mit von der Partie. Seine Eltern sind nicht erfreut.
Es ist das Ende des Sommers. Die Camper sind schon fort, nur einige der Aufseher und die Kellnerinnen sind noch da. Morgen werden sie zu dem großen Anlegesteg gehen, in das niedrige Boot steigen, zwischen den rosafarbenen Inseln hindurchfahren, auf den Winter zusteuern.
Es ist Joannes halber freier Tag, so dass sie nicht im Speisesaal ist und mit den anderen das Geschirr abwäscht. Sie ist in der Hütte, packt ihre Sachen. Ihr Kleidersack ist schon fertig, lehnt wie eine riesige Leinenwurst an ihrem Bett; jetzt packt sie ihren kleinen Koffer. Den Scheck für ihre Arbeit hat sie schon hineingesteckt: 200 Dollar, das ist eine Menge Geld.
Ronette kommt in die Hütte, noch in Uniform, zieht die Tür leise hinter sich zu. Sie setzt sich auf Joannes Bett und zündet sich eine Zigarette an. Joanne steht mit ihrem zusammengelegten Flanellpyjama aufmerksam da: Irgendetwas ist passiert. In letzter Zeit ist Ronette wieder zu ihrem früheren wortkargen Selbst zurückgekehrt; sie lächelt nur noch selten. Bei den Abenden im Aufenthaltsraum ist Darce aufs Spielfeld zurückgekehrt. Er ist um Hilary herumgeschwänzelt, die – mit Rücksicht auf Ronette – so getan hat, als merkte sie nichts. Vielleicht wird Joanne gleich erfahren, wie es zu dem großen Bruch gekommen ist. Bis jetzt hat Ronette noch nichts gesagt.