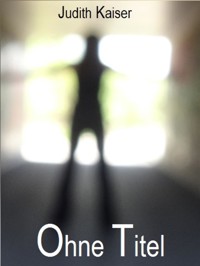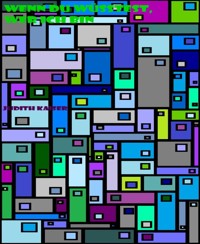2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Das heißt, du siehst es, als eine Frage der Ehre?“ […] „Man merkt, dass du noch nicht lange hier bist. Es geht nicht mehr um Ehre. Die Gesellschaft hat andere Werte entwickelt und Ehre gehört nicht dazu. Es geht wieder nur ums Überleben. Nur anders. Verstanden?“ Emma Simons sucht ihren Vater, der ihre Mutter mit ihren fünf Kindern hat sitzen lassen. Dabei trifft sie Steffi. Sie ist so ziemlich die Einzige, die Emma nicht seltsam findet. Denn Emma ist Gestaltwandlerin. Und wird innerhalb von gerade mal einem Tag zum Mobbingopfer der Klasse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Traumvogel
Für Carolin L., Marie und Clara K. und meinen Bruder, die alle gemobbt wurdenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Hey, ich weiß nicht, wer das hier liest, aber ich bin dir sehr dankbar. Weißt du, manche Leute sagen, es hilft, wenn man über seine Probleme spricht. Nun ja, ich habe viele Probleme – zum Beispiel mit dem Geld. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen soll. Es tut dir leid? Danke, aber das lass mal meine Sorge sein. Darum geht es hier nicht. Ich habe nämlich ein viel größeres Problem: Eine Geschichte.
Ja, eine Geschichte von einem Mädchen, das die Gestalt wechseln kann. Ich muss sie erzählen. Ich muss die Trauer loswerden, die ich seit unserem Abschied in mir trage oder mit mir herumschleppe. Eine Last, verstehst du?
Das klingt kitschig, nicht? Ist auch so. So ist die Welt nun mal: kitschig! Natürlich nicht immer, in diesem Fall aber schon.
Sollen wir jetzt anfangen mit dem Kitsch? Es wird dir wohl nicht erspart bleiben. Wenn du vorhast, das Folgende zu lesen jedenfalls.
Kapitel 1
Der Bus hatte Verspätung. Wie immer. So was haben Schulbusse an sich. Ich warf einen Blick auf meine Uhr: 13:45Uhr.
„Ach Scheiße! Jetzt muss ich schon wieder verschieben!“, fluchte Valerie, meine beste Freundin.
Mario lachte. „Wie schade, da muss dein Liebster wohl bis morgen warten.“ Mario war verdammt nah dran. Oder besser gesagt, es war mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Valerie mit meinem Cousin zusammen war, aber sie sagte immer noch gerne, dass sie zum Kieferorthopäden ging. Wahrscheinlich fand sie es witzig.
„Fresse!”, erwiderte sie, „Ich bin nicht mit dem Kieferorthopäden zusammen.“
„Ach, dann hab ich also doch noch ‘ne Chance?“, säuselte Mario.
„Arschloch!“
Ich seufzte. Immer das Gleiche! Kaum war Emma nicht mehr da, versuchten sie, uns zu verarschen! Pech für sie, dass wir abgehärtet waren. Sie schienen es nur wieder und wieder zu vergessen.
„Wie oft hast du denn schon verschoben?“, fragte ich.
„Ein oder zwei Mal.“, erwiderte sie und klappte ihr Handy auf, „Shit! Akku alle.“
„Wart schnell! Du kannst meins haben.“ Ich kramte in meiner Tasche. „Hier.“
„Danke.“
„Passt schon.“, meinte ich, „Ruf lieber schnell an, sonst flippt der Huber noch aus. Du weißt ja, wie er ist.“
Während Valerie telefonierte, ging ich rüber zum Fahrplan. Wahrscheinlich würden sie den Bus ausfallen lassen, da der nächste in einer Viertelstunde kam – rechtzeitig zum Ende der 7. Stunde. Mit den zusätzlichen Schülern würde er restlos überfüllt sein.
„Dein Handy.“, sagte Valerie und hielt es mir vors Gesicht.
„Schock mich, Mann! Das war mies.“
„Der Bus kommt übrigens.“
Also doch ein Sitzplatz, immerhin. Für den letzten Schultag nicht schlecht. Was fast noch besser war, war der Platz in der ersten Reihe. Der war immer am saubersten.
„Machen wir Mathe?“
„Nee. Die Ferienhausaufgaben mach ich immer auf den letzten Drücker. Du kennst mich doch.“
„Ich mach sie schon. Letztes Jahr musste ich erst wieder nachschlagen. Das hat ewig gedauert.“ Ich holte meinen Block, ein Arbeitsblatt und einen Stift heraus. „Hmm… Die 7 kürzt sich weg. Dann bleibt nur noch 8x=9+7. Ha! X=2“
„Hey, ich versuch gerade, Musik zu hören. Sei leise!“
„Sorry.“
„Nächste Haltestelle: Ludwig Thoma Straße.“
Der Bus bremste ab und fuhr die Kurve schwungvoll aus, bevor er noch abrupter abbremste und stehen blieb.
„Okay. Tschüss.“
„Tschüss.“
Ich schob mich an Valerie vorbei auf den Gang und sprang runter auf den Bürgersteig, da jemand Limo auf den Stufen ausgeschüttet hatte und es an den Schuhsohlen klebte. Als der Bus losfuhr, bekam ich noch die stinkende, heiße Abgaswolke ab.
Während ich an der Straße entlang ging, fächerte ich mir mit meiner Mappe (in der sich zum Glück ein gutes Zeugnis befand – viele von meinen Mitschülern würden die Achte wiederholen müssen.) Frischluft zu. Es hatte ja 30° im Schatten. Seltsamerweise waren die letzten Schultage irgendwie immer heiß und sonnig. Gut, es war Ende Juni, aber es gibt ja auch häufig Hitzegewitter während der Ferien. Na ja, beschweren wollte ich mich ja gar nicht – es passte zur allgemeinen Stimmung. Mit der Aussicht auf sechs Wochen Sommerferien kann ja niemand meckern. Nicht mal unser Klassenbester, Luke – kotz.
Ich bog links auf den gepflasterten Weg ab, der zu dem Hochhaus hinführte, in dem sich unsere Wohnung befand. Grau, klobig und hässlich. So als ob wir kein Geld hätten. Wir waren ja zugegebenermaßen nicht mal annähernd reich, aber es hätte für ein Reihenhaus gereicht. Meine Eltern gaben das Geld allerdings lieber für Designerzimmer, die alle drei Jahre neu gestaltet wurden, aus.
Ich sperrte die Tür auf und trat in den abgedunkelten Treppenaufgang, der immer so roch als wäre noch nie gelüftet worden. Ich hasste es hier. Die Nachbarn konnten einen rund um die Uhr bespitzeln, wofür sie genügend Zeit hatten, da es entweder junge Leute mit Teilzeitjobs im Supermarkt oder Rentner waren, die ihren Kindern ihr Haus überlassen hatten. Ich warf einen kurzen Blick nach links und entdeckte, Frau Nenner, eine 74-jährige Witwe, die mich durch das Fenster in ihrer Haustür beobachtete. Ich winkte ihr zu und lächelte, bevor ich ein Stockwerk weiter hoch lief und die Tür zu unserer Wohnung öffnete.
„Hallo!“, rief ich und ließ die Tür wieder ins Schloss fallen.
Keine Antwort.
„Hallo? Mama?“
Ich hörte eine gedämpfte Stimme aus einem der hinteren Zimmer. Seltsam, vielleicht telefonierte sie. Oder waren heute Morgen nicht die Eier aus gewesen? Stimmt. Sie hatte gesagt, dass sie in den Supermarkt fahren würde. Aber woher kam dann die Stimme?
Ich warf meinen Schulrucksack in die Ecke unter den Jackenhaken, zog hastig die Sandalen aus und ging den Gang entlang. Sie kam aus meinem Zimmer, die Stimme, und ich erkannte die Melodie von Lady Madonna von den Beatles.
Ich atmete auf. Wahrscheinlich hatte ich die CD heute Morgen versehentlich laufen lassen. Ich schob die Tür zu meinem Reich auf.
Ich muss sagen, ich bin stolz darauf. Nicht viele Mädchen haben ein Zimmer mit genau zueinander passenden Möbelstücken, Wänden, Vorhängen und Bettwäsche. Links von der Tür standen IKEA Regale aus dunklem Holz, auf die man sich setzen konnte. Die Kissen darauf passten exakt zu den orange-roten Wänden und den Bildern von verfärbten Bäumen. Mir gegenüber war das große Fenster, das auf den Balkon führte. Die roten Vorhänge waren zur Hälfte zugezogen, um die Sonne abzudunkeln. Daneben stand der leicht rötlich gefärbte Kleiderschrank. Direkt rechts von mir stand meine sehr teure Stereoanlage und trällerte immer noch vor sich hin. Dazwischen eingekeilt und ebenfalls aus dunklem Holz stand mein Bett mit der ordentlich gefalteten orangenen Bettdecke.
Nur dass sie nicht ordentlich war. Sie war zerknittert, da jemand auf ihr drauf saß. Emma! Ich erkannte sie sofort, auch wenn sie nicht ihre normale Gestalt angenommen hatte, sondern die einer jungen, blonden Frau. Sie trug schwarze Stiefel mit Absatz, enge Jeans, ein noch engeres Glitzertop, einen weiten Schal und Sonnenbrille. Ich erkannte sie allerdings nicht an der ebenfalls bekannten Gestalt, sondern daran, dass sie im Schneidersitz saß. Das taten zwar viele, aber Emma hat eine besondere Art, es zu tun. Sie hält dabei den Rücken immer schnurrgerade und ihre Hände umfassen immer ihre Zehenspitzen. Im Moment wippte sie leicht zum Takt der Musik hin und her und starrte aus dem Fenster.
Habe ich schon erwähnt, dass ich die Gestalt bereits kannte? Ich glaube ja. Emma hatte genau so ausgesehen, als ich sie zum ersten Mal sah. Es hieß nichts Gutes. Aus diesem Grund zögerte ich kurz, bevor ich eintrat.
Sie drehte ihren Kopf langsam in meine Richtung, musterte mich einen Moment von oben bis unten, nickte und schlüpfte von der Matratze herunter. Sie hat eine bestimmte Art, sich zu bewegen, als ob sich die Schwerkraft nicht auf sie auswirkt. Alle ihre Bewegungen waren abgerundet, fließend und lautlos. Selbst als sie mit Absätzen über das Parkett lief, entstand kein Geräusch.
Sie blieb dicht vor mir stehen, so dass sich unsere Zehenspitzen fast berührten. Ich weiß nicht, wieso sie das so macht, wenn sie mit Leuten redet. Es ist einem Anfang aber durchaus unangenehm. Da sie jetzt wesentlich größer war als ich, musste ich meinen Kopf leicht in den Nacken legen, um ihr Gesicht sehen zu können. Dadurch wirkte sie, als wolle sie mich einschüchtern, bedrohen oder sonst etwas in der Art tun. Ich schluckte.
„Du kommst, um dich zu verabschieden, nicht?“, fragte ich.
„Hmm…“, machte sie, „Wahrscheinlich schon.“
Wir schwiegen beide. Ich, weil ich nicht wusste, was sie sonst von mir wollen könnte und Emma, weil sie nicht recht wusste, was sie sagen sollte.
„Ähm…“, begann ich, „Emma, könntest du dich vielleicht in deine normale Gestalt verwandeln. Es ist mir so… na ja… unangenehm.“
„Oh, sorry.“ Sie schrumpfte in Sekundenschnelle zusammen, wobei sich ihre Gesichtszüge ebenfalls in rasender Schnelle veränderten.
„Danke.“
Sie war jetzt sogar ein paar cm kleiner als ich, trug eine Bluse, normale Jeans, war barfuß und ihr Ausdruck wirkte nicht so, als ob sie mich verachtete. Das ist irgendwie so. Emma ist immer ein bisschen so wie ihre momentane Gestalt. Sie hatte sich etwa vor 2 Monaten zum Spaß in mich verwandelt. Damals hatten wir uns beide vor Lachen gekringelt.
„Also ich muss ehrlich sein: Du hattest vorhin recht. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden.“, gab sie zu – es bewies mal wieder, dass sich mit ihrer Gestalt auch die Persönlichkeit veränderte, „Vielleicht auch für immer. Ich weiß es nicht.“
Ich hatte gewusst, dass es eines Tages soweit kommen würde – wir beide hatten es gewusst. Emma hatte es häufig erwähnt, während ich es immer ausgeblendet hatte. Trotzdem war es jetzt, wo der Moment gekommen war, ein Schock. Ich wusste nicht was ich sagen sollte.
„Danke, dass du gekommen bist. Wo bei euch wahrscheinlich so viel los ist und so.“ Meine Stimme nahm zum Ende hin immer weiter ab. Ich wollte sie nicht an ihren Bruder erinnern. Ich wollte sie nicht beleidigen, traurig machen oder sonst irgendwas. Ich wollte nur höflich sein.
„Du musst dir keine Sorgen wegen der Sache mit meinem Bruder machen. Er war sowieso immer ein Idiot.“, meinte sie, wobei sie mir – wie so oft – das Gefühl gab, Gedanken lesen zu können.
„Aber er hatte doch seine guten Seiten.“, erwiderte ich lahm.
„Hast wohl Recht. Trotzdem. Es macht mir wirklich nicht so viel aus.“
Sie konnte nie mit Trauer oder Wut umgehen. In keiner ihrer Gestalten. Sie konnte es einfach nicht einschätzen. Jetzt gab sie vor, dass ihr nichts fehlte und erwähnte dabei ihren Vater nicht – wie logisch.
„Jedenfalls schön, dass du nochmal gekommen bist.“
„Bitte. Ich kann mich doch nach einer so guten Freundschaft nicht einfach aus dem Staub machen.“
„Hmm...“, machte ich, „Richte deiner Familie mein herzliches Beileid aus“
„Mach ich.“, versprach Emma feierlich.
Ich zögerte, doch es gab nichts Weiteres zu sagen. Ich konnte sie nicht zum Bleiben zwingen und überreden konnte ich sie erst recht nicht. Das Einzige was ich tun konnte, war zusehen und hoffen. Hoffen – auf was denn? Darauf, dass sie zurück kam? Sehr wahrscheinlich.
„Dann, Tschüss.“
„Warte!“, rief sie, als ich auf den Balkon ging, um ihr den Weg zur Eingangstür frei zu machen (Es war besser wenn wir nicht zusammen gesehen wurden.), „Ich will dir noch etwas zeigen.“
Sie trat neben mich.
Unter uns erstreckte sich ein Gewirr aus Straßen und Häusern, Bürogebäuden und Sportplätzen, Autos und Fahrrädern... Der Himmel war noch immer blau, obwohl man am Horizont Wolken erkennen konnte.
„Wolken.“, bemerkte ich, „Das ist gut. Der Regen würde die Bratpfanne hier mal abkühlen.“
„Meinst du?“, wollte Emma wissen, „Sie werden so getrieben und regnen da, wo es nötig ist. So sind sie halt. Es wird von selber abkühlen. Im Herbst ist es schon wieder vorbei.“
„Du hast wahrscheinlich Recht.“ Sie meinte natürlich nicht das Wetter, obwohl es auch nicht schlecht gewesen wäre, einen Schauer abzubekommen.
Aber würden die Wolken im Herbst schon weitergezogen sein? Vergessen würde niemand. Ich wusste nicht recht, ob es stimmte, dass Wunden mit der Zeit verheilen. Es könnte sein, aber ich wollte und will mich nicht darauf verlassen.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich ziemlich erschrak, als Emmas Vogel auf meiner Schulter landete. Ich habe vergessen, ihn zu erwähnen, nicht? Er sitzt immer auf Emmas Schulter. Wahrscheinlich ist er für mich schon fast unsichtbar, da er nie woanders ist.
Und das war es, was mich stutzig machte: Er ist oder war nie woanders.
Ich sah mich nach Emma um. Sie war nicht mehr da. Mein Mund klappte auf.
„Emma! Du hast es geschafft!“
Der Vogel auf meiner Schulter zwitscherte freudig.
„Wow! Weiß deine Oma das schon? Ist es das erste Mal? Bist du schon geflogen? Macht es Spaß? Wie hoch kannst... Auu!“
Der Vogel hatte mir einmal ins Ohr gepikst.
„Was soll das?“, fragte ich und hielt die Hand auf die schmerzende Stelle.
Statt einer Antwort rieb der Vogel seinen Kopf an meiner Wange, breitete seine Flügel aus und hob ab.
„Emma! Stopp!“ Gleichzeitig realisierte ich, dass kein Geschrei jetzt noch was bringen würde.
Der Vogel flog weiter. Höher und höher. Von unten schwarz gegen den blauen Himmel.
„Tschüss.“, murmelte ich ergeben. Sie ging. Emma ging. Sie verließ mich und diese Welt. Sie hatte die Wahl. Ich musste ausharren. Ich blieb alleine zurück.
Als der Vogel zu einem Punkt wurde, dachte ich an die Wolken. Ich war eine davon, wehrlos. Emma dagegen hatte Flügel.
Schließlich wurde sie in der Ferne verschluckt. Im Hintergrund lief The Long And Winding Road von den Beatles.
Kapitel 2
Das hast du nicht verstanden, nicht wahr? Nicht den Hinweis auf den Songtext – obwohl der Song wirklich gut ist. Ich meine den Zusammenhang. Du weißt nichts von Cedrick, Tobi und Finn. Du weißt nicht, was vorher passiert ist. Du weißt nicht, wieso Emma gehen musste. Nun, ich werde es dir erzählen. Im Grunde genommen waren es zwei Sachen, die dazu führten:
1. Mobbing
2. Zwei Morde
Beides Sachen, die viel zu häufig vorkommen. Viel zu oft. Aber doch kommen sie vor. Wieso? Gute Frage.
Ich weiß es nicht.
Es ist auch keine Schande, es nicht zu wissen. Jeden Tag labern Millionen von Menschen – Politiker, Fernsehmoderatoren, Prominente, Lehrer oder auch einfache Bürger – davon, wie schön die Welt nur ohne – sagen wir mal – Krieg wäre.
Alles klar! Krieg ist grausam, gewalttätig und meistens unnötig. Nachher sind die beteiligten Staaten auch noch pleite. Spricht alles dagegen. Selbst kleine Kinder lernen schon, dass Gewalt keine Lösung ist.
Und doch, würden wir den Frieden schätzen, wenn wir keinen Krieg kennen würden? Antwort: Wir würden die Ruhe gar nicht wahrnehmen.
Genauso ist es beim Mobbing. Den Schülern wird eingebläut, dass Mobbing nicht angesagt ist. Alle schwören, dass sie niemals nur zuschauen würden, geschweige denn mitmachen.
In unserer Klasse hielt sich dieser Vorsatz genauso gut wie der Neujahrsvorsatz keine Schokolade mehr zu essen. Manchmal frage ich mich echt, ob sie es als Mobbing eingestuft hätten. Es schien ihnen sehr viel Spaß zu machen.
Ich nehme an, es lag an dem Ver…
Wart mal! Wieso erzähle ich dir nicht die ganze Geschichte? Du findest, dass es eine gute Idee ist? Schön, ich werde es versuchen, aber dafür müssen wir noch weitere 3-4 Monate zurückspringen. Ich versuche, mein Bestes zu tun:
Es war ein normaler Montag: Mathe, Doppelstunde Deutsch, Physik, Französisch und Englisch. Ein Alptraum von einem Stundenplan. Jeden Montag das Gleiche.
Ich gähnte und vergaß dabei meine Hand vor den Mund zu halten.
„Steffi, halt dir doch bitte die Hand vor den Mund.“, ermahnte mich Herr Haßenfuß, unser Deutsch Lehrer.
„Tut mir leid.“, sagte ich, bevor er mit einer Predigt über Manieren anfangen konnte, „Kommt nicht wieder vor.“
„Das möchte ich hoffen.“
„Steffi, was ist passiert?“, fragte Nick durch das halbe Sprachlabor (Computerraum).
„Nichts.“, rief ich schnell zurück.
„Aber wieso...“
Ich ignorierte ihn. Er konnte nie die Klappe halten.
„Nick, halt doch endlich die Fresse.“, brüllte Jojo, als er weiter laberte und dabei immer aufgeregter wurde.
„Ja, genau.“, fügte Mario hinzu. Typisch! Er war mit allem einverstanden was Jojo sagte, hatte aber nie eine eigene Meinung.
„Das ist hier kein Arbeitsklima.“ Herr Haßenfuß versuchte vergeblich, den Lärm zu übertönen. „Seid still, sonst gibt’s Strafarbeiten.“
Keine Reaktion.
„Ich sagte, es gibt Strafarbeiten.“
„Die können sie sich sonst wo hin stecken, ihre Strafarbeiten!“, entgegnete Jojo.
„Jonathan, du kommst nach der Stunde zu mir.“
„Aber ich wars doch gar nicht. Das war er.“ Er zeigte auf Mario.
„Gut. Mario, du kommst nach der Stunde zu mir.“
„Kann es sein, dass der leicht bescheuert ist?“, fragte ich Valerie.
„Wer?“
„Um genau zu sein eigentlich alle drei.“
„Hmm… Hast du jetzt schon was gefunden?“
„Nee. Welcher Lehrer kommt schon auf die Idee, uns über Zwieback halten zu lassen? Ich meine ja nur.“
Wir begannen wieder nach einer guten Website zu suchen, doch wir fanden nichts mehr. Alle Seiten, die nur irgendwie sinnvoll aussahen, waren gesperrt.
Endlich gongte es zur Pause. Alle packten ihr Zeug ein und standen auf. Ungefähr die Hälfte gähnte.
„Halt! Sitzen bleiben! Ich muss euch noch die Hausaufgabe aufgeben.“
Ich musste grinsen, als Herr Haßenfuß immer röter anlief, da wir trotzdem den Raum verließen.
„So viel dazu: Der Lehrer beendet die Stunde.“, meinte ich und folgte den anderen die Treppe hinunter.
Wir gingen langsam, da die meisten ihr Heft aufgeschlagen hatten und versuchten, den Physik Stoff zu kapieren. Die meisten fanden die Übungen zwar interessant, den normalen Unterricht aber nicht. Nur Luke und sein Haufen Streber standen herum und guckten sehr selbstzufrieden drein.
Herr Pulver kam mal wieder zu spät.
Als er dann doch kam, war er seeehr schlechter Laune und diktierte uns die ganze Stunde irgendeinen Scheiß über den elektrischen Widerstand, den niemand kapierte. Jedenfalls war ich ziemlich froh, als es zum Schluss gongte.
Die Pause war stressig, da ich noch meine Chemieschulaufgabe abgeben musste. Dummerweise war die Schlange vor dem Lehrerzimmer ziemlich lang, weshalb ich zu spät zu Französisch kam.
Frau Gans war nicht gerade begeistert, aber sie sparte sich den Vortrag zur Pünktlichkeit, weil sie gerade dabei war Melanie auszufragen.
„… Die Schüler waren glücklich, da sie ihre Hausaufgaben schon erledigt hatten.“, diktierte Frau Gans.
„Les élèves sont être… äh… jolis, que ils ai faire… Was heißt schon noch mal?“, stöpselte Melanie. Sie hatte sich von der Sprechweise her nicht einmal den Hefteintrag angeschaut.
„Déja, aber fangen wir von vorne an. Passé composé bildet man mit der dritten Person Plural Form von avoir und dem paricipe passé von être. In diesem Fall. Also: Les élèves…“, erklärte Frau Gans seufzend.
„Les élèves… ont… est jolis, que ils ai faire déja son… devoir.“, schlug Melanie vor.
„Weiß jemand das participe passé von être?“, fragte sie.
Lukes Hand schoss hoch, während sich einige andere zögernd meldeten.
„Ja, Filip?“
„Eté.“
„Genau. Melanie, bitte noch mal den ersten Satz. Und übrigens, glücklich heißt heureux, nicht joli.“
„Les élèves ont été heureux.“
„Danke. Was heißt jetzt also weil?“
„Keine Ahnung.“
„Luke?“
„Parce que.“
„Bitte, Melanie.“
„Les élèves ont été heureux, parce que ils ai faire déja son devoirs.“
„Bis parce que stimmts, obwohl es eigentlich parce qu’ils heißt.“, fuhr Frau Gans fort, „Aber danach kommt das plus que parfait. Weißt du wie man das bildet?“
„Nein, oder doch. War das nicht das Dings mit dem Imperfekt, oder so?“
„Imparfait.“, verbesserte Frau Gans, „Wer kann es mir genauer erklären?“
Wieder war Lukes Hand als erstes oben, aber Frau Gans hatte andere Pläne. Sie wollte mich drankriegen.
„Steffi?“
„Das plus que parfait setzt sich in diesem Fall aus der 3. Person plural imparfait von avoir zusammen und dem participe passe von faire.“, sagte ich gelangweilt auf. Nur weil man zu spät zur Stunde kam, hieß das noch lange nicht, dass man den Stoff nicht konnte.
„Äh, danke.“, erwiderte Frau Gans, „Sarah, das participe passé von faire?“
„Fait?“
„Ja, richtig. Melanie, weißt du jetzt, wie es geht?“
„Les élèves ont été heureux, parce qu’ils… avaient fait?“
„Ja, weiter.“
„… déja son devoirs.“
„Devoirs ist plural.“
„Ses devoirs?“
„Ja und achte auf die Stellung von déja. Noch mal von vorne bitte.“
„Les élèves ont été heureux parce qu’ils avaient déja fait ses devoirs.“
„Halleluja. Du kannst dich setzen.“, seufzte Frau Gans sichtlich erleichtert. Sie schien irgendwie der Meinung zu sein, jeder würde ihren Unterricht interessant und lehrreich finden.
Den Rest der Stunde übersetzten wir noch weitere Sätze dieser Art und veranstalteten ein Gähn-Konzert. Unabsichtlich, ehrlich!
Englisch war auch nicht viel besser. Frau Meindl hatte immer den gleichen Unterrichtsablauf: Abfrage, Hausaufgabenverbesserung, Hefteintrag und Übungsaufgaben. Dabei verwendete sie immer die gleichen Sätze. Und hatte eine schreckliche Aussprache. Sie behauptete immer, es sei Amerikanisch – es klang eher nach Deutsch. Typische Zitate sind: „Thank god.“; „Thank God, it’s Friday.“ (Natürlich nur freitags); „Continue, xy!“; „Xy, you’re first on my shit list.“ und „Please do…“ Sie benutzte nie andere Ausdrücke.
„Good morning class 8c.“
„Morning.“
„Take a seat please.“
Das war gar nicht mehr nötig, denn wir saßen bei der Begrüßung eh schon halb auf den Stühlen.
„I’d like to ask Davy a few questions. Please come to the board, Davy.“
Einige seiner Kumpels wünschten ihm auf dem Weg vor viel Glück oder sagten ihm noch schnell etwas ein. In diesem Fall machte Luke einen auf strengen Lehrer und warf ihnen böse Blicke zu.
Die Abfrage lief besser als Melanies, war aber auch nicht herausragend. Wenigstens war sie nicht so nervtötend. Bei der Hausaufgabenverbesserung meldeten sich niemand außer Luke, Filip, Leo und Bene, die sich eben immer meldeten. Nach einer Weile beschloss ich, mich auch mal zu melden, da ein guter Unterrichtsbeitrag eigentlich nie schaden kann. Frau Meindl war, glaube ich, recht froh, sich nicht schon wieder einen Zwangsfreiwilligen aussuchen zu müssen.
„Continue, Steffi.“
„In the first years a lot of pilgrims died because they weren’t used to the climate.“
„That’s correct. Continue, Leo.“
Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich so langwierig über diesen bestimmten Schultag rede. Der Grund ist ganz einfach: Es ist so und vielleicht erklärt dies einige meiner Aussagen im weiteren Verlauf der Geschichte. Außerdem haben einige eine andere Erinnerung oder eine gar andere Einstellung dazu. Das hier ist jedenfalls meine.
Der Rest der Englischstunde verlief ähnlich eintönig, weshalb ich gegen Ende der Stunde abwesend aus dem Fenster schaute.
Das war der Moment in dem ich Emma das erste Mal sah. Sie war in Gestalt einer jungen blonden Frau, die einen Porsche vor dem Schultor parkte.
Es war an diesem Tag rein gar nichts Interessantes passiert und die Eltern holten ihre Kinder für gewöhnlich nicht in schicken Autos ab. Auch war sie zu jung, um Mutter zu sein. Vielleicht eine ältere Schwester, die ihre Geschwister von der Schule abholte und anschließend mit ihnen shoppen ging?
„Hey, Valerie. Guck mal!“ Ich zeigte auf den Porsche.
Sie pfiff leise durch die Zähne. „Schicke Karre.“
„Mmh. Achtung, die Meindl kommt.“
Wir drehten uns hastig wieder vom Fenster weg.
„Seid ihr schon fertig?“, wollte sie wissen.
„Äh, nee.“
„Was habt ihr dann zu reden?“
„Wir haben unsere Lösungen verglichen.“, erklärte ich ihr schnell, „Wir wollten uns bei der einfachen Übung sicher sein bevor wir die schwerere machen.“ Die Ausrede wirkte immer.
„Soll ich euch noch etwas erklären?“, fragte sie.
„Nein, danke.“, warf ich ein, „Wir kommen schon klar.“
Sie ging weiter.
Vor dem Fenster stieg die Frau aus dem Auto und schob ihre Sonnenbrille zurück. Noch etwas, das seltsam war. Sie machte es nicht auf diese komische Art und Weise, so dass es so aussieht, als ob die Bewegung nur Coolness ausdrücken sollte. Es sollte einfach nur bewirken, dass sie – jetzt wo das Licht nicht mehr von vorne kam – etwas sah. Auch als sie sich gegen die geschlossene Autotür hinter sich lehnte, tat sie es nicht auf eine herausfordernde Art, sondern nur weil sie nicht stehen wollte. (Der Schal verdeckte den Vogel, deswegen taucht er erst später auf.)
Valerie hatte das Ganze auch beobachtet. „Wer ist denn die?“
Und jetzt versteht sie nicht falsch. Es war kein: “Wer ist denn die?“ Sie sagte: „Wer ist denn die?“ Sie meinte es nicht abschätzig – noch nicht.
„Sie sieht jedenfalls nicht so aus, als würde sie auf jemanden warten.“, antwortete ich.
„Nee, die schaut einfach nur.“
„Hm… Komm! Machen wir weiter.“
„Gut, also. Ich glaube es heißt: The Mayflower left?“
„Ja. In die nächste Lücke kommt: sailed for.“
Wir dachten nicht weiter über die höchst seltsame Szene nach – eine nette Ablenkung, nichts weiter. Nach dem Gong gingen wir an dem Porsche und der Frau vorbei an die Bushaltestelle. Wir beachteten sie nicht einmal. Der Bus kam – ausnahmsweise pünktlich – und fuhr ab. Wir machten Hausaufgaben und stritten uns, ob man avoir oder être im passé composé für aller benutzte. (Das Buch sagte: être) Ich stieg an der Ludwig Thoma Straße aus und… Da war sie wieder – Emma! Verzeihe, die Frau.
Besser gesagt, ich sah sie nicht gleich, sondern erst, als ich schon vor dem Weg zum Hochhaus stand. Sie war dem Bus im Porsche gefolgt. Ich wusste es, denn es konnte nicht anders gewesen sein. War sie speziell mir gefolgt? Mir, einem unscheinbaren Mädchen unter so vielen anderen? Nein, unmöglich. Wieso mir?
Ich ignorierte sie und bog nach links ab. Ich kramte schon nach meinem Schlüssel als sie etwas rief. Ich verstand sie nicht, da ein Auto vorbeifuhr. Sollte ich mich jetzt umdrehen oder so tun als hätte ich nichts bemerkt. Mein erster Impuls war, so schnell wie möglich ins Haus zu kommen, doch im Endeffekt siegte mein schlechtes Gewissen.
„Wie bitte?“, fragte ich und wandte mich ihr zu.
Keine Antwort. Stattdessen kam sie auf mich zu. Ich weiß noch, dass ich daran dachte, weg zu laufen. Diesmal war es nicht meine innere Stimme, die mich zum Bleiben zwang, sondern Emmas Art zu gehen, als ob sie schwebte. Es sah so aus als wäre sie unermüdlich. Ich hätte es nicht geschafft.
Sekunden und Minuten zogen sich in die Länge. Dann war sie da – direkt vor mir, keine Armeslänge entfernt.
„Entschuldigung, aber darf ich Ihnen eine Frage stellen?“, sagte sie ohne dabei ihre Stimme anzuheben. Es klang so als wolle sie ihre Frage einfach ankündigen.
„J-Ja. Natürlich.“
„Kennen Sie einen gewissen Tobi Simons, der hier einst gewohnt hat?“, wollte sie wissen. Ich musste mir Mühe geben, um nicht die Augenbrauen hoch zu ziehen, denn ihr Deutsch klang schon sehr gestelzt.
„Nein. Tut mir leid.“ Und als sie mich nur anstarrte fügte ich noch hinzu: „Sie könnten aber noch bei den Nachbarn klingeln, Einige wohnen schon seit weiß Gott wann hier.“
„Ich danke Ihnen.“, gab sie zurück, wobei ihre Mundwinkel zuckten. Sie sah ziemlich deprimiert aus.
Ich wusste nicht recht wieso, aber ich konnte mir die nächste Frage nicht verkneifen. „Wieso suchen Sie ihn?“
Einen Moment glaubte ich, ich wäre zu weit gegangen, doch nach einigen Sekunden lächelte sie. „Sie sind freundlicher als jeder, den ich heute sonst getroffen habe.“
Ich nahm an, dass es wohl an ihrer komischen Art lag. „Danke.“
„Er ist mein Vater, sonst nichts.“
Sonst nichts? Ich hatte schon von vielen Kindern gelesen oder gehört, die ihren eigenen Vater nicht kannten. Allerdings spielten sich solche Geschichten eigentlich immer in Afrika oder Südamerika ab – nicht hier, in Deutschland.
„Nein. Es tut mir wirklich leid.“, sagte ich, dieses Mal mit etwas mehr Mitgefühl, „Ich kenne ihn nicht.“
„Das glaube ich dir auch.“, erwiderte sie in einem mütterlichen Tonfall, „Und noch mal vielen Dank.“
Damit wuschelte sie mir die Haare und ging zurück zu dem Porsche. Als sie um die Ecke gebogen war, schnaubte ich laut und sagte: „Danke auch.“ Wenn ich irgendetwas hasse, ist es, wenn jemand mir die Haare zerzaust.
Kapitel 3
Man möchte meinen, dass man Begegnungen mit Fremden schnell wieder vergisst – auch die seltsamen. Aber so war es nicht. Ich dachte in den Tagen darauf sehr häufig an diese vaterlose Frau. Ich konnte sie nicht so richtig einordnen: Sie war nicht hochnäsig, nur ungeschickt im Umgang mit anderen. Sie war irgendwie bemitleidenswert, dann aber irgendwie nicht – schließlich hatte sie mich wie ein Kleinkind behandelt.
Jedenfalls hatte sie sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Völlig unerwartet und völlig unerwünscht – oder vielleicht doch nicht? Als Jugendlicher sehnt man sich nach Abwechslung: Man hält sich für erwachsen, ist es aber nicht. Man darf abends nicht lange weg bleiben, weil man in die Schule muss. Die ist allerdings auch wieder für “Langweiler”. Jede Abwechslung ist willkommen. Wahrscheinlich lag es daran. Was meiner Meinung nach auch typisch für Jugendliche ist, dass ich meiner Mutter nie von ihr erzählte. Interessiert hätte es sie schon, aber meine Mutter konnte nie die Klappe halten. Außerdem hatte sie eine unerweichliche Meinung zu allem, was Diskussionen nicht unbedingt erleichterte.
Ich erzählte ihr auch nicht von dem nächsten Treffen, das eine Woche später stattfand. Ein Dienstag, aber am Abend. Dieses Mal merkte man deutlich, dass sie nicht nur aus einer reichen Familie kam, sondern auch, dass sie sehr abgeschieden gelebt haben musste.
Also, wie schon gesagt, es war Dienstagabend. Früher Abend – natürlich – länger durfte ich nicht außer Haus bleiben. Valerie und ich waren gerade in der Eisdiele gewesen – so wie jeden Sommerabend. Wir hatten uns heute beide einen Becher im Eiscafé selber gegönnt. Valerie einen Schokobecher und ich einen Joghurt-Erdbeerbecher. Unsere persönlichen Favoriten. Wir setzten uns nicht oft hinein, weil unser Taschengeld nur für soundso viel Male reichte. Deswegen hatten wir beide das Gefühl, einen kugelrunden Bauch zu haben.
„Wie sieht‘s aus? Hast du schon dein Lesetagebuch fertig?“, erkundigte sich Valerie.
„Natürlich. Du denn nicht?“
„Nee, wieso sollte ich. Ich finde das Ganze mit Lesetagebuch sowieso bescheuert.“, bemerkte sie.
„Glaubst du ich etwa nicht?“, meinte ich beleidigt, „Eigentlich finde ich das Prinzip schon gut, aber dieses Jahr ist es wirklich schon ein bisschen zu kindisch.“
„Da schau an. Letztes Jahr warst du noch hin und weg.“, neckte sie.
Ich beschloss, den Ton zu überhören. „Da wollte ich meine Note verbessern. Ist ja auch eine super Gelegenheit gewesen.“
„Streberin.“
„Genauso wenig wie du.“
„Trotzdem. Streberin.“
„Idiot.“
„Depp.“
„Volldepp.“
„Vollidiot… Auu! Lass das!“
Ich grinste. „Wie Sie wollen.“
„Ebenfalls, stets zu Ihren Diensten, Ma’am.“
Wir gingen eine Weile schweigend weiter, nahmen aber den Umweg durch den Stadtpark, um den Bahnhof zu umgehen.
„Du weißt schon, dass wir uns beeilen sollten?“, fragte Valerie, als die ersten betrunkenen Pärchen aufzutauchen begannen.
„Hmm.“, machte ich, „Die verziehen sich doch eh in die Büsche. Außerdem sind wir sowieso gleich draußen.“
„Lass das doch mal deine Mutter hören!“
„Damit sie mir wieder drei Wochen Eisdielenverbot gibt?“
„Klar, bleibt mehr für mich übrig.“
„Von was denn?“ Wir fuhren beide zusammen.
Wir hatten mittlerweile den Parkzaun erreicht und gingen die Bahnhofsstraße entlang. Mich überraschte es nicht, dass hier irgendwer rumlief, den wir kannten, aber diese Teenagerin kannte ich nicht. Wenn sie schon so anfing, war sie wahrscheinlich besoffen. Valerie und ich beschlossen, ohne uns abzusprechen, sie zu ignorieren. Doch als wir weiter gingen, hielt sie meinen Arm fest.
„Bitte. Wir kennen uns doch.“
Diese Mal erkannte ich sie. Es war die Frau, die mir am letzten Montag gefolgt war. Seltsam nur, dass sie mich im Halbdunkeln noch erkannt hatte.
„Oh. Entschuldigung.“
„Macht nichts. Wer kann sich schon an jemanden erinnern, den er erst einmal kurz gesprochen hat?“
„Und d… Sie?“, fragte ich. Sie hatte nämlich recht, diese Frau: Wer konnte sich schon an jemanden erinnern, den er erst einmal gesprochen hat? Es sei denn…
„Ich bin dir in der letzten Woche gefolgt. Ich habe dir nicht geglaubt.“, erklärte sie mir als sei ich ein kleines Kind, „Als mein Vater meine Mutter hat fallen lassen, hat er… Er hat… Ach, es ist jetzt sowieso das Gleiche passiert, er wohnt nicht mehr in diesem grauen Klotz.“
Ich schwieg. Ich fühlte mich hintergangen. Es hätte mir nichts daran liegen müssen, dass sie, eine Fremde, mir nicht vertraute, doch irgendwie lag es mir am Herzen. Ich wollte, dass sie mir glaubte und ich wollte, dass sie mich ernst nahm. Vielleicht um ihr ein klein wenig überlegen zu sein. Menschen mögen es nicht, wenn sie von Fremden unterschätzt oder gar bevormundet werden. Es ist ihnen unheimlich. Valerie bemerkte sie auch – meine Ratlosigkeit – die Regel machte bei ihr keine Ausnahme.
„Was kontrollierst du Steffi?“, wollte sie wissen. Toll! Noch jemand der mich bevormundete! Dass sie es nur freundlich meinte, ging mir erst später auf.
„Valerie, bitte.“
„Hallo! Die hat kein Recht…“ Ich legte meine Hand auf ihre Schulter, ohne zu merken, wie sie jetzt genau das gleiche Gefühl hatte. Nur war sie vernünftig genug, um zu gehen.
„Na schön. Wir sehen uns morgen im Bus.“ Damit war sie verschwunden. Jetzt wo sie nicht mehr da war, realisierte ich erst, wie verrückt ich eigentlich war. Ich stand mitten in der Nacht mit irgendeiner Frau herum, von der ich nur wusste, dass sie mich seit gut einer Woche verfolgte. Ich schüttelte den Kopf. Das war natürlich das, was meine Mutter sagen würde. Es war noch nicht mal richtig dunkel.
Sie lächelte gezwungen. „Weise Entscheidung.“
„Wohl wahr.“, meinte ich unsicher.
„Sie kommt schon zurück. Eine gute Freundin hast du dir da ausgesucht.“
„Sie ist keine Packung Nudeln oder so.“
„Nein. Das ist sie nicht.“, stimmte die Frau mir zu.
„Haben Sie mich jetzt nur deshalb aufgehalten?“, fragte ich.
„Nein.“, gab sie zu, „Ich brauche deine Hilfe.“
„Wofür denn?“ Ich wusste nicht, was ich von ihr halten sollte. In einem Moment war sie nett, humorvoll und aufgeschlossen. Im Nächsten war sie wieder ein wenig arrogant und wichtigtuerisch. Außerdem war es ziemlich seltsam, dass sie mich erst eine Woche verfolgte und dann meine Hilfe erwartete. Ich hätte ablehnen sollen, aber ich brachte es nicht übers Herz.
„Ich muss einen Brief absenden.“, vertraute sie mir an.
„Und wa…?“ Ich konnte gerade noch abbrechen. „Ja?“
„I-Ich weiß aber nicht wie.“
„Inwiefern?“
„Ich weiß nur, dass ich eine Briefmarke oder so brauche und einen Briefkasten – glaub ich.“ Das war das erste Mal, dass sie Unsicherheit zeigte.
„Haben Sie den Brief dabei?“, fragte ich und versuchte, nicht zu schmunzeln.
„Ja, hier.“ Sie drückte ihn mir in die Hand.