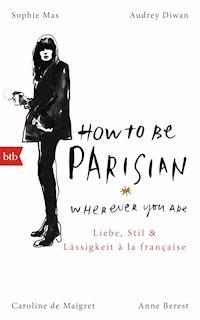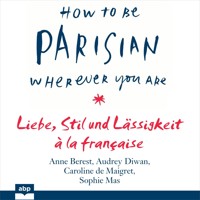7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Wäre Woody Allen eine junge Französin – er würde genau so schreiben
Längst sind die drei Schwestern erwachsen geworden, doch noch immer konkurrieren sie erbittert um die Zuneigung des Vaters. Bis nach einem Eklat der Verdacht im Raum steht, dass eine von ihnen ein Kuckuckskind ist.
Anne Berest erzählt die Suche der drei Schwestern nach ihrer Herkunft und Identität in bester französischer Tradition – mit großem Einfühlungsvermögen und hinterhältigem Witz.
Wenn es nicht die Besuche am Grab der Mutter sind, so sind es die Geburtstage, zu denen die drei Schwestern aufs Land fahren. Wieder einmal treffen sie sich zu einem solchen Anlass im Haus der Familie, wo der Vater mit seiner neuen Frau, Catherine, lebt. Provoziert durch die Ablehnung der Schwestern enthüllt Catherine der versammelten Familie ein Geheimnis: Eine der Schwestern ist nicht die Tochter des geliebten Vaters. Wie Gift dringt diese Enthüllung in die Beziehungen der Familienmitglieder und die Köpfe und Herzen der Schwestern. Denn eine jede findet plötzlich genug Zeichen dafür, bloß ein Kuckuckskind zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für meine Schwestern
Ödipus: »Wie das? Ein Vater, der dem Niemand gleich ist?«
Sophokles, König Ödipus, IV, i
Keine Beerdigungen mehr, hatte ich gesagt, Schluss, da gehe ich nicht mehr hin. Das hatte ich gesagt, ja. Aber so, wie die Umstände waren, fühlte ich mich verpflichtet, moralisch gezwungen, und, um ganz ehrlich zu sein, zweifellos trieb mich auch eine boshafte Neugier an.
Fast jedoch hätte ich im letzten Moment davon abgesehen, vor allem wegen der Hitze, so ein Wetter ist anstrengend, außerdem weiß man nicht, was man anziehen soll. Schließlich konnte ich ja nicht in Shorts zum Begräbnis meines Vaters gehen.
Zum zweiten Mal in meinem Leben bin ich in der misslichen Lage, bei einer Beisetzung zugegen zu sein, zu der mich niemand eingeladen hat.
Das erste Mal war vor zehn Jahren bei der Beerdigung des Vaters meines Kindes.
Das zweite Mal ist heute bei der Beerdigung meines leiblichen Vaters.
Ich glaube – aber die Erinnerung verblasst –, dass ich beim ersten Mal nicht besonders traurig war. Nicht mehr als heute. Allerhöchstens fühle ich mich unwohl inmitten dieser dunklen Menschentrauben, die langsam voranschreiten. Dieses Mal wollte ich nicht in Schwarz gehen und habe mir ein dunkelbraunes Kleid gekauft. Es gefällt mir nicht, ich werde es danach wegwerfen.
Wenn ich traurig sein sollte, dann nicht wegen ihres Hinscheidens, weder des einen noch des anderen, sondern wegen des Desinteresses, das diese beiden Männer mir immer entgegengebracht haben. Als hätte ich es nicht verstanden, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sie gingen an mir vorbei, ohne mich zu sehen, so wie diese Leute hier, die mich auf dem Friedhofsweg überholen und nicht wissen, wer ich bin. Aber traurig bin ich schon lange nicht mehr.
Es geschah vor zehn Jahren.
Wie es dazu kam, dass sich mein ganzes Leben innerhalb weniger Tage, zwischen dem Ende des Herbstes und dem Beginn des Winters, vollkommen verändert hat, erinnere ich nicht mehr in allen Einzelheiten – als wären die Ereignisse ausgelöscht.
Man müsste die Zeit mithilfe einer magischen Linse oder eines inneren Bildbetrachters zurückdrehen und sich selbst wieder sehen können – vorher. Müsste erinnern, was wir damals dachten, fühlten, jedoch mit dem Vorwissen über das, was kommen sollte, damit wir gewisse Details nicht vergessen und es später bereuen, sie vernachlässigt zu haben um der Belanglosigkeiten willen, die uns beschäftigten und die uns damals von größter Wichtigkeit erschienen – und die wir offensichtlich seither vergessen haben.
Der Geburtstag
Ich fahre gern mit dem Auto, denn die Gedanken fliegen gleichzeitig mit den Landschaften vorüber. Ohne anzuhalten. Auf der Straße nach Épernay streicht das Sonnenlicht noch über die Weinberge; seit wir Reims verlassen haben, bricht der Abend herein; heute ist Irènes Geburtstag. Achtunddreißig wird meine große Schwester. Achtunddreißig Jahre heute, neunzehn ihr ganzes Leben lang, mit einem hellblauen Sweatshirt, auf dem Rainbow steht. Jeder Buchstabe in einer anderen Farbe: R rot, A orange, I gelb, N grün, B blau, O dunkelblau, W violett. Ihre Freundin Katia hatte es ihr zum Geburtstag geschenkt. Ich war zwölf und träumte davon, neunzehn zu sein und das gleiche Sweatshirt zu tragen wie Irène.
Wir drei Schwestern sitzen zusammen auf dem Rücksitz wie damals, als wir Kinder waren: Irène und Charlie an den Türen, ich in der Mitte. Sie, die kleine und die große, wollen unbedingt am Fenster sitzen. Ich will nur meine Ruhe, will keinen Stress.
Ich überlege, wie lange es her ist, dass wir alle drei zusammen- und aneinandergedrängt hinten in einem Auto saßen – die drei Schwestern mit dem auffälligen roten Haar.
Sie so dicht neben mir zu spüren, stört mich, ich bin es schon lange nicht mehr gewöhnt, engen Körperkontakt mit ihnen zu haben. Der Druck ihrer Schenkel auf meine ist mir so unangenehm, dass ich mit kleinen, ruckartigen Bewegungen die Knie spreize, damit sie, ohne es zu merken, mit ihren Beinen von mir abrücken. Dennoch muss ich an unsere nackten Kinderleiber denken – wie Charlie und ich uns in der Sitzbadewanne im Badezimmer von Épernay wuschen. Die Haare voller Schaum. Die Arme glänzend von Seife. Unsere flachen Oberkörper. Ich sehe Charlie vor mir, ihren Körper, der aussah, wie in einem Zug aus einem Fleischblock geschnitten. Ein Äffchen, das jede meiner Bewegungen bewunderte. Und nachahmen wollte.
Als wir klein waren, gehörte Charlie mir ganz allein; sie war ein schönes Spielzeug, dessen Genuss mir meine Eltern überlassen hatten. Sie durfte alles von mir haben, und sie fraß sich voll mit den kleinsten Krumen meines Selbst, die sie von mir abknabberte, wenn wir zusammen waren.
Heute sehe ich sie an, meine kleine Schwester, ihr Spiegelbild im Wagenfenster. Der obere Teil ihres Gesichts ist gesprenkelt von den Reflexen der orangeroten Sonne in ihrem Haar. Im Profil gesehen springt ihr Kinn ganz schrecklich vor, als wollte es sich vom Rest des Gesichts frei machen. Bei Männern und Frauen scheinen Nase und Ohren das ganze Leben lang weiterzuwachsen, bei Charlie ist es das Kinn. Und dann hat sie auch noch die Haare kurz geschnitten. Zu kurz.
Neben mir im Wagen sehe ich sie an, meine kleine Schwester, und suche nach dem, was von mir in ihr übrig geblieben ist; was von unserer kindlichen Liebe noch da ist. Ich suche. Und finde nichts. Von unserer natürlichen Abhängigkeit ist wohl nichts übrig. Ich frage mich, wann diese enge Verbindung sich aufgelöst und welche von uns beiden die Wende eingeleitet hat. Unser heutiges Verhältnis ist unangenehm – wie bei Liebenden, deren Liebe erloschen ist und die sich gegenseitig dafür entschuldigen: Entschuldige, dass ich dich nicht mehr blind liebe; entschuldige, dass du für mich nicht mehr das Ein und Alles bist, von dem mein Leben abhängt; entschuldige, dass ich kein Interesse mehr an dir habe und mich anderweitig umsehe, nach denjenigen, die mir heute ähnlicher sind als du; entschuldige, dass ich nicht mehr weiß, was für ein Zauber mich gepackt hat, als ich dich sah und wollte, dass du nur mir gehörst. Wo ist all das geblieben? Unsere Liebe wurde von anderen Leuten eingenommen, Männer traten an ihre Stelle.
Doch mit Mathieu bade ich nicht zusammen. Wenn er sich wäscht, habe ich keinen Zutritt zum Bad. Mathieu sagt, dieser Moment sei wie ein »Ritual«, das man respektieren müsse, wolle man sich selbst respektieren. Wenn Mathieu zu mir kommt, bringt er immer ein schwarzes Necessaire voller Badeutensilien mit, Schwämme, Bürsten, Waschlappen. Deren Benutzung bietet er mir nie an, und ich bitte ihn nicht darum. Wenn er aus dem verbotenen Bad kommt, strömen Zitrusdämpfe in mein Schlafzimmer. Mathieu schämt sich nicht für seine Nacktheit, im Gegenteil, er scheint mir mit seiner Ungezwungenheit die Überlegenheit seines nackten Körpers über meinen beweisen zu wollen. Ein perfekt proportionierter Körper. Vollendet. Ohne Ecken und Kanten, ohne die Zeichen der Kindheit. Ein wundervoller Körper. Und während er sich ankleidet, beobachte ich wortlos sein gewandtes Auftreten; jede seiner Bewegungen führt mir beispielhaft all das vor, was ich nicht bin: die Eleganz jeder Gebärde, die Zielsicherheit der Hände.
Vorher, als er in seine Hosenbeine schlüpfte, sagte Mathieu, seine Großzügigkeit würde ihm oft schaden. Im Grunde ist er der Meinung, dass ich ihn nicht verdiene. Und er bildet sich etwas ein auf diesen Gedanken, der ihn in seinen Augen stark macht. Diese Kraft macht ihm Lust, mich wiederzusehen. Ein letztes Mal. Jedes Mal das letzte Mal. Diese Kraft betört mich und macht mich ihm gefügig.
Wenn wir uns treffen, um miteinander zu schlafen – immer bei mir –, faltet Mathieu sorgfältig seine Kleider und hängt sie über den Stuhl, bevor er seinen vollkommenen Körper auf meinem Bett drapiert. Er streckt sich aus, dann muss ich zu ihm gehen. Erst rührt er sich nicht, als liege er im Sterben. Ich muss langsam seine Haut liebkosen. Dann regt er sich und schiebt mich von sich. Grundsätzlich muss ich meine Bluse anbehalten, den Pulli oder das T-Shirt, ich darf nicht gänzlich nackt sein. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir, der Rothaarigen, so ist oder auch bei anderen Frauen.
Er ist zum fünfzehnten Mal bei mir. Fünfzehnmal dieselben Bewegungen. Zusammenfalten. Auseinanderfalten. Mein Stuhl war vorher zu nichts nütze. Nun ist er sehr wichtig.
Ich übe mich in Geduld. Es ist eine Frage der Zahl – eines Tages wird er dreißig-, zweiundvierzig-, fünfundsiebzigmal zu mir gekommen sein, und irgendwann werde ich nicht mehr mitzählen. Ich muss nur warten und darf mir nichts anmerken lassen, keine Freude, keine Enttäuschung. Warten.
Ich lasse mich treiben, während das Auto mich den tausendmal gefahrenen Weg entlangfährt, bei dem man jedes Geräusch kennt – das Einbiegen in den Kiesweg, das Ziehen der Handbremse, den ausgehenden Motor, das Schlagen der Türen. In der Hand drücke ich den Schlüssel, den Mathieu mir gegeben hat. Ich hätte mir gewünscht, dass er mich heute Abend zum Geburtstagsfest begleitet, aber er sagte ohne Umschweife: »Ich kann nicht mitkommen, denn ich, ich habe meiner Familie nichts von dir erzählt.«
Mathieu ist ein Mann, der Wert auf geordnete Verhältnisse und ebenbürtige Situationen legt.
Aber er hat mir seinen Schlüssel gegeben, damit ich nach dem Essen zu ihm komme.
Charlie hingegen hat jemanden mitgebracht. Zum ersten Mal kommt sie in Begleitung nach Épernay. Der junge Mann sitzt vorn neben Irènes Mann, der zu schnell fährt. Er sieht gut aus, aber sein Oberkörper ist sehr schmal, seine Arme sind dünn. Unsere Augen treffen sich im Rückspiegel. Er sieht mich an und wendet den Blick ab. Dann sieht er mich wieder an. Als könnte er sich nicht beherrschen, mich anzustarren.
Ob er mit Charlie am Flughafen arbeitet? Er wirkt jung für einen Fluglotsen. Charlie hat mir nie etwas von ihm erzählt. Früher hat sie mit mir über alles gesprochen, heute sagt sie mir nichts mehr.
Ich sehe schon das Ende der Straße, die Zeit ist schnell vergangen, das Hoftor steht offen, wir fahren die Auffahrt hinauf, der Kies knackt und knirscht unter den Reifen. Hinter den Bäumen taucht Épernay auf, das Haus unserer Kindheit. Das breite schwarze Ziegeldach, das nach dem Orkan stellenweise erneuert werden musste. Die Fenster, die in die dicken Mauern aus Kalktuff eingelassen sind. Und die beiden Zypressen, die es von hinten überragen wie zwei Rinderhörner in der Nacht. Die Bäume tragen noch Laub, Catherine, die Frau unseres Vaters, pflegt den Garten; als wir klein waren, war er verwildert. Sie hat verschiedene Blumen gepflanzt, Sämereien ausgebracht, dazu fragt sie Irène um Rat. Catherine kümmert sich geduldig um diesen kinderlosen Garten – drei Mädchen für einen alleinstehenden Vater, das war ein bisschen viel.
Wir steigen aus und bleiben reglos stehen, denn wir haben Schreie im Haus gehört. Witzig, wie wir mit vorgebeugtem Kopf dastehen, um besser hören zu können. Ja, alle fünf haben wir dasselbe wahrgenommen. Einen Streit. Aber war das wirklich Catherines Stimme? Schreie, leise wie ein Jammern. Charlie fängt an zu lachen, nun hören wir nichts mehr. Irène befiehlt ihr, den Mund zu halten, aber mittlerweile ist wieder Stille im Haus eingekehrt. Nichts mehr. Haben Papa und Catherine wiederum uns kommen hören? Bestimmt.
Wir gehen zur Haustür und halten auf der Schwelle den Atem an, Irène, ihr Mann Jean-François, Charlie, der schöne Junge und ich – in der Bewegung erstarrt, die Arme voller Taschen.
Unser Vater öffnet die Tür, küsst seine älteste Tochter und wünscht ihr zum Geburtstag alles Gute. Er küsst Charlie, dann mich, den Männern gibt er die Hand. Normalerweise empfängt uns Catherine an der Tür, während Papa noch in seiner Werkstatt ist und Dinge repariert, von denen kein Mensch je wissen wird, wozu sie gut sind. Doch ungewöhnlicherweise drängen wir uns heute hintereinander auf der Außentreppe, keiner wagt sich ins Haus hinein, und Papa regt sich auf: »Warum so schüchtern? Aber wenn ihr lieber draußen bleiben wollt – von mir aus!«
Er fügt hinzu: »Cat macht sich fertig. Sie kommt in fünf Minuten.« Dann fragt er Irène, ob sie daran gedacht hätte, Blumen mitzubringen.
Irène sagt, Scheiße, das sei ihr Geburtstag, und an ihrem Geburtstag müsse sie doch nicht an Blumen für Catherine denken. Für gewöhnlich sei das ja wohl umgekehrt. Ausnahmsweise könnte man auch mal ihr, der Floristin, Blumen schenken. Papa nimmt unsere Mäntel und meint, man würde zu seinem Vater nicht »Scheiße« sagen, er hütet sich aber wohlweislich, das Thema Blumen weiterzuverfolgen.
Irène und ihr Mann verschwinden in die Küche, auch Charlie verschwindet irgendwohin. Ihr Begleiter steht da, allein, im Wohnzimmer neben der Veranda, vor dem Esstisch, der hergerichtet ist wie ein Hund für eine Zuchtschau. Zum feierlichen Anlass hat Catherine ihr Jugend-Service eingedeckt: Zierdeckchen, Spitzenservietten, silberne Butterdose, Messerbänkchen aus Perlmutt und natürlich die Champagnerflöten, die sie selbst anfertigt. Die Ränder sind handbemalt, verziert mit abstrakten, schillernden Sternen.
Der junge Mann blickt sich um, er hat einen Ausdruck im Gesicht, etwas, das mich beeindruckt, mir aber gleichzeitig auch auf die Nerven geht. Etwas, das mich davon abhält, ihn anzusprechen, um ihm seine Anspannung zu nehmen, aber da kommt Papa und fordert mich auf, »meinem Gast« das Haus zu zeigen. Ich habe ihm gesagt, dass ich vielleicht jemanden mitbrächte, und so verwechselt er ihn, er denkt, der Mann in Charlies Begleitung sei Mathieu. Er denkt, das sei mein Freund.
Während wir die Treppe hinaufgehen, erkläre ich ihm, dass dieses Haus seit einigen Jahren nicht mehr wirklich unser Haus sei. Nachdem Charlie ausgezogen war, zog Catherine ein und gestaltete das Haus gemäß ihren »Bedürfnissen« um. Mein Zimmer, das größte, ist nun ein kleines Wohnzimmer, in dem Catherine ihre persönlichen Sachen untergebracht hat, darunter das Filmplakat von Bagdad Café, das sie selbst mit Wasserfarben gemalt hat.
Charlies Zimmer dagegen hat sich am wenigsten verändert, es wurde nur in »Gästezimmer« umbenannt, auch wenn dort nie jemand übernachtet, außer von Zeit zu Zeit Charlie selbst.
Am Ende des Flurs ist eine geschlossene Tür, die nie jemand öffnet. Hinter dieser Tür, die mir seit meinem sechsten Lebensjahr Angst macht, befindet sich das ehemalige Arbeitszimmer unserer Mutter.
Nach ihrem Tod hat nie wieder jemand diese Tür aufgemacht.
Dennoch weiß ich auswendig, wo jeder einzelne Gegenstand steht, und manchmal stelle ich mir alles beim Einschlafen vor.
Ein kleiner Waschtisch mit einer Platte aus Badezimmerfliesen, die mein Vater gefertigt hat, darauf bereitete meine Mutter Biologieversuche für ihre Schüler vor; ein Regal mit ihren Kinder- und Jugendbüchern – Reihen der Bibliothèque rose und Bibliothèque verte, in die sie ihr Exlibris geklebt und die sie ganz sicher in der Überzeugung aufbewahrt hat, wir würden sie eines Tages lesen, doch wir haben uns nie getraut, sie aufzuschlagen; Darstellungen der Evolution der Arten, die sie im Klassenzimmer aufhängte; Schuhschachteln, Hutschachteln, deren Inhalt ich nie auszupacken wagte, den Irène mir aber irgendwann einmal ganz genau aufgelistet hat; ihre Toilettenartikel, darunter ein orangerotes Flauschhandtuch – ich erinnere mich, dass dieses Handtuch auf einem Foto von Charlie zu sehen ist, die in einer Plastikwanne im Garten badet. Es gibt auch noch Spielzeug von uns: ein kleiner Gliederhund aus Holz, der die Zunge heraushängen lässt, wenn man ihn an der Leine zieht; die Giraffe Sophie, ohne die ich mich angeblich nicht waschen wollte; ein paar Barbiepuppen mit abgeschnittenen Haaren – Charlie und ich wollten einmal Friseur spielen; unter dem Vorwand, wir müssten lernen, dass die Haare von Puppen nicht nachwachsen, weigerte sich Papa, uns neue zu kaufen.
Dass unser Kinderspielzeug im Arbeitszimmer unserer Mutter gelagert wurde, hinterließ bei mir Spuren. Als hätte man die Zeugen unserer Kindheit in ein heiliges Grab gelegt, um uns das Ende einer Zeitspanne zu signalisieren. All diese aufgehäuften Dinge rochen nach porösem Gips. In meiner Vorstellung hatte sich die Asche unserer Mutter mit dem Staub vermischt und winzige feste Partikel gebildet, und so schwebte sie für mich wie durch Zauberhand in der Luft dieses Abstellraums.
Unsere Mutter war wirklich hier, driftete in Form kleinster Teilchen, nicht wahrnehmbarer Überreste ihres Körpers umher, unbestimmt und leicht – ein lebendiger Zersetzungsprozess.
Wir gingen wieder zu den anderen ins Wohnzimmer hinunter. »Cat« hat sich schließlich zu uns gesellt, ein vorbildlicher Generalfeldmarschall mit aschblondem Helm, der die Zähne zusammenbeißt und dabei weiterlächelt.