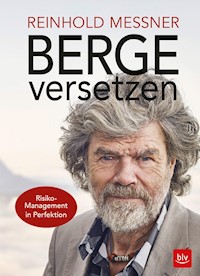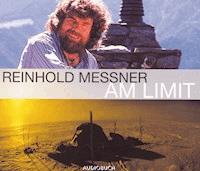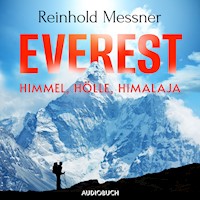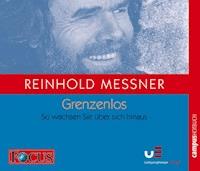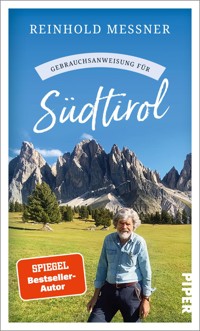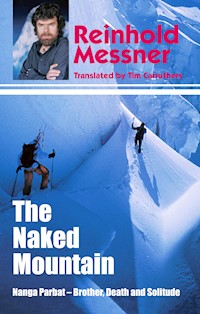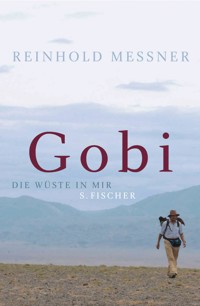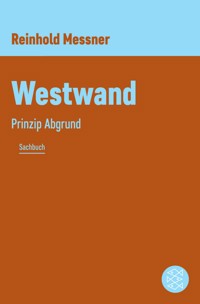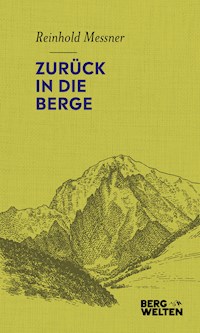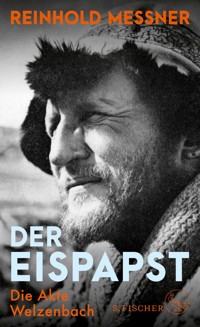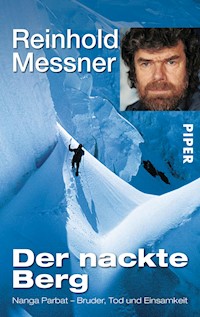9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als erstem Menschen gelang Reinhold Messner die Besteigung aller 14 Achttausender. Zumeist auf unbekannten Routen, im Alpinstil und gänzlich auf sich allein gestellt. Die entscheidenden Momente dieser bis heute unvorstellbaren Gesamtleistung schildert und analysiert Reinhold Messner in dieser ungeheuer packenden Dokumentation seiner Erlebnisse an den höchsten Bergen der Welt. Von der traumatischen Nanga-Parbat-Expedition im Jahre 1970 bis zum letzten Achttausender, dem Makalu, im Jahre 1986. Zudem schildert er die Erschließungsgeschichte aller Achttausender und führt sie fort bis zum heutigen Tag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Überlebt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2013
© BLV Verlagsgesellschaft mbH, München 2002
Erschienen im Verlagsprogramm Malik
Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München
Covermotiv: Archiv Reinhold Messner (Reinhold Messner und Hans Kammerlander auf dem Gipfel des Cho Oyu)
Grafiken: Harald und Ruth Bukor
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zum Einstieg
120 Jahre Höhenwahn
Achttausender-Tourismus
Lhagyelo – Die Götter haben gesiegt
1 – Nanga Parbat
Nanga Parbat – Himmel, Hölle, Himalaja
Nanga Parbat – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
2 – Manaslu
Manaslu – Zwei kamen nicht zurück
Manaslu – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
3 – Gasherbrum I
Hidden Peak –Ein alter Stil als neue Idee
Gasherbrum I – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
4 – Mount Everest
Chomolungma –Der letzte Schritt
Everest – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
5 – K2
Chogori – Der einsame Gipfel des Ruhms
K2 – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
6 – Shisha Pangma
Shisha Pangma – Keine Aussicht im Nebel
Shisha Pangma – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
7 – Kangchendzönga
Kangchendzönga – Vom Sturm festgenagelt
Kangchendzönga – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
8 – Gasherbrum II
Gasherbrum II – Begegnung mit dem Tod
Gasherbrum II – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
9 – Broad Peak
Falchen Kangri – Messbar ist höchstens die Höhe
Broad Peak – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
10 – Cho Oyu
Cho Oyu – Grenzgänger zwischen zwei Welten
Cho Oyu – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
11 – Annapurna
Annapurna – Die »Hürden« sind im Bauch
Annapurna – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
12 – Dhaulagiri
Dhaulagiri – Rekord als Spiel
Dhaulagiri – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
13 – Makalu
Makalu –Ruhigen Fußes zum Ziel
Makalu – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
14 – Lhotse
Lhotse – Gezwungen, frei zu sein
Lhotse – Die wichtigsten Daten der Erschließungsgeschichte
8000 Meter im Jahr 2000
Ende des Trad-Alpinismus?
Die Achttausender und ihre Nebengipfel (über 8000 m) – Erstbesteigungen
Bildnachweis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Tiefblick vom Nordostgrat des Kangchendzönga. Friedl Mutschlechner, hier im blauen Anzug, folgt dem rot gekleideteten Sherpa Ang Dorje (6. Mai 1982).
Mount Everest von Norden, der von dieser Seite seit 1921 wiederholt angegangen wurde.
120 Jahre Höhenwahn
Die alpine Kultur war von hartem Wettkampf und unverwässertem Machismo gekennzeichnet, aber die meiste Zeit über waren ihre Anhänger damit beschäftigt, gegenseitig Eindruck zu schinden. Es ging weniger darum, den Gipfel eines bestimmten Berges zu erreichen, als um die Art und Weise, wie man dorthin gelangte: Prestige erlangte, wer die härtesten, unzugänglichsten Routen mit minimaler Ausrüstung in Angriff nahm, und dies in der kühnsten Manier, die man sich vorstellen kann.
Jon Krakauer
Das Höhenbergsteigen ist bisher von fünf verschiedenen Perioden gekennzeichnet und trotz seines Niedergangs erneuerungsfähig. Die Voraussetzung dafür ist eine genaue Kenntnis der Achttausender-Geschichte und der Mut zur Selbstkritik.
1895, als Albert Frederick Mummery am Nanga Parbat verschollen blieb, wussten die Bergsteiger wenig über den Zustand des Menschen in der sauerstoffarmen Luft über 8000 Meter Meereshöhe. Der Griff nach dem »Dritten Pol« damals mag deshalb nach Größenwahn klingen; die Briefe allerdings, die der britische Alpinist im Himalaja an seine Frau schrieb, sind eher Zeugnisse der Naivität, was Größe und Gefahren dieser Achttausender angeht, nicht Hochstapelei. Trotzdem, mit Mummery begann vor mehr als 100 Jahren jener Griff nach den höchsten Bergen der Welt, der tausend und mehr Menschen das Leben kosten sollte, der Millionen und Abermillionen an Dollars verschlang, der ständig neue Motivationen suggerierte, immer wieder und immer höher hinaufzusteigen.
»Diese dunkle Bergwelt mit all ihren Drohungen ist am Ende der Quell allen Lebens«, verkündete Mummery, ehe er am Fuße des Nanga Parbat starb, ohne in die Gipfelregion vorgestoßen zu sein. Und weiter: »Ich bin sicher, dass der Gipfel uns gehören wird!« Dieser Satz aus dem letzten Brief Mummerys an seine Frau ist symptomatisch für dieses Jahrhundert eines Eroberungswahns, der das Viktorianische Zeitalter überdauern sollte: Zuerst ging es um das »ultima Thule«, das letzte Geheimnis am Ende der Welt; dann um den »Gral auf dem Thron der Götter«; heute geht es um den Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde. Ganz haben uns die bösen Geister des Größenwahns nie verlassen.
Obwohl wir uns die »Eroberung des Nutzlosen« auf den Rucksack geschrieben haben, stecken wir diesen immer noch voll mit Heldentümelei, Gipfelsieg und Eroberungssucht. Auch wenn heute die Sherpas und Bergführer alle Vorarbeit und Verantwortung tragen und nicht die Achttausender-Touristen selbst, ihre Erfolge tragen sie wie Orden vom Berg herab ins Tal. Heute mehr denn je.
Ein Gipfel gehört dir nie, auch nicht, wenn du wieder herunten bist, niemals. Außer, du kannst ihn kaufen. Dann gehört er dir, auch wenn du nicht oben warst. Diese Grundregel in einer vornehmlich kapitalistischen Welt wollten und wollen vor allem die Höhenbergsteiger nicht wahrhaben. Sie erfanden und erfinden immer andere Idealismen, um die Besitznahme ihrer »blauen Berge« zu rechtfertigen. Der lange Weg vom Mythos Berg zum Massentourismus auf dem Dach der Welt kann auch in der Geisteshaltung einer Spezies nachempfunden werden, der jede Selbstkritik abhandengekommen ist.
In seinem ungestillten Überlegenheitsdünkel stilisiert sich der Bergsteiger von Generation zu Generation zum Übermenschen, in dessen Höhen sich heute vor allem der Spießbürger bedeutend vorkommt. So folgt er nun im Gänsemarsch den ausgetretenen Pfaden, die eine Elite von suchenden Einzelgängern vor einem Jahrhundert erkundet hat: vielfach ohne Karten, ohne Vorgaben, ohne Erfahrungswerte.
Es fehlte damals an allem, aber die Pioniere waren beseelt von jenem Selbstverständnis, das die Menschen in der Viktorianischen Zeit auszeichnete: Auch die Berge mussten erobert werden.
Vor dem Ersten Weltkrieg kam man nicht besonders weit dabei. Der Nanga Parbat war zu gefährlich, der K2 zu steil, der Kangchendzönga zu hoch.
In den beiden Jahrzehnten zwischen den großen Kriegen beseelte vor allem die deutschsprachigen Bergsteiger der Ruf und die Berufung zu Höherem. Obwohl Briten in ihrer Sachlichkeit (Mount Everest 1921–1938) und Amerikaner in ihrer Naivität (K2 1938–1939) immer wieder weit über die magische Demarkationslinie in 8000 Meter Meereshöhe stiegen, blieben alle Versuche der deutschsprachigen Höhenbergsteiger in ihrem Heldentum stecken. So entstand eine Krankheit, die bis heute nicht geheilt werden konnte. Ich nenne sie den Höhenwahn.
»Wenn Männer ihr Leben nicht wagen, um Dinge zu versuchen, die vorher noch nie getan wurden, wird die Menschheit auf dem absteigenden Ast sein«, hatte Karlo Wien bekannt, bevor er 1937 mit seiner Mannschaft am Nanga Parbat von einer Lawine begraben wurde. Dieser Karlo Wien gehörte jener Elite von Akademikern an, die Willo Welzenbach in seinem »magischen Idealismus« beerbt hatten, nachdem dieser 1934 am Nanga Parbat an Erschöpfung gestorben war. Fasziniert von der »epischen Macht des Todes« verstiegen sie sich immer mehr auf jenen »aufsteigenden Ast einer Herrenrasse«, der mit allerlei Idealismen besetzt war: Kampf, Sieg, Kameradschaft.
Die Männer am Nanga Parbat hatten alles miteinander zu teilen, Zelt und Angst, Brot und Schicksal. Wie die Soldaten wenig später an der Front. Genügsam war man, alle folgten dem Führerprinzip, und ein Bergsteiger hatte hart zu sein, hart wie der Fels.
Bei so viel Selbstkontrolle und Nibelungentreue konnte Distanz zum eigenen Tun nicht aufkommen. Statt aus den Tragödien zu lernen, brachen immer jüngere Bergsteiger auf, um »die Toten vom Nanga Parbat zu rächen«.
Ungünstige Voraussetzungen, die falsche Taktik, der vernünftige Rückzug wurden nie diskutiert. Zum Beispiel dass Merkl und nicht Welzenbach die Führung der Expedition 1934 innegehabt hatte; dass zu viele gleichzeitig versucht hatten, den Gipfel gemeinsam zu erreichen; dass der Entschluss abzusteigen hinausgeschoben worden war, bis die Tragödie der einzige Ausweg blieb. Die Spur, die Welzenbach und Co. im Eis und Schnee des Himalaja hinterließen, verrät nicht nur den Geist der Zeit und die Begeisterungsfähigkeit einer ganzen Bergsteigergeneration, auch die Übernahme einer Handvoll fragwürdiger Werte, die nie hinterfragt worden sind.
Auch die Achttausender-Eroberer der fünfziger und sechziger Jahre waren Kinder ihrer Zeit. Mit nationalen Parolen wurde in Frankreich, England, Deutschland, Österreich und Japan Geld gesammelt für die Eroberung des »Dritten Pols«. Ganze Nationen identifizierten sich mit den »Helden« von der Annapurna, vom Mount Everest, vom Nanga Parbat, vom Manaslu. Als chinesische Bergsteiger mit dem Shisha Pangma 1964 den »letzten Achttausender« bestiegen hatten, schickte Mao das Nationalgefühl der Chinesen den Gipfelsiegern hinterher. Die Nationalflagge am Rucksack des Expeditionsleiters blieb zwei Jahrzehnte lang das Symbol eines überholten Eroberungswahns, der keine Reichtümer, sondern nur nationales Prestige vom Dach der Welt holen sollte.
Ein Shangri La war der Himalaja mit seinen Achttausendern auch in den siebziger Jahren nicht. Aber ein Jahrzehnt lang blieb es aufregend, das Höhenbergsteigen neu zu erfinden. Mit brauchbaren Karten, einer vereinfachten Logistik und ohne den ethischen Ballast aus der Zwischenkriegszeit spielten wir Pfadfinder ohne Fahne und Maske. Zuerst an den schwierigen Wänden, dann bei Überschreitungen und in immer kleineren Gruppen. Das Wie war wichtiger geworden als das Wieviel und um jeden Preis. So fand ich zu meinem Stil.
Die achtziger Jahre brachten die Öffnung aller Achttausender-Regionen und hundert Rekorde. Ein jüngster mit 13 und ein ältester Bergsteiger, Yuichiro Miura mit 80 Jahren, standen auf dem Gipfel des Mount Everest. Der Südwestpfeiler wurde zur schwierigsten und die Ostwand zur gefährlichsten Route. Besteigungen »allein und an einem Tag« wurden gemessen, nachdem die Strecke präpariert und der Athlet wochenlang vorher auf- und abgestiegen war.
Am K2 kletterten Japaner zuerst über die Nordflanke zum Gipfel, dann folgten Schnellbesteigungen, Parallelbesteigungen der »Magic Line« und zuletzt die »größte Tragödie«. Nach den 13 Toten 1986 wollten die Überlebenden allerdings immer noch nicht einsehen, dass es der Mensch ist, der Fehler macht, und nicht der Berg.
Ein Team aus der Sowjetunion überschritt die großen Gipfel des Kangchendzönga in mehreren Kombinationen. »Ausgereizt« ist das Höhenbergsteigen trotzdem noch nicht, ebenso viele »Herausforderungen« wie vor Jahrzehnten sind denkbar und früher oder später auch machbar. Vorerst aber heißt das Kriterium nicht Qualität beziehungsweise Stil, sondern Quantität. Als ob ich mit meinen (31) Achttausender-Expeditionen nur die Zahl 14 vorgegeben hätte.
Der Massentourismus hat den höchsten Berge der Welt erreicht. Seit Jahren vergeben die Tourismus-Ministerien in Pakistan, Nepal, China und Indien die Permits. Sie wetteifern untereinander darum, wer mehr von den begehrten Trophäen zur Besteigung feilbieten kann und wessen Teams in der internationalen Presse indirekt mehr für den lokalen Trekking-Tourismus werben. Wir Bergsteiger ließen uns schon gestern als Werbekletterer missbrauchen, ohne allerdings dafür bezahlt zu werden. Besonders Jerzy Kukuczka und ich.
Polnische Expeditionsleiter, Bürokraten in Nepal und Pakistan duldeten Kukuczka immer wieder als Gast in immer anderen Expeditionen, auch weil sie das Wetteifern um die 14 Achttausender anheizen wollten. Mir versuchte man am Ende Permits vorzuenthalten. Kukuczka hat in nur elf Jahren alle 14 höchsten Berge der Welt bestiegen und diesen Rekord nur kurz vermarkten können. Seine Sponsoren im Westen lachten sich ins Fäustchen. Als am 24. Oktober 1989 in der Lhotse-Südwand sein Seil riss, hinterließ der dreifache Vater eine verarmte Familie und eine Reihe von Claqueuren, die sich weder um die Hinterbliebenen noch um seine Aussagen kümmerten. Sein »Vierzehnter Himmel« ließ sich mit antagonistischen Sprüchen besser verkaufen als mit genauen Berichten über »Aufstieg und Fall« dieses zähen Machers.
Jerzy Kukuczka war einer der letzten »Dinosaurier« des vorkommerziellen Höhenbergsteigens. Fünfzehnmal stand er auf einem Achttausender-Hauptgipfel, davon viermal im Winter, oft als Erstbegeher einer schwierigen Route. Nach ihm haben sich nur noch der Schweizer Erhard Loretan, Carlos Carsolio und der Franzose Pierre Beghin dem schwierigen und langen Weg des immer wieder anderen Zugangs verschrieben. Als Beghin, nach seinem grandiosen Alleingang in der direkten Makalu-Südwand, an der Annapurna-Südwand zu Tode stürzte, erlebte ich die schmerzliche Erkenntnis, dass mein Stil bei zunehmender Schwierigkeit unverantwortlich ist.
Als wäre der Trend der neunziger Jahre – Commercial Expeditionen aus dem Reisekatalog – die Antwort auf unser Scheitern, geben dem Himalaja-Bergsteigen heute ein paar Bergführer die Richtung, die nicht nur sich, sondern gleichzeitig eine Reihe von Schutzbefohlenen und hilfsbedürftigen Amateurbergsteigern auf das Dach der Welt bringen. Sie bieten nicht nur Organisation, Logistik und Animation, sondern auch die größtmögliche Erfolgschance. Das Wie ist nicht mehr so wichtig.
Und weil es immer mehr sind, die diesen Weg gehen – Teams aus Australien, Neuseeland, Amerika ebenso wie Gruppen aus allen Teilen Europas –, wird es für den Einzelnen immer leichter, den Gipfel zu erreichen, für den Grenzgänger immer schwieriger, irgendwo am oberen Ende der Welt, ganz auf sich allein gestellt, seinen Weg zu gehen. So werden immer mehr Achttausender-Touristen das Höhenbergsteigen vorausbuchen und wohlorganisiert zu Ende gehen – auch weil die Suchtkrankheit Höhenwahn ansteckend ist.
Bei einem Treffen führender Bergsteiger und Kletterer in Juval wurde 1987 unter dem Titel »Wettlauf zum Gipfel« die Zukunft der Alpinistik diskutiert. Untere Reihe, von links: F. Mutschlechner, »Manolo«; mittlere Reihe: A. Gona, L. Jovane, R. Cassin, H. Mariacher, J. M. Bovin, E. Escoffier, J. Affanasiev; obere Reihe: E Perlotto, R. Messner, J. Kukuczka.
Achttausender-Tourismus
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Es ist längst keine provokante Behauptung mehr, sondern eine Tatsache: Am Mount Everest findet heute, anders als zu der Zeit meiner im vorliegenden Band versammelten Grenzgänge, Bergtourismus statt. Zweimal im Jahr werden die beiden Normalwege – die Hillary-Route von Süden (Nepal), die Mallory-Route von Norden (Tibet) – für Massenaufstiege präpariert. Hundertschaften von Sherpas bauen eine Piste vom Einstieg in den Khumbu-Eisfall bis zum Gipfel. Dabei werden Leitern gestellt, Fixseile verlegt, Brücken über Gletscherspalten gebaut, vier Hochlager, in denen Betreuer und Köche stationiert sind, aufgebaut und Sauerstoffdepots angelegt. Die Klienten, die eine Passage zum Gipfel gebucht haben, werden zuletzt über diese touristische Infrastruktur von Betreuern zum Gipfel geleitet.
In der Vormonsunzeit 2013 war dieser Everest-Tourismus so gut organisiert, dass ich nur staunen konnte: das Basislager sauber, die Koordination zwischen den Reiseveranstaltern aus aller Welt so perfekt, dass es kaum zu Staus an der Lhotse-Flanke oder am Gipfelgrat kam. Alle die Gipfelanwärter, die je nach Qualität der Betreuung vom Basislager zum Gipfel zwischen 20000 und 70000 US Dollar bezahlt hatten, sahen sich selbst als Bergtouristen. Obwohl in Kondition und Bergerfahrung große Unterschiede zwischen den einzelnen Klienten festzustellen waren, ein größerer Teil schaffte es bis zum Gipfel. Einige stiegen auch noch auf den Lhotse, den vierthöchsten Berg der Erde, der wie der höchste im Monat Mai für Touristen präpariert worden war.
Für mich gibt es keinen Zweifel: In den kommenden Jahren werden an allen 14 Achttausendern die leichtesten und sichersten Routen immer wieder für Gruppenreisen so präpariert werden, dass viele Bergtouristen mit guter Kondition und der notwendigen Leidensfähigkeit die Gipfel der höchsten Berge der Welt erreichen können.
Diese Art Bergtourismus, von den alpinen Vereinen angeregt, kennen wir in den Alpen seit 150 Jahren. Mit dem Zerfall des Alpinismus in Sport – Hallenklettern, Skyrunning, Sportklettern an präparierten Routen – und Tourismus-Klettersteiggehen, Wandern von Hütte zu Hütte, Pistenskifahren – haben sich die traditionellen Alpinisten ihre Nischen dort gesucht, wo die vielen anderen Bergsteiger nicht sind.
Das Problem sind nicht die Bergtouristen, wenn sie auf ihren vorgegebenen Wegen bleiben. Auch nicht die Extrembergsteiger, die das Unberechenbare suchen und ihre Aktionen selbst verantworten. Das Problem sind parasitär agierende Alpinisten – Männer wie Frauen –, die die Infrastrukturen der Pistenbergsteiger nutzen und sich anschließend so gebärden, als seien sie in Eigenverantwortung und ohne alle Vorgaben aufgestiegen.
Die Aggressionen junger Sherpas 2013 am Mount Everest galten nur am Rande dem Schweizer Ueli Steck und dem Italiener Simone Moro. An den beiden haben die Sherpas, die unter großer Gefahr Jahr für Jahr die »Piste« zum Everest Gipfel bauen, ihre Wut ausgelassen, die sich in zwei Jahrzehnten gegen jene »Parasiten« (Sherpa-Ausdruck) angestaut hat, die klammheimlich die Infrastruktur am Berg nutzen und gleichzeitig auf jene herabsehen, die diese für Touristen gebaut haben.
Nur wenn alle ihr Bergsteigen als das beschreiben, was es ist – Sport, Tourismus oder Extrembergsteigen –, kann das Nebeneinander am Berg wieder ein friedliches werden. Dabei geht es nicht um besser oder schlechter – nur Sport ist etwas anderes als traditioneller Alpinismus. Bei Ersterem geht es um die Messbarkeit, beim Zweiten um möglich oder unmöglich. Zum Tourismus gehören Vorgaben und Betreuung, zum Extrembergsteigen die absolute Eigenverantwortung sowie das Ungewisse. Wer sich wie ein Tourist verhält, sich gleichzeitig aber als Extrembergsteiger ausgibt, betrügt sich im Grunde selbst, beleidigt gleichzeitig auch Betreuer und ihre Klienten, die keine Probleme damit haben, ihre Art des Bergsteigens als das zu beschreiben, was es ist.
An den Achttausendern haben auch heute noch alle Platz. Es setzt nur die Bereitschaft der traditionellen Bergsteiger voraus, die Wege der Touristen zu meiden. Sollte einmal die Notwendigkeit bestehen, eine Piste als Fluchtweg zurück ins Leben zu nutzen, gilt es den Sherpas, die gute Bergführer und Organisatoren geworden sind, für ihren Einsatz zu danken.
Ich verdanke es der »Gnade der frühen Geburt«, dass ich alle 14 Achttausender in Eigenregie besteigen konnte. Dabei hatte ich auch noch das Glück, mit exzellenten Alpinisten zu klettern – Peter Habeler, Michl Dacher, Friedl Mutschlechner, Hans Kammerlander – und immer wieder neue Zugänge – neue Routen, Alpinstil, Alleingänge – zu finden. Es ist nicht die Summe der Achttausender-Besteigungen, die mich stolz macht, es ist die Lebenserfahrung, die ich bei 31 Expeditionen dorthin nach Hause gebracht habe. Was heute für mich zählt, ist dieses Überlebensgefühl, das jedes Leben in der Gefahr krönt. Vor allem nach gescheiterten Versuchen – Makalu-Südwand, Dhaulagiri-Südwand, Lhotse-Südwand – und jener Kritik von Kameraden, die ihre Enttäuschung nicht auf dem Gipfel gestanden zu haben, in Rufmorde oder Kampagnen verkleiden. All das gehört zur Menschennatur, die unberechenbar ist wie die Natur auch. So wenig mir die Zahl 14 bedeutet, so wichtig ist es mir heute, die vielen Einblicke in unsere Psyche auch mit all jenen zu teilen, die in ihrem Leben Nützlicheres tun, als auf Achttausender zu steigen.
Everest, Basislager, Ende Mai 2013
Lhagyelo – Die Götter haben gesiegt
1970–1986
Messner brachte alle Zweifler zum Schweigen, indem er über die tibetanische Seite des Everest kletterte und den Berg ein weiteres Mal ohne Sauerstoffflaschen bestieg – dieses Mal ganz allein, ohne die Hilfe von Sherpas oder anderen.
Jon Krakauer
Am 17. Oktober 1986 kamen Hans Kammerlander und ich zurück ins Basislager am Lhotse. Ich war ruhig, ausgeglichen. Die Emotionen der letzten Tage waren abgeklungen. Im unteren Teil des Eisbruchs eilten uns die anderen entgegen: Friedl Mutschlechner, Renato Moro und seine Helfer von »Trekking International«, die Sherpas, die Küchenmannschaft: »Hallo!« Glückwünsche. Jemand reichte uns heißen Tee. Brigitte und Sabine umarmten uns. Alle atmeten sichtlich auf.
Mich packte eine riesige Freude, auch weil sich alle anderen freuten. Aber da war kein Stolz. Ich fühlte mich nicht als Held, weil ich nun alle 14 Achttausender bestiegen hatte. Auch nicht als Ausnahmebergsteiger. Ich hatte etwas zu Ende geführt, was ich mir vier Jahre vorher vorgenommen hatte. Ich war zufrieden, weil es nun hinter mir lag. Auch weil ich der Erste war in diesem »Wettlauf«, den andere auf meinem Rücken verkauften. Das sollte endlich vorbei sein; das Morgen, die Nach-Achttausender-Zeit konnte beginnen. Ich fühlte mich leicht und frei, weil die ganze Welt vor mir lag.
Siebzehn Jahre lang habe ich gebraucht, um alle 14 Achttausender zu besteigen. Doch dabei war das Endziel anfangs nicht existent, später unausgesprochen da und in den letzten Jahren zweitrangig geworden. Das andere, immer noch schwierigere Routen zu klettern, immer wieder neue Ziele zu suchen, war mir viel wichtiger gewesen. Ständig habe ich nach neuen Wegen Ausschau gehalten, war ich bemüht, die Grenzen, die des Bergsteigens und meine eigenen, weiter und weiter hinauszuschieben.
Die wahre Kunst des Bergsteigens ist das Überleben, und schwierig wird es dort, wo wir das bisher Geleistete beherrschen und noch einen Schritt darüber hinausgehen wollen. Dorthin, wo noch niemand war; dorthin, wo einem kaum noch jemand folgt und versteht. Dort aber, wo noch niemand war, beginnen Empfindungen und Erfahrungen, die intensiver sind als im »abgegrasten« Gelände.
Die Geschichte der Achttausender-Besteigungen ist mehr als 100 Jahre alt. 1895 schon hat Albert Frederick Mummery am Nanga Parbat einen ersten Versuch gemacht. Einen Versuch in einem Stil, der heute noch als beispielgebend gelten kann. Mummery ist am Nanga Parbat verschollen geblieben. In der Zeitspanne zwischen 1921 und 1924 haben englische Expeditionen dreimal hintereinander den Everest versucht. Sie kamen, teilweise sogar ohne Sauerstoffmasken, bis knapp an den Gipfel heran. Es folgten die erfolglosen Versuche am Kangchendzönga, am Nanga Parbat, am K2. In den dreißiger Jahren gab es genügend Alpinisten, die die Kraft, Erfahrung und Ausdauer gehabt hätten, die Achttausender zu erklettern. Trotzdem scheiterten sie alle an den 14 höchsten Gipfeln. Die Zeit war noch nicht reif für die höchsten Berge der Welt.
Erst knapp nach dem Zweiten Weltkrieg, zwischen 1950 und 1964, wurden alle 14 Achttausender bestiegen. Man kann auch sagen »besiegt«, denn damals ging es vornehmlich darum, seine Fahne auf den Gipfel zu pflanzen, als Erster den Fuß auf die Spitze dieser großen Berge zu setzen, in geographischer und sportlicher Hinsicht, ein Stück Welt zu erobern.
In dieser Eroberungsphase des Achttausender-Bergsteigens waren nationale Interessen im Spiel. Die meisten Expeditionen wurden von nationalen Körperschaften getragen, sie wurden von den Staaten, von lokalen Alpenvereinen finanziert und die besten Bergsteiger zu diesen Unternehmen eingeladen. Eingeladen, ohne dass sie selbst einen größeren Beitrag in die Expeditionskasse zu zahlen brauchten.
Um die Gipfel zu erreichen, setzte man nahezu alle nur erdenklichen Hilfsmittel ein. Hilfsmittel, die damals allerdings noch bescheiden und sogar fehlerhaft waren. Acht Achttausender wurden mit Sauerstoffgeräten, sechs ohne diese erstmals bestiegen. Wenn immer wieder behauptet wird, ich sei der Erste gewesen, der ohne Maske auf einen Achttausender geklettert sei, so ist das falsch. Bereits 1950 haben die Franzosen Lachenal und Herzog, die mit der Annapurna den ersten Achttausender bestiegen, ohne Sauerstoffgeräte operiert. Und Hermann Buhl, der grandiose Alleingänger am Nanga Parbat, kam auch ohne den Flaschensauerstoff aus. Nur an den großen Achttausendern war es damals üblich, die Maske einzusetzen, weil Bergsteiger und Mediziner gemeinsam der Meinung waren, dass es physiologisch unmöglich sei, ohne künstlichen Sauerstoff über 8600 Meter Meereshöhe hinaufzugehen.
Nach der Besteigung aller 14 Achttausender schien es, als ob das Interesse an den höchsten Bergen der Welt nachlassen würde. Zwar gelang es amerikanischen Bergsteigern unter der Leitung von Norman Dyhrenfurth 1963, den Mount Everest zu überschreiten – Aufstieg aus dem Western Cwm über den Westgrat, Abstieg über den Südostgrat, die Route, über die Hillary und Tensing am 29. Mai 1953 als Erste den Gipfel betreten hatten –, sonst aber blieb die Entwicklung stehen.
Ein »eroberter« Achttausender hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Das war nur mehr für aktive Bergsteiger nachvollziehbar. 1962 hatten Toni Kinshofer, Anderl Mannhardt und Siegi Löw die Spitze des Nanga Parbat erreicht, wobei sie beim Aufstieg eine neue, direkte Route aus dem Diamir-Tal, von Westen her, genommen hatten. Auch dies eine Pioniertat, wenn man bedenkt, dass es damals noch nicht üblich war, Zweitrouten an diesen riesigen Bergen zu erschließen. Die große Masse beachtete diese neuen Wege am Everest und Nanga Parbat kaum.
Opferritual für die Götter im Himalaja (»Lhagyelo«). Diese Zeremonie findet vor dem Aufstieg im Basislager statt (im Bild der Kangchendzönga von Norden).
Die eigentliche Phase der Zweitrouten, der schwierigeren Wege an den Achttausendern, begann 1970. Damals gelang es einer englischen Mannschaft unter der Leitung von Chris Bonington, die gewaltige Südwand der Annapurna erstmals zu durchsteigen. Dougal Haston und Don Whillans waren es, die die Spitze erreichten, nachdem eine Handvoll Bergsteiger einen Monat lang an den schwierigen Fels- und steilen, zum Teil überhängenden Eispassagen Seile fixiert, Material geschleppt hatten. Man fand einen Weg durch eine Wand, die zweimal so groß ist wie die Eiger-Nordwand.
Himalaja heute
So wie in den Alpen die großen Berge, die ursprünglich nur einer Elite vorbehalten waren, innerhalb eines Jahrhunderts von Scharen von Bergbegeisterten berannt und bestiegen wurden und immer mehr bestiegen werden, ist es nun auch mit den Achttausendern im Himalaja. 65 Jahre nach der ersten Besteigung des ersten Achttausenders (Annapurna 1950) herrscht am Mount Everest wie am Montblanc in der Hochsaison Hochbetrieb.
Es ist verständlich, dass eine junge Generation von Bergsteigern nach der Eroberung der Gipfel (1950 bis 1964) und der schwierigen Routen (1970 bis heute) nun den »Rekord« sucht. Schnellbesteigungen, »Abfahrten« mit Ski oder Snowboard sind nach Alpinstil, Alleinbegehung und Überschreitung an den Achttausendern Mode geworden.
Möglich geworden sind diese jüngsten sensationellen Erfolge allerdings nur, weil eine immer größere Zahl von Anwärtern an den leichteren Achttausender-Flanken Saison für Saison die Infrastruktur schafft, auf der tausend und mehr Durchschnittsbergsteiger eine Chance haben, ganz nach oben zu kommen. Diesem Trend ist nichts entgegenzuhalten als die Tatsache, dass es heute zehnmal so viele »leere« Routen an den Achttausendern gibt wie »überlaufene«.
Die junge Elite der Bergsteiger weicht inzwischen sowieso auf Sechs- und Siebentausender aus, wo sie Wände, Pfeiler und Grate klettert, die vor 20 Jahren noch als »unmöglich« galten. Dort zählt nicht die Sauerstoffmaske und nicht die Spur, auch nicht Doping oder Sherpa-Hilfe, dort zählen Logistik, Ausdauer, Erfahrung und vor allem das Kletterkönnen.
Erst wenn allgemein klar sein wird, dass eine Achttausender-Besteigung im Gänsemarsch »weniger wert« ist als ein Siebentausender in Eigenregie, werden die Kolonnen dort langsam ausbleiben, wo sie jede Qualität ersticken. Einige wenige aber, alle, die dann wieder Lust und das Können dafür hätten, könnten dorthin gehen, wo alle anderen nicht sind – einmal im Leben vielleicht sogar bis zum Gipfel der Welt. Und wer dabei scheiterte, würde größere Erfahrungen sammeln als die vielen »einsamen Sieger« beim hundertfachen gemeinsamen Aufstieg zum Prestigegipfel ihres Lebens.
Im gleichen Jahr gelang es uns im Rahmen einer internationalen Expedition, bestehend aus Deutschen, Österreichern und Südtirolern, die Rupal-Wand am Nanga Parbat erstmals zu durchsteigen. Mein Bruder Günther und ich sind zu dieser Erstbegehung eingeladen worden. An Ort und Stelle aber verschrieben wir uns mit Haut und Haaren dieser Riesenwand, unserem »Problem«. Dies war meine erste Begegnung mit den großen Bergen des Himalaja. Und damit begann für mich ein neuer Lebensabschnitt.
Der Himalaja ist nicht nur größer als die Alpen – er war damals für mich voller Geheimnisse. Auf mehr als 2500 Kilometern Länge dehnt er sich vom Indus-Knie im Westen bis zum Brahmaputra-Knie im Osten aus, zwischen dem Nanga Parbat in Pakistan und dem Namche Bawa in China. Die Alpen waren mir zu klein geworden. Im Himalaja beginnen die Berge dort, wo sie in den Alpen aufhören. So hoch wie das Matterhorn nämlich, etwa 4500 Meter, liegen im Himalaja in der Regel die Basislager. Und gerade weil die Achttausender fast in die Stratosphäre hineinreichen, in jenen Bereich, wo der Partialdruck der Luft so gering ist, dass der Mensch kaum überleben kann, bieten sie bergsteigerisch eine besondere Problematik.
Bevor ich in den Himalaja kam, hatte ich viele der großen Alpenwände durchklettert. Dabei war es mir nicht um die Gipfel gegangen, sondern darum, in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenigen technischen Hilfsmitteln die schwierigsten Routen kennenzulernen, da und dort »Neuland« zu erschließen, das heißt Routen zu klettern, die vorher niemand hatte klettern können. Es ging mir nie um geographische Eroberungen, sondern um die Erweiterung meiner Fähigkeiten. Die gleiche Idee wollte ich nun in den Himalaja tragen. Der Mensch sollte wachsen können an diesen Bergen mit ihren Wänden, Graten und Gefahren. Nicht Idealismus oder Heroismus waren meine Triebfedern, sondern der Wunsch, mich auszudrücken. Ein Aufstieg über den leichtesten Weg, der Gipfel selbst, reizte mich nicht so sehr.
Damals waren die Achttausender für mich eine Art Mythos, etwas Unzugängliches, nicht Begreifbares, etwas Gewaltiges, das man nicht am Maßstab der Alpen messen kann. Als ich aber dort stand, am Fuße des Nanga Parbat, merkte ich, dass die Unterschiede in den Dimensionen gar nicht allzu groß sind. Optisch wirken die Himalaja-Berge kleiner, als sie in Wirklichkeit sein mögen. Denn sie beginnen ja dort, wo die Alpengipfel aufhören, also sind sie höchstens zweimal, maximal dreimal so hoch, wie ein Alpenberg vom Wandfuß bis zum Gipfel misst.
Zudem sind die Achttausender ein reiner Zufall. Das war mir allerdings damals noch nicht klar. Die Engländer und Amerikaner messen nicht in Metern, sondern in Fuß, und die meisten Achttausender sind für sie mehr als 26000 Fuß hoch. Ein »27000er«. Keine so einprägsame Zahl wie der Achttausender-Begriff. Hätte Napoleon das Metermaß ein bisschen länger gemacht, gäbe es weniger als 14 Achttausender; hätte er es ein bisschen kürzer gemacht, gäbe es vielleicht sogar Neuntausender.
Im Übrigen bin ich nicht so sicher, ob es tatsächlich genau 14 Achttausender sind. Doch dies ist eine Sache der Geographen. Sie haben 14 Achttausender gezählt. Sie haben dabei nur selbstständige Bergstöcke als Achttausender gelten lassen. Nicht die ungezählten, zum Teil noch unbestiegenen Nebengipfel, die es am Kangchendzönga, am Broad Peak, ja, wenn man es genau nimmt, an den meisten Achttausendern gibt. Wer den Kangchendzönga von weit weg sieht, auf den wirkt er wie ein einziger, massiver, mächtiger Bergstock. Seine Nebengipfel sind kaum auszumachen. Es ist richtig, dass sie als solche und nicht als eigene, selbstständige Achttausender-Gipfel gezählt werden. Dasselbe gilt allerdings nicht für den Lhotse. Er ist der Südgipfel des Mount Everest, wie der Name sagt. Vielleicht sollte er nicht als eigenständiger Achttausender aufgeführt werden. So war es ursprünglich in der Geographie vorgesehen.
Die meisten Achttausender wurden in der Mitte des letzten Jahrhunderts, als Indien englische Kolonie war, vom Survey of India vermessen. Man widmete dem damaligen Chef dieses Amts, Sir George Everest, den höchsten Berg der Welt, jenen Berg, den die Nepalesen vorher Sagarmatha und die Tibeter Chomolungma genannt hatten und den sie heute noch so nennen. Ich bin jedoch der Ansicht, dass man sich wieder auf die ursprünglichen Bergnamen besinnen sollte. So auch beim K2, dem zweithöchsten Berg der Welt. K2, das bedeutet nichts anderes als einen Vermessungspunkt, nämlich: der zweite Gipfel des Karakorum von links. Die Einheimischen dagegen nennen ihn Chogori, den großen Berg.
Es erhebt sich auch die Frage, inwieweit die Vermessungsangaben von damals tatsächlich stimmen. Der Himalaja wächst noch, und die Schneewechten auf dem Gipfel sind bedingt durch die Jahreszeiten verschieden hoch. Sollten in Zukunft genaue Vermessungen der Himalaja-Region durchgeführt werden können, bin ich sicher, dass es Korrekturen geben wird. Vielleicht sogar so starke Korrekturen, dass ein hoher Siebentausender unter die Achttausender fällt, oder, was ebenfalls denkbar ist, dass einer der heutigen 14 Achttausender aus dieser Kategorie herausgenommen werden muss.
Um einen dieser Achttausender erklettern zu können, braucht man eine Genehmigung. Man kann in Nepal, Pakistan oder China, wo diese 14 höchsten Gipfel der Welt stehen, nicht ohne Erlaubnis bergsteigen. In Nepal wurden früher die Genehmigungen vom Außenministerium vergeben, heute ist es das Ministerium für Tourismus, an das man sein Ansuchen zu richten hat. Das gleiche gilt für Pakistan; eine ähnliche Organisation, der CMA (Chinesischer Bergsteigerverband) erteilt die Permits in China.
Diese Permits kosten mehr oder weniger viel Geld, auf jeden Fall einige tausend Dollar. Das war für uns das Problem. Als ich und all die anderen, die sich dieser Idee verschrieben hatten, in den siebziger Jahren mit der Erschließung der schwierigsten Wände an den Achttausendern des Himalaja-Gebirges begannen, hatten wir viele neue Ideen. Aber kein Geld, keine Beziehungen, keinen national orientierten Idealismus.
Damals war es schwierig, eine Genehmigung zu bekommen. Viele Bergflanken waren von den Regierungen gesperrt, für Expeditionen unzugänglich. Einige Berge galten als heilig und waren deshalb aus der Liste der zu genehmigenden Gipfel gestrichen worden; wieder andere waren schon ausgebucht. Verglichen mit heute standen 1975 die Chancen, ein Permit für einen Achttausender zu bekommen, in etwa 100:1.
Das war ein Grund, warum damals nur selten Expeditionen aufbrachen. Einen weiteren Grund bildeten die Finanzierungsschwierigkeiten. In der ersten Phase der »Gipfelsiege«, zwischen 1950 und 1964, hatte ein nationales Interesse bestanden, diese höchsten Berge der Welt für Frankreich, für Italien, für England zu »erobern«. Ganze Nationen waren darauf aus, sie von ihren Bergsteigern als Erste bestiegen zu sehen. Amerikaner, Japaner, Italiener, Deutsche, Franzosen, Engländer hatten sozusagen stellvertretend für das ganze Volk all ihr Können, all ihre starken Männer eingesetzt, um einen Achttausender zu »bezwingen«.
Mit dieser Ideologie war es nun vorbei. Aber gleichzeitig war auch kein Geld mehr für solche Expeditionen flüssig. Wir mussten neue Wege finden, um unsere Träume zu finanzieren. Glücklicherweise waren inzwischen Industrie und Presse an diesen Bergbesteigungen interessiert. Mit viel Geschick und Ausdauer war es möglich, eine Expedition durch die freie Wirtschaft zu finanzieren. Dies erschien mir auch sinnvoller, als öffentliche Mittel in Anspruch zu nehmen.
Der Anmarsch zum Berg war für uns so etwas wie eine lange Wanderung in den Alpen. Wir benützten diese Wochen, um uns zu akklimatisieren, und in dieser Hinsicht hat sich bis heute kaum etwas verändert. Zwar fliegt der eine oder andere das erste Stück von der Hauptstadt bis zum letzten größeren Dorf vor dem Basislager mit dem Hubschrauber, aber die meisten gehen nach wie vor zu Fuß. Den Sprung ins Basislager per Hubschrauber oder Flugzeug zu machen, ist riskant. Gerade diese erste, langsame, gleichmäßige Akklimatisation ist für den Körper notwendig und wichtig, für Aufstiege in große Höhen sogar überlebenswichtig. Ich habe in meinem Anmarschverhalten von 1970 bis heute nichts geändert, nicht in der Taktik, nicht im Gehrhythmus, nicht im Verhältnis zu den einheimischen Trägern, die uns helfen, die Ausrüstung bis an den Fuß des Berges zu schleppen und die mir im Laufe von 16 Jahren mehr und mehr ans Herz gewachsen sind.
1970 übernahm ich die eingeführte Methode. Am Nanga Parbat arbeiteten wir in einem schwerfälligen Expeditionsstil. Wir hängten Seile in die Wand, erkundeten sie Stück für Stück in mehreren Auf- und Abstiegen. Dann bauten wir die Lager auf, versorgten diese mit Nahrungsmitteln. Wir stiegen so, unterstützt von einer starken Nachschubmannschaft, bis in den Gipfelbereich. Von dort aus unternahm ich am Nanga Parbat, zuerst allein und dann mit meinem Bruder, einen Vorstoß bis zum höchsten Punkt.
Erst fünf Jahre später hatte ich die Kraft und die Phantasie, den Stil völlig zu verändern. Nachdem ich als Südtiroler zu Beginn meiner Expeditionszeit schwer an Gelder von Industrie und Presse herankam, war ich gezwungen, billigere Expeditionen zu organisieren. Also musste ich etwas umstellen. Ich musste vor allem völlig anders denken als alle anderen vor mir. Ich kam zurück auf den »Verzicht-Alpinismus«, den ich schon in den Alpen praktiziert hatte. Wenn man auf die Sauerstoffgeräte und die Hochlager verzichtet, braucht man keine Hochträger. Wenn man aber keine Hochträger hat, muss man diese auch nicht versorgen und kann viel effizienter arbeiten.
Ich habe diesen neuen Stil erfunden. Unbewusst war mir schon länger klar gewesen, dass ich nur wachsen konnte, wenn ich auf Absicherungen verzichtete. Die fehlenden Mittel haben mich gezwungen, alles Überflüssige wegzulassen. Ähnlich wie in einem Wirtschaftsunternehmen habe ich mehr und mehr »notwendige Hilfen« abgebaut. Dies schien mir fairer als der technologische Alpinismus.
Ich habe alle Achttausender ohne Sauerstoffmaske bestiegen, so wie ich nie in meinem Leben einen Bohrhaken geschlagen habe. In den Alpen, in meiner ersten Phase des extremen Kletterns, war mir dies eine selbst auferlegte Regel. Der Bohrhaken macht es rein theoretisch möglich, das Ungewisse, das, was dem Bergsteigen die Spannung gibt, auszuschalten. Gerade dieses »vielleicht Unmögliche« ist wichtig. Ich hätte mich selbst betrogen, wenn ich es durch ein technisches Hilfsmittel von vornherein annulliert hätte. Ich wusste 1978, dass ich es mit einem Sauerstoffgerät schaffen würde, auf 8500 Meter zu klettern, aber das wollte ich nicht. Ich wollte sehen, ob ich mit meinen Kräften, mit all meinen Zweifeln und Ängsten fähig war, so weit in dieses »mögliche Unmögliche« vorzustoßen. Als Mensch und nicht als Maschinenmensch.
Wenn ich heute zurückschaue auf meine 16 Himalaja-Jahre, werden in mir auch jene Momente wieder wach, in denen ich aufgeben wollte, in denen ich mich vor den Achttausendern fürchtete. Und wie ich zweifelte! Wie oft habe ich mich gefragt, ob ich weitermachen sollte. Sechzehn Jahre lang in den Himalaja zu fahren, bedeutet 16 Jahre lang Training und Schweiß. Die Disziplin des Risikos einzuhalten, die ein Überleben garantiert, verlangt Konzentration und Ausdauer. Sechzehn Jahre lang immer wieder zu scheitern und neu anzufangen – das war der Schlüssel zu diesem Erfolg.
Ich habe die Achttausender nicht »gesammelt«, wie mir manchmal unterstellt wird. Auch nicht, nachdem mir 1982 in einer einzigen Saison drei geglückt waren. Nach diesem ersten Achttausender-Hattrick habe ich die Entscheidung getroffen, alle 14 Achttausender zu besteigen. Ich wollte die Liste aber nicht einfach zu Ende bringen. 1984 unternahm ich eine Achttausender-Überschreitung, die mir wichtiger war als alle 14 Achttausender zusammen. Beide Berge, den Gasherbrum I und den Gasherbrum II, hatte ich vorher bereits einmal bestiegen, sie waren also für meine »Sammlung« nicht notwendig. Ich habe bei allen Achttausender-Besteigungen Ideen verwirklichen können. Sogar bei den beiden letzten. Obwohl ich aus Zeitgründen über die Normalwege von Makalu und Lhotse hochstieg, gelang es mir, ein Primat aufzustellen: Erstmals haben dabei zwei Bergsteiger, Hans Kammerlander und ich, in einer Saison in Nepal zwei hohe Achttausender besteigen können, ein Ziel, an dem einige andere Bergsteiger vorher gescheitert waren.
Ich habe 18-mal auf einem Achttausender gestanden; vier Achttausender habe ich zweimal bestiegen. Am 16. Oktober 1986 war ich im »Wettlauf« um die Achttausender, den andere zu einem Vergleichskampf hochgespielt hatten, von den »Konkurrenten« weiter entfernt als je zuvor.
1970, als ich mit dem großen Bergsteigen begann, gab es nur einen lebenden Alpinisten, Kurt Diemberger, der zwei Achttausender geklettert hatte. Hermann Buhl, der erste westliche Bergsteiger mit zwei Achttausendern, war 1957 tödlich verunglückt. Erst 1975 gelang es mir, mit Nanga Parbat, Manaslu und Hidden Peak als Erster drei Achttausender bestiegen zu haben. Seit damals war ich immer einen Platz voraus auf der von Journalisten und Bergsteigern verhassten und immer wieder gedruckten Liste »Wer hat die meisten Achttausender?«. Der von mir hoch geschätzte polnische Bergsteiger Kukuczka hatte am 16. Oktober 1986 zwölfmal einen Achttausender bestiegen, elf verschiedene Gipfel, den Broad Peak zweimal; ich war 18-mal auf einem Achttausender gestanden. Es stand also 3:2.
Zum Glück ist Bergsteigen weder mit »Rekorden« noch mit Zahlen ausdrückbar. Schon gar nicht messbar in Sekunden, Höhenmetern oder Graden. Ich hatte Glück, die »Götter waren mir gnädig«. Das wünsche ich auch allen anderen, die sich in die Achttausender »vernarrt« haben, Kukuczka, Loretan, Ozaki. Glück brauchen wir alle, denn die Berge sind unendlich viel größer als wir. Wir Menschen werden sie nie »besiegen« können. »Lhagyelo«, wie die Tibeter sagen, wenn sie einen Berg oder hohen Pass betreten, sage auch ich: »Die Götter haben gesiegt.«
Ich bin nicht stolz auf diesen »Rekord«, den ich nicht als solchen empfinde. Ich bin nicht stolz auf diesen Erfolg, den ich mir lange gewünscht habe. Ich bin nur stolz, dass ich überlebt habe.
Alle Achttausender – und überlebt
Zugegeben, für den Außenstehenden, für den alpinen Normalverbraucher, mag der Lhotse das Zielband eines ungewöhnlich spektakulären und gefährlichen Wettlaufs um die höchsten Berge der Welt gewesen sein. Nur, es war kein Wettlauf, möglicherweise für die Verfolger, nicht aber für Reinhold Messner.
Reinhold Messner wollte mehr, viel mehr. Um der breiten Öffentlichkeit klarzumachen, wie überlegen Messner das Feld anführte und das Metier in der »Weißen Arena« beherrscht, hätte man zur Verdeutlichung Punkte für die einzelnen Besteigungen, gewertet nach der Schwierigkeit des Aufstiegs, vergeben müssen.
Sechzehn Jahre lang hat Reinhold Messner das Bergsteigen im Himalaja geprägt. 16 Jahre Expeditionsbergsteigen, das heißt auch 16 Jahre Einsamkeit, ständig gegenwärtige Gefahr, Angst und Verzweiflung. Zu Extremsituationen gehört nicht nur ungeahntes Glücksgefühl.
Das Ausschlaggebende, das Besondere daran: Reinhold Messner hat es überlebt. Was hat diesen Mann überleben lassen? Erfahrung? »Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch ein Leben lang schlecht machen.« (Kurt Tucholsky)
Zu viele erfahrene Bergsteiger haben im Himalaja ihr Leben gelassen. Dass Messner Erfahrung hat und Wissen, mehr als jeder andere, ist Tatsache, reicht aber nicht aus, um seine Erfolge, sein Überleben zu erklären. Was den Menschen Messner auszeichnet, ist seine angeborene und eisern trainierte physische und psychische Kraft. Dazu kommt ein in vielen Jahren hoch entwickelter Instinkt, immer und vor allem in extremen, lebensbedrohlichen Lagen situativ das einzig Richtige, und das konsequent, zu tun.
Dass Messner der absolute Ausnahmebergsteiger ist, beweist seine Art bergzusteigen, sein Stil. Er ist spielerisch, lässt am Gelingen keinen Zweifel. Man spürt, dass ihm das Bergsteigen, die großen Herausforderungen im Himalaja, das Unterwegssein Spaß machen. Der Berg ist kein Gegner, eine Besteigung kein Kampf.
Hoch sensibilisiert ist Messners Gespür, wann, wo und wie eine große Unternehmung durchzuführen ist und unter Einschätzung aller Risiken auch gelingen kann.
Für die größte Herausforderung, der sich Reinhold Messner stellte, die Alleinbesteigung des Nanga Parbat, hat er von seinem ersten Versuch bis zur Vollendung volle sechs Jahre gebraucht. Sechs Jahre, aber dann war sie perfekt. Reinhold Messner wird um seine Erfolge beneidet. Nicht um seine Erfolge sollte man ihn beneiden, sondern um seinen Stil.
Günter Sturm
geschrieben im Herbst 1986
(Besteiger von vier Achttausendern)
Günter Sturm
Inzwischen ist auch das Höhenbergsteigen an den Achttausendern global geworden. Es hat seit 1950 die gleiche Entwicklung gemacht wie hundert Jahre früher das Alpenbergsteigen: Eroberung der Gipfel (1950–1964); Schwierigkeitsalpinismus (ab 1970); Verzichtsalpinismus (ab 1975); Pistenalpinismus (ab 1980). An den Achttausendern herrscht heute Tourismus vor.
1 – Nanga Parbat
8125 m
Der nackte Berg
Nanga Parbat
Allein an der Diamir-Flanke des Nanga Parbat gelangen Reinhold Messner drei Erstbegehungen. 1970 stieg er mit seinem Bruder Günther in etwa über die Mummery-Rippe ab. Beim Alleingang 1978 kletterte er rechts des großen Séracs hinauf und links davon ab. Die Kinshofer-Route (1962) führt links durch Rinnen und Schneefelder in die Mulde links des Gipfeltrapezes und über dieses zum höchsten Punkt.
1970/1978
Nanga Parbat – Himmel, Hölle, Himalaja
»Das wahre Ziel ist nicht, die äußerste Grenze zu erreichen, sondern eine Vollendung, die grenzenlos ist.«
Rabindranath Tagore
Bis 1969 war ich ein besessener Alpen-Bergsteiger gewesen. Ich war ganze Sommer lang nur geklettert. Das Geld, das ich dafür brauchte, verdiente ich mir als Bergführer. Dann und wann hielt ich auch einen Vortrag. Aber jede freie Minute verbrachte ich beim Training oder in irgendeiner schwierigen Alpenwand.
1968, als eine deutsche Expedition an der Rupal-Wand des Nanga Parbat gescheitert war, packte mich erstmals Begeisterung für diese Achttausender. 1969 gelang es mir, die schwierigste Wand der Ostalpen, die damals berüchtigte Philipp/Flamm-Verschneidung, während eines Unwetters allein zu durchsteigen. Auch die schwierigste Wand der Westalpen, die Droites-Nordwand, kletterte ich frei solo. Die Alpen waren zu klein für mich geworden. Dies war kein überhebliches Gefühl; es steckte die Sehnsucht dahinter, meine Grenze weiter auszudehnen, die Neugierde eines jungen, in vieler Hinsicht unerfahrenen Menschen. Wie weit ich noch gehen konnte?
In diesem Sommer 1970 stand die Rupal-Wand des Nanga Parbat auf Platz eins meines bergsteigerischen Wunschzettels. Allerdings wusste ich nicht, wie ich je dorthin kommen könnte. Als Südtiroler wurde ich weder als »deutscher« noch als »österreichischer« und auch nicht als »italienischer« Bergsteiger geführt. Ich wurde also von keiner Expeditionsgruppe angesprochen oder gar eingeladen. Im Frühling 1969 war ich zwar als Ersatzmann von einer Nordtiroler Expeditionsgruppe unter Leitung von Otti Wiedmann in die Anden nach Südamerika eingestellt worden, vorerst aber sah ich keine Möglichkeit, bei einer Achttausender-Expedition mitzukommen.
Ich hatte auch nicht die finanziellen Mittel, selbst eine Expedition auf die Beine zu stellen. Da gab es zwar von der Firma Millet aus Frankreich ein erstes Werbeangebot, mit der entsprechenden Jahrespauschale aber konnte ich weder mein Leben noch eine Expedition finanzieren. Ich arbeitete sehr viel.
Zum Glück gab es damals »Vorbilder«: Bergsteiger, die ihr Leben teilweise aus Werbeverträgen finanzierten. Einer von ihnen war Walter Bonatti. An ihm orientierte ich mich. Meinen ersten Werbevertrag ließ ich nach seinen Vorgaben ausarbeiten. Als mir Walter Bonatti sein letztes Bergbuch »Die großen Tage« mit den Zeilen widmete: »Für Reinhold Messner, der jungen, letzten Hoffnung des großen, klassischen Bergsteigens«, gab mir das viel Selbstvertrauen. Als Südtiroler hatte ich sonst auch emotional wenig Rückhalt. Wichtig war es, dass wir jungen Bergsteiger uns an Männern wie Bonatti auch praktisch orientieren konnten.
Der Himalaja erschien mir damals als ein Traum, eine Art Himmel für den Bergsteiger. Deshalb die Skepsis neben der Überraschung, als mich der deutsche Expeditionsorganisator Dr. Karl M. Herrligkoffer im Herbst 1969 zu einer Nanga-Parbat-Südwand-Expedition einlud. Er nannte sein Unternehmen »Siegi-Löw-Gedächtnisexpedition«. Traurig war ich nur, dass mein Bruder Günther, der mich bis dahin bei den meisten Erstbegehungen in den Alpen begleitet hatte, nicht auch mit von der Partie sein sollte. Nachdem aber Sepp Mayerl und Peter Habeler, die ebenfalls auf der Einladungsliste gestanden hatten, ausfielen, kam auch mein Bruder in die Mannschaft.
In einer ziemlich großen Expedition, mit erfahrenen deutschen und österreichischen Bergsteigern, kletterten Günther und ich im Mai und Juni 1970 etwa 40 Tage lang, mit Unterbrechungen, in der Südwand des Nanga Parbat. Meist waren wir an der Spitze der Gruppe. Wir kamen bis unter die Merkl-Rinne, an einen Punkt, den vor uns keine Mannschaft erreicht hatte. Öfter hatten uns Schlechtwetter und Lawinengefahr aus der Wand zurück ins Basislager getrieben. Einmal blieben Günther und ich mehr als eine Woche lang in der Wandmitte eingeschneit. Elmar Raab, Werner Heim, Gerhard Baur, Peter Vogler waren oft bei uns.
Wie oft hatten wir geglaubt, dass die Expedition scheitern würde. Schließlich sollte nach langer Diskussion mit dem Expeditionsleiter ein letzter Versuch gewagt werden. Günther, Gerhard Baur und ich stiegen noch einmal zum letzten Lager auf, wo Felix Kuen und Peter Scholz auf etwa 7300 Meter ein Zelt aufgestellt hatten. Von dort aus erreichten wir am 27. Juni, zuerst getrennt, im letzten Stück gemeinsam kletternd, den Gipfel des Nanga Parbat. Die Rupal-Wand, die höchste Fels- und Eiswand der Erde, war durchstiegen. Sicherlich hatten wir beide in der letzten Anstiegsphase die Grenze unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Wir waren in unserer jugendlichen Begeisterung weiter gegangen, als ich es heute tun würde.
Wir kamen spät zum Gipfel. Mein Bruder war sehr müde. Erste Zeichen der Höhenkrankheit stellten sich bei ihm ein. Beim Abstieg merkte ich, dass er nicht mehr weit kommen würde. Es wäre unverantwortlich, ja unmöglich gewesen, ihn in diesem Zustand die Rupal-Wand hinabzulotsen. Vor allem, weil wir kein Seil dabei hatten. Ich hätte Günther also nicht sichern können. Er wäre beim Abstieg gewiss irgendwo aus der Wand gefallen.
An diesem späten Nachmittag, bei aufkommendem Gewölk, entschloss ich mich kurzfristig, mit Günther ein Stück in die Westflanke abzusteigen, in die Scharte unmittelbar oberhalb der Merkl-Rinne. Von dort aus glaubte ich, am nächsten Tag in die Rupal-Wand zurückkehren zu können. In der Hoffnung, dass andere Bergsteiger aufsteigen würden, um uns zu helfen, warteten wir eine fürchterliche Nacht lang ab. Wir biwakierten in 8000 Meter Meereshöhe ohne jeden Schutz. Ohne Daunenjacke, ohne Sauerstoffgeräte, ohne zu trinken, ohne zu essen. Es war eine Nacht, die uns seelisch und körperlich aushöhlte.
Am anderen Morgen sah ich kaum noch eine Chance, irgendwohin zu gehen, geschweige denn, bis an den Fuß des Berges zu gelangen. Nachdem wir etwa bis 10 Uhr vormittags gewartet hatten und erkennen mussten, dass Peter Scholz und Felix Kuen nicht zu uns, sondern zum Gipfel unterwegs waren, begannen wir in unserer Verzweiflung den Abstieg über die Diamir-Seite des Nanga Parbat. Ich war dem Wahnsinn nahe. Es war in diesem Augenblick, als ich hinfiel und mein Geist sich über den Körper erhob. Ich sah mich von außen den Berg hinabrollen. Noch einmal hatte ich die Energie, zurückzugehen in meinen Körper, ich musste den Bruder in Sicherheit bringen.
Die Diamir-Wand ist flacher als die Rupal-Wand. Von oben gesehen erschien sie machbar. Dabei war für uns das erste Stück ein momentaner Ausweg aus der Todessituation. Ich hätte das Sterben in Untätigkeit nicht ertragen können. Wir wollten wenigstens einen letzten, verzweifelten Versuch machen, ein Stück den Berg hinunterzukommen. Bis Mitternacht mühten wir uns ab. Immer wieder wartete ich auf Günther, um ihn zwischen Séracs und den Felsen der Mummery-Rippe hinunterzuleiten.
Am dritten Tag dieses qualvollen Abstiegs – wir waren schon weit unten im flacheren Gletscher, und ich ging voraus, um nach dem Weg zu suchen – kam Günther nicht mehr nach. Erst als ich zurückging und die große Lawine sah, die inzwischen abgegangen war, ahnte ich, dass er darunter begraben liegen musste, dass ich allein war. Aber ich konnte nicht begreifen, dass er tot war. Er, der mich auf Hunderten von schweren Routen begleitet hatte, er sollte nicht mehr mit mir zusammen sein! Mit ihm hatte mich das Gefühl verbunden, gemeinsam unverwundbar zu sein. Warum ließ er mich auf diesem Weg durch Felsen, Eisbrüche und Hochtäler allein?
Die direkte Route in der Rupal-Flanke des Nanga Parbat. Nach wiederholten Versuchen (1963–1968) gelang den Messner-Brüdern Reinhold und Günther erstmals der Aufstieg bis zum Gipfel, nachdem fünf Hochlager (C) errichtet worden waren. Den Abstieg mussten sie nach einem Biwak an der Merkl-Scharte (B1) über die Gegenseite des Berges (Diamir-Flanke) nehmen. Erst 35 Jahre später gelang es Koreanern, diese Route erstmals zu wiederholen.
Einen Tag und eine Nacht lang suchte ich nach ihm. Mitten in dieser gigantischen Gletscherwelt zwischen den Eistrümmern, ausgedörrt, mit Erfrierungen an Händen und Füßen erlebte ich erstmals den Wahnsinn. Ich wusste nicht mehr, wer ich war, noch was ich tat. Ich konnte kaum noch gehen. Trotzdem setzte ich meinen Abstieg fort, kroch abwärts. Als ich zu Holzfällern kam, die mir den Weg ins Tal zeigten, erwachte ich aus einer Gleichgültigkeit, wie sie dem Sterben vorausgeht.
Überlebt – die Überschreitung des Nanga Parbat
In den letzten Jahren glänzte ein neuer Kletterstern über den Dolomiten auf. Er erregte zunehmend Aufsehen. Der »Reinhold« wurde zu einem Begriff. Immer verwegener wurden seine Felsfahrten. Er meisterte allerschwierigste Führen im Alleingang, legte als Einzelgeher erste, direkte Routen mit dem Schwierigkeitsgrad »äußerste obere Grenze« durch glatteste Plattenmauern, bezwang mit Seilgefährten große »Sechser«-Wände in Wintererstbegehungen.
Er übertraf alle bisherigen Höchstleistungen, unterbot alle üblichen Kletterzeiten. Vollendetste Beherrschung der Technik des freien Kletterns, Ruhe in der Gefahr, vorausschauende Planung und Überlegtheit in der Durchführung seiner Unternehmungen zeichneten ihn aus. Für Reinhold Messner schien es keine Schwierigkeiten mehr im Fels zu geben. Ein Klettergenie. Vielleicht nur ein Felsakrobat…?
Messner kam in die Westalpen und stellte auch dort alles auf den Kopf mit kürzesten Begehungszeiten. Er wies sich damit als ebensolcher Könner im steilsten Eis und kombinierten Gelände aus wie vorher im Fels. Mit einer außerordentlichen Härte und Durchschlagskraft, mit schier unerschöpflichen Kraftreserven.
Bruder Günther begleitete ihn auf manch ernster Fahrt, als gleichfalls ausgezeichneter, ausdauernder Fels- und Eisgeher, der vielleicht bloß ein wenig »im Schatten seines großen Bruders« stand.
Messner fehlte noch die Bewährung auf Expeditionen, an den Weltbergen. 1970 durchstieg er die Rupal-Wand am Nanga Parbat!
Reinhold Messner hat die bisherigen Grenzen alpinistischen Könnens gesprengt und neue Maßstäbe gesetzt. Ein überragendes Bergsteigerphänomen! Dabei ist er beileibe kein robuster, muskelstrotzender Holzfällertyp. Sondern sensibel, schlank, feingliedrig, dennoch durchtrainiert bis in die letzte Faser. Dem Körperbau nach eher ein Hermann Buhl. Auch Reinhold ist von einem inneren Feuer getrieben, schöpft die Kräfte zu seinen Unternehmungen mehr aus seelischen Bereichen.
Der eigentliche Schlüssel zu seiner fast unglaublichen Leistungsfähigkeit, seiner Höhenanpassung liegt aber in seinem systematischen autogenen Training, in den jogamäßigen Übungen zur Unterwerfung von Körperfunktionen unter seinen stahlharten Willen. Ein Bergsteiger-Jogi! Dazu rationellster Krafteinsatz, gesteuert durch einen ungewöhnlich scharfen Verstand.
Die Rupal-Flanke des Nanga Parbat, die höchste Steilwand der Erde. 1938 hatte ich sie, vom Firngrat zum Silbersattel aus, tagelang vor Augen gehabt. Im Profil gesehen, ein fast unirdisch gewaltiger, 4500 Meter hoher Pfeiler aus Fels und Eis. Er galt uns als Inbegriff der Unersteigbarkeit. Ich war damals als Vertreter Tirols Mitglied der Expedition der Deutschen Himalaja-Stiftung, die von Paul Bauer über die Rakhiot-Seite geführt wurde. Eine Gruppe von uns rekognoszierte anschließend noch die Diamir-Flanke. Wir anderen umkreisten nachher per Flugzeug den Nanga, schwebten an der Südwand vorbei, hinein in das Diamir-Tal, sahen unter uns zum Greifen nah die legendäre Mummery-Rippe. Daheim studierten wir die Flugaufnahmen, Pläne für 1940 wurden geschmiedet. Aber da war schon der Zweite Weltkrieg ausgebrochen.
Der nunmehr geglückte Aufstieg durch die Rupal-Wand darf wohl als der bisher kühnste und vielleicht auch schwierigste an einem Achttausender betrachtet werden…
Reinhold und Günther Messner stiegen erstmals vom Gipfel eines Achttausenders – anschließend an die Erstbegehung seiner schwierigsten Wand – auf der anderen Seite über eine 3500 Meter hohe, noch nie bezwungene Eis- und Felsflanke ab. In ein fremdes, menschenleeres Gletschertal. Auf sich allein gestellt, ohne dass sie unten von einer Lagerkette aufgenommen, von helfenden Freunden erwartet werden konnten. Eine Pioniertat, wie sie die Chronik des Himalaja nicht kennt!
Mathias Rebitsch
in der »Tiroler Tageszeitung« vom 5.9.1970
(Expeditionsteilnehmer 1938 am Nanga Parbat)