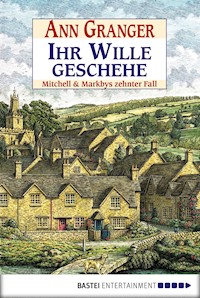4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Lange Zeit hat Fran Varady nichts mehr von der schrulligen Stadtstreicherin Edna gehört, die sie von früher kennt und die mit wilden Katzen auf einem Friedhof lebte. Doch dann kreuzt sie unvermittelt wieder ihren Weg. Inzwischen wohnt Edna in einem Heim, verbringt ihre Tage allerdings wie früher, indem sie planlos durch die Gegend streift. Scheinbar - denn Fran glaubt, eine Methode in ihrem Wahnsinn zu erkennen. Sie ist sich sicher, dass Edna verfolgt wird, und will der Frau helfen. Doch niemand glaubt ihr. Bis ein Mord geschieht ...
ÜBER DIE REIHE: Fran Varady ist eine junge mittellose Schauspielerin in London. Eigentlich ist sie auf der Suche nach einem Job - stattdessen gerät sie immer wieder in Verbrechen hinein. Daher ermittelt sie nebenbei als Privatdetektivin ohne Lizenz und klärt mit ihrer optimistischen und zupackenden Art eine ganze Reihe von Mordfällen auf.
Eine Wohlfühl-Krimi-Reihe mit einer starken und ungewöhnlichen Protagonistin: Ann Granger bietet mit der Fran-Varady-Serie Spannung ohne Gemetzel und Blutvergießen, dafür mit sympathischen Figuren und typisch englischem Flair.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der Autorin bei beTHRILLEDÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED
Die Cosy-Krimireihe mit Fran Varady:
Band 1: Nur der Tod ist ohne Makel
Band 2: Denn umsonst ist nur der Tod
Band 3: Die wahren Bilder seiner Furcht
Band 4: Dass sie stets Böses muss gebären
Band 5: Und hüte dich vor deinen Feinden
Band 6: Denn mit Morden spielt man nicht
Außerdem sind von Ann Granger folgende Krimireihen bei Bastei Lübbe lieferbar:
Mitchell & Markby
Martin & Ross
Jessica Campbell
Über dieses Buch
Lange Zeit hat Fran Varady nichts mehr von der schrulligen Stadtstreicherin Edna gehört, die sie von früher kennt und die mit wilden Katzen auf einem Friedhof lebte. Doch dann kreuzt sie unvermittelt wieder ihren Weg. Inzwischen wohnt Edna in einem Heim, verbringt ihre Tage allerdings wie früher, indem sie planlos durch die Gegend streift. Scheinbar – denn Fran glaubt, eine Methode in ihrem Wahnsinn zu erkennen. Sie ist sich sicher, dass Edna verfolgt wird, und will der Frau helfen. Doch niemand glaubt ihr. Bis ein Mord geschieht …
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit ihrer Mitchell-und-Markby-Reihe. Daneben gibt es von Ann Granger noch folgende weitere Reihen: Die Fran-Varady-Reihe, die Jessica-Campbell-Reihe und Kriminalromane im viktorianischen England mit Lizzie Martin und Benjamin Ross.
ANN GRANGER
UND DAS EWIGE LICHT LEUCHTE IHR
FRAN VARADYS SIEBTER FALL
Aus dem britischen Englisch von Axel Merz
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »Rattling the Bones«
Originalverlag: Headline Book Publishing, a division of Hachette Livre UK Ltd, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2008/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung eines Motives © Owen Franken/CORBIS
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7567-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Meinem geliebten Ehemann … seit vierzig Jahren!
Kapitel 1
Ich wurde mehr oder weniger von meiner verstorbenen Großmutter aufgezogen, Erszebet Varady. Meine Mutter ging eines Tages aus dem Haus, als ich sieben Jahre alt war, und blieb für vierzehn Jahre verschwunden. Großmutter war das, was man einen prägenden Einfluss nennt. Ich lernte, guten Kaffee zu mögen und scharfes Gulasch, mich niemals auf einer öffentlichen Toilette auf den Sitz zu setzen und mich vor Personen in Uniform zu hüten, gleich welchen Geschlechts. Großmutter Varady wusste wie einer der alten Schamanen Vorzeichen zu deuten. »Manchmal, wenn sich Unheil zusammenbraut, bleibt einem nichts anderes übrig, als wegzulaufen«, pflegte sie philosophisch zu sagen. Es wäre eine gute Sache gewesen, hätte ich ihren Instinkt in dieser Hinsicht geerbt, doch schlimme Situationen hatten auf mich schon immer eine verhängnisvolle Anziehungskraft. Je schwieriger die Umstände, desto größer mein Verlangen, mich einzumischen. Es ergibt nicht den geringsten Sinn. Es ist, was Dramatiker einen fatalen Fehler nennen.
Großmutter hatte lebhafte eigene Erfahrungen mit dem Weglaufen vor schlimmen Situationen – sie war in der Folge der Aufstände von 1956 mit nichts als ihrem Baby (meinem Vater) im Arm aus Ungarn geflüchtet. Sie hatte auch meinen Großvater dabei, doch er erholte sich unpassenderweise gerade von einer schweren Grippe und war keine große Hilfe. Immer wieder gaben seine Knie in ungünstigen Augenblicken nach. Meine Großmutter äußerte oft die Meinung, dass keine Situation so schwierig sei, dass ein männlicher Varady sie nicht noch verschlimmern könnte.
Trotz der Tatsache, dass mein Großvater selbst Arzt gewesen war, hatte er sich keiner besonders robusten Gesundheit erfreut. Er starb bereits vor meiner Geburt. Ich besitze ein Foto von ihm, aufgenommen, als er vielleicht dreiundzwanzig war, so alt, wie ich heute selbst bin. Es ist ein professionelles Porträt, aufgenommen in Budapest in einem Studio, dessen Einrichtung sich wahrscheinlich seit den Tagen von Franz Josef nicht geändert hatte. Mein Großvater posiert mit einem Arm auf einem griechischen Säulenstumpf und den anderen schneidig in die Hüfte gestemmt. Er blickt schräg in die Kamera und stellt ein leichtes Grinsen zur Schau, als könnte er sich nicht entscheiden, ob er lächeln soll oder nicht. Oder vielleicht lag es auch nur daran, dass er zufrieden war mit seinem Aussehen. Er trägt ein einreihiges Sakko, dessen mittlerer Knopf geschlossen ist. In der Brusttasche steckt ein kunstvoll gefaltetes Taschentuch, und am gegenüberliegenden Revers steckt eine Nelke. Sein Hemdkragen sieht so eng aus, als würde er ihm die Luft abschneiden, und unter dem Kragen trägt er eine gestreifte Fliege. Außerdem hat er einen gepflegten kleinen Schnurrbart, und aus irgendeinem Grund trägt er einen Hut.
Dieses Porträt thronte während meiner gesamten Kindheit stolz auf unserem Kaminsims. Ich bemerkte recht früh, dass mein Vater (der vor ungefähr zehn Jahren starb) ihm sehr ähnlich sah. Das heißt, abgesehen von der Nelke und dem Hut. Mein Vater war ebenfalls keine große Hilfe in einem Notfall. Nachdem meine Mutter uns hatte sitzen lassen, blieb er zwar körperlich anwesend, doch geistig war er mit ihr weggegangen. Im Verlauf einer Serie von Gelegenheitsarbeiten, die er ausnahmslos mit großer Begeisterung angefangen hatte, nur um kurze Zeit später resigniert wieder aufzugeben, hing er einfach zu Hause herum. Er war ein netter Mann, warmherzig und freundlich, doch in Wirklichkeit keine große Hilfe. Es war schon immer Sache der Varady-Frauen gewesen, sich um alles zu kümmern und Probleme zu lösen. Ich frage mich manchmal, ob es die Erkenntnis war, dass sie die gesamte Last ihrer Ehe würde tragen müssen, die dazu geführt hat, dass meine Mutter aufgab, auch wenn ich nicht die leiseste Ahnung habe, warum sie letztendlich ging. Bei den wenigen Treffen, die wir viele Jahre später hatten, sprach sie nicht darüber, und ich fragte nicht. Sie ist inzwischen ebenfalls tot, genau wie Großmutter. All diese Fragen hängen unbeantwortet in der Luft … mitgenommen in die Gräber, wie die Viktorianer zu sagen pflegten. Einige Menschen versuchen, alte Geheimnisse aufzudecken. Sie klappern mit den Knochen und hoffen, dass irgendeine Erkenntnis zum Vorschein kommt. Ich habe so etwas nie getan.
Allerdings habe ich mich – und vielleicht ist das der Grund, obwohl es immer meine Absicht war und bis heute geblieben ist, eines Tages meinen Lebensunterhalt als Schauspielerin zu verdienen – in letzter Zeit als eine Art Teilzeit-Detektivin betätigt. Möglicherweise hat die bereits erwähnte hohe Todesrate meiner wenigen Verwandten damit zu tun. Sie führte dazu, dass ich bereits mit sechzehn Jahren allein auf der Welt und heimatlos geworden war. Mein Schauspielunterricht fand damals ein abruptes Ende. Doch ich habe noch eine andere Theorie.
Von Kindheit an habe ich stets auf eigene Faust herausfinden müssen, was rings um mich herum vorging. In meiner Familie wurde ein Kind geliebt, ernährt und gut erzogen, doch es wurde nicht in wichtige Diskussionen einbezogen. Niemand erklärte mir, wohin meine Mutter gegangen war, abgesehen von einer erbärmlichen Ausrede von irgendeinem »Urlaub«, die niemanden genarrt hätte, ganz zu schweigen von einer Siebenjährigen mit dem klaren, logischen Verstand eines Kindes. Mein Vater und meine Großmutter zusammen mit der bunten Schar von Besuchern, die immer wieder an unserer Tür auftauchten, tauschten Informationen von sensitiver Natur vermittels Blinzeln und Blicken und unmerklichem Nicken aus. Und wenn es einmal notwendig wurde zu reden, steckten sie in der Küche die Köpfe zusammen und redeten ganz aufgeregt auf Ungarisch miteinander, das Vater und Großmutter mich zu lehren versäumt hatten. Ich hatte immer geglaubt, es wäre nur ein Versehen gewesen, dass sie mich die Sprache meiner Vorfahren nicht gelehrt hatten. Heute frage ich mich, ob es damals nicht gerissene Schläue war.
Das Resultat von alledem jedenfalls war, dass ich früh lernte, auf Indizien zu achten. Ich schlich durch die Wohnung auf der Suche nach verräterischen Stücken Papier und hielt die Ohren auf, wenn Anrufe kamen. Ich studierte den Ausdruck auf den Gesichtern meines Vaters und meiner Großmutter, wenn sie sich unbeobachtet glaubten. Ich durchsuchte Schubladen, wenn ich allein zu Hause war. Einmal fand ich einen richtigen Schatz alter Fotografien. Ich ging sie alle durch auf der Suche nach einem Bild mit meiner Mutter darauf, doch sie war auf keiner einzigen Aufnahme zu sehen. Und wieder weiß ich bis zum heutigen Tag nicht, ob dies ein Zufall war oder ob irgendjemand die Schnappschüsse von ihr aussortiert und ins Feuer geworfen hatte. Niemand klärte mich je auf, und selbstverständlich wagte ich nicht zu fragen. Ich hätte sowieso nur eine Ausflucht zur Antwort erhalten anstatt der unverblümten Wahrheit.
Alte Fotografien faszinieren mich seither ununterbrochen. Sie öffnen ein fesselndes Fenster in die Vergangenheit. Die Silhouettenbilder ebenfalls, welche die Leute gemacht haben, bevor es Kameras gab. Ich habe brillante Exemplare in Antiquitätengeschäften gesehen. Auch wenn keine Gesichtszüge erkennbar sind, bin ich sicher, dass die abgebildeten Personen unverkennbar waren – zumindest für diejenigen aus dem persönlichen Umfeld. Gesichter sind nicht das Einzige, woran andere Menschen uns erkennen. Körpersprache ist individuell, eine Angewohnheit wie das Drehen einer Haarlocke um den Finger oder auch nur eine bestimmte Haltung beim Stehen. Manche Menschen kann man schon aus großer Entfernung erkennen, und zu jenen gehörte auch Edna, die alte Stadtstreicherin.
Edna und ich waren früher für eine Weile sozusagen Nachbarn gewesen. Ich hatte damals in Rotherhithe in einem besetzten Haus gewohnt und Edna auf einem verlassenen Kirchhof ganz in der Nähe mit einer Familie verwilderter Katzen als Gesellschaft.
Die eingangs geschilderten Ereignisse hatten dazu geführt, dass ich zur Hausbesetzerin geworden war, und ich nehme an, dass irgendeine andere Unbill des Schicksals Edna in die Welt der richtigen Obdachlosen geführt hatte. Sie gehörte zu jenen, die durch sämtliche Löcher in den Maschen des sozialen Netzes gefallen waren, entweder absichtlich oder durch schlichte Unachtsamkeit von Seiten der Behörden. Eine Angehörige des verlorenen Stammes, abgetrieben vom Ufer des Normalen, um alleine zu schwimmen oder unterzugehen, wenn schon nicht der Fürsorge der Gemeinde anvertraut, was im Endeffekt oftmals nur wenig besser ist.
Vor nicht allzu langer Zeit ermöglichte mir eine Laune des Schicksals den ersten Schritt aus dieser verlorenen Welt und dem besetzten Haus in Rotherhithe. Die Stadtplaner in ihren modernen, hellen Büros hatten entschieden, dass wir alle dem Fortschritt und der Stadtteilsanierung zu weichen hatten, ohne Rücksicht darauf, wohin wir gingen. Die Häuser in der Jubilee Street und den umgebenden Straßen fielen mitsamt Ednas Kirchhof den Bulldozern der Baukonzerne zum Opfer, und unsere Wege trennten sich. Ich lebte seither vergleichsweise komfortabel, doch bis zu jenem Morgen hatte ich nicht die geringste Ahnung, wohin Edna gegangen war oder ob sie überhaupt noch »bei uns« war, wie meine Großmutter Varady immer zu sagen pflegte. Die Menschen sprachen sehr vorsichtig über den Tod in unserem Haus, als würde sich so etwas bei anständigen Familien nicht ereignen. Ein weiteres der vielen Probleme, die ihnen bei ihrer Auseinandersetzung mit der Realität zu schaffen machten.
Edna mochte damals in den Rotherhithe-Tagen »bei uns« gewesen sein, doch sie war niemals ganz »bei sich«. Ihr Geist war bereits weitergezogen auf eine Ebene, die niemand von uns anderen zu erreichen oder begreifen vermochte. Wir nannten sie wenig freundlich die »verrückte alte Edna«, was nicht nur gefühllos, sondern schlichtweg falsch war. Wenn Ednas Verstand nicht arbeitete wie der von anderen Menschen, dann lag es daran, dass sie es so wollte. Sie war nicht krank; sie hatte sich für dieses Leben entschieden. Eine kleine Gestalt, die von Grabstein zu Grabstein huschte wie eine Krabbe auf den Felsen. Sie war mir stets unglaublich alt erschienen, auch wenn ihr richtiges Alter angesichts der zahlreichen Schichten von Kleidung, die sie trug, und ihrer Vorliebe für tief in die Stirn gezogene Wollhüte über widerspenstigen grauen Locken schwer zu schätzen war.
Ich hatte wirklich geglaubt, ich würde Edna niemals wiedersehen – doch da stand sie, ohne den Hauch eines Zweifels, und eierte die Camden High Street hinauf in Richtung U-Bahn-Station. Ihr Gang war stets genauso unverkennbar gewesen wie der ganze Rest. Sie bewegte sich zugleich seitwärts und vorwärts. Ich mag es nicht »watscheln« nennen, weil Watscheln ein beträchtliches zu bewegendes Gewicht vermuten lässt. Ednas Leibesumfang war durch ihre Kleidung verursacht, nicht durch Fettleibigkeit, und sie war flink und leicht auf den Füßen. Sie verlagerte ihr Gewicht geschickt von einer Seite auf die andere, um anschließend den unbelasteten Fuß ein paar Zoll nach vorn zu schieben, bevor sich der Vorgang mit dem anderen Fuß wiederholte. Es war eine Art Hüpfen, fast wie ein Tanzschritt. Ich hatte einmal einen Spielzeugclown, der auf die gleiche Weise durch unser Wohnzimmer sauste, bis jemand auf ihn getreten war.
Ich trabte aufgeregt los und hatte sie rasch eingeholt. »Edna!«, rief ich. »Warte! Ich bin es, Fran!«
Sie behielt den Kopf mit dem Wollhut unten und ließ sich durch nichts anmerken, ob sie mich gehört hatte oder nicht. Das war normal. Edna hat es nie gemocht, dass man ihr hinterherruft. Sie zog es vor, den Augenblick der Kontaktaufnahme selbst zu bestimmen, und pflegte – in den alten Tagen – auf beunruhigende Weise hinter schiefen Grabsteinen hervorzuspringen, um ihrem Gegenüber einen ziemlich heftigen Schrecken einzujagen, wie die solcherart Behandelten sich hinterher häufig beschwerten. Nun erwiderte ich diesen Gefallen, indem ich ihr direkt in den Weg sprang und sie auf diese Weise zum Stehenbleiben zwang. Ich bin nicht groß, doch Edna war noch viel kleiner, und ihr Wollhut reichte mir kaum bis ans Kinn.
»Komm schon, Edna«, redete ich auf sie ein. »Du erkennst mich wieder, ganz bestimmt.«
Sie unternahm keinen Versuch, sich an mir vorbeizuschieben, und ich war sicher, dass sie mich verstanden hatte. Doch sie schwieg beharrlich und stand mürrisch und mit eingezogenem Kinn da.
»Ich bin es, Fran«, wiederholte ich an die Adresse der schmuddeligen Wollmütze unter meinem Kinn. »Fran Varady. Ich hab in dem besetzten Haus in Rotherhithe gewohnt, du erinnerst dich? In dem Haus in der Jubilee Street, wo dieses junge Mädchen ermordet wurde.«
Es war reines Pech, dass in diesem Moment zwei Touristen vorbeikamen. Außerdem war Edna stets ein wenig schwerhörig gewesen oder hatte so getan, als ob, daher hatte ich laut und sehr vernehmlich gesprochen.
Die Touristen starrten mich entsetzt an und eilten weiter.
Endlich jedoch reagierte Edna. »Nein«, murmelte sie. Sonst nichts.
»Doch, Edna, du erinnerst dich. Komm schon, stell dich nicht so an, okay?«
Sie änderte ihre Meinung. Sie blickte zu mir auf, und in ihren tiefliegenden Augen glitzerte so etwas wie Schalk. »Ja, Fran. Selbstverständlich erinnere ich mich an dich, meine Liebe. Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun?«
Ihre Stimme war stets außergewöhnlich gewesen. Vollkommen unpassend zu ihrem heruntergekommenen Äußeren. Sie war tief und voll und wunderbar moduliert, ohne den geringsten Zweifel vornehm. Richtig vornehm, meine ich, nicht aufgesetzt. Ich habe eine Ausbildung als Schauspielerin hinter mir, und ich kenne mich aus mit Stimmen. Wenn man Edna reden hörte, war sie plötzlich keine ältere, heruntergekommene Stadtstreicherin mehr. In den alten Tagen in Rotherhithe hatte ich erlebt, wie Bullen, die sie von ihrem Kirchhof hatten vertreiben wollen, augenblicklich ihre Haltung und ihren Tonfall geändert hatten, sobald Edna zu ihnen gesprochen hatte.
Ich bin immer noch Schauspielerin, nur am Rande bemerkt. Ich mag zurzeit ohne Engagement sein und die Zeit mit dem einen oder anderen Gelegenheitsjob und ein wenig Ermittlungsarbeit ausfüllen, doch ich habe meinen Traum nicht aufgegeben.
»Du musst überhaupt nichts für mich tun, Edna«, antwortete ich nun. »Ich wollte nur Hallo sagen und dass ich mich freue, dich zu sehen.« Ich bemerkte, dass sie keine Tüten bei sich trug. »Wo wohnst du jetzt?«, wollte ich wissen.
»In einem Wohnheim!«, antwortete Edna voller Abscheu. »Sie haben mich in ein Wohnheim gesteckt! Zuerst brachten sie mich in ein Heim voller alter Leute, die nichts weiter taten, als vor einem Fernseher zu sitzen. Das elende Mistding flimmerte den lieben langen Tag vor sich hin, dass es in den Augen schmerzte, und es plärrte seinen Unsinn so laut in die Welt hinaus, dass man hätte taub werden können. Stell dir vor, einige der alten Leute waren schon taub, und die anderen haben die ganze Zeit über vor dem Kasten geschlafen. Ich wäre unter keinen Umständen dort geblieben, das habe ich ihnen gleich gesagt. Also brachten sie mich in dieses Wohnheim. Es ist nicht besser als das Altersheim, bis auf die Tatsache, dass man nicht den ganzen Tag vor diesem elenden Kasten sitzen muss. Aber die Hälfte der Leute im Wohnheim ist verrückt, und Haustiere sind auch nicht gestattet! Ich brauche keine Leute. Ich mag die Menschen nicht. Ich mag Tiere.«
Die letzten Worte stieß sie vehement hervor.
»Das tut mir leid«, sagte ich. »Ich schätze, du vermisst deine Katzen.«
»Sie haben sie weggenommen.« Edna war jetzt in voller Fahrt, aufgepeitscht durch die Erinnerung an vergangene Empörung. Sie fuchtelte mit den Händen und scharrte frustriert mit den Füßen und sah aus wie ein ölverschmierter, gestrandeter Vogel an einem von einer Ölpest heimgesuchten Strand, der verzweifelt und ohne Erfolg versucht, sich in die Luft zu schwingen.
»Etwas, das sich Katzenwohlfahrt schimpft, hat sie bei sich aufgenommen. Nachdem die armen Tiere über den ganzen Kirchhof gejagt, eingefangen und in hässliche kleine Kästen gesteckt wurden. Was ist daran Wohlfahrt, frage ich dich? Die Tiere wurden aus ihrem Zuhause gerissen, und sie haben sie mir weggenommen.« Sie stellte ihre Bemühungen zur Levitation ein und richtete die verblassten Augen mit verschwörerischem Glitzern auf mich. »Weißt du, was sie mit den Katzen gemacht haben? Eingeschläfert haben sie sie. Ermordet haben sie sie!«
»Vielleicht wurden sie nur umgesiedelt?«, schlug ich vor.
Edna bewies in diesem Moment, dass es ein Unterschied war, ob man in einem Paralleluniversum lebte oder nicht alle Tassen im Schrank hatte. »Die jungen Katzen umgesiedelt, vielleicht«, sagte sie streng. »Die älteren ganz bestimmt nicht. Es waren keine Hauskatzen, sie waren daran gewöhnt, frei umherzustreifen, und sie waren zu alt, um sich noch zu ändern.«
»Richtig«, sagte ich.
Ich war froh, dass sie unter dieser geschickten Tarnung so scharfsinnig war wie eh und je. Ich bezweifelte, dass ihr Verstand noch so gut funktioniert hätte, wenn sie in diesem Altersheim geblieben wäre und Stunde um Stunde vor dem plärrenden Fernseher verbracht hätte. Das Leben im Wohnheim mochte ihr nicht besonders schmecken, doch auf gewisse Weise hatte es ihr zum Vorteil gereicht. Sie war entschieden sauberer, die Haut rosig und gewaschen, die Kleidung abgerissen, doch nicht stinkend, und ihr allgemeiner Zustand schien besser.
Sie stieß ein unerwartetes Gackern aus, ihre Art von Gelächter. »Sie haben mich umgesiedelt, das haben sie getan. Genau wie die Katzen. Aber ich bin keine junge Katze mehr. Ich bin eine von den alten, zu alt, um mich noch zu ändern.«
Sie schüttelte den Kopf und blickte erneut böse drein. »Ich hänge nicht in diesem Wohnheim rum. Es stinkt ständig nach gebackenen Bohnen. Ich verbringe meine Tage draußen an der frischen Luft. Genau wie ich es immer getan habe«, schloss sie zufrieden.
Doch das war offensichtlich nicht ganz die Wahrheit. Vor ein oder zwei Jahrzehnten musste sie ein anderes Leben geführt haben. Ich fragte mich, wie viel davon sie bewusst unterdrückt hatte und an wie viel sie sich noch erinnerte. Doch sie war noch nicht fertig mit ihrer Rede.
»Sie haben sogar den alten Kater mitgenommen«, kehrte sie zum Katzenthema zurück. »Er hat ihnen eine fröhliche Jagd geliefert, bevor sie ihn mit einem Stück Fleisch in die Falle gelockt haben. Ich hoffe nur, er hat sie alle tüchtig zerkratzt und gebissen. Er hatte scharfe Krallen, und seine Zähne waren sehr spitz und stark. Er konnte Mäuseknochen zerkauen, als wäre es Gelee.« Ihr Gesichtsausdruck wurde sehnsüchtig. »Aber er ist kämpfend untergegangen. Vielleicht hätten sie mich zusammen mit ihm einschläfern sollen.«
»Ich hab jetzt eine Wohnung«, verriet ich ihr. Ich bemühte mich, so freundlich zu klingen wie nur möglich, weil sie mürrisch und immer noch aufgebracht wegen ihrer Katzen war. »Sie befindet sich in einem Haus, das einer wohltätigen Stiftung gehört. Es ist eine Stiftung, die Leuten wie mir günstig Wohnungen vermietet. Es gibt sieben Wohnungen in diesem Haus und eine Art Garten nach hinten. Es ist wirklich hübsch. Komm doch mal vorbei, und besuch mich.«
»Vielleicht lasse ich meine Karte da«, sagte Edna abwesend, indem sie in jene parallele Welt hinüberdriftete oder zumindest den Anschein erweckte. Es war ihre Art, einer Einladung eine Absage zu erteilen. Dann kehrte sie überraschend wieder in die Gegenwart zurück. »Wie geht es deinem jungen Mann?«
»Du meinst Ganesh?«, fragte ich. »Er ist nicht mein junger Mann. Er ist ein Freund. Es geht ihm sehr gut. Er arbeitet inzwischen bei seinem Onkel, in einem Zeitungsladen.«
Ganeshs Eltern hatten in Rotherhithe einen Obst- und Gemüseladen gehabt und waren auf die gleiche Weise wie wir anderen alle vertrieben worden. Sie waren nach High Wycombe gezogen. Ganesh war zurückgelassen worden und in die Dienste eines anderen Familienmitglieds getreten, in einem anderen Geschäft. Ich weiß, dass Ganesh nicht darüber erfreut ist, auf diese Weise in der Familie herumgereicht zu werden, doch er scheint gleichzeitig nicht imstande zu sein, sich von ihr zu lösen. All das steht unter dem Kapitel Dinge, über die Ganesh nicht reden will.
»Ich war auch schon einmal verlobt«, sagte Edna im leichten Konversationston.
Obwohl ich an die scheinbar willkürlichen Sprünge gewöhnt war, die Edna vollführte, während sie dachte und redete, kam dies so unerwartet, dass ich einen Schritt zurück machte und mich auf der Stelle fragte, ob ich denn recht gehört hatte. Edna hatte bisher nie persönliche Informationen preisgegeben oder auch nur eine Andeutung gemacht, ob ihr früheres Leben irgendetwas für sie bedeutete oder ob sie auch nur eine Erinnerung daran hatte.
Ich musterte sie von oben bis unten, studierte sie eingehender. Es war unmöglich zu sagen, wie sie früher ausgesehen haben mochte. Sie besaß ein rundliches Gesicht, doch ihr Kinn war spitz. »Herzförmig« nennt man so ein Gesicht. Nur dass sich in Ednas Fall alles ein wenig gesenkt hatte. Ihre Augenbrauen waren ausgefallen und existierten nur noch in Form vereinzelter grauer Haare. Dafür waren ihr am Kinn neue Haare gewachsen. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen, die Lider waren schwer, die Wimpern waren den Augenbrauen gefolgt. Trotzdem bemerkte ich zum ersten Mal, dass ihre Haut sehr fein war, wie ein Stück zerknitterte Seide. Vielleicht war sie früher einmal ein hübsches Ding gewesen mit herzförmigem Gesicht, makelloser Haut und langen Wimpern, und ein Mann hatte sich in sie verliebt.
Sie runzelte die Stirn. Ich dachte zuerst, dass sie meine Neugier als aufdringlich und unhöflich betrachtete, doch es lag daran, dass sie in ihren Erinnerungen kramte.
»Ich glaube, das war ich. Ich glaube wirklich, das war ich«, sagte sie weniger sicher als zuvor. »Aber ich frage mich, mit wem?«
Ihr Blick ging an mir vorbei und wurde unvermittelt scharf. Ihre Haltung wirkte mit einem Mal angespannt, und Panik huschte über ihre Gesichtszüge. In ihren Augen glänzte Furcht, und ihr Blick zuckte hierhin und dorthin wie bei einem in die Enge getriebenen Tier.
»Ich muss los«, sagte sie.
Sie machte einen Schritt zur Seite und überraschte mich mit der Geschwindigkeit, mit der sie an mir vorbeihuschte. Ich sprang hinter ihrer flüchtenden Gestalt her und packte sie beim Arm.
»Edna? Was ist denn los? Stimmt etwas nicht?«
»Ich kann nicht bleiben«, sagte sie ärgerlich. »Lass mich los!«
Sie wand sich aus meinem Griff und wandte sich zur Flucht. Sie bahnte sich einen Weg durch die Menschenmengen wie ein verrückt gewordener Maulwurf, bog um die Ecke, wo die Kentish Town Road auf die Camden High Street trifft, und watschelte die Kentish Town Road hinunter, bis sie im Verkehr und zwischen den Fußgängern außer Sicht verschwunden war.
Ich ließ sie ziehen und blickte mich um, weil ich neugierig war, was um alles in der Welt sie so erschreckt haben konnte.
Ringsum herrschten das übliche Gedränge und die übliche Geschäftigkeit. Alles war in ständiger Bewegung, und die Bilder änderten sich unablässig wie bei einem Kaleidoskop. Doch nein, nicht alles bewegte sich. Eine Sache, oder besser, eine Person stand reglos da.
Er stand direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, an der Ecke zur Parkway im Schatten eines Bankgebäudes. Er gehörte zu der Sorte von Personen, die man normalerweise nicht bemerken würde, doch wenn es einmal geschah, brannte sich das Bild unauslöschlich ins Gehirn ein.
Ich sehe ihn jetzt noch vor mir, wie er im Schatten lauert, angelehnt an die respektable Fassade der Bank. Es war, als wäre er eifrig bedacht, unbemerkt zu bleiben, und als hoffte er, falls man ihn doch entdeckte, sich mit einer gewissen Legitimität durch das Bankhaus im Rücken zu umgeben. Alles an ihm war hell und bleich, und er wirkte ein wenig geisterhaft. Er schien jung zu sein, ziemlich groß und hager gebaut, und ich gewann den Eindruck einer Haut, die trotz des schönen, warmen Sommers nie mit Sonnenschein in Berührung gekommen war. Seine Kleidung war entweder weiß oder zumindest sehr hell; auf die Entfernung hin vermochte ich dies nicht genau zu sagen. Er trug knielange Shorts mit großen Klappentaschen an den Seiten der Beine, dazu ein T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und eine weiße Kappe mit Schirm, eher eine Tenniskappe als eine Baseballmütze. Und er starrte in Richtung des U-Bahn-Eingangs und beobachtete mich. Als ihm bewusst wurde, dass ich ihn entdeckt hatte, reagierte er genauso schnell wie schon zuvor Edna, indem er sich umwandte und um die Ecke in den Parkway verschwand, in die entgegengesetzte Richtung Ednas.
Er hätte bleiben sollen, wo er gestanden hatte. Ich hätte ihn wahrscheinlich als einen weiteren der zahllosen seltsamen Vögel abgetan, von denen es in der Camden High Street nur so wimmelte. Selbst wenn er mir ein wenig verdächtig erschienen wäre, hätte ich wohl kaum etwas unternehmen können. Wäre ich zu ihm gegangen und hätte ihn beschuldigt, Edna und mich zu beobachten, bevor er entschlüpfen konnte, hätte er erwidern können, dass ich wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte und er lediglich auf einen Freund wartete, mit dem er verabredet war. Gut möglich, dass er versucht hätte, mir Drogen anzudrehen. Seine gesamte Körpersprache sprach ihn schuldig, doch ich entschied rasch, dass es sicherlich nicht daran lag, dass er ein Pusher war, und ich bezweifelte, dass er ein Undercover-Bulle war. Die Drogenfahnder mögen in allen möglichen Verkleidungen daherkommen, doch sie sehen immer wie Bullen aus. Vielleicht liegt es an ihrer allgemeinen körperlichen Fitness und ihrer geraden Haltung. Sie wirken niemals entspannt.
Niemand käme je auf den Gedanken, mich für eine Zivilfahnderin zu halten. Ich bin zu klein und viel zu entspannt, und man kann mir ansehen, dass ich zu der Sorte gehöre, die normalerweise mit den Behörden auf Kriegsfuß steht. Es ist nicht so, dass ich es willentlich tue, wie ich hinzufügen möchte. Es ist einfach die Art und Weise, wie sich die Dinge entwickelt haben.
Ich handle instinktiv, und das ist nicht immer weise, wie mein Freund Ganesh nicht müde wird zu betonen. Doch ich habe nie zu der Sorte gehört, die nur herumsteht und zusieht, wie das Leben an ihr vorbeizieht. Ich packe die Dinge beim Schopf. Und so nutzte ich auch jetzt eine Lücke im Verkehrsstrom und rannte bei der Verfolgung der geisterhaften Erscheinung über die Straße in Richtung Parkway. Ich wollte wissen, was für ein Spiel er spielte, und ich musste herausfinden, wohin er ging, zu meiner eigenen Zufriedenheit. Nennen Sie es Neugier, nennen Sie es naseweis, nennen Sie es, wie Sie wollen.
Als ich im Parkway ankam, war er schon ein gutes Stück vor mir. Er marschierte in flottem Tempo und mit schwingenden Armen davon. Auf gewisse Weise war ich erleichtert, ihn zu sehen – wenigstens war er real, und ich hatte mir nicht alles eingebildet. Ich bin ziemlich gut zu Fuß und flitzte ihm hinterher. Als ich ihn eingeholt hatte, war ich dennoch außer Atem und wahrscheinlich rot im Gesicht. Er wusste, dass ich da war, wusste, dass ich ihm gefolgt war, doch er gab dies mit keinem Zeichen zu erkennen, außer einer weiteren Beschleunigung seiner Schritte. Seine Blässe war aus der Nähe noch auffälliger. Ich fragte mich, ob er krank gewesen war, so durchscheinend fischig und fahl war seine Haut. Seine Augen blickten starr geradeaus, scheinbar ins Nichts, scheinbar ohne irgendetwas zu streifen. Ich überlegte besorgt, ob er möglicherweise schizophren war, und falls ja, ob er seine Medikamente einnahm. Doch das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen konnte, war, dass er definitiv flüchtete, ohne dabei zu laufen. Vielleicht versuchte er, den Regent’s Park zu erreichen. Dort konnte er, ohne Verdacht zu erregen, loslaufen und mich mühelos abhängen.
Selbst seine jetzige Marschgeschwindigkeit machte mir bereits zu schaffen. Ich rang nach ausreichend Luft, um ihn anzusprechen, und es gelang mir, ein »Hey!« herauszukrächzen, doch es war zu spät.
Ohne Vorwarnung bog er nach rechts in die Gloucester Avenue ein und wenige Schritte weiter wieder rechts in die Gloucester Crescent. Seine Beine waren lang und entsprechend ausgreifend seine Schritte. Ich hingegen hatte kurze Beine und musste beinahe rennen, um mit ihm mitzuhalten. Ich gab mir die größte Mühe, und mein Atem ging immer schwerer, während ich mich fragte, wie es gekommen war, dass ich meine Kondition so verlieren konnte.
Ich verfolgte ihn durch die lange Reihe teurer Eigenheime, die den Crescent säumten. So ist das in Camden: die Reichen und die Obdachlosen zusammengewürfelt in einem einzigartigen Ökosystem.
Wir bewegten uns so schnell voran, dass wir die Inverness Street erreichten, bevor ich mich’s versah, und unversehens bog er erneut ab. Auf dem hiesigen Obst- und Gemüsemarkt herrschte starker Betrieb. Meine Beute machte inzwischen noch größere Schritte, so dass ich hinter ihr herhechelte wie hinter jemandem mit Siebenmeilenstiefeln. Ich rutschte auf zerquetschten Früchten aus. Ich wich Einkaufswagen aus, geschoben von mannhaften alten Weibern ohne Rücksicht darauf, gegen wessen Schienbeine sie krachten. Kleinkinder in Kinderwagen und auf eigenen Füßen verwandelten meinen Weg in einen Hindernisparcours.
Der Mann in Weiß hatte mich im Kreis geführt, und wir kamen einmal mehr auf der Camden High Street heraus. Er hatte seinen quälenden Vorsprung irgendwie aufrechterhalten. Ich erkannte zu spät, was er vorhatte.
Plötzlich rannte er über die Straße und verschwand im Camden Town Market.
Er hatte mich ausgetrickst. Er war clever, okay.
Im Camden Town Market herrscht eine drangvolle Enge, und die Sicht ist auf wenige Meter unmittelbar vor den eigenen Füßen und die Stände rechts und links begrenzt. Es ist ein schattiges Labyrinth aus schmalen Gassen zwischen vollbeladenen Ständen, Touristen, Schaulustigen und echten Käufern. Der Mann in Weiß war längst im Gewimmel verschwunden, bis ich den Eingang erreicht hatte. Ich hetzte blindlings hinterher, obwohl ein deprimierendes Gefühl mir sagte, dass ich wohl meine Zeit verschwendete.
Störrisch drängte ich weiter, während die Rufe der Standinhaber in meinen Ohren gellten und Menschen mich anrempelten in ihrem Bemühen, zu den Waren zu gelangen. Bummelnde Teenager hatten sich vor einem Schmuckstand versammelt und versperrten mir den Weg, während sie über die Vorzüge von bunten Perlenschnüren diskutierten. Ein Stück weit hinter ihnen erhaschte ich einen Blick auf eine weiße Tenniskappe. Dort, das musste er sein!
Ich drängte die Teenager beiseite und ignorierte den wütenden Blick des Standbesitzers und die indignierten Proteste der Mädchen. Bunte exotische Kleidung mit Pailletten und Glitzer baumelte von Ständern und wehte mir ins Gesicht, und der beißende, moschusartige Geruch von Farbe stieg mir in die Nase. Zwischen den Ständen erhaschte ich immer wieder flüchtige Blicke auf meine Beute, oder zumindest glaubte ich, dass sie es war. Eine hell aufblitzende Baseballmütze – war er es, oder war es jemand anders? Für jemanden, der uns von oben beobachtete, musste die Verfolgungsjagd aussehen wie eines von jenen Computerspielen, wo eine Figur eine andere durch ein Labyrinth voller Sackgassen, Hindernisse und Fallen jagt. Und dann war er weg.
Ich hatte ihn so lange verfolgt, hatte trotz all seiner Tricks unbeirrbar an seinen Fersen geklebt, dass ich zuerst nicht glauben konnte, ihn tatsächlich verloren zu haben. Die Erkenntnis, dass er mich abgeschüttelt hatte, traf mich wie ein schmerzhafter Schlag. Ich eilte noch ein paar Ecken weiter, suchte vergeblich die Gänge nach einer Gestalt in einer weißen Kappe ab – nichts.
Menschen schoben sich an mir vorbei, Musik drang blechern an meine Ohren und Geschnatter in einem halben Dutzend verschiedener Sprachen. Doch ich war allein.
Ich konnte mir denken, wie er es angestellt hatte. Wahrscheinlich hatte er einen günstigen Zeitpunkt abgewartet und dann die auffällige weiße Kappe abgesetzt. Er hatte sich geduckt, sich durch einen der Bekleidungsstände gezwängt und war in den parallelen Gang dahinter geflüchtet. Wahrscheinlich war er längst zurück auf der Camden High Street.
Ich kehrte auf dem gleichen Weg zurück, auf dem ich gekommen war, obwohl mir klar war, dass es keinen Zweck hatte. Ich blickte mich suchend in alle Richtungen um, doch ich vermochte beim besten Willen nicht zu sagen, wohin er verschwunden war. Vielleicht war er in die U-Bahn-Station gegangen und stand nun auf einer Plattform tief unter mir. Er kannte sich in dieser Gegend aus und hatte seine Ortskenntnis benutzt, um mir zu entwischen. Doch es war auch mein Revier, und ich war wütend auf mich selbst, dass ich ihn so unterschätzt und ihm ermöglicht hatte zu entkommen.
In einer von Menschen nur so wimmelnden Metropole trifft man unablässig Menschen und verliert sie wieder aus den Augen. Leben berühren sich für einen Moment, passieren einander wie die sprichwörtlichen Schiffe in der Nacht, und in kürzester Zeit ist jede Spur dieser Begegnung erloschen, als hätte es sie nie gegeben.
Doch ich hatte immer an Edna denken müssen, und ich hatte mich oft gefragt, was aus ihr geworden sein mochte. Sie war Bestandteil meiner ersten Ausflüge in das Detektivgeschäft, sie hatte mir sogar einen nützlichen Hinweis geliefert, und ich fühlte mich ihr in gewisser Weise verpflichtet.
Während ich also noch schwitzend und außer mir vor Wut dort stand und hechelnd nach Luft rang, schwor ich mir, beim nächsten Mal vorbereitet zu sein! Ich halte die Augen nach dir offen, Kerl, und ich erkenne dich wieder. Edna hat dich auch erkannt … und sie hatte Angst vor dir.
Ich hätte wahrscheinlich ebenfalls Angst gehabt, wenn ich bei Trost gewesen wäre. Doch wie ich bereits gesagt habe: Schlimme Situationen üben eine beinahe magische Anziehungskraft auf mich aus.
Wie Licht auf Motten.
Kapitel 2
Das unerwartete Zusammentreffen mit Edna hatte mich an das erinnert, was ich erst vor so kurzer Zeit hinter mir gelassen hatte. Ich bin sehr wenig herumgekommen in meinem Leben und war kaum jemals außerhalb von London. Das ist für sich genommen schon ein wenig seltsam heutzutage, schätze ich. Andererseits habe ich eine Menge spirituelle Reisen hinter mich gebracht, während ich aus der vernunftbestimmten Normalität (wenn man die zusammengeflickte Welt von Großmutter und Dad so nennen konnte) in die Obdachlosigkeit geglitten war und wieder aus ihr zurück.
Für die meisten »normalen« Menschen ist die Welt der Leute ohne Familie und Heimat ein fremdes Land, und doch müssen sie nur einen Schritt vor ihre Haustür machen, um seine Bewohner zu erspähen. Wenn ihnen danach ist, sie zu sehen, heißt das, und den meisten ist entschieden nicht danach. Sie werfen einen Umhang der Unsichtbarkeit über das Elend und eilen hastig vorüber.
Diese eigenartig verzerrte »andere« Welt folgt einer merkwürdigen Logik. Sie funktioniert nach ihren eigenen Regeln, errichtet ihre eigenen Gesetze und hat manchmal sogar ihre eigene Zeit. Ganze Gemeinschaften blühen und gedeihen in sogenannten aufgelassenen Häusern mit der Androhung der Zwangsräumung über dem Kopf wie ein Damoklesschwert. Unbeständigkeit als Lebensstil. Wer wirklich keinen anderen Platz kennt als die Straße, um sich zu betten, schläft häufig tagsüber, wenn die Hauptstraße voller achtloser Passanten und luftverschmutzendem Verkehr ist. Des Nachts, wenn Myriaden Gefahren aus den Schatten treten oder in betrunkener Feindseligkeit aus den Clubs und Bars hinaus auf das im Licht der Straßenlaternen feucht glänzende Kopfsteinpflaster torkeln, durchstreifen die Obdachlosen ihre Reviere in ständiger Wachsamkeit.
Menschen in der »normalen« Welt sollten sich nicht einreden, dass es so gut wie unmöglich ist, durch die Maschen des sozialen Netzes in die Welt der Besitzlosen zu fallen. Manchmal, wenn man extrem viel Glück hat oder außergewöhnlich entschlossen daran arbeitet, gelingen der Rückweg in die andere Richtung und der Wiedereintritt in das verlorene Paradies einer akzeptablen Existenz, der Wechsel von Entwurzelung zu einer neuen Sicherheit, wie angespannt auch immer. Ich gehöre zu jenen Glücklichen, welchen diese gefahrvolle Transition gelungen ist. Ich vergesse niemals, welches Glück ich hatte. Genauso wenig, wie ich die vergesse, die nicht daran teilhatten.
»Ich hab mich immer gefragt, was wohl aus Edna geworden ist«, sagte ich an jenem Abend zu Ganesh. »Und ich war immer neugierig, woher sie kam und warum es sie auf diesen Kirchhof in Rotherhithe verschlagen hat.«
»Tatsächlich?«, entgegnete Ganesh und schlug seinen Jackenkragen hoch wegen der steifen Brise, die durch die Chalk Farm Road wehte. Der Wind war nicht kalt und die Luft feuchtwarm, doch er brachte Staub und kleine Partikel mit sich, die um uns herumwirbelten wie ein urbaner Sandsturm.
»Ja, tatsächlich. Du nicht?«
»Nein«, sagte Ganesh.
»Komm schon, Ganesh. Bestimmt hast du auch darüber nachgedacht.«
»Es wird dir vielleicht nicht aufgefallen sein«, entgegnete Ganesh gereizt, »doch in Rotherhithe habe ich den lieben langen Tag im Geschäft meines Vaters Kartoffeln und Zwiebeln verkauft. Genau wie ich heute mein Leben damit verbringe, für Onkel Hari durch die Gegend zu rennen und Zeitungen zu verkaufen. Und weiß man es zu schätzen? Ha! Einen Dreck tut man!«
Ich erkannte die Anzeichen eines im Hintergrund schwelenden Familienstreits. »Du hast dich mit Hari gezankt!«, stellte ich fest.
»Man kann nicht mit Onkel Hari streiten!«, sagte Ganesh mit mühsam unterdrückter Wut. »Es ist völlig unmöglich! Wie soll man mit jemandem streiten, der überhaupt nicht auf das reagiert, was man sagt? Streiten, das ist, wenn sie einem zuhören und dann mit einem brüllen. Und wenn man ihnen zuhört und dann zurückbrüllt, richtig? Das ist zanken.«
»Okay …?«, sagte ich zweifelnd.
»Aber ich kann nicht mit Onkel Hari streiten, weil er mir überhaupt nicht zuhört, wenn ich etwas sage!« Ganeshs Stimme wurde lauter und lauter, bis er brüllte. »Ich lege ihm meinen Standpunkt dar. Höflich. Er ignoriert es. Ich wiederhole meine Worte. Er fragt, warum ich dastehe und schnattere, wenn doch Arbeit zu tun ist? Ich frage erneut und sehr höflich, ob er mir ein wenig von seiner Aufmerksamkeit schenkt, um über irgendetwas zu reden. Oh, er hat viel zu viel zu tun. Ich soll später kommen, wenn der Laden geschlossen ist. Und später, wenn wir oben in der Wohnung sind, gibt es wieder irgendwas, um das er sich dringend kümmern muss.«
»Was gibt es denn für ein Problem?«, fragte ich mitfühlend.
Ganesh blieb wie angewurzelt stehen und wirbelte zu mir herum. »Was es für ein Problem gibt? Du bist genauso schlimm wie Hari! Ist das, was ich dir beschrieben habe, denn nicht Problem genug?«
»Sicher. Was ich meinte, war, welches Problem möchtest du denn mit Onkel Hari besprechen, auf das er nicht einzugehen bereit ist?«
»Das würdest du nicht verstehen. Es ist eine Familienangelegenheit«, antwortete Ganesh ausweichend.
»Weißt du, es wird dir nicht gefallen, wenn ich dir das sage, aber auf deine Weise bist du kein Stück besser als dein Onkel Hari«, sagte ich.
Bei diesen Worten verfiel Ganesh in ein ausgedehntes beleidigtes Schweigen, das er erst wieder brach, als wir den Potato Heaven erreicht hatten.
Okay, ich weiß, es ist ein grauenhafter Name, und sowohl Ganesh als auch ich haben uns die größte Mühe gegeben, Jimmie diese Idee auszureden – ohne jeden Erfolg. Jimmie war überzeugt, dass der Name die Kundschaft anziehen würde, und vielleicht hatte er Recht damit, denn der Laden war dieser Tage ständig voll und Jimmie in ein breites Grinsen gehüllt statt in Zigarettenrauch.
Er paffte noch immer bei jeder sich bietenden Gelegenheit, doch wenigstens gelang es ihm inzwischen, den Zigarettenrauch aus dem Essbereich zu halten.
Als wir Reekie Jimmie, wie er von allen beinahe liebevoll genannt wurde, kennen gelernt hatten, hatte er ein Kartoffelrestaurant geführt, das nicht die geringste Konzession an die Wünsche der Kundschaft machte, weder was eine freundliche Einrichtung noch gesundes Essen oder irgendetwas sonst anging. Dann hatte Jimmie beschlossen, sich einer gehobenen Kundschaft zuzuwenden. Er war mit einem Italiener ins Geschäft gekommen und hatte eine schicke Pizzeria eröffnet. Ich hatte eine Weile als Kellnerin dort gearbeitet (während ich für eine Rolle in der unvergesslichen Theaterproduktion The Hound of the Baskervilles gelernt hatte). Alles wäre wunderbar gewesen, hätte es nicht ein kleines Problem zwischen der Pizzeria und dem Gesetz gegeben. Doch die Bullen kamen zu dem Schluss, dass Jimmie nur ein unglücklicher Strohmann gewesen und nicht hell genug für derartige Vergehen war, und so hatten sie ihn zu seiner ersten großen Liebe zurückziehen lassen: Kartoffeln.
»Bei denen weiß man wenigstens immer, wo man dran ist, richtig, Süße?«, hatte er mir erklärt.
Doch genau wie das Leben im Heim Edna verändert hatte, so hatte der Pizzaladen etwas mit Jimmie angestellt. Er hatte Stil gelernt. Er hatte begriffen, dass die Einrichtung wichtig ist. Also hatte er die Pizzeria-Einrichtung behalten, zusammen mit dem wunderschönen Fliesenmosaik des Vesuv an der Wand, doch auf der Speisekarte standen wieder Kartoffeln – nur dass sie nun mit Bolognese-Füllung (Schweinehackfleisch) und Milanese (Kalb) serviert wurden und dass ein Gericht Quattro Formaggi hieß (4 Käsesorten). Verstehen Sie, was ich meine?
Nachdem Ganesh und ich mit unseren Kartoffeln in einer Ecke Platz gefunden hatten (Bolognese für mich und Quattro Formaggi für Ganesh, weil er Vegetarier ist), brachte ich das Thema Edna wieder auf den Tisch. Es erschien mir sicherer, als über Ganeshs Probleme mit seinem Onkel zu reden. Abgesehen davon war Edna auch das Thema, über das ich reden wollte.
»Sie bekam richtig Angst, als sie den Kerl auf der anderen Straßenseite bemerkte, der sie beobachtet hat.« Ich hatte Ganesh alles von meiner Begegnung mit Edna und dem unerwarteten Ende derselben erzählt und auch nicht verschwiegen, dass Ednas Verfolger mir entwischt war.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Ganesh stirnrunzelnd. Er hatte bisher zu nichts, was ich erzählt hatte, die Stirn gerunzelt, doch das lag nur daran, dass sich lange gummiartige Fäden von seiner Gabel hinunter auf den Teller zogen und er sie nicht zerreißen konnte. Je wilder er die Gabel drehte in dem Bemühen, alles wie Spaghetti aufzuwickeln, desto länger und dünner wurden die Käsefäden. Schließlich packte er sein Messer und wollte sie durchschneiden, doch sie wurden einfach nur flach unter der Klinge.
»Was ist das für ein Zeug?«, schimpfte er aufgebracht.
In diesem Augenblick teilten sich die Käsefäden doch noch, und es gelang ihm, sich eine beherrschbare Gabel voll in den Mund zu schieben.
»Woher willst du wissen, was Edna empfunden hat?«, fuhr er fort, nachdem er beim Schlucken eine Miene gezogen hatte, die eindeutig Ekel bekundete. »Edna ist nicht wie andere Leute. Ihre Mimik ist nicht wie die anderer Leute. Sie mochte Fremde noch nie. Es hat ihr sicher nicht gefallen, dass du sie mitten auf der Straße angehalten hast. Ich schätze, die Menschenmenge auf den Straßen hat sie eingeschüchtert, das ist alles.«
»Nein!«, widersprach ich entschieden. »Das war er! Er hat ihr Angst gemacht. Wenn er unschuldig war, warum ist er dann weggelaufen?«
»Er ist nicht wirklich gelaufen, hast du erzählt«, verbesserte mich Ganesh. Er kann wirklich furchtbar pedantisch sein.
»Dann ist er eben sehr schnell gegangen! Er hat sich mir absichtlich entzogen! Und er hat es sehr professionell gemacht, weißt du? Er kennt sich aus mit so etwas, schätze ich. Leuten zu entwischen. Er wusste ganz genau, was er tun musste.«
»Würde ich dich nicht kennen und würdest du mir offensichtlich folgen, würde ich ebenfalls versuchen, dir zu entwischen«, entgegnete Ganesh. »Das ist das ganze Problem, verstehst du? Du bist immer so furchtbar entschlossen, genau das zu tun, was dir beliebt – was im Allgemeinen bedeutet, was dir gerade zufällig als Erstes in den Sinn kommt –, dass du nicht einmal innehältst und überlegst, wie das alles für andere Leute aussieht. Ich kenne dich. Ich habe akzeptiert, dass du dich manchmal wie eine Irre verhältst. Es gefällt mir nicht, doch ich habe gelernt, damit zu leben. Andere Leute halten dich einfach nur für verrückt.« Er gab seine Bemühungen mit dem Käse auf, der sich nun, nachdem er abgekühlt war, wie Plastik auf der Kartoffel verfestigt hatte, und starrte mich nachdenklich an. »Ganz besonders mit diesen merkwürdig gefärbten Haaren«, schloss er.
Ich war zu dieser Zeit ein wenig empfindlich, was meine Haare anging, und ich empfand es als taktlos von ihm, meine Haare zu erwähnen. Der Rest erzeugte in mir kein Gefühl von Widerspruch. Mir ist durchaus bewusst, dass andere Menschen mich manchmal merkwürdig finden. Doch wie ich das sehe, ist es ihr Problem, nicht meines. Mein Problem war meine Haarfarbe.
»Auf dem Etikett stand, dass die Tönung dunkel kastanienbraun wäre«, setzte ich zu einer schwachen Verteidigung an.
»Aber das da«, und bei diesen Worten stieß Ganesh mit der Gabel nach mir, »das da ist nicht dunkel kastanienbraun! Es ist purpurrot. Du siehst aus, als stünden deine Haare in Flammen!«
»Okay, ich kaufe mir eine neue Tönung und unternehme etwas dagegen! Aber jetzt, in diesem Augenblick, kann ich wohl nichts dagegen machen, oder? Was ist mit Edna?«
»Was soll mit ihr sein?«
»Ganesh!« Ich konnte nicht anders, ich erhob die Stimme. »Was wollen wir tun?«
»Nichts. Insbesondere ›wir‹ werden gar nichts tun. Ich habe keinerlei Probleme mit dem, was du mir erzählt hast. Es ist alles nur deine überbordende Fantasie und diese Ausbildung in Dramaturgie, die du absolviert hast. Für dich ist alles eine einzige große Produktion. Alles besteht nur aus Schurken und Verschwörungen und finsteren Missetaten, und du als die Heldin hast natürlich die Aufgabe, alles in Ordnung zu bringen.«
Ich öffnete den Mund zu einer protestierenden Erwiderung, doch er ließ mich nicht zu Wort kommen.
»Du weißt doch überhaupt nicht, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Du glaubst, dass sie erschrocken ausgesehen hat, aber das heißt bei Edna noch überhaupt nichts. Du denkst, der Typ von der anderen Straßenseite hat sie beobachtet. Na schön, vielleicht hat er das. Es ist schließlich nicht ungesetzlich. Es ist nicht mal ungewöhnlich. Wenn ich auf dich warte, beobachte ich ebenfalls die Leute, die vorbeigehen. Der Typ hing aus irgendeinem Grund dort herum und hat dich dabei beobachtet, wie du mit einer Obdachlosen geredet hast. Es war wahrscheinlich nichts als Zufall, dass er euch beobachtet hat. Besser, als in die Luft zu starren.«
»Aber … aber … aber …«, setzte ich zu einer Entgegnung an. Vergeblich.
Ganesh, der sicherlich selbst gut in einem Drama-Kurs zurechtgekommen wäre, auch wenn er wahrscheinlich eine Vorliebe für die Melodramen des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt hätte, hob die Hand wie ein alter Verkehrspolizist. »Und dann kommst du auf die Idee, ihn zu verfolgen, und er fasst den durchaus verständlichen Entschluss, dich abzuhängen. Mehr noch …«
Er funkelte mich böse an, weil ich in einer Pantomime kunstvollen Gähnens Zuflucht gesucht hatte und mir dabei artig die Hand vor den Mund hielt.
»Selbst wenn die kleinste Chance bestanden hätte, dass du auch nur annähernd richtigliegst, hast du trotzdem keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Wenn du Edna wiederfinden und sie fragen würdest, könnte sie sich entweder nicht erinnern oder würde es dir nicht verraten oder dir irgendeine Geschichte erzählen. Sie kann die Realität nicht von der Fiktion unterscheiden.«
Wenn man Ganesh nur genügend Freiraum lässt, kommt er einem irgendwann entgegen. Er hatte mir geradewegs in die Hand gespielt. Ich legte meine Gabel beiseite und richtete triumphierend den Zeigefinger auf ihn. »Das ist der Punkt, an dem du dich irrst, Ganesh, und wenn du dich an die Zeit in Rotherhithe zurückerinnerst, wirst du mir Recht geben müssen. Alles, was Edna je gesagt hat, entsprach der Wahrheit. Es mag ein wenig merkwürdig klingen, wie es aus ihrem Mund kommt, aber sie hat nie irgendetwas erfunden. Nach Terrys Ermordung verriet sie mir, dass sie jemanden vor dem Haus rumhängen gesehen hätte, und es war die Wahrheit, erinnerst du dich? Sie konnte den Kerl sogar in gewisser Hinsicht beschreiben. Edna übersieht nichts. Sie mag vielleicht nicht darüber reden, aber das bedeutet nicht, dass es ihr nicht aufgefallen ist. Heute hat sie mir erzählt, dass sie einmal verlobt gewesen ist, und ich glaube ihr.«
Ganesh brach in johlendes Gelächter aus. Es war sehr unhöflich, und das sagte ich ihm dann auch.
Er verstummte. »Also schön. Die alte Frau ist nicht annähernd so verblödet, wie sie nach außen hin tut. Sie war wahrscheinlich vor langer Zeit eine richtig respektable Person. Irgendwas hat dazu geführt, dass sie ausgeflippt ist. Sie ist ausgestiegen und nie wieder zurückgekehrt. So was passiert andauernd.« Ganesh runzelte erneut die Stirn und fügte melancholisch hinzu: »Nur mir könnte es nicht passieren.«
»Wieso denn nicht?«
»Weil meine Familie mir hinterherkommen würde. Sie würde mich aufspüren und zurück nach Hause zerren, damit ich weiter Kartoffeln oder Zeitungen verkaufe oder womit auch immer sie zum gegebenen Zeitpunkt handeln. Es gibt keine Flucht vor meiner Familie!« Er beäugte mich. »Du auf der anderen Seite könntest sehr leicht enden wie Edna.«