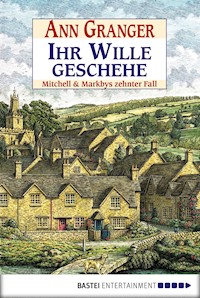4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Fran Varady hat endlich einen "richtigen" Job in einer Pizzeria gefunden, der ihr die nötigen Rücklagen verschafft, um wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Doch in dem Lokal gehen recht merkwürdige Dinge vor sich, die ihren detektivischen Spürsinn wecken. Außerdem hat sie versprochen, einem Jungen zu helfen, der sich illegal in England aufhält und einen zwielichtigen Menschenhändler namens Max sucht. Als dann auch noch ein grausamer Mord geschieht, steht Fran plötzlich zwischen mehreren Fronten und wird von gefährlichen Verbrechern gejagt ...
ÜBER DIE REIHE: Fran Varady ist eine junge mittellose Schauspielerin in London. Eigentlich ist sie auf der Suche nach einem Job - stattdessen gerät sie immer wieder in Verbrechen hinein. Daher ermittelt sie nebenbei als Privatdetektivin ohne Lizenz und klärt mit ihrer optimistischen und zupackenden Art eine ganze Reihe von Mordfällen auf.
Eine Wohlfühl-Krimi-Reihe mit einer starken und ungewöhnlichen Protagonistin: Ann Granger bietet mit der Fran-Varady-Serie Spannung ohne Gemetzel und Blutvergießen, dafür mit sympathischen Figuren und typisch englischem Flair.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der Autorin bei beTHRILLEDÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED
Die Cosy-Krimireihe mit Fran Varady:
Band 1: Nur der Tod ist ohne Makel
Band 2: Denn umsonst ist nur der Tod
Band 3: Die wahren Bilder seiner Furcht
Band 4: Dass sie stets Böses muss gebären
Band 6: Denn mit Morden spielt man nicht
Band 7: Und das ewige Licht leuchte ihr
Außerdem sind von Ann Granger folgende Krimireihen bei Bastei Lübbe lieferbar:
Mitchell & Markby
Martin & Ross
Jessica Campbell
Über dieses Buch
Fran Varady hat endlich einen »richtigen« Job in einer Pizzeria gefunden, der ihr die nötigen Rücklagen verschafft, um wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Doch in dem Lokal gehen recht merkwürdige Dinge vor sich, die ihren detektivischen Spürsinn wecken. Außerdem hat sie versprochen, einem Jungen zu helfen, der sich illegal in England aufhält und einen zwielichtigen Menschenhändler namens Max sucht. Als dann auch noch ein grausamer Mord geschieht, steht Fran plötzlich zwischen mehreren Fronten und wird von gefährlichen Verbrechern gejagt …
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit ihrer Mitchell-und-Markby-Reihe. Daneben gibt es von Ann Granger noch folgende weitere Reihen: Die Fran-Varady-Reihe, die Jessica-Campbell-Reihe und Kriminalromane im viktorianischen England mit Lizzie Martin und Benjamin Ross.
ANN GRANGER
UND HÜTE DICH VOR DEINEN FEINDEN
FRAN VARADYS FÜNFTER FALL
Aus dem britischen Englisch von Axel Merz
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2002 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »Watching out«
Originalverlag: Headline Book Publishing, a division of Hodder Headline PLC, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2004/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Rainer Schumacher/Stefan Bauer
Covergestaltung: Gisela Kullowatz unter Verwendung von Motiven © getty-images: James Gritz
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7565-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Caroline Graham gewidmet, in Freundschaft und Dank
für ihre Aufmunterung und Unterstützung
Kapitel 1
Sechs von uns drängten sich in der Wärme oben im The Rose Pub zusammen. Keiner von uns sagte ein Wort. Unsere Aufmerksamkeit war auf einen großen, staubigen geflochtenen Wäschekorb ge-richtet. An diesem Korb hing ein Schild auf einer Seite, auf dem zu lesen stand: ›Zurück an das Hotel Royal, Yarmouth‹, und auf der anderen Seite ein zweites Schild: ›Privateigentum. Bitte stehen lassen.‹
»Ah«, sagte Marty zu guter Letzt und mit gezwungener Zuversicht. »Sehen wir doch mal nach, was drin ist.«
Der Rose Pub war eine Londoner Taverne im alten Stil. Er hatte braun glasierte Fliesen an den Außenwänden und nikotinfleckige Raufasertapete innen. Der ursprüngliche Salon und der Thekenraum waren längst zu einem großen Raum zusammengelegt worden, an dessen gegenüberliegendem Ende sich eine kleine Empore befand. Auf diese Empore lud Freddy, der Wirt, Sänger und Komiker ein, um sein Publikum zu unterhalten. Wer verzweifelt genug war, um sich im Showbusiness zu versuchen, nahm seine Angebote an und stellte sich dort oben hin, wo er so verwundbar war wie die Kokosnüsse an einem Wurfstand auf dem Jahrmarkt, während die Kundschaft pfiff und rüde Bemerkungen brüllte.
Oben, wo wir uns misstrauisch mit dem Wäschekorb auseinandersetzten, gab es eine richtige, wenn auch kleine Bühne mit Vorhängen. Dies war nicht nur, was Freddy seinen Veranstaltungsraum nannte, sondern zugleich sein Privattheater, wo die größeren Shows spielten. Freddy war über alle Maßen stolz auf seine Erfolge als Veranstalter. Die Aufführungen fanden nicht häufig statt, doch wenn es so weit war, dann galten sie in der Gegend als etwas, das man nicht versäumen durfte, und die Sitzplätze waren stets ausverkauft.
Freddy war kein Mann, der mit Geld um sich warf, und steckte stets nur bescheidene Beträge in die Produktion seiner Shows, die er immer am Eingang wieder zurückgewann. Er wusste, wie man das Maximum aus einer Produktion herausholte, während jemand anderes all die Arbeit hatte, bis die Show stand. Als Organisator suchte Freddy seinesgleichen. Doch sein natürlicher Geiz zeigte sich in unserer Umgebung. Der Veranstaltungsraum war seit Jahren nicht mehr renoviert worden, und die ausgeblichenen Samtvorhänge auf der Bühne sahen aus, als würden sie unter dem Gewicht der Jahre und des angesammelten Drecks jeden Moment herunterfallen. Außerdem hing ein haftender Geruch in dem Raum, zu dem jedes einzelne der hundertzwanzig Jahre währenden Geschichte des Rose Pub beigetragen hatte.
Der Grund für unsere Anwesenheit war, dass wir hier oben auf der Bühne auf Freddys Einladung hin eine dramatische Adaption von Conan Doyles Roman Der Hund von Baskerville spielen sollten. Es war Freddys neueste schlaue Idee, wie er die Massen unterhalten und gleichzeitig ein paar zusätzliche Mäuse verdienen konnte. Das Stück war von unserem Regisseur Marty umgeschrieben worden. Er war selbst ein Autor und hätte liebend gerne eines von seinen eigenen Stücken auf die Bühne gebracht, doch Freddy wollte traditionelle Unterhaltung, und was Freddy wollte, das bekam er auch.
»Vielleicht«, hatte Marty optimistisch gesagt, »vielleicht lässt er mich, wenn wir richtig gut sind, beim nächsten Mal eins von meinen Stücken aufführen.«
Das war extrem unwahrscheinlich, doch kreative Künstler und Autoren sind zarte Seelen, und Marty benötigte sämtliche Aufmunterung, die er bekommen konnte.
Für diejenigen unter Ihnen, die die Handlung von Conan Doyles Erzählung nicht kennen: Die Familie Baskerville wird wegen der Verbrechen irgendeines Vorfahren von einem übernatürlichen Hund bedroht. Sir Charles Baskerville wurde tot aufgefunden, und neben seinem Leichnam war der Abdruck einer Hundepfote. Sein Erbe, Sir Henry, ist soeben aus Kanada nach England gekommen, um sein Erbe anzutreten. Der Hausarzt der Familie wendet sich an Holmes, weil er befürchtet, der Hund könne auch Henry töten. Also schickt Holmes seinen Assistenten Watson nach Devon, um Sir Henry zu beschützen, während er sich selbst draußen im Moor versteckt. Dann gibt es da noch einen Schmetterlingsjäger namens Stapleton und seine Schwester (die in Wirklichkeit seine Frau ist) und einen entkommenen Sträfling (der mit Sir Henrys Haushälterin verwandt ist), und alles wird ein wenig kompliziert. Der Höhepunkt ist das Auftauchen des grässlichen Hundes, der den armen Sir Henry verfolgt. Sir Henry wird von Holmes und Watson in letzter Minute gerettet und das Rätsel aufgeklärt. Es gibt noch ein paar weitere Charaktere in der ursprünglichen Geschichte, doch Marty hat sie herausgeschnitten. Sie werden verstehen, warum.
Ich sollte die weibliche Hauptrolle übernehmen: Mrs Stapleton, die Frau, in die sich Sir Henry verliebt. Marty selbst spielte Sir Henry. Holmes konnte er nicht spielen, weil er nicht die richtige Figur besaß. Jeder, der sich Holmes vorstellt, denkt an Basil Rathbone in jenen wundervollen Schwarz-Weiß-Filmen oder Jeremy Brett in der alten Fernsehserie. Marty jedoch war klein und untersetzt mit einem pummeligen Gesicht, zurückweichendem blonden lockigen Haar und Brillenträger. Er besaß eine starke Ähnlichkeit mit einem Teddybär. Ich war nicht einmal sicher, ob er die richtige Besetzung für Sir Henry Baskerville war, aber wahrscheinlich sah ich auch nicht nach der richtigen Besetzung für die Rolle einer exotischen Schönheit wie Mrs Stapleton aus; deswegen verkniff ich mir jede Kritik. Ich bin ebenfalls eher klein und trage die Haare kurz geschoren, bis auf vorne, wo sie länger sind und wie eine buschige Tiara abstehen. Ich hatte mich von einem ehrgeizigen Friseurlehrling zu dieser Frisur überreden lassen.
Marty hatte jemanden namens Nigel gefunden, einen großen, hageren Burschen, der die Rolle des Sherlock Holmes spielen sollte. Mein Freund Ganesh spielte Dr. Watson. Ich weiß, dass der Dr. Watson aus den Romanen kein Inder ist, doch ich war überzeugt, dass Gan seine Rolle gut spielen würde. Es war schwierig gewesen, ihn zu überzeugen; er hatte sich nie besonders für die Bühne interessiert, doch wir hatten an ihm festgehalten, weil Marty ihn unbedingt in dieser Rolle haben wollte. Obwohl wir ihn zu zweit bearbeitet hatten, war Ganesh anfangs stark geblieben, bis uns sein Onkel Hari schließlich zu Hilfe gekommen war und ein Machtwort gesprochen hatte. Hari hat eine heimliche romantische Ader, die ihr Ventil normalerweise darin findet, dass er sich endlos Videos mit Bollywood-Filmen ansieht. Er war überzeugt davon, dass Ganesh mit seiner Rolle als Watson im Rose Pub den ersten Schritt auf dem Weg zum Star machen würde. Haris Begeisterung für das ganze Projekt war alarmierend. Er war sogar bereit, Ganesh früher aus dem Laden gehen zu lassen, damit er pünktlich zu den Proben kam – vorausgesetzt, es geschah nicht allzu häufig.
Wir hatten das Stück in meiner Wohnung gemeinsam gelesen. Das war nicht so einfach gewesen, wie es vielleicht klingen mag. Marty, der es geschrieben und ausgedruckt hatte, litt an einer leichten Dyslexie und entzifferte seine Zeilen auf die abenteuerlichste Weise. Wir alle waren zunehmend ungeduldig und nervös geworden, bis ein derb aussehendes rothaariges Mädchen nach Kostümen gefragt hatte.
Sie würde gleich zwei Rollen spielen, die von Sir Henrys Haushälterin und die von Holmes’ Wirtin, Mrs Hudson, und hatte daher ein besonderes Interesse an der Antwort. Marty sagte ihr, dass er entschieden hätte, sie müsse sich mit Schaumstoff polstern, um dick genug für Mrs Hudson zu sein, und zusätzlich eine Haube tragen, um ihr Haar zu verbergen. Für die Rolle der Haushälterin solle sie schlank auftreten und ein Pincenez tragen. Marty persönlich hatte ein Pincenez aus Draht gefertigt, und die Haube war eigentlich eine Duschhaube, die er von seiner Vermieterin geborgt hatte. Er holte beide Artikel mit einer Geste von bescheidenem Triumph aus einer Plastiktüte.
Das zeitigte jedoch nicht ganz den Effekt, den er sich erhofft hatte. Vor allem das Mädchen mit den krausen Haaren war wenig beeindruckt. Ob wir nicht alle unsere eigenen Kostüme machen oder vielleicht sogar zu einem richtigen Kostümverleiher gehen und uns dort ausstaffieren lassen sollten, fragte sie mit einer gewissen Schärfe in der Stimme. Nicht nötig, versicherte uns Marty rasch. Abgesehen von der Tatsache, dass wir kein Geld besaßen, würde Freddy sämtliche Kostüme stellen.
Ermutigt durch seine Worte beendeten wir unsere Lesung und gingen auf ein Pint in Freddys Pub. Anschließend gingen wir nach oben, um die Kostüme zu inspizieren, die von anderen Produktionen übrig geblieben waren, welche Freddy in seinem Veranstaltungsraum aufgeführt hatte, darunter auch ein Musical aus viktorianischer Zeit.
Marty öffnete den Deckel des Wäschekorbs, und ein stark muffiger Geruch entwich.
»Puh!«, sagte Nigel. »Das riecht ein wenig, findet ihr nicht? Seid ihr sicher, dass niemand eine Leiche in dem Ding versteckt hat?«
Martys Hand tauchte in den Korb, und er zog das erste Requisit hervor. Es war ein Bowler. »Wunderbar!«, rief er, polierte den Filz mit dem Ärmel und hielt Ganesh den Hut hin.
»Vergiss es!«, sagte Ganesh und wich zurück. »Ich trage keinen Bowlerhut!«
»Stell dich nicht so an, Kumpel!«, sagte Nigel tröstend. »Ich muss einen Jägerhut tragen. Freddy leiht sich den irgendwo. Bescheuerter als mit einem Jägerhut kann man gar nicht aussehen.«
»Das liegt daran«, sagte Ganesh steif, »dass du Holmes bist. Ich bin nur Watson.«
Damit war es entschieden. Er würde den Bowler nicht tragen. Obwohl Ganesh sich nach außen hin gesträubt hatte, in unserem Stück überhaupt mitzuspielen, war er insgeheim sauer, weil er nicht die Hauptrolle bekommen hatte. Wir waren mitten in der ersten Episode künstlerischer Trotzanfälle.
Inzwischen machte uns die Kälte zu schaffen. Freddy hielt nichts davon, Heizungen einzuschalten, wenn sie die Kosten nicht einspielten. Sollte irgendjemand unbesonnen genug sein, den Raum zu mieten, schaltete er die Heizung ein. Bis dahin jedoch war der Raum kalt wie eine Leichenhalle, und die Heizung hatte keine Chance. Vor meinem geistigen Auge sah ich unser Publikum, wenn es je zur Uraufführung kommen sollte, wie es in Übermänteln auf den Plätzen saß. Die Klügeren von ihnen, die den Schauplatz bereits kannten, würden ihre Wärmflaschen mitbringen. Wir hingegen auf der Bühne würden uns durch das Stück zittern. Nur das kraushaarige Mädchen, das auf den Namen Carmel hörte, würde nicht frieren in seiner Rolle als Mrs Hudson mit den dicken Schaumstoffpolstern.
»Mach endlich weiter, Marty«, flehte ich, »bevor wir alle zu Eis erstarren.«
Wir kramten in dem Korb, zogen Dinge hervor, legten sie zur Seite oder wieder zurück. Wir legten mehr zurück, als wir zur Seite legten.
»Igitt«, sagte Carmel. »Das stinkt alles.«
»Es muss nur mal gelüftet werden«, sagte Marty in dem vergeblichen Versuch, unserer Kritik die Spitze zu nehmen.
»Ich werde jedenfalls nichts davon anziehen«, erklärte Carmel. »Bestimmt ist alles voller Flöhe.«
»Na, dann nimm es doch mit nach Hause, und wasch die Sachen, die du tragen willst«, beharrte Marty.
»Ich habe keine verdammte Wäscherei!«, fauchte sie.
»Musst du auch nicht. Nimm es einfach mit zu dem Waschsalon an der Ecke, und steck es in eine von den Maschinen dort.«
»Marty«, glaubte ich sagen zu müssen. »Ich denke nicht, dass dieses Zeug eine Waschmaschine überstehen würde. Es ist alles uralt und brüchig. Es wurde nicht gepflegt, und der viele Schweiß hat den Stoff verrotten lassen.«
»Hast du das gehört?«, kreischte Carmel.
»Es ist aber die viktorianische Periode!«, sagte Marty verzweifelt. »Du und Fran, ihr braucht nichts weiter als lange Röcke und Blusen mit langen Ärmeln. Könnt ihr denn keine langen Röcke auftreiben? Versucht es doch mal im Oxfam-Laden!«
»Ich dachte, wir würden ein wenig Geld mit diesem Stück verdienen und nicht unser Honorar für Kostüme ausgeben«, schmollte Carmel. »Außerdem brauche ich zwei. Ich kann nicht die gleichen Sachen für beide Rollen anziehen – erst recht nicht, wo ich in einer Rolle dick und in der anderen dünn bin!«
Ich zog einen gestreiften Rock und eine dazu passende Jacke mit Keulenärmeln hervor. »Ich nehme das hier mit nach Hause und werde versuchen, es mit der Hand zu waschen«, sagte ich und steckte beides in eine Tesco-Tragetüte.
Martys Stimmung hellte sich sichtlich auf. »Recht so! Komm schon, Carmel … The show must go on, wie man so schön sagt.«
»Wir sind hier nicht im verdammten Palladium«, entgegnete sie. »Ich werde mir ein paar Sachen von Freundinnen leihen … wenn ich kann.«
Wir beließen es dabei. Es gibt immer einen Quertreiber in jeder Gruppe, die ein gemeinsames Projekt angeht. Inzwischen hatten wir alle so ziemlich die Nase voll von Carmel. Sie hatte sich von Anfang an über alles aufgeregt und würde das auch weiter tun, bis zu dem Augenblick, in dem der Vorhang hochging. Letzten Endes würde sie sich überwinden und sich irgendein Kostüm besorgen. Sie war einfach von Natur aus widerborstig.
Manche Leute würden Ihnen wahrscheinlich erzählen, dass das Gleiche auch für mich gilt; aber ich versuchte, Marty zu unterstützen, weil ich sehen konnte, dass er mit den Nerven am Ende war. Er hatte eine Menge Hoffnung und persönliches Engagement in dieses Stück gesteckt, doch selbst die größte Hartnäckigkeit erstarrt irgendwann, wenn es zu kalt ist.
Wir kamen zu einem einstimmigen Entschluss: Wenn wir noch länger hier herumhingen, würden wir alle an Lungenentzündung erkranken. Also stopften wir alles in den Korb zurück bis auf die Dinge, die wir mit nach Hause nehmen wollten. Zögernd steckte Ganesh den Bowler in eine Tüte. Dann trampelten wir die Treppe in die Bar hinunter, wo wir von einem willkommenen Schwall warmer Luft begrüßt wurden.
Das Geschäft ging gut hier unten, auch wenn es im Rose Pub kein Essen außer Nüssen und Chips gab. Freddy hatte ein System mit seinen Chips. Er öffnete einen Karton – beispielsweise mit Käse-und-Zwiebel-Aroma –, und jeder bekam nur diese Sorte, bis der Karton leer war und er den nächsten öffnete, der, wenn man Glück hatte, Salz-und-Essig- oder Barbecue-Geschmack hatte … oder auch nur wieder Käse-und-Zwiebel. Das waren die einzigen drei Geschmacksrichtungen, die Freddy verkaufte. Er verkaufte nicht alle gleichzeitig, weil er der Meinung war, hinter dem Tresen gäbe es nicht genügend Platz, um Kartons mit Chipstüten zu verstauen, die dann doch nur überall im Weg lägen.
Niemand stritt mit ihm deswegen. Freddy war ein beeindruckender Anblick, nicht besonders groß, doch mit dicken Armen und einem Leib wie ein Fass auf Beinen. Die Stammgäste des Rose Pubs hatten einen herzlichen Respekt vor ihm, und da er uns für das Stück bezahlte, hatten wir ganz besonders Respekt vor ihm zu zeigen.
Aber wie auch immer … Freddy und ein muskulöser Barmann mit kahl rasiertem Schädel arbeiteten an diesem Abend ununterbrochen hinter dem Tresen. Sogar Denise, Freddys Frau, war zum Helfen herbeigerufen worden. Ich sage ›sogar‹, weil Freddy normalerweise aus Prinzip keine Frauen hinter die Theke ließ. Denise war die einzige, für die er eine Ausnahme machte, und das auch nur im Notfall. Denise war recht füllig, sodass mit Freddy und dem Barmann kaum noch Platz hinter dem Tresen war. Die drei kamen sich ständig irgendwie in den Weg. Ich sah, dass Freddy nicht die beste Laune hatte. Aber man geht ohnehin nicht in den Rose Pub, wenn es altmodischer Charme ist, den man sucht.
Das Podium unten war an diesem Abend leer, doch trotz der fehlenden Livemusik und klamaukender Komiker war der Laden zum Bersten voll. Die Luft war dick vom Rauch und dem Geruch nach verschüttetem Bier. Noch hatte niemand einen Streit angefangen. Um fair zu sein, wer sich nicht benahm, wurde rasch an die frische Luft gesetzt. Das war einer der Gründe, warum Freddy keine Frauen beschäftigte. Seiner Überzeugung nach waren hinter der Theke Muskeln erforderlich, nicht Glamour.
»Ich muss nach Hause«, sagte Ganesh. »Ich muss morgen ziemlich früh aufstehen, um die Zeitungslieferungen um sechs Uhr anzunehmen.«
Marty sagte, dass er ebenfalls nach Hause müsse und an dem Manuskript arbeiten.
»Schreib ja nichts um!«, flehten wir ihn wie aus einem Munde an. Wir hatten gerade erst die Zeilen entziffert, die er uns gegeben hatte, und damit angefangen, sie auswendig zu lernen.
Er sagte, es ginge darum, die technische Seite zu bearbeiten. Wir ließen ihn ziehen. Nigel und Carmel trotteten zum Tresen, gefolgt von Owen, der den Schurken spielen sollte, und Mick, der den Butler von Sir Henry geben würde sowie jede andere bisher nicht besetzte Rolle. Ich sagte zu Ganesh, dass ich ihn bis zum Laden begleiten würde. Doch ich hatte die Tür noch nicht erreicht, als eine weibliche Stimme meinen Namen quer durch den Raum rief.
»Fran! Geh nicht weg! Ich warte seit fast einer Stunde hier unten auf dich!«
Ich drehte mich um und sah Susie Duke, die auf zehn Zentimeter hohen Absätzen in meine Richtung gestöckelt kam. Tagsüber trägt Susie Jeans und Turnschuhe. Aber wenn sie ausgeht, dann macht sie sich gerne zurecht. Sie trug einen sehr kurzen Rock und einen engen roten Pullover mit Pailletten. Die blonden Haare waren auftoupiert und wurden auf der Rückseite mit einer dieser riesigen Federspangen zusammengehalten. An ihren Ohrläppchen baumelten Ringe so groß wie Armreifen.
»Ich bin weg!«, sagte Ganesh rasch und verschwand.
»Ich habe dich mit deinen Freunden reinkommen sehen«, begrüßte mich Susie, packte meinen Arm und schleppte mich mit sich zu dem Platz, wo sie gesessen hatte. »Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr runter. Was habt ihr die ganze Zeit da oben gemacht? Es ging um dieses Stück, nehme ich an. Komm, beeil dich, oder wir verlieren unseren Tisch.«
Ehrlich gesagt bestand keine Gefahr, den Tisch zu verlieren. Es war ein Nischentisch in einer Fensterecke, und sobald Susie aufgesprungen war, um hinter mir herzurennen, hatte Freddys Hund einen Satz auf die Bank gemacht und sich dort ausgestreckt. Der Hund wurde normalerweise hinten im Hof gehalten. Er war ein massiver, muskulöser Bursche mit einem breiten Schädel, gelben Augen und einem unfreundlichen Gesichtsausdruck. Niemand hatte versucht, ihn von seinem Platz zu vertreiben, und seine Miene sagte uns, dass wir es ebenfalls besser bleiben lassen sollten.
Susie ließ sich jedoch nicht davon beeindrucken. »Los, verschwinde, Digger. Runter da! Du darfst nicht auf die Bänke.«
Digger verdrehte die gelben Augen in ihre Richtung und knurrte.
»Das solltest du lieber nicht versuchen, Süße«, empfahl ein Mann am Nachbartisch. »Gleich beißt er dich.«
»Freddy!«, rief Susie in Richtung Theke. »Schaff deinen Köter von unserem Platz!«
Wenn Susie in Fahrt ist, hat sie eine Stimme wie eine Banshee. Sie war nicht zu überhören. Freddy stieß einen Pfiff aus, und Digger sprang von der Bank und trollte sich.
»So«, sagte Susie und klopfte ihren Sitzplatz wütend mit der flachen Hand ab, um Hundehaare zu entfernen. Damit wirbelte sie jedoch nur eine Wolke alten Staubs aus den Polstern auf. »Setz dich, Fran. Ich besorge uns was zu trinken. Was möchtest du?«
»Ein halbes Pint Lager«, antwortete ich. Ich wusste, dass mir dieser Drink nicht umsonst angeboten wurde. Susie kämpfte darum, ein undichtes Boot namens Duke Detective Agency über Wasser zu halten, und ich hatte das unbestimmte Gefühl, als würde ich darin involviert werden. Ich hatte auch schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, welchen Vorschlag sie mir unterbreiten würde – und war für mich fest entschlossen, dass ich nichts damit zu tun haben wollte.
Susie stöckelte zum Tresen, um unsere Getränke zu holen. Ich setzte mich und beobachtete sie. Ich musste unwillkürlich an unsere erste Begegnung denken. Susie hatte in der Tür ihrer Wohnung gestanden, benebelt vom Gin und voller Zorn und Trauer. Und sie hatte allen Grund dazu gehabt – sie war in Trauer gewesen. Der Gedanke daran ließ ein weiteres Bild in mir aufsteigen, ein sehr unangenehmes: das von ihrem Ehemann Rennie, zusammengesunken über dem Lenkrad seines Wagens, ein Stück Schnur um den Hals gewickelt, das in das rote geschwollene Fleisch eingeschnitten hatte. Ich schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben. Ich kann nicht gerade behaupten, dass meine Sympathie für Susie sich auf ihren verstorbenen Mann erstreckt hätte, einen schmierigen kleinen Privatdetektiv, der kein Talent besessen hatte, sich Freunde zu machen. Doch meine Sympathie für seine Frau bedeutete noch lange nicht, dass ich für sie oder mit ihr arbeiten wollte, wovon ich vermutete, dass sie das vorschlagen würde. Sie hatte das schon einmal versucht.
»Cheers!«, sagte Susie, nachdem wir es uns unter den Augen des wachsamen Digger auf der Bank gemütlich gemacht hatten. Sie hob ihr Glas und prostete mir zu. »Auf das Verbrechen!«
»Es gibt andere Dinge, auf die ich lieber trinken würde«, sagte ich.
Susie schüttelte die blonden Haare, und die riesigen Ohrringe baumelten. »Des einen Eule ist des anderen Nachtigall«, sagte sie. »Du weißt schon, wie ich das meine … sonst hätte ich nichts zu arbeiten. Also dann, Fran.«
Jetzt würde es kommen.
»Hast du noch mal über den Vorschlag nachgedacht, den ich dir gemacht habe?«
»Ja, habe ich«, sagte ich zu ihr. »Versteh mich nicht falsch, Susie, aber ich glaube nicht, dass ich für diese Art von Arbeit gemacht bin.«
»Fang nicht so an!«, schnaubte sie. »Du liebst es, deine Nase in jedes krumme Ding zu stecken, das dir über den Weg läuft!«
Ich sah meine eigenen detektivischen Unternehmungen nicht in diesem Licht und fühlte mich ein wenig beleidigt. »Nur, wenn es mich direkt betrifft«, widersprach ich.
»Wem versuchst du etwas vorzumachen?«, hakte Susie nach. »Du kannst der Versuchung nicht widerstehen.« Sie beugte sich über den Tisch, und ich inhalierte eine Nase voll billigen Parfüms. »Ich brauche dich, Fran. Ich kann das Geschäft nicht alleine führen.«
»Musst du denn in diesem Geschäft bleiben?«, entgegnete ich … dumm von mir, ich weiß.
»Ich habe kein anderes verdammtes Geschäft, oder?«, schnappte sie. »Wer würde mir schon einen anderen Job anbieten, wenn ich zum Amt gehen würde? Ich bin zu alt, Fran. Wenn du keine sechzehn mehr bist, findest du nirgendwo was.«
»Du siehst aber noch großartig aus«, murmelte ich.
»Für mein Alter, sicher«, murmelte sie. »Falls es dich interessiert, ich bin neununddreißig. Auf dem Arbeitsmarkt ist das weit über dem Verfallsdatum. Das solltest du dir besser für deine Zukunft merken.«
Ich wies sie darauf hin, dass ich nicht mal zweiundzwanzig war.
Susie schenkte mir einen sardonischen Blick. »Die Zeit bleibt nicht stehen, weißt du, Fran? Die Regeln sind für dich nicht anders als für alle anderen. Du solltest aufpassen, dass du deinen Kram geregelt kriegst. Und ich rede nicht von diesem Stück, das du mit deinen Freunden probst.«
Ich musste das Stück und meine Teilnahme daran verteidigen. »Du weißt sehr genau, dass ich Schauspielerin werden will!«, sagte ich erregt. »Das Stück mag nicht das beste sein, das je auf die Bühne gebracht wurde, aber wir wollen es so gut machen, wie wir können. Warum kommst du nicht vorbei und siehst es dir an, anstatt es gleich niederzumachen? Du wärst vielleicht überrascht.«
Wenn ich wütend geklungen habe, dann vielleicht deswegen, weil sie einen wunden Punkt getroffen hatte. Wir alle haben unsere Träume, und ich hielt an meinem fest, weil ich nichts anderes hatte. Ich würde ganz sicher nicht das Handtuch werfen und anfangen, für sie zu arbeiten.
»Außerdem habe ich einen Job!«, fügte ich von oben herab hinzu. »In dem neuen Pizzaladen, dem San Gennaro, und das Geschäft blüht, das kann ich dir sagen!«
Susie war nicht beeindruckt. »Ja, sicher. Und wie lange soll das so gehen?«
Diese Frage hatte ich mir selbst auch schon gestellt. »Warum?«, entgegnete ich scharf. »Hast du irgendwas gehört?«
»Nein!«, antwortete sie ein wenig zu schnell. »Aber ich erkenne eine unsaubere Geschichte, wenn ich eine sehe. Eines Tages erscheinst du zur Arbeit und findest den Laden geschlossen vor, oder, wahrscheinlicher, es wimmelt nur so von Bullen. Heute da und morgen fort, diese Art von Laden eben.«
»Unter uns gesagt«, gestand ich ihr, »ich denke genau das Gleiche.«
»Siehst du?«, sagte sie triumphierend. »Du bist schlau, Fran. Als Privatdetektivin bist du ein Naturtalent. Du hast den richtigen Riecher dafür.«
»Aber nicht den Magen. Ich weiß, was für Aufträge Rennie übernommen hat. Ich habe keine Lust, hinter Ehefrauen oder -männern herzuspionieren, die fremdgehen, oder die Kreditwürdigkeit von irgendwelchen Leuten zu überprüfen. Ich drücke niemandem Vorladungen in die Hand, dem ich nicht zu nahe treten muss. Ich laufe mir nicht die Hacken ab und suche in ganz London nach irgendwelchen Zeugen, die nicht gefunden werden wollen!«
»Du wärst aber verdammt gut darin«, beharrte sie. »Du kennst Leute draußen auf der Straße. Sie würden mit dir reden, wo sie sonst schweigen.«
»Sicher. Sie würden mit mir reden. Sie würden mir sagen, wohin ich mich scheren kann. Sie sind schlau genug, um sich nicht als Zeugen zur Verfügung zu stellen, egal wofür. Das nennt man Überleben, Susie. Nichts hören, nichts sehen und nichts sagen, vor allem nichts Böses. Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit ein paar Nachforschungen angestellt, aber nur, weil ich mehr oder weniger dazu gezwungen wurde. Weil irgendetwas passiert war, das ich nicht ignorieren konnte. Ich habe die Nase in Dinge gesteckt, die für mich wichtig waren, und ich habe es auf meine eigene Art und Weise getan. Das ist etwas ganz anderes als die Art von Arbeit, von der du redest.«
Susie blickte nachdenklich drein, doch sie hatte meinen Worten nicht wirklich zugehört. Sie war immer noch darauf fixiert, mich zu überzeugen, und jetzt stand sie im Begriff, ihre Taktik zu ändern. Aus heiterem Himmel fragte sie: »Hast du eigentlich einen Führerschein?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ganesh hat angefangen, mir Fahrstunden zu geben, als er noch den Lieferwagen vom Gemüseladen hatte und wir in Rotherhithe gewohnt haben. Aber heute hat er keinen fahrbaren Untersatz mehr, und deswegen ist das auch vorbei.«
»Ich zeige dir, wie es geht«, erbot sie sich.
»Warum?«, fragte ich.
»Ich bin dir etwas schuldig«, lautete ihre Antwort. »Du hast herausgefunden, wer meinen Rennie umgebracht hat. Dafür schulde ich dir sogar eine ganze Menge. Lass mich dir zeigen, wie man Auto fährt. Besorg dir einen vorläufigen Führerschein, und ich besorge uns ein paar L-Schilder.«
Die Idee klang verlockend, doch sie hatte einen großen Haken. »Was für einen Wagen hast du?«, fragte ich. In Wirklichkeit wollte ich wissen, ob es immer noch der gleiche war, in dem Rennie ermordet aufgefunden wurde. Weil ich nicht in diesen Wagen einsteigen würde, nie im Leben.
Susie begriff sofort, worauf ich hinauswollte. »Ich habe den Mazda verkauft«, sagte sie. »Stattdessen habe ich mir einen hübschen kleinen Citroën zugelegt. Ich habe dir doch erzählt, Rennie hatte eine Lebensversicherung. Ich habe die Police in dieser Porzellankatze gefunden, die er mir Weihnachten geschenkt hat. Er war manchmal eigenartig, mein Rennie. Hatte seine Geheimnisse.« Sie zupfte an ihrem roten Pullover. »Die Versicherungsgesellschaft hat ohne Probleme gezahlt. Siehst du? Ich habe neue Sachen und alles.«
»Ich denke drüber nach«, sagte ich. »Aber im Augenblick habe ich die Proben und meinen Job bei der Pizzeria …«
»Nein, denk nicht darüber nach, tu es einfach.« Susie schob sich vom Tisch weg und stand auf. »Ich muss jetzt gehen. Ich melde mich wieder, Fran.«
Während ich ihr hinterhersah, als sie davonstöckelte, kam mir in den Sinn, dass Susie selbst ebenfalls ziemlich gerissen war. Sie hatte mich mit ihrem Angebot, mir Fahrstunden zu erteilen, in einem unbedachten Moment erwischt. Was auch immer ich erwartet hatte, das war es jedenfalls nicht gewesen. Ich hatte ihr Angebot nicht rundweg abgelehnt, was nach ihrer Lesart bedeutete, dass ich angenommen hatte. Es würde mir schwerfallen, mich da wieder rauszuwinden, ohne ungehobelt zu erscheinen. Außerdem hätte ich gerne einen eigenen Führerschein gehabt. Doch zwischen dem Wenden in drei Zügen und dem Anfahren am Berg würde ich vermutlich eine ganze Menge über die Karrierechancen zu hören bekommen, welche die Duke Detective Agency mir zu bieten hatte.
Kapitel 2
Ich war irgendwie nervös in letzter Zeit, und Probleme wegen des Stücks waren nicht die einzige Ursache dafür. Hatten Sie je das Gefühl, einen großen Irrtum in der Einschätzung von jemand anderem begangen zu haben? Ich bin sicher, Sie kennen dieses Gefühl. Seien Sie nicht zerknirscht deswegen – es ist nur menschlich. »Mach deine Fehler, und lerne aus ihnen«, hat meine Großmutter Varady immer zu mir gesagt. Ich habe ihr natürlich nicht zugehört. Zumindest nicht bei dem Teil, wo es darum ging, aus Fehlern zu lernen. Doch obwohl ich in meinem Leben eine ganze Menge Fehler begangen habe, habe ich im Allgemeinen immer hübsch einen nach dem anderen gemacht. Auf diese Weise blieb immer alles irgendwie zu regeln. Diesmal jedoch stieg das unbehagliche Gefühl in mir auf, dass ich zwei Fehler zur gleichen Zeit begangen hatte. Es lag nur der Hauch einer Andeutung in der Luft, dass die Dinge diesmal außer Kontrolle geraten könnten, doch es reichte aus, dass ich begann, mich zu fragen, ob ich vielleicht den Boden unter den Füßen verloren hatte.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Das Leben war ganz gewiss nicht nur schlecht. Bevor ich angefangen hatte, mich wegen möglicher schlechter Entscheidungen zu sorgen, war ich ziemlich schwungvoll gewesen. Beispielsweise war ich erst kürzlich in eine Erdgeschosswohnung gezogen, die einer gemeinnützigen Wohnstiftung gehörte. Davor hatte ich eine Weile in Onkel Haris unbenutzter Garage kampiert; also war das Gefühl, ein Dach über dem Kopf zu haben, der reinste Segen. Vor der Garage wohnte ich in einer Kellerwohnung, aus der mich ein Wasserrohrbruch vertrieben hat. Und davor hatte ich in besetzten Häusern gelebt. Wie Sie sehen, ist die Geschichte meiner Wohnsitze ein wenig bunt.
Mein Name ist Francesca Varady, genannt Fran. Beständigkeit hat in meinem Leben bisher keine große Rolle gespielt. Meine Mutter ließ mich sitzen, als ich sieben war, und kehrte vierzehn Jahre lang nicht mehr zurück. Ich wurde von meinem Vater und meiner Großmutter aufgezogen. Ich verlor beide im gleichen Jahr, dem Jahr, als ich sechzehn wurde, und seit damals habe ich mich alleine durchgeschlagen. Dad starb zuerst, und weil Großmutter die Mieterin unserer Wohnung war, konnte der Vermieter mich nach ihrem Tod auf die Straße setzen. Die Fortsetzung des Schauspielunterrichts, den ich damals besucht habe, war ebenfalls keine Option gewesen.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wunderbar es für mich war, endlich ein vernünftiges eigenes Dach über dem Kopf zu haben. Ich gewöhnte mich schnell an eine normale Existenz. Ich gewöhnte mich daran, nicht all meine Besitztümer in einer Plastiktüte mit mir herumzutragen. Meiner Hündin Bonnie gefiel die neue Wohnung, weil es einen Garten gab, in dem sie herumtollen konnte. Jeder, der mich in der Wohnung besuchte, sagte, dass ich eine Menge Glück gehabt hätte. Das wusste ich selbst. Das Nomadenleben meines Erwachsenendaseins schien endlich vorüber zu sein. Diese Wohnung war so permanent, wie sie nur sein konnte. Selbst Ganesh billigte sie. Vorausgesetzt, ich stellte keinen Bockmist an, würde sich mein Leben von nun an in geordneten Bahnen bewegen und vorangehen. Doch andererseits, wenn man erst anfängt, so zu denken, bettelt man förmlich um Schwierigkeiten.
Ganesh und ich sind Freunde, seit ich in Rotherhithe in einem besetzten Haus gewohnt habe. Er hat damals bei seinen Eltern gewohnt, die einen Gemüseladen an der Ecke führten. Die Stadtentwicklung hat uns alle von dort vertrieben. Ganeshs Eltern haben einen neuen Laden in High Wycombe eröffnet, aber weil es keinen Platz für ihn gab, musste er zu seinem Onkel Hari ziehen und bei ihm arbeiten. Onkel Hari hat einen Zeitungsladen in Camden. Mich hatte es ebenfalls nach Camden verschlagen, und der große Vorteil war, dass wir nicht weit voneinander entfernt wohnten und immer noch Freunde waren.
Wie um zu beweisen, was für ein normaler Mensch ich von nun an sein würde, hatte man mir einen regelmäßigen Job angeboten, und ich hatte zugesagt. Doch das war der Punkt, von dem ich inzwischen vermutete, er könnte mein erster Fehler gewesen sein.
Wie ich Susie erinnert hatte, arbeitete ich als Kellnerin in einer Pizzeria, die sich San Gennaro nannte. Davor war es ein Imbiss gewesen namens Hot Spud Café, geführt von einem gewissen Reekie Jimmie. Dann war Jimmie eine Partnerschaft mit einem Italiener eingegangen, der eine Kette von Pizzaläden eröffnen wollte. Jimmie war als Manager geblieben und hatte mich als Personal eingestellt.
Ich hatte nichts dagegen, Pizzas zu servieren. Ich hatte auch nichts gegen die ätzende Uniform mit der roten Weste und dem Bauernkostüm – nicht wirklich jedenfalls. Ich kam einigermaßen mit meinen Kolleginnen zurecht. Doch ich war beunruhigt wegen Jimmies Rolle und der ganzen Situation hinter den Kulissen. Da ging irgendetwas vor, das spürte ich in den Knochen. Das war auch der Grund, warum ich so scharf auf Susies Andeutungen reagiert hatte. Sie hatte aus Erfahrung gesprochen, und ich hatte die gleichen Erfahrungen gemacht.
Wenn man sich nahezu acht Jahre lang mehr oder weniger ehrlich durchs Leben schlägt, wie ich es getan habe, entwickelt man ein Gespür für diese Dinge. Man braucht es auch. Jedes Mal, wenn ich den Fuß in das Restaurant setzte, hatte ich das Gefühl, Publikum bei einer Art Zaubershow zu sein, der Art von Show, bei der der Zauberkünstler einem das Mädchen im Schrank zeigt, den Schrank fest verschließt, um ihn herumläuft und gegen die Seiten und den Boden klopft. Das Mädchen ist echt, doch dann, bevor man sich’s versieht, ist es aus dem Schrank verschwunden. Nichts ist, wie es scheint, und man kann sich am Kopf kratzen, so viel man will, man kommt nicht dahinter. Genauso fühlte ich mich beim San Gennaro.
Das Geschäft lief gut, keine Frage. Das Lokal lag in Primrose Hill, hinter der Camden High Street, in der Nähe der Regent’s Park Road. Das ist ein hübscher Name für eine schöne Gegend aus frühen viktorianischen Häusern, die eine urbane Insel bilden, bewohnt von gut situierten Yuppies aus der Medienszene und anderen aufstrebenden Branchen. Jimmies Hot Spud Café war schon immer eine Anomalie in der Gegend gewesen, und die Pizza passte viel besser zum Bedarf der Einheimischen.
Das San Gennaro war jedoch nicht nur irgendeine gewöhnliche Pizzeria. Das alte Café war von Silvio völlig umgebaut worden, dem neuen Partner von Jimmie, der in Wirklichkeit mehr oder weniger alles kontrollierte. Wir hatten eine funkelnde neue Küche, und der Restaurantbereich war fantastisch. Die Wände waren mit wunderschönen, aus Neapel importierten Fliesen verkleidet. Sie waren zu Bildern zusammengesetzt, die eine italienische Gartenlandschaft und im Hintergrund die Bucht von Neapel zeigten, komplett mit Vesuv. Selbst die Toiletten waren gefliest worden, und die Gäste wuschen sich die Hände inmitten der Ruinen von Pompeji. Die Fliesen erregten allgemeine Bewunderung bei der Kundschaft, und nicht wenige erkundigten sich, wo man solche Fliesen erwerben konnte. Das verschaffte Silvio die Gelegenheit, sie an eine Importgesellschaft zu verweisen, von der ich vermutete, dass sie den anderen Teil seiner Geschäftsinteressen darstellte.
Unsere Pizzas waren gut und mussten es auch sein, angesichts der Tatsache, dass sie ein Drittel mehr kosteten als eine Pizza in irgendeinem anderen Laden. Wir hatten auch eine gute Auswahl an italienischen Weinen, nicht nur Hausmarke, weil unsere Kundschaft zu der Sorte gehörte, die meinte, sich mit Weinen auszukennen. Wir hatten inzwischen mehrere Stammgäste und waren angewiesen, diese mit besonderer Zuvorkommnis zu bedienen. Alles sah ganz normal und wohlgeordnet aus. Was also stimmte nicht?
Zum Ersten: Silvio war ohne jeden Zweifel ein ganz gerissener Geschäftsmann. Jeder konnte das sehen. Doch warum sollte so ein Mann riskieren, jemanden wie Reekie Jimmie als Manager eines Ladens mit derart guten Aussichten einzusetzen? Jimmie war ein netter Kerl, zugegeben, ein freundlicher Kettenraucher ohne die geringste Spur von natürlichem Ehrgeiz oder auch nur Talent für das Restaurantgeschäft. Wir alle fragten uns sowieso ständig, wie er überhaupt in dieses Geschäft gekommen war.
Als er mir erzählte, dass er das Hot Spud Café aufgeben würde, war ich nicht weiter überrascht. Ich wusste, dass er von einer Pizzeria geträumt hatte, doch ich hatte nicht wirklich geglaubt, dass er seine Pläne in die Tat umsetzen würde, nicht ernsthaft. Ich hatte geglaubt, er würde weggehen und irgendetwas anderes anfangen, das seinen Fähigkeiten mehr entgegenkam. Fragen Sie mich nicht, was. Es musste einfach irgendetwas geben, worin er gut war. Jeder ist in irgendetwas gut, und sei es noch so unwahrscheinlich. Aber da war Jimmie nun, im Pizzageschäft, genau wie er es angekündigt hatte, und vom finanziellen Standpunkt aus betrachtet ging es ihm sehr viel besser als vorher. Er hatte sich von oben bis unten in schicke neue Sachen gekleidet und lief nun mit einer dunklen Sonnenbrille herum, selbst im Winter. Er sah aus wie einer jener Schieber aus den Filmen der fünfziger Jahre. Das Einzige, was noch fehlte, war ein Schnapprandhut. Ein paar Tage lang hatte er sogar versucht, eine Zigarettenspitze zu benutzen. Ich glaube, er muss Bilder von Noël Coward gesehen haben. Gott sei Dank kam er mit der Spitze nicht zurecht, und sie verschwand wieder. Trotzdem, er sah ganz aus wie ein Mann, dem es finanziell gut ging.
Warum also störte es mich? Warum freute ich mich nicht einfach, dass es dem armen Kerl endlich mal gut ging? Ja, selbstverständlich war ich froh, dass er seine finanziellen Sorgen hinter sich gelassen hatte. Hätten wir das nicht alle gern? Aber Geld hat seine eigene Art, einen für andere Dinge blind zu machen, manche davon wichtig. Es ist verlockend zu sagen: »Hey, mir geht es gut; also rüttele nicht an meinem Boot.« Wer braucht schon schlechte Neuigkeiten und peinliche Fragen, insbesondere, wenn alles rosig aussieht? Doch sobald ich den Blick von dem Geld abwandte, das Jimmie machte, wirkte die Landschaft ringsum völlig verändert und definitiv düster.
Ganesh meinte dazu, ich wäre eine Pessimistin. Er wurde sogar richtig grob. »Du musst schon mehr als nur wieder so ein merkwürdiges Gefühl in den Eingeweiden haben«, sagte er immer wieder. »Wo sind deine Beweise? Zeig mir ein paar Fakten.«
Ich wies ihn darauf hin, dass die Einsetzung von Jimmie als Restaurantmanager für sich genommen schon ein eigenartiger Fakt war. Mehr noch, obwohl er sich Manager nannte, schien er überhaupt nichts zu managen. Er führte keine Bücher, weil dafür jemand vorbeikam. Der gleiche Buchhalter, ein wortkarger, krötenhafter Typ in mittlerem Alter, breit wie hoch, war es auch, der uns am Ende der Woche unsere Lohntüten gab. Mario, der Küchenchef, und Luigi, der Barchef, sagten Jimmie, was er an Vorräten bei wem zu bestellen hatte, und Jimmie tat fröhlich, wie ihm geheißen.
Pietro, der Akkordeonspieler, der abends die Musik machte, und Bronia, Po-Ching und ich, die Kellnerinnen, kamen einigermaßen gut miteinander aus, wie ich bereits sagte. Doch irgendetwas war mit dem Laden, das uns alle irgendwie störte. Wir redeten nie miteinander über Dinge, die die Pizzeria betrafen, nicht einmal eine beiläufige Bemerkung, wie sie Kollegen bisweilen austauschen. Wir redeten über die Art von Themen, über die man redet, wenn man vermeiden will, eine falsche Meinung zu äußern. Popmusik, Fernsehsendungen und Bronias narrensicheres polnisches Hausmittel gegen Erkältungen, welches das Verspeisen von Unmengen von Zwiebeln beinhaltete und das literweise Trinken von Kamillentee.
Es war wie das Arbeiten unter dem alten ostdeutschen Regime, schätze ich, wo man nie hatte wissen können, welcher von den Kollegen einen bei der Stasi anschwärzte. Wir trauten einander nicht über den Weg. Wir hielten die Köpfe unten. Wir machten unsere Arbeit. Wir zeigten keinerlei Interesse an irgendetwas außer dem Entgegennehmen von Bestellungen, dem Servieren von Speisen und dem Abräumen von Tischen. Wir wurden pünktlich bezahlt, und oberflächlich betrachtet war alles in bester Ordnung. Aber insgeheim waren wir alle so nervös wie eine Katze, die sich ins Territorium einer anderen verlaufen hat.
Die beiden anderen Mädchen schienen die Situation gelassener zu nehmen als ich. Wahrscheinlich bedauerten sie, dass ihre Arbeit nicht mehr Spaß machte, doch das war auch schon alles. Was mich betraf, die ich ein besseres Gespür für Gefahr als Bronia und Po-Ching hatte, ich hatte ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, sobald ich mich dem Lokal auch nur näherte. Ich wusste, dass ich nicht dort sein sollte und dass jeden Augenblick der Kater, dem dieses Revier gehörte, hinter einer Blechtonne hervorschießen und mich verprügeln würde.
Pietro, der einmal gesessen hatte und dessen Instinkte genauso geschärft waren wie meine, fühlte sich gleichermaßen unwohl. Ich erkannte es an seiner Körpersprache. Doch wir sagten nie ein Wort. Ich bediente an den Tischen, und Pietro kauerte über seinem Akkordeon, als stünde es zwischen ihm und was auch immer sich dort draußen an Unheil zusammenbraute. Wenn er nicht seine neapolitanischen Medleys spielte, saß er mit dem Akkordeon auf den Knien da und streichelte es, liebkoste die Tasten und redete leise mit dem Instrument wie mit einem Lebewesen.
Wenn das alles gewesen wäre, worüber ich mir Sorgen machen musste, es hätte durchaus gereicht. Doch ich hatte mich zu allem Überdruss auch noch überhastet einverstanden erklärt, bei dem Stück mitzuspielen.
Obwohl ich, wie ich bereits erklärt habe, meinen Schauspielkurs nie abgeschlossen habe, hat mich meine Entschlossenheit nie verlassen, eines Tages Schauspielerin zu werden. Und als Marty, ein alter Freund aus Schultagen, auftauchte und sagte, dass er im Rose Pub ein Stück aufführen würde, nutzte ich die Chance, die sich mir bot, und war dabei. Nicht nur, dass es eine Gelegenheit war, vor einem richtigen Publikum aufzutreten, sondern ich bin auch ein Fan von Sherlock Holmes, und als ich hörte, welches Stück Marty aufführen würde, hatte er mich am Haken.
Seitdem hat meine anfängliche Begeisterung eine Reihe von Dämpfern erhalten. Ich hatte angefangen zu vermuten, dass Marty für das Theater das Gleiche wie Reekie Jimmie für die gebackenen Kartoffeln war. Wir würden am Ende der Proben ein Stück aufführen, schön und gut, doch Gott allein wusste, wie es vom Publikum aufgenommen werden würde.
Am nächsten Morgen hatte ich den festen Entschluss gefasst, Susies Angebot, mir Fahrstunden zu geben, anzunehmen. Es erschien mir töricht, es nicht zu tun. Auf dem Weg zur Arbeit sprang ich beim Postamt rein und holte mir ein Antragsformular für eine vorläufige Fahrerlaubnis. Ich füllte es während meiner Kaffeepause aus, auch wenn mich der schwarz eingerahmte Kasten schreckte, in dem gefragt wurde, ob ich im Falle meines Todes meine Organe spenden wolle. Ich glaubte nicht, dass meine Fahrstunden mit Susie so gefährlich werden würden.
Jimmie kam rein, während ich noch mit Ausfüllen beschäftigt war, und interessierte sich sofort für mein Vorhaben. Er erzählte mir seine ganze motorisierte Geschichte und zählte jeden Wagen auf, den er gehabt hatte, seit er sechs gewesen war – oder zumindest kam es mir so vor. Dann kam auch Luigi hinzu und schwelgte in goldenen Erinnerungen an seinen ersten Wagen und an seinen zweiten … Was ist das nur mit Männern und Autos?
Jimmie wollte wissen, wie viel mich der Führerschein kosten würde. Neunundzwanzig Pfund, antwortete ich. Er fragte, ob ich denn so viel Geld übrig hätte. Ich könnte es so eben zusammenkratzen, erwiderte ich, wenn ich mich ein wenig zusammennahm und sonst nicht viel ausgab. (Aber wann tue ich das nicht?) Er sog die Luft zwischen den Zähnen hindurch, ging davon und kehrte mit dreißig Mäusen aus der Kasse wieder zurück.
»Nenn es einen Loyalitätsbonus, Süße. Du hast hart gearbeitet, und du und dein Freund, ihr wart schon früher gute Stammgäste in meinem alten Kartoffelladen.«
Ein sehnsüchtiger Unterton schlich sich in seine Stimme, als er seinen einstigen Laden erwähnte. Vielleicht nutzte sich der Glanz des Managerlebens allmählich ab? Ich wünschte, er hätte das Wort ›loyal‹ nicht benutzt angesichts der Tatsache, dass ich so viele Hintergedanken wegen der Pizzeria hegte. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er Ganesh nicht meinen ›Freund‹ genannt hätte, weil er nicht mein Freund ist – jedenfalls nicht so, wie Jimmie und viele andere Leute zu glauben scheinen. Ich hätte Jimmie sagen können, dass Ganesh ›nur ein Freund‹ ist, aber das ist ein Ausdruck, den ich nie benutze. Es klingt, als wären Freundschaften nicht wichtig, aber sie halten oft länger als manch eine Beziehung. Ganesh ist der beste Freund, den ich je hatte und wahrscheinlich je haben werde. Ich nehme an, wir könnten etwas anderes aus unserer Freundschaft machen, aber wir wissen beide, dass das ein Fehler wäre. Man soll nicht an etwas herumdoktern, das funktioniert. Abgesehen davon hat Ganeshs Familie sicherlich andere Pläne für ihren Sohn, bei denen ich keine Rolle spiele. Doch das ist etwas, worüber Ganesh nie mit mir redet.
Ich bekam keine Chance, Jimmie das alles zu erklären, weil, wie gesagt, Luigi in diesem Augenblick auftauchte und sich mit seinen Erinnerungen in die Unterhaltung mischte. Abgesehen davon bezweifle ich, dass Jimmie verstanden hätte, was ich ihm sagen wollte. Luigi hätte es ganz bestimmt nicht verstanden, und ich würde nicht den Fehler begehen, Luigi irgendetwas über mein Privatleben zu erzählen. Unser Barmann war ein jugendlich wirkender Typ mit kalten schwarzen Augen, der mich immer an jene schlanken Katzen erinnerte, die man nach Einbruch der Nacht dicht an Mauern gedrängt über Bürgersteige schweifen sieht.
Wie dem auch sei, ich nahm das Geld, füllte mein Formular zu Ende aus und machte, dass ich nach draußen kam.
Sie kennen sicher den alten Witz über die Londoner Busse: Erst wartet man Ewigkeiten auf einen einzigen, und dann kommen drei auf einmal vorbei. Es gibt auch andere Ereignisse im Leben, die diesem Gesetz folgen. Man trottet wochenlang ungestört vor sich hin, und nichts durchbricht die Routine, und dann ist es mit einem Mal so, als hätte eine unsichtbare Hand irgendwo einen Schalter umgelegt, und die Dinge überschlagen sich.
Für mich ist der Tag, an dem ich meinen Antrag auf Erteilung eines vorläufigen Führerscheins abgegeben habe, der Tag, an dem die Dinge anfingen, sich zu überschlagen. Der Topf, der die ganze Zeit über vor sich hin geköchelt hatte, kochte mit einem Mal über – auch wenn mir das im ersten Augenblick nicht bewusst war.
Vielleicht war die unsichtbare Hand, die den Schalter umgelegt hatte, in gewisser Hinsicht Susie gewesen. Ihr Eingreifen in mein Leben, auch wenn es nach außen hin völlig harmlos erschien, hatte Räder in Bewegung gesetzt. Manche Menschen sind einfach so. Wenn sie in der Nähe sind, passieren Dinge.
Kapitel 3
Wie sich herausstellte, sollte es bis zur kommenden Woche dauern, bevor sich der nächste Zwischenfall ereignete. Das Wochenende war angenehm gewesen, kalt, aber klar und sonnig. Am Sonntagnachmittag beschlossen Ganesh und ich, ein wenig für unsere Fitness zu tun. Wir bummelten von Camden Lock am Kanal entlang in Richtung Regent’s Park, wo er mitten durch den Zoo verläuft. Wir konnten die Tiere hören. Die Vögel flatterten in ihren Volieren direkt auf der anderen Seite der Absperrung, und Steinböcke wanderten in ihrem Gehege am anderen Ufer des Kanals hin und her. Familien waren dort unterwegs. Kleine Kinder in bunten Jacken und Wollmützen sprangen durch die Pfützen am Leinpfad. Menschen führten ihre Hunde aus. Wie schön alles aussieht, dachte ich, und wie viel schöner die Dinge doch sind an einem sonnigen Tag. Warum zerbrach ich mir den Kopf wegen Jimmie und der Pizzeria? Es war nichts falsch. Es waren nur die kurzen grauen Wintertage, die meine Fantasie zum Überschäumen gebracht hatten. Ich kam zu dem Schluss, dass ich unter einer Form von Winterdepression litt, bei der der Mangel an Sonnenlicht einen dazu bringt, alles in den dunkelsten Tönen zu sehen, und das Sich-Elend-Fühlen zum Alltag gehört.
Nicht so an diesem Tag. An diesem Tag war alles in bester Ordnung. Selbst Ganesh schien die Auswirkungen des falschen Achtundvierzig-Stunden-Frühlings zu spüren. Er zog ein Blatt Papier aus der Tasche und sagte schüchtern: »Ich habe ein paar neue Sachen geschrieben.«