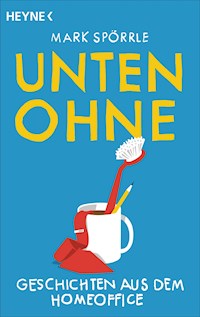
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
»Können Sie mich hören? Hallo? Hallo?«
Paketboten, die während des Meetings Sturm klingeln, Wohnungen, die zu Großraumbüros werden, Router mit Schwächeanfällen, Hunde im Video-Call: Das Büro in den eigenen vier Wänden hält so manche Überraschung bereit. Bestsellerautor Mark Spörrle erzählt irrwitzige Geschichten aus der schönen neuen Arbeitswelt – und er macht ein für alle Mal klar, wer im Homeoffice die Hosen an hat. Nämlich niemand. Zu keinem Zeitpunkt.
Mit vielen farbigen Illustrationen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Ähnliche
Das Buch
Es ist gar nicht so lange her, da quälten wir uns morgens durch den Berufsverkehr, um in einem grauen Büro einer sinnentleerten Tätigkeit nachzugehen. Heute machen wir das einfach von zu Hause aus. Das Homeoffice macht das Leben leichter und ermöglicht uns noch vor dem Duschen faszinierende Einblicke in die Wohnzimmer und Küchen unserer Geschäftspartner. Bestsellerautor und Heimarbeitsveteran Mark Spörrle erzählt irrwitzige Geschichten aus der schönen neuen Arbeitswelt: von stummgeschalteten Mikrofonen, Arbeitsunfällen in den eigenen vier Wänden und der hohen Kunst des Multitaskings.
Der Autor
Mark Spörrle (*1967) arbeitet als ZEIT-Redakteur und verarbeitet die Absurditäten des Alltags in Kolumnen und Büchern. Sein satirischer Ratgeber Senk ju for träwelling – Wie Sie mit der Bahn fahren und trotzdem ankommen und die irrwitzigen Geschichtenbände Ist der Herd wirklich aus? sowie Aber dieses Jahr schenken wir uns nichts! wurden als Best- und Longseller bekannt. Mark Spörrle lebt mit Frau, Tochter und Hund in Hamburg.
Mark Spörrle
UNTENOHNE
Geschichten aus dem Homeoffice
Illustriert von Yves Haltner
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 05/2021
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covermotiv: Yves Haltner, Berlin
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-28398-8V001
www.heyne.de
Inhalt
Unten ohne
Zwei am Schreibtisch sind eine(r) zu viel
Essentials im Homeoffice I:Das Netz
Ich muss Paulmann anrufen
Credibility
Hundstage
Kampf ums Chat-Fenster
Essentials im Homeoffice II:Essen
Coworking Space for free
Fuck the System
Der Feind in meinem Hinterhof
Essentials im Homeoffice III:Harmonie
Gänsehaut! Wir feiern virtuell
Dank
Mark Spörrle – Yves Haltner
Sämtliche Figuren, Vorkommnisse und peinliche Pannen in diesem Buch sind völlig frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig.
Homeoffice – Sie denken, das ist ganz leicht? Nur so tun, als ob man arbeitet, und nebenbei den Garten umgraben, das Bad streichen, endlich mal wieder mit alten Freunden telefonieren oder zumindest sämtliche Socken und Schlüpfer sortieren?
Vergessen Sie’s!
Homeoffice ist anders.
Ganz anders.
Obwohl, das mit den Socken und Schlüpfern sollte man tun.
Man weiß ja nie …
Unten ohne
Ich hatte einen Video-Call mit Kai. Jemanden wie Kai hätte man früher einen »harten Hund« genannt. Heute würde man wohl eher sagen, er sei ein »smarter Typ«. Kai weiß alles, ist immer bestens vorbereitet und stets so perfekt anzogen, als arbeite er permanent im Büro und erwarte jederzeit superwichtigen Besuch. Um ehrlich zu sein, Kai ist nicht nur so angezogen. Er arbeitet auch permanent im Büro und hat jede Menge superwichtigen Besuch.
Ich nicht. Ich arbeite von daheim aus. Und deshalb war ich so frei, das Online-Meeting mit Kai auf morgens acht Uhr zu legen. Nicht ganz fair vielleicht. Aber ich wusste: Jemand wie Kai konnte unmöglich zugeben, dass ihm ein Meeting zu früh angesetzt war.
Ich malte mir aus, wie er im Morgengrauen aufstand, sich eiskalt abduschte und in einen seiner zweiunddreißig schicken Anzüge quälte, um unausgeschlafen ins Büro zu eiern. Vielleicht vergaß er auch genau die Unterlagen, die er dringend für unser virtuelles Meeting brauchte und die er am Abend vorher noch im Bett durchgearbeitet hatte, bis er erschöpft eingeschlafen war. Er musste also noch einmal fluchend zurück, um die Sachen zu holen. Kam in Zeitstress, verpasste die nächste U-Bahn, warf sich in ein Taxi, das im Stau stecken blieb, erreichte mit knapper Not um kurz vor acht die Firma, rannte wie ein Irrer in sein Büro. Und schaffte es, während sein Computer hochfuhr, gerade noch, sein durchgeschwitztes blaues Hemd gegen eines der sieben frischen blauen Hemden in der untersten Schublade seines Schreibtischs zu tauschen. Ich weiß, das klingt jetzt charakterlich zweifelhaft, aber mir half diese kleine Fantasie.
Ich dagegen hatte mich am Vorabend noch gründlicher als Kai auf unser Gespräch vorbereitet. Was mich in meinem Schlafpensum nicht im Geringsten beeinträchtigte, da ich bis kurz vor acht gemütlich im Bett liegen konnte. Dann stand ich auf, wusch und frisierte mich flüchtig und schlüpfte in meine bereit hängende Ausstattung für frühe Video-Calls mit wichtigen Leuten: Weißes Hemd. Schickes blaues Sakko. Unterhose.
Ja, Unterhose.
Mehr braucht man im Homeoffice, ehrlich gesagt, nicht. Ich kannte den Erfassungsbereich meiner Laptopkamera. Und selbst, wenn er sich heimtückisch verstellt haben sollte, oder wenn – was noch nie passiert war und nie passieren würde – die Deckelbefestigung des Laptops plötzlich erlahmte und sich nach vorne neigen würde: Da war immer noch die Tischplatte.
So viel zu den Risiken der Hosenlosigkeit im Homeoffice.
Die Vorteile dagegen, ich hatte das gründlich analysiert, waren enorm: 1. Zeitersparnis. Nicht nur weil der Weg ins Büro wegfiel. Ein durchschnittliches In-die-Anzughose-Schlüpfen inklusive Reißverschluss-und-Knopf-Schließen erforderte bei mir zwischen zehn und dreißig Sekunden, je nach Tagesform, Wetteranfälligkeit, Reißverschlussqualität und Knopflochweite. 2. Unfallprävention. Ich verminderte das gesundheitliche Risiko des Hosenanziehens. Niemand will es zugeben, aber die Arztpraxen sind voll von Männern, die sich beim Hosenanziehen etwas eingeklemmt haben, oder sich verheddert haben und gestürzt sind. 3. Kostenersparnis. Ich hatte keinen Materialverschleiß und sparte Reinigungskosten. Eine Hose, die man nicht trägt, nutzt man nicht ab, muss man nicht waschen, trocknen, bügeln und/oder zur Reinigung bringen und wieder abholen. 4. Der Umweltaspekt! 5. Komfort. Es war ohne Hose einfach luftiger. Ein nicht zu unterschätzender Punkt. An dem Tag, als Kai und ich online aufeinandertrafen, sollten es 25 Grad werden. 6. Nachhaltigkeit. Eine Hose, die man nicht trägt, muss man gar nicht erst kaufen, auch nicht eine Größe größer, wenn man im Homeoffice unversehens zugenommen hat.
Zum Zeitpunkt meines Gesprächs mit Kai hatte ich also drei komplette Anzüge im Einsatz; sowie vier halbe, die lediglich aus einem Sakko bestanden. Und ich fühlte mich gut damit, diese bei Video-Call-Bedarf zwanglos mit einer Vielzahl von Unterhosen zu kombinieren.
Alles, womit Kai im Gegensatz zu mir noch punkten konnte, war, dass er bei unserer Unterhaltung vielleicht etwas wacher sein würde als ich. Weil er beim Rennen erst zur U-Bahn, dann zum Taxi und später durch die langen Flure bis zu seinem Büro seinen Kreislauf gehörig hochgepeitscht hatte. Doch auch auf dieses Handicap hatte ich eine Antwort: Ich machte mir einen doppelten Espresso extra.
Als wir uns dann pünktlich auf die Sekunde vor unseren Monitoren gegenübersaßen, hob und senkte sich Kais Brustkorb wie wild unter dem Sakko und dem sichtlich frischen, noch in Liegefalten geknifften Hemd – yes, ich hatte richtig gelegen!
»Guten Morgen, Kai, wie schön, dass wir reden!« Ich gab ihm keine Zeit, Atem zu holen oder gar schlagfertig zu werden, ging sofort in medias res, denn angeblich wartete schon der nächste Video-Call mit Kais ärgstem Rivalen. In Wahrheit wollte ich im Anschluss mit meiner Familie frühstücken.
Ich gestehe, ich setzte Kai ein bisschen unter Druck. Es ging um eine Kooperation, die für unsere beiden Unternehmen ganz offenkundig vorteilhaft war. Die Frage war nur, für wen der Vorteil ein bisschen größer ausfiel. Wer diktierte die Bedingungen? Der noch immer gehetzt wirkende Kai – oder mein durchs Homeoffice entspanntes, ausgeschlafenes Ich? Während ich von »anderen lukrativen Optionen« faselte, hörte ich meine Liebste in der Küche mit der Kaffeemaschine hantieren.
Und dann nutzte ich die Chance, als mein Handy brummte. Ich nahm den Anruf mit entschuldigender Geste an, bat Kai, eine Sekunde zu warten, und gab vor, »die andere Option« dran zu haben.
»Ich bin überrascht, dass Sie jetzt schon anrufen«, sagte ich dann ins Telefon. »Oh, ich verstehe … ja, das freut mich, das ist natürlich schön, dass Ihnen das wichtig … ach, DIE Chance?! Und wie viel würden Sie … Oh, das ist … vielen Dank, das ist großartig, wunderbar … Ich bin hundertprozentig sicher, die anderen werden Ihr Angebot genauso sehen, und damit können wir wirklich etwas auf die Beine stellen … Das würde mich auch sehr freuen, ich bin sicher, wir sprechen ganz bald …!«
Und während ich dem Anrufer überschwänglich für die weitreichenden Zugeständnisse dankte, signalisierte ich Kai gleichzeitig gestenreich meinen inneren Zwiespalt.
Die echte Anruferin, eine Frau, die sich für unser bei eBay-Kleinanzeigen eingestelltes Treppenschutzgitter interessierte, zweifelte unterdessen erst an ihrem, dann an meinem Verstand.
Kaum hatte ich aufgelegt, winkte meine Tochter Luise durch den Türspalt und signalisierte, dass das Frühstück längst fertig sei.
Ich tat, als ob meine Assistentin mich in den nächsten dringlichen Termin rufen wolle.
Meine Tochter griff sich nur stumm an den Kopf. Dass sie mich peinlich fand, kannten wir beide, das kam bei uns täglich vor. Dass sie allerdings dieses eine Mal die Tür nicht zuknallte (das tun Assistenten schließlich auch nur selten), rechnete ich ihr hoch an.
»Ich muss mich jetzt entschuldigen, lieber Kai«, sagte ich freundlich-geschäftsmäßig. »Du kannst gerne noch mal in Ruhe ein paar Tage über alles nachdenken; das gibt auch mir genug Zeit für die richtige Entscheidung …«
Kai unterbrach mich. Er sagte zu, sofort. Und war mit all meinen Bedingungen einverstanden. Er würde die Vereinbarung sofort nach unserem Telefonat unterzeichnen.
Das Homeoffice hatte gewonnen! Entspanntheit über Ehrgeiz triumphiert! Ich war wie beseelt. Wie im Rausch. Nicht nur mein Tag war gerettet, meine ganze Woche war es, ach, meine gesamte berufliche Zukunft!
Wir waren gerade dabei, den schönen Deal mit ein bisschen Small Talk abzuschließen, als Kai von der Seite sehr effektvoll einen Kaffee serviert bekam. Er erhob seine Tasse und prostete mir lächelnd zu. »Auf unsere Zusammenarbeit!«
Gerade wenn man sich nur digital trifft, darf das Menschliche nicht zu kurz kommen. Kleine Gesten der Verbundenheit sind sehr wichtig, erst recht, wenn man den Sieg davonträgt.
Leider hatte ich keine Assistentin und keinen Assistenten, der mir ebenso eine Tasse reichte, aber die Küche war ja gleich nebenan. »Sekunde«, lächelte ich und federte hoch, »Sekunde!«
Im nächsten Moment fror meine Hand an der Türklinke fest: Im Chatfenster prangte bildfüllend eine Micky Maus.
Die Micky Maus auf meiner Unterhose.
Und ich hörte Kais Lachen.
Es war das Lachen eines Mannes, der wusste, dass er das Spiel doch noch gewonnen hatte.
Zwei am Schreibtisch sind eine(r) zu viel
Von Anfang an nahm ich mir vor, die Sache mit dem Homeoffice gut zu machen. Ich war sicher, ich würde das schaffen. Denn zwei Dinge sind es, mit denen das Arbeiten daheim klappt: Man braucht einen Plan. Und etwas Selbstdisziplin. Wer das hat, kann nicht nur sich selbst organisieren, der kann von daheim aus auch wunderbar mit anderen zusammenarbeiten. Ich muss zugeben, ich hatte weitere Vorteile: den richtigen Job und die richtigen Chefs.
Ich wurde nicht enttäuscht. An den Tagen, an denen ich im Homeoffice war, sparte ich mir den Weg ins Büro, hatte mehr Zeit für die Arbeit und mehr Zeit für die Familie und für mich selbst. Während andere sich noch mit wahnsinnigen Autofahrern, durchgeknallten Radfahrern und irren Fußgängern herumschlugen, saß ich schon am heimischen Schreibtisch, den ich stets sauber und ordentlich hielt. Und natürlich: Ich arbeitete konzentriert und zielgerichtet und bemühte mich stets zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Abends saßen meine Liebste und ich mit dem Laptop auf der Couch und schauten uns im Internet die Clips der armen Trottel an, die ihr Leben im Homeoffice weniger gut im Griff hatten.
Da war der Firmenboss, der seine Videokonferenz aus der Küche leitete, während hinter ihm der Milchtopf überkochte. Keiner seiner Mitarbeiter sagte auch nur ein Wort. Oder der Meteorologe, der sich für seine Wettervorhersage im Anzug auf dem Balkon platziert hatte, als ein Möwenschwarm ihm das Sakko versaute. Am meisten zum Ei machte sich aber dieser Börsentrader. Der hatte zum Arbeiten keinen besseren Ort gefunden als das untere Stockbett im Zimmer seiner Jungs. Die saßen währenddessen auf dem oberen Bett, spielten Fortnite, ließen die Beine in die Kamera baumeln und lästerten vernehmlich über ihren Vater.
»Was hat ihn nur dazu gebracht, das zu veröffentlichen?«, kicherte Lizzy. »Und ist dir aufgefallen, dass sich nur Männer mit solchen Geschichten lächerlich machen?«
Ich wollte dieses Thema nicht weiter vertiefen, allein schon, weil mir keine Frau als Gegenbeispiel einfiel.
»Ob er wirklich kein Arbeitszimmer hat?«, fragte sie weiter.
»Vielleicht hat er eins, und es war besetzt«, vermutete ich.
Sie machte eine kurze Pause. »Habe ich dir schon gesagt«, fragte sie dann, »dass ich morgen auch von zu Hause aus arbeiten werde? Und ich MUSS ins Arbeitszimmer.«
Das war keine gute Nachricht. Das Arbeitszimmer war zwar klein, um nicht zu sagen: winzig. Aber es reichte für einen Tisch und einen Stuhl, und vor allem hatte es eine Tür, die man schließen konnte. An meinen bisherigen Tagen im Homeoffice hatte ich vor allem diese Tür schätzen gelernt. Denn sie schirmte ab. Vor Fragen und Unterhaltungen, vor Getrampel und Gerede aus dem Treppenhaus, vor Klingeln und Klopfen an unserer Wohnungstür, vor den Geräuschen aus den Nachbarwohnungen und von der Straße – egal ob ich schrieb oder mich auf ein Projekt konzentrierte: In diesem Zimmer fühlte ich mich gut. Es gab in unserer Wohnung nur zwei weitere Orte, die als Arbeitsplatz grundsätzlich infrage kamen: der Schreibtisch unserer 13-jährigen Tochter und der Esstisch. Beide waren, vorsichtig gesagt, nicht ideal.
In Luises Zimmer kam ich mir immer vor wie ein Spion; außerdem musste ich mich sehr zusammennehmen, um den Schreibtisch nicht versehentlich aufzuräumen, wenn ich ihn hinter den Kleiderhaufen und Bücherstapeln gefunden hatte. Auch ist es für das eigene Selbstbewusstsein wenig förderlich, wenn das pubertierende Kind aus der Schule kommt und einen so hochkant aus seinem Reich wirft, als sei man tatsächlich ein Spion.
Und am Esstisch in unserem großen Raum, der zugleich als Wohnzimmer und Küche dient, war ich zu sehr mittendrin. Jeder, der unsere Wohnung betrat oder verließ, jeder, der hier wohnte, homeofficte, sich schnell etwas zu trinken holte, wie angestochen ins WC rannte oder jemanden dauerkichernd besuchte (wie die Freundinnen von Luise), musste zwangsläufig hier vorbei. Und natürlich war es dann sehr verlockend, den Am-Tisch-Sitzenden-und-sich-verzweifelt-Konzentrierenden zu fragen, ob er schon mit dem Hund draußen gewesen sei. Ob Herr Tiegs nicht besser am Freitag kommen solle, und wieso man seit Tagen dasselbe Hemd anhabe.
Oder auch nur, meine Liebste war darin eine Meisterin, im Vorbeigehen leise und in äußerst rücksichtsvollem Ton zu sagen: »Ich störe dich NICHT!« Was natürlich störte. Sogar sehr. In der Regel versuchte sie das beim nächsten Mal wiedergutzumachen, indem sie sich zwang, nichts zu sagen. Sondern mich einfach nur ansah. Aber das so bedeutsam, dass ich nicht anders konnte, als zu fragen: »Na gut, verflixt: Wer ist jetzt dieser Herr Tiegs? Und was hat er mit meinem Hemd vor?«
Außerdem grenzte unsere Küche direkt an die Hölle. In der Nachbarswohnung lebte ein Paar, das auf den ersten Blick sehr nett war. Auf den zweiten sprachen sie entweder ungewöhnlich laut, oder die Zwischenwand war ungewöhnlich dünn. Obwohl wir uns nie richtig mit ihnen unterhalten hatten, wussten wir alles über sie: dass er sich als Architekt um Bauprojekte kümmerte; dass sie als Grafikerin arbeitete; was ihre Lieblingsserien auf Netflix waren; was ihre drei Kinder im Alter von drei, fünf und sieben Jahren gerne aßen, tranken, hörten; und vor allem, dass diese Kinder nichts mehr liebten, als zwischen Morgengrauen und Mitternacht in der Wohnung Fangen und Fußball zu spielen und Rad zu fahren – nein, eins lieben sie noch mehr: Fangen und Fußball zu spielen und Rad zu fahren, wenn einer von uns am Esstisch saß, um zu arbeiten.
Es gab also in unserer Wohnung nur einen Ort, wo man sich richtig konzentrieren konnte: das Arbeitszimmer. Aus dem Lizzy mich jetzt vertreiben wollte.
Aktuell, sagte sie, habe sie dringenden Schreibkram zu erledigen. Ich sagte bedauernd, das sei bei mir genauso.
»Kein Problem«, rief sie. »Dann teilen wir uns den Schreibtisch. Jeder setzt sich an eine Seite!«
Und als sie meinen Blick sah, fügte sie hinzu, wir würden selbstverständlich ein Sprechverbot einführen.
»Und ein Verbot für bedeutsame Blicke«, forderte ich.
Das fiel ihr schwer, aber sie willigte ein.





























