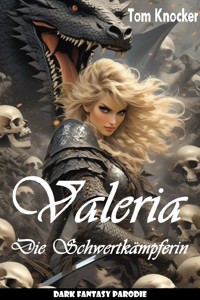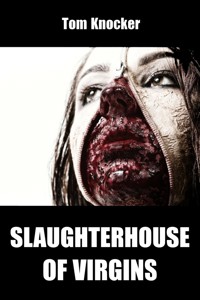0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Valeria schippert mit ihren Gefährten nach Santrilvanien, wo eine besäuselte Halbgöttin über die Weinberge und Volksleute herrscht. Allerdings suchen die Abenteurer einen Paladin, weil er angeblich ihrer verhexten Bogenschützin helfen kann. Er hat sich selber von einem Vampir in einen attraktiven Menschen zurückverwandelt und kann jedes Lebewesen mit einem Ritual reinigen.
Um die Geheimzutaten zu besorgen, müssen die Abenteurer einen verfressenen Troll und Geister aufsuchen. Zudem brodelt die Eifersucht innerhalb der Gruppe. Doch sind wirklich alle lüsternen Vampire ... tot?
Tom Knocker ist ein Pseudonym von Thomas Neukum
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tom Knocker
VALERIA
Die Hüterin der Macht
Dark Fantasy Parodie III © 2024
Inhaltsverzeichnis
Karte
Vorbemerkung
Prolog
Die Küste
St. Sabbelheim
Verschleierungen
Bekanntschaften ohne Marktgeschrei
Eine derbe Hirtenidylle
Zum alten Leuchtturm
Die Bekenntnisse des Paladins
Plausch über die Halbgöttin
Das Sammelsurium
Wandertrieb
Streit ums Bett
Trollheim
Rebengurgel
Königin Bakkiña
Die Palastfeier
Audienz im Schlafgemach
Das Wettessen
Reinste Liebeskrämpfe
Volksaufstand
Zusammen in einem Boot
Expedition unter Wasser
Die Nixen
Nessloch
Rückkehr in den Turm
Die Konspiration
Kulthandlung
Die Entführung
Im Kladdergebirge
Sarglager
Die Blutdämmerung
Stadt der Vampire
Zahn um Zahn
Grauenvolle Zicken
Brandgefährliche Gardisten
Eine unvollständige Evakuierung
Rufus der Tödliche
Sternstunde des Schreckens
Oh, Blutdämonin
Das Ritual der Verwandlung
Epilog
Nachbemerkung
Karte
Vorbemerkung
Unsere Ahnen aus Mesopotamien,Ägypten,Griechenland und dem Römischen Reich vermixten bekanntlich ihre Mythen infolge von Wanderungsbewegungen zu einem aberwitzigen Eintopf. Er kann uns noch heute Bauch- und Kopfschmerzen verursachen.
Götter wurden vermenschlicht, Menschen viehisch und die Sinnenfreuden verteufelt. Ja, wir waren schon immer gut darin, uns mit todernsten Mienen einen fantastischen Quatsch auszudenken.
Wenn man aber erst mal ein Gebäude aus dem Marmor des Unsinns errichtet hat, dann erscheint diese Architekturden Bewohnern von innen heraus logisch. Darin liegt die Gefahr, die wir noch in der Religion und Politik des 21.Jahrhundert erkennen.
Ich wollte diese Thematik nichtsdestotrotz unbekümmertaufs Korn nehmen.Ein winziges Problem hat mir nur die Anrede in den Dialogen bereitet. Völlig unpassend wäre das höfliche Siezen aus den industriellen Beamtenstaaten. Zwar kommt ein kleines „du“ salopp rüber, aber im Grunde lässt sich nureine adlige Person mit großem „Ihr“ ansprechen. Sofern eine Gruppe gemeint ist, habe ich in den meisten Fällen wiederum die Kleinschreibung bevorzugt. Doch das dürfte den Lesefluss weniger beeinträchtigen als ein steifer Zombie.
In diesem Sinne wünsche ich auch mit diesem Teil der Dark Fantasy Komödie viel Spaß!
Prolog
Im Morgengrauen schlurfte ein Zombie mit hoher, schiefer Matrosenmütze über das Schiffsdeck. Das Meer erschien unheimlich still und nebelverhangen.
Vorne am Bug stand der hochgewachsene Nekromant, Shadarzu. Er trug wie jeder Geister- und Totenbeschwörer selbstverständlich einen schwarzen Mantel als Berufskleidung. Dennoch schimmerte sein markantesGesicht hell und freundlich, als er sich umdrehte.
„Eine entspannte Schiffsreise wirkt doch Wunder, und man fühlt sich wie neugeboren, nicht wahr?“, sagte Shadarzu spöttisch zu dem Zombie.
„Uh! Aye“, erwiderte er.
„Kannst du dich deutlicher ausdrücken?“
„Wir luven südöstlich. Erwarte Befehle.“
Tja, der Nekromant schaute zu seinen Gefährten.
Valeria, die eine meisterhafte Schwertkämpferin und seine geliebte Freundin war, strich sich zweifelnd durch ihre blondenHaare. Sie erwiderte den Blick von Shadarzu, bis eine verweste Katze sorglos über das Deck stakste.Was für eine verderbte Muschi, dachte Valeria.
Dann äugte sie zu der verdammt schönen Dunkelelfe, Lyriell. Sie hatte als Bogenschützin schon mehrmals zumÜberleben der Gruppe beigetragen. Doch Lyriell litt unter einer Wesensveränderung, schwieg gerne und verschloss in sich bestimmt nicht nur keusche Gedanken.
Der bärtige Zwergenmönch Olof, der einen Plattenpanzer trug und seinen Streithammer gegen ein Fass lehnte,wusch sich das Gesicht munter mit Bier. Nachdem er gegurgelt hatte, spuckte er die Plörre jedoch über die Reling.
„Pfui Deiwel, viel zu wässrig!“, meinte der Zwergenmönch.Dabei diente er dem tatkräftigen und heilsamen Gottdes Wassers,genannt Okeanos.
Leider machte das auch Olof noch lange nicht zu einemguten Seemann. Er nahm seinenStreithammer, ging aneinem Dutzend herumlatschenderMatrosenleichen vorbei und redete mit Shadarzu. Der Zombie mit der hohen, schiefen Mütze wartete noch immer auf Befehle.
„Südöstlich, hat der da gegrunzt, richtig? Meinem Gefühlnach müssten wir zwar schon am Ziel sein, aber wir sollten den Kurs einfach halten“, sagte Olof zu dem Nekromanten.
„Das Gefühl ist kein fachkundiger Lotse.“
Olof murrte: „Wir hätten doch einen Käpt’n gebraucht.“
„Keine Sorge, ich werde noch einmal den Navigator rufen“, erwiderte Shadarzu.
Er raunte eine Beschwörungsformel und wob Zeichen in die Luft. Sogleich manifestierte sich ein aquamarinblauer Geist mit Kompass.
„Ahoi, wie kann ich helfen, Meister?“, fragte er.
„Ich möchte von dir sicher kein Backrezept für Windbeutel haben. Sag uns einfach, wie weit wir noch von Santrilvanienentfernt sind und wohin genau die untoten Kameraden steuern müssen“, befahl der Nekromant.
Warum machten Shadarzu, Valeria, Lyriell und Olof überhaupt diese skurrile Reise? Nun, die vier Abenteurer hatten in einer anderen Region des Archelands erbittertgegen den Höllenherzog gekämpft. Sie siegten zwar überihn, seine Dämonenhorden und Schergen. Seine kannibalische Komplizin, diese Hexe Ragana, richtete aber vorihrem Tod ein doppeltes Unheil an.
Erstens hatte sieValerias Bauchkettchen zerrissen. Es handelte sich um ein Erbstück ihrer Eltern, die von einem schwarzen Drachen getötet wurden. Die Schwertkämpferinwar schließlich die Tochter eines Königs und seiner Lieblingssklavin. Doch Valerias Bauchkettchen hatte zu allem hin die Magie besessen, den auserwählten Mann der Trägerin stark zu betören und somit die Sexualtriebe von Shadarzu zu revitalisieren. Genau das lag durchaus imInteresse des Nekromanten, weil er sonst unter dem Laster litt, dass er sich zu untoten Schicksen und Schönheiten aus dem Unterreich hingezogen fühlte.
Zweitens hatte die Hexe Ragana jedoch Lyriell verflucht. Denn dieDunkelelfe war ursprünglich eine gutherzige, ja naiveHochlandelfe gewesen. Allerdings gabes Anzeichen dafür, dass sie seit ihrer Verwandlung sadomasochistische Neigungen unterdrückte. Die Dunkelelfen waren für ihre Kaltblütigkeit bekannt und versetzten fast jeden Menschen in Schrecken, wenn sie einmal das Unterreich verließen. In Wahrheit wäre Lyriell unter diesem berüchtigten Volk natürlich eine Fremde gewesen. Doch zugleich hätten die Hochlandelfen sie nicht mehr akzeptiert oder sogar gesteinigt. Zu wem gehört sie also überhaupt?
Valeria empfand auf einer gewissen Ebene sogar Mitleid mit Lyriell. Trotzdem hatte die Dunkelelfe am Gemächt von Shadarzu gelutscht! Na gut, dieser mutmaßliche Vorfall ereignete sich in einer Höhle, die mit Illusionszauberngeschwängert war. Außerdem pennte Olof zu diesem Zeitpunkt, was ihn zu einem denkbar schlechten Augenzeugen machte. Shadarzu versicherte Valeria, dass nichts geschehen sei und er sie unverändert liebte. Doch konnte sie ihm glauben? Die Tatsache blieb, dass ihr zauberhaftes Bauchkettchen zerrissen und damit ihre lebensstrotzende Anziehungskraft auf den Nekromanten vermindert war.
Lyriellkannte entfernt einen Goldschmied der Hochlandelfen, der sich auf die Reparatur von magischen Schmuckstücken verstand. Bevor die Gefährten ihn aber aufsuchen könnten, hatten sie gemeinsam dieses Abenteuer zu bestehen: Sie mussten Lyriell zurückverwandeln.
Darum reisten sie nach Santrilvanien. Nachforschungenzufolge wohnte dort einPaladin, und er konnte jedem Geschöpf diejenige Daseinsform zurückgeben, die ihm ursprünglich vom Leben zugedacht war. Er wandte dieses außerordentlicheRitual bei sich selber an, nachdem ihn ein Vampir gebissen hatte.
Im Gepäck der Abenteurer befand sich ein versteinertes,goldenes Drachen-Ei. Eine Prophetin hatte ihnen aus irgendwelchen Gründen geraten, dieses Relikt als Gastgeschenk für den Paladin mitzunehmen.
Valeria war als Dämonenjägerin mit ihrer Gruppe trotz aller Bescheidenheit auch in den Besitz von genug Dukaten gekommen, um dieses rüstige Segelschiffchen zu kaufen. Wenn es nur nicht so problematisch gewesen wäre, eine Besatzung aufzutreiben! Alle anständigen Seemänner weigerten sich aufgrund von Schauergeschichten, die überdas sogenannte Meer des Unglücks erzählt wurden.
Shadarzu hatte mit Fragen zu unterscheiden versucht, ob die Vorkommnisse in diesen mündlichen Berichten bloß möglich oder wirklich wahr seien, woraufhin alle sagten:„Wirklich möglich!“ Jedenfalls erklärten sich nur geldgierige Draufgänger für die Schiffsreise bereit. Statt derartige Halunken anzuheuern, weckte Shadarzu einige Leichen in den Matrosengräbern auf. Er machtedas andächtig und nicht so grob wie irgendeine Magd mit der Morgenglocke. Diese Zombies waren kostenfrei und furchtlos. Kein Wunder, denn in ihren Hirnresten blühten schon Zwiebeln!
Mit derErlaubnis von Shadarzu übermittelte dafür der Geist desNavigators genaue Anweisungen an die recht marode Mannschaft. „Die Küste mit der Stadt St. Sabbelheim ist nahe“, fügte er hinzu.
Ein Zombie am Steuerrad korrigierte leicht den Kurs. ImAusguck auf dem Hauptmast stand allerdings ein Matrose mit eingetrockneten Augenhöhlen und röhrte durch den Nebel hindurch: „Iiich sehe nix!“
„Du musst mal Augentropfen nehmen“, rief Valeria zurück. Dann sagte sie nachdenklicher zu Shadarzu: „Eigentlich müsste ein Leuchtturm bei diesem Wetter verstärkte Signale senden, oder?“
Urplötzlich heulte einSturm und peitschte das Wasser auf. Der Zombie aus demAusguck stürzte an einem geblähten Segel vorbei, krachte auf die Reling und kippte in die Fluten.
Lyriell hielt sich wie ihre Gefährten fest. „Wo kommt denn auf einmal dieses Unwetter her?“, fragte sie laut.
Shadarzu erwiderte: „In diesem Meer sind Gespenster.“
„Gespenster?“, echote Olof. „Das fällt eher in dein Fachgebiet als in den Zuständigkeitsbereich von mir und Okeanos.“
„Ich kann die Gespenster von einem direkten Angriff abhalten, ja“, rief Shadarzu. Seine rabenschwarzen Haareflatterten. „Aber etwas anderes bereitet mir größere Sorgen. Viel größere!“
Die Dunstfetzen wurden hinweggefegt, und ein Monsterkrake tauchte auf. Seine riesigen Tentakel bewegten sich auf das Schiff zu.
„Du liebes bisschen“, sagte Valeria. Gleichzeitig zogsie ihr blitzendes Langschwert, den Đämønenschlächŧer. „Zugegebenermaßen enthalten diese Schauergeschichten der Seeleute doch ein Fünkchen Wahrheit.“
Da Lyriell alsDunkelelfe levitieren konnte, schwebte sie zwei bis dreiMeter über demSchiff und spannte ihrenBogen. Sie hatte sich vor ihrer Abreise einen magischen Köcher mit einem endlosen Vorrat an durchschlagendenProjektilen besorgt.Pfeil um Pfeil bohrte sich in das knorpelige, schwammige Fleisch des Monsterkraken. Falls erQuietschlaute von sich gab, so wurden sie von dem Brausen des Meeres und dem Knarren des Holzes übertönt.
Valeria war für eine Menschenfrau stark und geschickt, aber der Đämønenschlächŧer verlieh ihr eine übernatürliche Kraft. Mit einem Hieb hackte sie einen Fangarm entzwei. Das Blut spritzte wie aus einem wild gewordenen Schlauch.
Als weitere Tentakel die Schwertkämpferin schnappen wollten, schubste sie einen Zombie vorwärts. Der Monsterkrake packte ihn, stopfte ihn sich in das Maul und verschlang den ranzigen Untoten.
Gleich danach war ein Würgen zu hören. Das Ungetüm kotzte den Zombie schlecht zerkaut wieder aus.
„Pah, du hättest erst mal von dem Dünnbier trinken müssen“, schrie Olof. Er machte sich bereit, mit seinem Streithammer einen ordentlichen Treffer zu landen.
Der Geist des Navigators konnte hier nicht mehr helfen und verschwand, aber es taumelten noch genug Matrosenleichen über das Schiff. Shadarzu scharrte drei um sich und befahl auch den übrigen, ihre Waffen zu heben. Freilich ähnelten sie in ihrem Kampfstil sternhagelvollen Gichtkranken mit Tranchiermessern und Beilen.
Dann schlug der Zwergenmönch mit seinem Streithammer auf einen Fangarm, so dass die ekelbraune Haut aufplatzte. Der Monsterkrake hatte allerdings nie so etwas wie eine Flucht erlernen müssen und geriet stattdessen vor Schmerz in eine blindwütige Raserei.
Ein anderer Fangarm wickelte sich um Olof und hob ihn empor. Auch wenn sein Plattenpanzer robust war, so gab die Rüstung unter dieser Urgewalt doch nach. Der Zwergenmönch wurde fast zerquetscht und brüllte: „Oh, mein Gott!“
Mit einem Rumms landete Olof wieder auf dem Schiffsdeck, nachdem die Schwertkämpferin auch diesen Tentakel abgehackt hatte. Der Zwergenmönch wickelte sich ächzend aus und begann nun ernsthaft, ein Gebet zu sprechen.
Ungeachtet dessen umgriff derMonsterkrake mit seinen verbliebenen Fangarmen denRumpf des Schiffes und drückte zu. Die Planken krachten, Wasser strömte ein, und alles geriet bedrohlich in Schieflage.Sämtliche Zombies schlitterten in die Wogen.
Entsetzt hielt die schwebende Dunkelelfe mit Pfeil undBogen inne, während sich Olof wie auch Shadarzu an dieSeile des Hauptmasts klammerten. Valeria schnappte sichmit erstaunlicherKörperbeherrschung den Beutel, worin das kürbisgroße Drachen-Ei war. Trotzdem …
Das Schiff sank.
Auf einmal tauchte ein noch gewaltigeres Meeresungeheuer mit schimmernden Schuppen auf! Herrje, in ihrer Not hatten die Abenteurer nicht genug Muße, um es genauer zu betrachten. Doch was hätte das noch geholfen? Sie waren scheinbar dem Untergang geweiht.
Völlig unerwartet attackierte das Meeresungeheuer jedoch den Monsterkraken. Er ließ die Schiffstrümmer los,zappelte und wurde in die Tiefe gerissen.
Von einem Moment auf den anderen verschwand das Unwetter. DasMeer plätscherte in idyllischer Ruhe, und der Himmel strahlte azurblau.
Halb hingen, halb saßen die Gefährten mit demDrachen-Ei und allerlei Krimskrams auf den Resten des Schiffes.Lyriell schwebte zu ihnen. Die Gruppe trieb auf den klarerkennbaren Küstenstreifen zu, und gleichwohl wusste die Dunkelelfe gar nicht, was sie dazu sagen sollte.
Dafür klopfte Valeria ihrem Nekromanten einfach mal auf die Schulter. „Alles klar, mein Lieber? Ich frage mich,wem wir die Beruhigung der See denn nun zu verdankenhaben“, erkundigte sie sich zudem bei Olof. „War dasdein Gott Okeanos? Hat er auch dieses Meeresungeheuer für uns geschickt?“
Olof wiegte uneindeutig den Kopf. „Öhm, ich würde sagen, dass es in Santrilvanien auf jeden Fall spannend wird.“
Die Küste
Möwen kreisten über den Abenteurern, als sie auf den Schiffstrümmern mit zersplittertem Mast und verkeiltem Bierfass zum Strand paddelten. Sie schulterten ihre übersichtlich gewordenen Gepäckstücke und stapften nur eine halbe Meile westlich von der Stadt an Land. Während derZwergenmönch erst mal seinen Bart auswrang,blinzelte Lyriell zwischen der Schwertkämpferin und Shadarzu in die Sonne.
Ein dreißigjähriger Fischer mit wettergegerbter Hautund ausgelegten Netzen war in die Beschäftigung vertieft, Schalentiere zu sortieren. Konnte es denn sein, dass sich dazwischen der angeschwemmte Saugnapf eines Monsterkraken und der klappernde Unterkiefer eines Zombies befanden?
Der Fischer rang um Fassung und blickte auf. Sobald er aber die Fremden und unter ihnen eine Dunkelelfe bemerkte, schrie er wie ein Kleinkind. Angst, Unverständnis, Zorn und Machtlosigkeit übertönten einander.
Er rannte weg.
„Die typische Gefühlsäußerung von überzüchteten Vorurteilen“, sagte Shadarzu ruhig zu Lyriell. Der Geister- und Totenbeschwörer kannte sich damit aus, zumal er einHalb-Elf war. Ganz heimisch fühlte er sich weder in dieser noch in jener Welt. Sein Vater war ein menschlicher Fürst gewesen, aber seine Mutter eine elfische Druidin. Äußerlich kam Shadarzu mehr nach seinem männlichen Elternteil und konnte als Mensch durchgehen. Da die Situation für Lyriell verzwickter war, fragte er sie: „Hast du noch deinen Gesichtsschleier dabei?“
„Ja, mich blendet sowieso das Licht.“
Nachdem dieDunkelelfe ihr Gesicht zart verschleiert hatte, seufzte sie. Die Weinberge und ein alter, beschädigter Leuchtturm außerhalb von St. Sabbelheim zeichneten sich ganz deutlich ab.
„Das Klima ist schön warm“, meinte Valeria. „Ich wage zu hoffen, dass wir nicht noch wegen nasser Kleidung geächtet werden und unsere Sachen schnell trocknen. Lasst uns in die Stadt gehen.“
Also spazierten sie zum Hafen.
In einer offenen Lagerhalle wischte sich ein graumelierter Mann über die Stirn. Er trug ein ärmelloses Wams undentrollte ein Pergament, als würde er sich durch eine Inventur quälen. Dabei waren die Kisten in dem Lager nicht unbedingt zahlreich. Der Hafenarbeiter setzte sich mit krummem Rücken und stützte sein Kinn wie ein schwermütiger Philosoph auf die Faust, aber da kamen die Abenteurer vorbei. Sofort erhob er sich wieder.
Olof sagte herzhaft: „Grüß Gott!“
„Hm, welchen?“, fragte der Hafenarbeiter.
„Ich finde, dass sich der Gott des Wassers anbietet.“
„Seid ihr etwa durch den Sturm geschippert?“
Shadarzu nickte. „Ja, es war nicht der reine Spaß.“
„Wo ist euer Schiff?“
„Kaputt“, antwortete Valeria.
„Ich vermute, es war kein Handelsschiff, oder? Für mich seht ihr nicht wie Kaufleute aus“, meinte der Hafenarbeiter. Er musterte vor allem die verschleierte Bogenschützin.
„Kaufleute wären dieses Risiko nicht eingegangen“, wisperte Lyriell hörbar.
„Das stimmt leider.“
Auflockernd sagte Valeria zu dem Hafenarbeiter: „Wirsind nur Abenteuertouristen. Was kannst du uns über dieses schöne Land erzählen?“
„Nun ja, Santrilvanien ist zumindest schöner und ertragreicher als vor zehn Jahren. Reisende wie ihr dürften es auch verschmerzen, dass man hier in keiner Strandbar abhängen kann. Dennoch mangelt es uns Einheimischen an wichtigen Importgütern wie Eisenerz. Manche Geräte sindschon rostig.Darüber hinaus“ – er zögerte – „bekommt das Volk wenigTrauben zu essen.“
„Was?“, platzte es aus Olof heraus. „Hier sind die Weinberge doch so protzig wie grüne Riesen.“
Der Hafenarbeiter rollte nachdenklich sein Pergamentzusammen und drehte es wie einZeigestöckchen in den Fingern. „All der Wein, Milch und Honig sind für unsere Majestät, Königin Bakkiña.“
„Wir haben davon gehört, dass sie eineHalbgöttin ist“,erwiderte Olof. „Trotzdem kann sie mit ihrem Gaumen doch nicht ganze Weinberge liquidieren!“
Der Hafenarbeiter wurde aus irgendeinem Grund vorsichtig oder gelangte einfach zu der Überzeugung, dass er seine ökopolitische Meinung nur wohldosiert äußern sollte. „Wollt ihr zum Palast?“
„Wir schauen uns erst mal die Stadt an“, sagte Valeria.
„Gut, ich will meinerseits nachschauen,ob ich in einerKiste noch ein Heilkraut für den Eigenbedarf habe. Seltsam, dass ein Arbeiter wie ich die Philosophenkrankheit bekommt, nicht wahr?“
„Welche Philosophenkrankheit und was für ein Heilkraut denn?“, fragte der Zwergenmönch.
„Haschisch, es wirkt gut gegen das Denkorgan.“
Shadarzu schmunzelte höhnisch. „Na denn, wir danken vielmals für diesen Gedankenaustausch. Tschüss!“
„Tschüss“, verabschiedete sich der Hafenarbeiter.
Die Abenteurer gingen tiefer in die Stadt.
Auf dem buntscheckigen Marktplatz roch es nach frisch gebackenem Brot, Schafskäse, Räucherfisch,Leder und Schweiß. Die überlebensgroße Goldstatue einer Dame mit Kopfschmuck und gemeißelten Reben stach besonders ins Auge.
Dann trat jedoch eine hübsche Zigeunerin mit rotbraunen Stiefeletten nach vorne, um ihre Gauklerkunst aufzuführen.
St. Sabbelheim
Cynthia, die Zigeunerin, zeigte auf dem Marktplatz einen akrobatischen Säbeltanz. Sie jonglierte mit den beiden Klingen und zwei Orangen gleichzeitig. Behände machte sieaus den Früchten – zack, zack – vier Teile und ließ alle nach einigen Umkreisungen irgendwie in der Luft verschwinden. Außerdem nahm Cynthia eine Fackel, spuckte Feuerund vollführte dabei einen Rückwärtssalto.
Beeindruckt schauten die Abenteurer zu.
Doch die meisten Einheimischen gingen ungerührt ihren Geschäften nach. Waschweiber, Handwerker, Fuzzis aus Amtsstuben und Omis mit Jutesäcken tratschten erbarmungslos.
„Allmählich wird diese Hampelei langweilig.“
„Mein Pudel hat bessere Kunststücke drauf.“
„Stimmt, er kann nach verbrannten Klopsen springen.“
„Was nützt das? Davon werde ich nicht satt.“
„Du bist ohnehin fett.“
„Na, na, der Hochadel frönt ganz anderen Genüssen.“
„Wir sollten mal mit der Hacke am Palast anklopfen.“
„Nicht doch! Es sind nicht alle so.“
„Zumindest ist der Herr von Harribert anständiger.“
„Dieser Affe kann ja nicht mal das ›O‹ aussprechen.“
„›Eine Pörtiön Öliven, bitte.‹“
„Ha-ha-ha!“
„Haltet lieber das Maul.“
„Lern du erst mal kultivierte Vokabeln, du Sauhund!“
Valeria fand es stets interessant, neue Sitten und nette Menschen kennenzulernen. Trotzdem wechselte sie mit ihren Gefährten vielsagende Blicke und ließ mehrere Dukaten in das hingestellte Schälchen der Zigeunerin klimpern. Cynthia bemerkte das natürlich und ließ ein verdutztes Lächeln sehen, bevor sie ihre Aufführung unterbrechen musste.
Denn ein adliger Herr mit Eierkopf, Schnurbärtchen undManschettenknöpfen erschien auf dem Marktplatz. Ihn begleitete ein Geschepper von Schritten auf den Pflastersteinen. Er wollte volksnah wirken und ließ sich mitnichten von der königlichen Garde schützen, sondern von der gewöhnlichen Bürgerwehr.
Diese Gefreiten trugen lottrige Kettenhemden, Eisenschilde, Helme und Schwerter. Lediglich ihr breitschultriger Hauptmann fiel Valeria angenehm auf. Seine blauen Augen hatten trotz seinerSilberrüstung einen so bescheidenen und aufrichtigen Ausdruck.
Obwohl das Volk gerade noch über die Edelleute gelästert hatte, verneigten sich fast alle brav vor dem adligenHerrn mit Manschettenknöpfen. Die Untertanen leierten volltönend eine Grußformel, die ihnen eingebläut worden war: „Ehre dem göttlichen Suff, der Königin und ihrem Puff!“
Der adlige Herr schien diesen Spruch allerdings gar nicht zu mögen und ignorierte ihn verlegen. „Zum Gruße, Volk!“
„Seid gegrüßt, erlauchter Herr von Harribert.“
„Ich stehe hier, weil ich einfach mal nach dem Rechten sehen und eine Pörtiön Öliven will“, verkündete er.
Als er in dem gezwungenen und bedächtigen Schweigen den Hauch eines Kicherns zu hören glaubte, reckte er seinen steifen Hals. Doch sogleich eilte der strubbelige Bursche eines Obst- und Gemüsehändlers herbei, umdem adligen Herrn ganz ergeben ein Schüsselchen mit Oliven zu überreichen.
Der Hauptmann der Bürgerwehr beobachtete mit Wohlwollen den wieder forthuschenden Jungen, aber auch Valeria und ihre Gruppe.Vor allem juckte es Harribert, sie endlich anzusprechen: „Wo kömmt ihr vier eigentlich her? Ihr seid tröpfnass!“
„Das habt Ihr gut bemerkt, aber es handelt sich bloßum den Nebeneffekt einer Reise übers Meer“, antwortete Valeria. Sie spürte, wie Shadarzu sie von der Seite anblickte und ihr nahelegen wollte, die Fragen nicht gleich so spitz zu kontern.
Tatsächlich runzelte Harribert pikiert die Stirn. „Ihr habtnicht körrekt beantwörtet, was ich zu wissen verlangte.“
Valeria wollte durchaus fair sein und diesen adligen Herrn mit seinem Sprachfehler nicht nachäffen. Doch sie störte sich an etwas anderem. „Ihr tut mit Euren herrischenManieren so, als würdet Ihr und gar nicht Königin Bakkiña dieses Land regieren.“
Ein Raunen lief durch die Menge.
„In gewissem Maße trifft das auch zu“, erwiderte Harribert. „Ich bekleide das Amt des Reichskanzlers.“
Das fand sich weder bei den Zwergen noch bei den Elfen. Obwohl Valeria schon einmal davon gehört hatte, gab es auch keinen Reichskanzler in der Monarchie von König Goldspitz, wo sie geboren worden war. Demnachbestand dieses recht unnütze Amt darin, dass man sich mit Geschwätz vor das Volk hinstellte.
Der hochstudierte Nekromant kannte diese Staatsorganisation allerdings besser und erklärte seinen Gefährten: „Ein Reichskanzler wird ernannt, damit er sich um die Regierungsgeschäfte kümmert. Nichtsdestoweniger liegen die endgültigen Entscheidungen bei der Königin, sofern sie das will.“
„Trefflich gesagt“, lobte Harribert hochnäsig. „Wenigstens ein Individuum in dieser kömischen Gruppe hat einen Happen Bildung genössen. Es steht trötzdem fest, dass ihr aus einer diversen Barbarei kömmt.“
Olof motzte: „Mal abgesehen davon, dass ich einem frommen Orden angehöre, entstamme ich einer Zwergensippe mit erstklassigen Eisenminen und Brauereien. Wir haben auch sehr gute Barbiere, aber als Barbar lasse ich mich nicht beschimpfen.“
„Gött bewahre, das habe ich auch nicht getan!“
„Und ob Ihr das getan habt“, beharrte Olof.
„Ihr reißt meine Aussage aus dem Köntext und missversteht mich. Die Sippen der Zwerge sind bei uns aufgrund ihrer Tugenden wie beispielsweise Fleiß stets willkömmen. Mich beschäftigt aber eine andere Frage. Ähem“, räusperte sich Harribert und deutete auf Lyriell. „Weshalb verschleiert sie da ihr Gesicht? Wenn ihr schon Königin Bakkiña erwähnt,sölltet ihr wissen, dass sie Wert auf die Freiheit der Frauen legt.“
„Ich trage diesen Schleier freiwillig“, betonte Lyriell. Ihre melodiöse und leicht dunkle Samtstimme machte Eindruck auf die Menschen ringsum. „Meine Augen und meine Haut sind einfach lichtempfindlich.“
„Willst du behaupten, dass du vön edler Blässe bist?“
„N-nein, ich …“
„Bei allem Respekt“, sagte Shadarzu und kam damitLyriell zu Hilfe,„die Mode einer lichtempfindlichen Damegeht einen Reichskanzler wirklich nichts an.“
Valeria fügte hinzu: „Steckt Eure Nase lieber in Eure grünen und schwarzen Oliven.“
Das Gekicher in der Menge wurde lauter.
„Welch' Unverschämtheit!“, echauffierte sich Harribert.
Quer über den Markplatz krakeelte auf einmal der Fischer, der vorden gestrandeten Fremden weggerannt war:„Sie ist mir vorhin ohne Gesichtsvorhang begegnet und eine böse DUNKELELFE!“
Verschleierungen
Erschrocken wich die Mehrheit vorder Gruppe mit derverhüllten Dunkelelfe zurück. Cynthia, die Zigeunerin, verharrte dagegen mit ihren Säbeln aufmerksam in halber Entfernung. Der Hauptmann der Bürgerwehr blieb sogar noch näher bei den Abenteurern stehen, was auch Harribert undden Gefreiten wieder Mut verlieh.
„Wenn der Vörwurf wahr ist, dann geht mich diese Damenmöde ausSicherheitsgründen sehr wöhl etwas an“, sagte der Reichskanzler.Also fragte er Lyriell in einem schon verurteilenden Ton: „Verschleierst du, dass du eine Dunkelelfe bist? Rede!“
„Ich bin keine … echte Dunkelelfe.“
„Söndern eine falsche, wie? In dem Fall beherrschst auch du die Gauklerkunst“, höhnte Harribert. Sein fragwürdigerHumor war so trocken wie Knäckebrot. Daraufhin sah er sich nach dem Fischer um. „Wö ist der Zeuge?“
Jemand rief: „Er ist schon wieder durch eine Seitengasse abgehauen wie ein Krebs.“
„Das Verhalten von heute ist nicht löbenswert“, ärgertesich der Reichskanzler. Damit wandte er sich erneut an Lyriell. „Beweise, dass du nichts zu verstecken hast, und lüfte deinen Schleier!“
„Ich will aber nicht.“
„Männer“, befahl Harribert, „nehmt ihr denSchleier ab!“