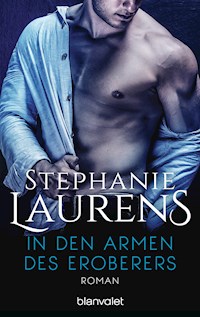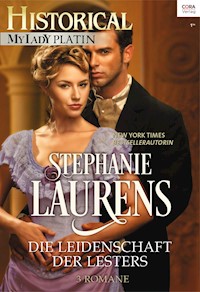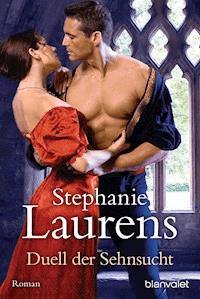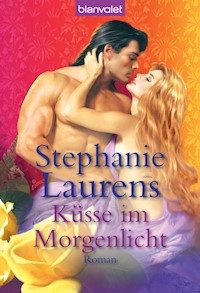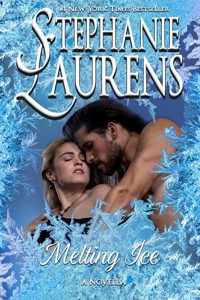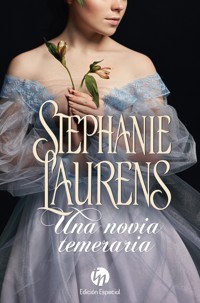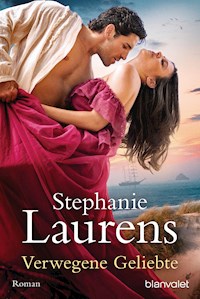
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frobisher
- Sprache: Deutsch
Eine eigensinnige Lady und ein unwiderstehlicher Gentleman bringen die Seiten zum Glühen!
England 1824: Kapitän Royd Frobisher hat sich als Seefahrer bereits einen Namen gemacht und will nun die Mission, die seine Brüder begonnen haben, erfolgreich abschließen. Allerdings stellt sich dies als schwieriges Unterfangen heraus, denn Royd wird dabei ausgerechnet von seiner Jugendliebe Isobel Carmichael begleitet. Die attraktive Frau verfolgt ihre ganz eigenen Pläne: Sie möchte nicht nur ihre verschwundene Cousine finden, sondern auch Royd zurückgewinnen. Als die beiden auf hoher See in große Gefahr geraten, sind sich Isobel und Royd tatsächlich bald näher als erwartet. Und müssen entscheiden, wie viel sie bereit sind, füreinander zu riskieren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
England 1824: Kapitän Royd Frobisher hat sich als Seefahrer bereits einen Namen gemacht und will nun die Mission, die seine Brüder begonnen haben, erfolgreich abschließen. Allerdings stellt sich dies als schwieriges Unterfangen heraus, denn Royd wird dabei ausgerechnet von seiner Jugendliebe Isobel Carmichael begleitet. Die attraktive Frau verfolgt ihre ganz eigenen Pläne: Sie möchte nicht nur ihre verschwundene Cousine finden, sondern auch Royd zurückgewinnen. Als die beiden auf hoher See in große Gefahr geraten, sind sich Isobel und Royd tatsächlich bald näher als erwartet. Und müssen entscheiden, wie viel sie bereit sind, füreinander zu riskieren …
Autorin
Stephanie Laurens begann mit dem Schreiben, um etwas Farbe in ihren wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Bücher wurden bald so beliebt, dass sie ihr Hobby zum Beruf machte. Stephanie Laurens gehört zu den meistgelesenen und populärsten Liebesromanautorinnen der Welt und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne, Australien.
Von Stephanie Laurens bereits erschienen
Ein feuriger Gentleman · In den Armen des Spions · Eine stürmische Braut · Ein süßes Versprechen · Ein widerspenstiges Herz · Stürmische Versuchung · Ein sinnliches Geheimnis · Triumph des Begehrens · Duell der Sehnsucht · Eine ungezähmte Lady · Gespielin der Liebe · Meisterin der Verführung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Stephanie Laurens
Verwegene Geliebte
Roman
Deutsch von Christiane Meyer
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Lord of the Privateers« bei MIRA Books, Canada. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Savdek Management Proprietary Limited Published by Arrangement with Savdek Management Pty Ltd Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Helen Hotson; sefoma) und RomanceNovelCovers.com
dn · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN 978-3-641-20826-4 V002 www.blanvalet.de
Prolog
AberdeenAugust – September 1824
Royd Frobisher stand in seinem Büro, von wo aus er einen Blick auf den Hafen Aberdeens hatte, am Schreibtisch und las noch einmal den Befehl durch, den er soeben erhalten hatte.
Bildete er es sich nur ein, oder klang Wolverstone besorgt?
Im Laufe der Jahre, in denen der Duke England als Kommandant der Agenten gedient hatte, hatte Royd viele solcher schriftlichen Aufträge bekommen. Die Wortwahl des heutigen Schreibens offenbarte jedoch die unterschwellige Unruhe und Besorgnis des für gewöhnlich so entschlossenen und besonnenen Mannes. Es war entweder Sorge oder Ungeduld – allerdings zählte Letzteres nicht zu dessen Schwächen.
Obwohl Royd viele Jahre jünger war als Wolverstone, hatte er sich vom ersten Moment an mit ihm verstanden. Sie waren Gleichgesinnte. Royd vermutete, dass er einer von Wolverstones wichtigsten Kontakten war, damit der Duke auch während seines Ruhestandes weiterhin über die Machenschaften informiert wurde, von denen die meisten Menschen im Königreich keine Ahnung hatten.
Royd las die knappen Zeilen, mit denen ihm aufgetragen wurde, sein Schiff, The Corsair, das momentan vor seinem Fenster im Wasser lag, nach Southampton zu bringen, damit es dort mit Vorräten beladen werden konnte und bereit war aufzubrechen, sobald die Nachrichten seines jüngsten Bruders Caleb aus Freetown ihn erreichten.
Was das hieß, war unmissverständlich. Wolverstone erwartete eine direkte Reaktion. Und das bedeutete, dass er, Royd, umgehend nach Westafrika aufbrechen und die nötigen Schritte unternehmen musste, um König und Land zu schützen.
Die Verpflichtung, König und Land zu schützen, war etwas, das Royd und Wolverstone teilten.
Und noch etwas hatten sie gemeinsam: die instinktive Fähigkeit, Situationen richtig einzuschätzen. Wenn Wolverstone besorgt war …
»Ich muss da jetzt rein.«
Die Stimme ließ Royd aufhorchen – mehr noch als die Worte ihn alarmierten.
»Ich werde mal nachfragen …«
»Ich muss ihn auf der Stelle sehen. Treten Sie zur Seite, Miss Featherstone.«
»Aber …«
»Keine Widerrede. Entschuldigen Sie mich.«
Royd hörte, wie sich jemand mit energischen Schritten näherte. Angesichts dessen konnte er sich lebhaft vorstellen, wie seine Sekretärin, eine Frau mittleren Alters, neben dem Empfangstresen stand und verzweifelt die Hände rang. Dabei war Gladys Featherstone eine Einheimische – sie müsste eigentlich wissen, dass Isobel Carmichael, wenn sie so außer sich war wie in diesem Augenblick, wie eine Naturgewalt war, die niemand aufhalten konnte.
Nicht einmal er.
Er hatte die Wand, die sein Büro vom Vorzimmer trennte, umbauen lassen, sodass der verglaste Teil erst gut einen Meter achtzig oberhalb des Bodens begann – also in seiner Augenhöhe. Wenn er an seinem Schreibtisch saß, zog er es vor, nicht von Leuten gesehen werden zu können, die vorbeikamen und mit dem Gedanken spielten, spontan die Zeit des Geschäftsführers der Reederei Frobisher zu vergeuden. Wenn Besucher ihn nicht sehen konnten, mussten sie zuerst Gladys fragen, ob er da war.
Doch er hatte am Schreibtisch gestanden, und Isobel war nur ein paar Zentimeter kleiner als er. Genauso wie er durch die Glasscheibe die Pfauenfeder auf ihrem Hut sehen konnte, die bei jedem ihrer energischen Schritte wippte, konnte sie bestimmt einen Teil seines Kopfes sehen.
Abwartend dachte er darüber nach, was sie so aufgewühlt haben mochte. Er war sich sehr sicher, es gleich zu erfahren.
In der ihr typischen Art riss Isobel die Tür auf, blieb dramatisch auf der Schwelle stehen und fixierte ihn. Durch diesen Augenkontakt, das instinktive Ineinanderverschmelzen ihrer Blicke, die Intensität der Verbindung, zog sich sein Magen zusammen, und weiter unten rührte sich etwas.
Vielleicht war es nicht weiter verwunderlich, wenn man mal über ihre Vergangenheit nachdachte. Aber jetzt …
Sie war fast einen Meter achtzig groß und von schlanker Statur. Wenn sie ihr Haar offen trug, umrahmten die blauschwarzen Locken ihr Gesicht und fielen ihr über die Schultern bis auf den Rücken. An diesem Tag jedoch hatte sie es zu einem Knoten zusammengewunden. Sie blitzte ihn mit ihren Augen, die die Farbe bittersüßer Schokolade hatten, unter ihren wundervoll geschwungenen schwarzen Wimpern hervor an. Ihr ovales Gesicht war blass, die Haut makellos. Ihre Lippen waren für gewöhnlich voll, gerade allerdings fest aufeinandergepresst. Anders als andere wohlerzogene Frauen schwebte sie nicht anmutig durch den Raum. Ihre Bewegungen wirkten zielstrebig und kraftvoll. Sie hatte die majestätische Haltung einer Amazone.
Ganz leicht neigte er den Kopf. »Isobel.« Als sie ihn daraufhin nur wortlos anblickte, zog er eine Augenbraue hoch. »Welchem Umstand verdanke ich diesen unerwarteten Besuch?«
Isobel Carmichael starrte den Mann an, von dem sie geglaubt hatte, mit ihm umgehen zu können. Sie hatte sich eingeredet, es aushalten zu können, gefühlsneutral in seiner Nähe zu sein, da sie kein professionelles Anliegen hatte. Sie hatte sich eingeredet, dass die Dringlichkeit ihrer Mission die übliche Reaktion auf ihn außer Kraft setzen würde – die Reaktion, die sie nun mit allen Mitteln versuchte, nicht zu zeigen.
Doch sein Anblick hielt sie mit eisernem Griff gefangen. Allein der Klang seiner tiefen Stimme – so tief, dass sie in ihrem Inneren vibrierte – brachte ihren Verstand ins Wanken. Und was das Hochziehen seiner Augenbrauen und seinen dennoch so intensiven Blick betraf, mit dem er sie fixierte …
Warum hatte sie keinen Fächer mitgenommen?
Sie biss innerlich die Zähne zusammen und zwang sich dazu, ihre körperliche Reaktion zu ignorieren. Ein Scheitern kam nicht infrage, und sie war bereits in sein Büro gestürmt. Zu ihm.
In seine Nähe, die sie immer so überwältigte.
Seine Locken, die fast genauso schwarz waren wie ihre, umrahmten sein Gesicht. Und dieses Gesicht würde sogar den Teufel selbst vor Neid erblassen lassen. Royd hatte eine breite Stirn, schwarze Augenbrauen, ausgeprägte Wangenknochen und ein energisches Kinn. Die Wirkung wurde durch den ordentlich gestutzten Bart, den er seit Kurzem trug, noch verstärkt. Was seinen Körper betraf … Selbst wenn er still stand, verströmte er eine männliche Stärke, die niemandem, der Augen im Kopf hatte, entgehen konnte. Er hatte breite Schultern, lange muskulöse Beine, und seine Bewegungen strahlten Eleganz aus, trotz der Lässigkeit, mit der er seine Kleidung trug. Seine Augen, die schon viel zu viel gesehen hatten, waren noch immer auf ihr Gesicht gerichtet. Und sie wusste, wie sündhaft seine Lippen waren.
Sie drängte den Aufruhr in ihrem Inneren endgültig zurück, holte tief Luft und sagte kurz und bündig: »Du musst mich nach Freetown bringen.«
Er blinzelte verwirrt, was ihr komisch vorkam. Eigentlich konnte ihn so gut wie nichts überraschen – zumindest zeigte er es nicht.
»Freetown?«
Mit einem Mal schien seine Anspannung mit Händen greifbar zu sein. Sie war sich sicher, dass er plötzlich extrem angestrengt wirkte.
»Ja.« Sie runzelte die Stirn. »Das ist die Hauptstadt der Kolonie Westafrika.«
Sie hatte angenommen, dass er das wusste, weil er die Stadt schon des Öfteren besucht hatte.
Sie betrat das Büro. Ohne den Blick von ihm abzuwenden, schlug sie seiner aufgeregten Sekretärin und allen anderen Besuchern im Vorzimmer die Tür vor der Nase zu.
Er legte den Brief, den er gelesen hatte, auf die Schreibunterlage. »Was willst du ausgerechnet dort?«
Als wären sie zwei gefährliche Tiere, die sich beide davor hüteten, den anderen aus den Augen zu lassen, wandte auch er den Blick nicht von ihr ab.
Sie blieb stehen, wo sie war. Der breite Schreibtisch zwischen ihnen beruhigte sie. Sie hätte sich auf einen der hochlehnigen Stühle vor dem Schreibtisch setzen können, doch vielleicht würde sie im Laufe dieses Gesprächs gezwungen sein, laut zu werden, und im Stehen schimpfte es sich besser.
Natürlich würde er sich, wenn sie stehen blieb, ebenfalls nicht hinsetzen. Blieb nur der Schreibtisch zwischen ihnen.
Sie war groß, doch trotzdem musste sie den Kopf ganz leicht in den Nacken legen, um ihm in die Augen blicken zu können – in diese Augen, die die Farbe eines aufgewühlten Ozeans und des stürmischen Himmels über Aberdeen hatten. In diese Augen, mit denen er sie so eindringlich, mit so vielen Emotionen ansehen konnte. Wenn sie geschäftlich miteinander zu tun hatten, verbarg er diese Eindringlichkeit, diese Empfindungen stets.
Allerdings war das hier kein geschäftlicher Besuch. Ihren Auftritt hatte sie so inszeniert, dass das eindeutig war – und Royd Frobisher hatte genügend Erfahrung damit, ihre Zeichen zu deuten.
Ihr Mund war mit einem Mal trocken. Glücklicherweise hatte sie sich die passenden Worte schon zurechtgelegt. »Wir haben gestern Nachricht erhalten, dass meine Cousine zweiten Grades – Katherine Fortescue – in Freetown vermisst wird. Sie hatte eine Anstellung als Gouvernante bei einer englischen Familie namens Sherbrook. Es sieht so aus, als wäre Katherine bereits vor einigen Monaten verschwunden, als sie für die Familie etwas auf der Poststation zu erledigen hatte. Mrs Sherbrook hat es erst jetzt ermöglichen können, einen Brief zu verfassen, um unsere Familie darüber zu informieren.« Noch immer hielt sie seinen Blick gefangen, hob nun ihr Kinn ein Stückchen an. »Wie du dir sicher denken kannst, ist Iona mehr als beunruhigt.« Iona Carmody war Isobels Großmutter mütterlicherseits und das unangefochtene Oberhaupt des Carmody-Clans. »Iona war unglücklich darüber, dass wir zu spät vom Tod von Katherines Mutter erfahren haben, um sie davon überzeugen zu können, zu uns zu kommen und bei uns zu leben. Katherine fasste den Entschluss, es allein zu schaffen. Deshalb nahm sie die Stelle als Kindermädchen in Freetown an. Als ich damals nach Fortescue Hall kam, war sie bereits abgereist.«
»Fortescue Hall … das liegt bei Stonehaven, ungefähr fünfzehn Meilen südlich von Aberdeen, richtig?«, fragte Royd.
Sie nickte. »Also muss ich jetzt selbstverständlich nach Freetown reisen, Katherine suchen und sie nach Hause bringen.«
Royd hielt ihren Blick weiter fest. Obwohl er an ihrem Plan nichts »selbstverständlich« fand, kannte er die Funktionsweise des matriarchalischen Carmody-Clans gut genug, um ihr ungeschriebenes Drehbuch zu befolgen. Isobel empfand es als ihr persönliches Versagen, dass sie nicht schnell genug gewesen war, um ihre Cousine aufzuhalten und in den sicheren Schoß der Familie zu führen. Und da Iona nun »beunruhigt« war, sah sie es als ihre Pflicht an, diesen Fehler wiedergutzumachen.
Sie und Iona standen sich nah. Sehr nah. So nah, wie nur zwei Frauen sich stehen konnten, die sich in besonderem Maße ähnlich waren. Viele Leute sagten über Isobel und Iona, dass der Apfel nun einmal nicht weit vom Stamm fiel. Deshalb verstand er, warum Isobel glaubte, es wäre ihre Aufgabe, Katherine zu finden und nach Hause zu bringen. Das hieß jedoch nicht, dass sie selbst nach Freetown reisen musste.
Vor allem nicht, da die Chancen sehr gut standen, dass Katherine sich unter den Entführten befand, zu deren Rettung er schon sehr bald entsandt werden würde.
»Es trifft sich, dass ich demnächst nach Freetown segeln werde.« Er sah nicht auf Wolverstones Brief. Nur ein kleines Zeichen, und Isobel wäre fähig, sich auf das Schreiben zu stürzen und es zu lesen. »Ich verspreche dir, dass ich deine Cousine finden und sicher nach Hause bringen werde.«
Isobels Blick ging ins Leere. Sie dachte über den Vorschlag nach, um dann – entschieden und beinahe trotzig – den Kopf zu schütteln.
»Nein.« Angespannt sah sie ihm in die Augen. »Ich muss selbst fahren.« Sie zögerte und bekannte missmutig: »Iona möchte, dass ich das persönlich übernehme.«
Acht Jahre waren vergangen, seit sie über etwas anderes als das Geschäft gesprochen hatten. Nachdem ihre Verlobung gelöst worden war, hatte sie ihn zuerst einmal gemieden, als hätte er eine ansteckende Krankheit. Erst als der wirtschaftliche Druck für sie beide zu groß geworden war, war sie gezwungen gewesen, wieder mit ihm zu reden. Denn er hatte mit der Werft ihrer Familie zusammenarbeiten müssen, um die Neuerungen, die er für die Flotte der Frobishers vorgesehen hatte, umsetzen zu können, und sie und ihr Vater waren nach dem wirtschaftlichen Niedergang infolge des Krieges auf die Frobisher-Reederei als Kunden angewiesen gewesen, um sich über Wasser halten zu können.
Wie zu erwarten gewesen war, arbeiteten sie ausgesprochen gut zusammen. Sie ergänzten sich in vielerlei Hinsicht einfach perfekt.
Er war Ingenieur. Er segelte so oft unter verschiedenen Bedingungen, dass ihm immer wieder auffiel, was sich in Sachen Sicherheit und Geschwindigkeit an den Schiffen noch verbessern lassen konnte.
Sie war eine brillante Planerin. Sie konnte seine Ideen aufnehmen und ihnen Struktur geben. Und er arbeitete dann daran, wie man sie technisch umsetzen konnte.
Allen Widrigkeiten zum Trotz und obwohl man es ihr nicht zugetraut hätte, war es ihr gelungen, die Werft als Geschäftsführerin zu leiten. Die Arbeiterschaft verehrte sie. Die Männer hatten miterlebt, wie sie von dem kleinen Mädchen, das übers Hafengelände getobt war, zu einer Geschäftsfrau herangewachsen war. Und sie betrachteten sie als eine von ihnen. Ihr Erfolg war auch der Erfolg der Männer, sie arbeiteten für sie, wie sie für keinen anderen Firmenleiter arbeiten würden.
Mit seinen technischen Plänen organisierte sie die Arbeitsschritte und besorgte die nötigen Bauteile. Dann brachte er das entsprechende Schiff, das er verändern lassen wollte, zu ihrer Werft.
Und was danach geschah, grenzte an Zauberei.
Gemeinsam verbesserten sie stetig die Leistung der Frobisher-Flotte. Einer Schifffahrtsgesellschaft sicherte das das Überleben. Im Gegenzug erarbeitete sich die Werft der Familie Carmichael aufgrund ihrer beispiellosen Arbeit an führender Position im Schiffbau einen extrem guten Ruf.
Auch wenn ihr Umgang miteinander angespannt blieb, waren sie geschäftlich gesehen ein ausgesprochen effizientes und höchst erfolgreiches Paar.
Dennoch hatte sie ihn im Laufe der vergangenen Jahre während ihrer zahllosen Treffen immer auf Distanz gehalten. Sie hatte ihm nie die Möglichkeit gegeben, sie zu fragen, was zum Teufel vor acht Jahren passiert war, und mit ihr darüber zu reden. Damals war er von einer Mission zurückgekehrt, und seine zukünftige Braut, von der er monatelang geträumt hatte und die er zum Altar hatte führen wollen, hatte ihm ins Gesicht gesagt, dass sie ihn nicht mehr sehen wolle, und ihm dann die Tür des Hauses ihrer Großmutter vor der Nase zugeschlagen.
Sie hatte ihm nicht die Chance gegeben, ein persönliches Gespräch mit ihr zu führen – auf der intimen Ebene, auf der sie früher so gut harmoniert hatten. So intuitiv, so frei, so offen. So direkt. Nie in seinem ganzen Leben hatte er mit einem anderen Menschen – egal, ob Mann oder Frau – so geredet wie mit ihr.
Er vermisste das.
Er vermisste sie.
Und er musste sich fragen, ob sie ihn auch vermisste. Keiner von ihnen beiden hatte geheiratet. Wenn man dem Klatsch und Tratsch Glauben schenken konnte, hatte sie keinem der zahlreichen Verehrer, die bereit gewesen waren, um die Hand der Erbin der Carmichael-Werft anzuhalten, auch nur den Hauch von Interesse signalisiert und sie schon gar nicht ermutigt.
Es hatte ihn nur Sekunden gekostet, sich die Vergangenheit ins Gedächtnis zu rufen. Unabhängig von dieser Vergangenheit stand sie nun in seinem Büro und war bereit, dafür zu kämpfen, ein paar Wochen an Bord von The Corsair verbringen zu dürfen.
Wochen an Bord des Schiffes, dessen Kapitän er war. Wochen, in denen sie ihm nicht würde aus dem Weg gehen können.
Wochen, in denen er bestimmt Gelegenheit bekommen würde, sie zu einem Gespräch zu überreden, um die Situation zwischen ihnen endlich zu bereinigen, damit sie loslassen und nach vorn blicken könnten.
Oder um das wiedergutzumachen, was schiefgelaufen war, und es noch einmal zu versuchen.
Als Reaktion auf sein Schweigen hatte sich ihr Blick verfinstert. Er wusste immer noch, was sie dachte. Von allen Frauen, die er im Laufe der Jahre kennengelernt hatte, war sie die Einzige, die in Erwägung ziehen würde, ihm eine Szene zu machen – und zwar eine leidenschaftliche Szene, die sich gewaschen hatte. Ein Teil von ihm hoffte tatsächlich …
Als hätte sie seine Gedanken erraten, verengte sie die Augen zu schmalen Schlitzen. Sie presste erneut die Lippen aufeinander. Dann sagte sie ganz ruhig: »Du bist es mir schuldig, Royd.«
Zum ersten Mal in den acht Jahren seit ihrer Trennung hatte sie gerade seinen Namen in diesem vertrauten Tonfall ausgesprochen, der noch immer sein Herz berühren konnte. Mehr noch: Es war der erste Bezug, den sie seit damals zu ihrer Vergangenheit herstellte.
Und er war sich noch immer nicht sicher, was sie meinte. Was war er ihr schuldig? Wofür? Ihm fielen einige Antworten ein, von denen allerdings keine genügend Licht auf die Frage warf, die ihn in den vergangenen acht Jahren beschäftigt hatte.
Zwar war er sich nicht sicher, ob es so klug war, dem Impuls, den er verspürte, zu folgen, aber der Drang war so stark, dass er nachgab und einfach handelte.
»The Corsair legt mit der morgendlichen Flut ab. Du müsstest vor Tagesanbruch am Anleger sein.«
Sie sah ihm eindringlich in die Augen und nickte dann kaum merklich. »Danke. Ich werde da sein.«
Damit machte sie auf dem Absatz kehrt, marschierte zur Tür, öffnete sie und rauschte hinaus.
Er sah ihr hinterher, dankbar, dass sie die Tür nicht wieder geschlossen hatte, sodass er den Schwung ihrer Hüften beim Gehen noch etwas genießen konnte.
Hüften, die er einst hatte festhalten dürfen, als er in ihre feuchte Hitze gedrungen war …
Als ihm aufging, welches Unbehagen ihm seine eindrucksvoll lebhaften Erinnerungen bereiteten, knurrte er missmutig. Gladys Featherstone starrte ihn an, als würde sie eine Zurechtweisung erwarten.
Er gab ihr ein Zeichen. »Sie müssten ein paar Briefe für mich rausschicken.«
Er ging zu seinem Schreibtisch zurück und ließ sich in den Sessel sinken, wartete, bis Gladys, die sich offenbar beruhigt hatte, auf einem der Stühle Platz genommen und den Notizblock auf ihre Knie gelegt hatte. Dann sammelte er sich und begann, den ersten von vielen Anweisungen zu diktieren, die nötig waren, damit er Aberdeen lange genug verlassen konnte, um nach Freetown und wieder zurück zu segeln.
Um die Mission zu einem Ende zu bringen, die zu erfüllen der Marineminister Melville ihm durch Wolverstone hatte auftragen lassen.
Und um herauszufinden, welche Möglichkeiten es für ihn und Isobel Carmichael noch gab.
Der Tag war noch fern und die Dämmerung nur eine Andeutung am fernen Horizont, als Isobel die Planken von Aberdeens Hauptkai betrat. In ihrem grauweißen Reisekleid, das ein eng geschnittenes Mieder, lange, geknöpfte Ärmel und einen Tellerrock hatte, sowie dem bis zur Taille reichenden pelzbesetzten Cape über den Schultern, fühlte sie sich bereit für die Zeit auf See. Eine ordentliche Haube mit breiten lilafarbenen Bändern, die sie fest unter dem Kinn verknotet hatte, weiche Glacéhandschuhe und passende halbhohe Stiefelchen vervollständigten ihre praktische Reiseausstattung. Sie war schon oft gesegelt, allerdings unternahm sie für gewöhnlich nicht so lange Reisen.
Sie hielt inne, um sicherzugehen, dass die Bediensteten, die ihre drei großen Koffer schleppten, ihr folgten. Dann drehte sie sich wieder um und ging weiter.
In regelmäßigen Abständen hatte man Leuchtfackeln aufgestellt, deren loderndes Licht die Szenerie erhellte. Der Geruch von brennendem Harz und die Würze des Rauchs, der sacht aufstieg, wurden vom Duft des Meeres übertroffen – von den Gerüchen nach Salzwasser, Fisch, feuchtem Stein, modrigem Holz und Hanf.
An den Liegeplätzen der Frobisher-Flotte herrschte schon reges Treiben. Hafenarbeiter stapften mit Fässern und Ballen auf den Schultern über den Kai, während Seeleute Taue und schwere Rollen von Segeltuch die Landungsstege hinaufschleppten. Sie war die Lautstärke gewöhnt und hörte nicht auf die groben Bemerkungen und Flüche der Männer. Mutig ging sie auf das imposanteste der Schiffe zu. Sie kannte dessen Besonderheiten sehr genau. The Corsair war eines von zwei Schiffen der Frobishers, die gerade vorbereitet wurden. Über dem Seitendeck des Flaggschiffs der Reederei erspähte Isobel Royds dunklen Haarschopf. Sie hielt kurz inne und genoss den Anblick einen Moment lang, ehe sie sich umdrehte und die Bediensteten anwies, ihre Koffer den Seeleuten zu übergeben, die auf dem Landungssteg warteten.
Es überraschte sie nicht, dass diese sofort zu Hilfe eilten. Den Männern am Kai und auf den Schiffen war ihr Gesicht bekannt – genauso wie ihnen Royds Gesicht bekannt war. Schon in Kindertagen hatten Royd und sie unzählige Stunden im Hafen und auf der nahen Werft verbracht. In jenen längst vergangenen Zeiten war der Hafen Royds persönliches Reich gewesen, während es für sie die Werft gewesen war. Als Royds Interesse am Schiffbau erblüht war, er war ungefähr zehn oder elf Jahre alt gewesen, hatte er sich auf die Werft geschlichen und war mehr oder weniger über sie gestolpert.
Zuerst hatten sie einander nicht gekannt, und jeder hatte auf eigene Faust alles erkundet. Royd war manchmal von einem seiner Brüder begleitet worden. Sie dagegen war immer allein gewesen, das einzige Kind eines führenden Unternehmers. Sie war ein Wildfang gewesen und hatte sich viel mehr für die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten interessiert, die für den Schiffbau nötig waren, als dafür, das Handarbeiten zu erlernen. Obwohl sie Royds Eindringen in ihre Domäne anfangs misstrauisch und sogar ein bisschen spöttisch beäugt hatte – sie hatte nämlich sehr schnell herausgefunden, dass er auf diesem Gebiet nicht annähernd so viel Ahnung hatte wie sie – , hatte er schnell begriffen, dass sie als James Carmichaels einziges Kind Zugang zu jeder Werkstatt und zu jedem Schiff auf der Werft gehabt und dass keiner der Arbeiter ihre Fragen ignoriert hatte.
Royd war ihr von dem Moment an auf Schritt und Tritt gefolgt. Und nachdem ihr klar geworden war, dass er als ältester der Frobisher-Brüder Zugang zur gesamten Flotte der Reederei Frobisher hatte, hatte sie sich ihm ebenfalls an die Fersen geheftet.
Von Beginn an hatte ihre Beziehung auf gegenseitigem Fortkommen gefußt, auf der Wertschätzung dessen, was der andere hinsichtlich der Möglichkeit, weiterzukommen und zu gewinnen, mitgebracht hatte. Sie waren beide begierig gewesen, durch die Türen zu gehen, die der andere aufhalten konnte. Sie hatten sich schon damals gegenseitig ergänzt. Als ein Paar hatten sie einander befähigt, intellektuell zu erblühen.
Sie hatten sich ermutigt. Bezogen auf Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Leidenschaft, waren sie einander sehr ähnlich gewesen.
Und sie waren es noch immer.
Isobel sah zu, wie ihre Koffer an Bord gebracht wurden, und bereitete sich innerlich darauf vor, ebenfalls aufs Schiff zu gehen. Das hier war genau das, was sie wollte, was nötig war – sie musste mit Royd nach Freetown reisen, um Katherine zurückzubringen. Das hatte oberste Priorität. Und danach …
Als sie Iona über ihr Vorhaben informiert hatte, Royd zu bitten, sie mit nach Freetown zu nehmen – ihn notfalls unter Druck zu setzen – , hatte ihre Großmutter sie einige Sekunden zu lange angeschaut, sodass es schon fast unangenehm gewesen war, hatte dann leise geschnaubt und gesagt: »Wir werden sehen.« Als sie aus Royds Büro zurückgekehrt war und von ihrem Erfolg erzählt hatte, hatte Iona schließlich gesagt: »Da er zugestimmt hat, schlage ich vor, dass ihr die Auszeit während der Reise dorthin und – wenn nötig – auch noch die Rückreise nutzt, um zu klären, was zwischen euch ist.« Sie hatte den Mund geöffnet, um weiterhin darauf zu bestehen, dass es nichts zu klären gäbe, doch Iona hatte ihr mit erhobener Hand bedeutet zu schweigen. »Du weißt, dass ich nie mit ihm einverstanden war. Er ist eigenwillig und unangepasst. Er hört nur auf sich selbst, und das war schon immer so.« Iona hatte das Gesicht verzogen und ihre knorrigen Hände auf dem Knauf ihres Gehstocks verschränkt. »Aber dieser Zustand, in dem ihr euch beide befindet – als wäre ein Teil eures Lebens auf unbestimmte Zeit abgesperrt, blockiert – , kann so nicht weiterbestehen. Keiner von euch hat auch nur die geringste Neigung gezeigt, jemand anderen zu heiraten. Um eurer beider willen: Ihr müsst die Sache klären, bevor ihr in euren Gewohnheiten zu festgefahren werdet. Denn das würde ich mir weder für die Frobishers noch für dich wünschen. Das Leben allein zu verbringen, ist kein erstrebenswerter Zustand. Ihr beide müsst zusammen entscheiden, ob da noch etwas zwischen euch ist. Und wenn nicht, müsst ihr die Realität akzeptieren, müsst nach vorn blicken und weitergehen.«
Iona hatte ihren Blick gefangen gehalten, und Isobel war nicht in der Lage gewesen, ihr zu widersprechen. Obwohl es viel leichter gesagt als getan war, die Sache zwischen Royd und ihr zu klären, hatte sie anerkennen müssen, dass Iona recht hatte: So wie es war, konnte es nicht weitergehen.
Doch etwas gab Isobel zu denken: Ionas Reaktion auf Royds Zustimmung zu Isobels Vorhaben und die Tatsache, dass Royd noch nicht einmal mit ihr darüber gestritten hatte. Sie fragte sich, warum er sich so verhalten hatte. Hatte er irgendwelche Hintergedanken, die sie betrafen? Dass sie keine Hinweise darauf bemerkt hatte, bedeutete ja nicht, dass es diese Hintergedanken nicht gab – nicht bei Royd.
Sie sah zum Schiff hoch, nickte den wartenden Bediensteten zum Abschied noch einmal zu, holte Luft, als wollte sie sich innerlich wappnen, hob die Röcke an und ging den Landungssteg hinauf. Sie konnte nicht verstehen, warum Royd keine andere Frau geheiratet hatte. Wenn er geheiratet hätte, wäre auch ihr weiterer Weg klar. Aber er hatte es nicht getan. Und genau deshalb sah sie sich nun der Notwendigkeit gegenüber, ihre gemeinsame Vergangenheit zu verbannen, damit ein für alle Mal Ruhe herrschte.
Das war das Nebenziel, das sie auf dieser Reise erreichen wollte – sie wollte die Hoffnungen, die sie in ihren Träumen verfolgten, vernichten und ihrem inneren, noch immer sehnsüchtigen Selbst klarmachen, dass es wirklich und wahrhaftig keine Chance auf eine Versöhnung zwischen ihnen beiden gab.
Er hatte ihr die Ehe versprochen, hatte sie und ihr Bett drei Wochen lang gewärmt und war anschließend für dreizehn Monate auf eine Reise gegangen. Bis auf seine anfängliche Beteuerung, dass er nicht länger als ein paar Monate wegbleiben würde, hatte sie nichts mehr von ihm gehört.
Und dann, ohne Vorwarnung, ohne eine Erklärung, war er zurückgekehrt. Er hatte von ihr erwartet, dass sie ihn mit offenen Armen empfangen würde. Überflüssig zu erwähnen, dass er sich da mächtig geirrt hatte. Sie hatte dem Mann mit dem schönen Gesicht erklärt, dass sie ihn nie mehr wiedersehen wolle.
Schön ist der, der Schönes tut. Ein Motto von Iona. Isobels Meinung nach hatte sie dieses Motto gelebt, aber wie die vergangenen acht Jahre gezeigt hatten, hatte es kein gutes Ende genommen. Und aus irgendeinem verfluchten Grund hatte ihre Faszination für Royd trotzdem nicht abgenommen. Sie musste diese Reise nutzen, um ihr naives, sehnsüchtiges Selbst, das ihn einst von ganzem Herzen geliebt hatte, davon zu überzeugen, dass Royd Frobisher nicht mehr der Mann ihrer Träume war.
Sie musste diese Reise nutzen, um auch das letzte Überbleibsel von tief in ihr verborgener Hoffnung auszuradieren.
Um den Kern ihrer damals so großen Liebe auszulöschen.
Sie hob den Kopf – und sah direkt in Royds Gesicht. In ebenjenes Gesicht, von dem sie sich von ganzem Herzen wünschte, dass es keine Macht mehr über ihre dummen, dummen Sinne haben würde.
Bis es so weit war, schien noch ein weiter Weg vor ihr zu liegen, denn prompt vollführte ihr Herz einen Salto, und ihre Sinne waren mit einem Schlag hellwach – nur, weil er in der Nähe war.
Und er machte alles noch schlimmer und komplizierter, indem er ihr die Hand reichte.
Sie war sich ziemlich sicher, dass er es bewusst tat, um sie zu prüfen. Um auf seine typische provokante Art zu versuchen herauszufinden, was sie auf dieser Reise vorhatte. Ob sie darauf bestehen würde, ihn weiterhin kühl auf Distanz zu halten, wie sie es immer getan hatte, wenn sie zusammen gesegelt waren, um eine Neuerung an einem Schiff zu testen, oder ob sie anerkennen würde, dass diese Reise anders war. Dass es hier um etwas Persönliches ging und nicht nur um das Geschäft.
Mitgefangen, mitgehangen.
Wenn sie die Reise nutzen wollte, um zu klären, was zwischen ihnen war, konnte sie ihre Vorsätze auch direkt in die Tat umsetzen.
Sie wappnete sich innerlich, sammelte sich und riss sich zusammen, ehe sie ihre behandschuhte Hand in die seine legte. Und als er seine Finger – besitzergreifend – um ihre legte, drängte sie ihre Reaktion auf die Berührung entschlossen beiseite.
»Willkommen an Bord, Isobel.« Er neigte den Kopf.
Als er sie losließ, konnte sie endlich wieder atmen. Sie nickte majestätisch. »Danke noch einmal, dass du zugestimmt hast, mich mitzunehmen.« Sie hob den Blick und sah ihn an. »Ich weiß, dass du es nicht hättest tun müssen.«
Die Art, wie er die dunklen Augenbrauen hochzog, sagte alles.
»Käpt’n …« Royds Quartiermeister, der mit dem Rücken zu ihnen gestanden hatte, um der Mannschaft Befehle zum Setzen der Segel zuzurufen, drehte sich um. Als er sie sah, grinste er und deutete eine Verbeugung an. »Miss Carmichael. Es ist immer ein Vergnügen, Sie an Bord zu haben, Miss.«
»Danke, Williams.« Sie kannte die gesamte Mannschaft, und jeder der Männer kannte sie. Die Männer segelten schon seit Jahren mit Royd. Sie warf Royd einen Blick zu. »Ich ziehe mich mal zurück, damit ich nicht störe.«
Er wies zum Achterdeck. »Wenn du an Deck bleiben willst, bis wir auf See sind, bist du da oben am wenigsten im Weg.«
Sie pflichtete ihm mit einem Nicken bei und ging zur Leiter. Royd folgte ihr, aber er kannte sie gut genug, um ihr zu erlauben, allein die Stufen hinaufzuklettern. Sie war es gewohnt, sich an Deck zu bewegen, auch wenn sie lange Röcke trug.
Sie spürte seinen Blick im Rücken, bis sie das Achterdeck erreicht hatte. Dort stieg sie von der Leiter und sah zurück. Royd war schon wieder zu Williams gegangen, und die beiden diskutierten, welche Segel sie für die Ausfahrt aus dem Hafen setzen wollten. Sobald sie auf offener See wären, würden sie so gut wie alle hissen, doch das Schiff aus dem Hafenbecken und durch die Mündung des River Dee zu lenken, erforderte viel Fingerspitzengefühl und weniger Kraft. Dank der Verbesserungen, die sie und Royd gemacht hatten, war The Corsair unter vollen Segeln das schnellste Schiff seiner Klasse – noch ein Grund, warum sie ihn gebeten hatte, sie nach Freetown zu bringen. Ganz abgesehen von der Geschwindigkeit war sie begierig darauf zu erleben, wie die Veränderungen, die sie bisher nur auf kurzen Testfahrten erlebt hatte, sich auf längeren Reisen auswirken würden.
Sie löste den Blick von Royds dunklem Haarschopf und betrachtete das Hauptdeck. Nach allem, was sie erkennen konnte, waren sie bereit abzulegen. Liam Stewart, Royds Stellvertreter, der am Steuerrad stand, blickte in ihre Richtung und lächelte.
Sie erwiderte das Lächeln und nickte ihm zu. »Mr Stewart.«
»Miss Carmichael! Willkommen an Bord. Ich habe gehört, dass Sie mit uns zusammen nach Afrika fahren.«
»Das stimmt. Ich habe in Freetown etwas zu erledigen.« Ihr wurde bewusst, dass, wenn Royd dort gewesen war, auch Stewart den Ort kannte. »Ich nehme an, dass Sie die Siedlung schon einmal besucht haben.«
Stewart nickte. »Wir waren schon einige Male im Hafen, aber nicht in den vergangenen Jahren.« Er sah sie entschuldigend an. »Da die Siedlung noch relativ jung ist, wird sich einiges verändert haben, seit wir zuletzt dort waren.«
Sie verzog das Gesicht, aber Stewart war nicht der Mann, der an ihrer Seite sein würde, wenn sie sich in die Siedlung vorwagen würde, um ihre Cousine zu suchen.
»Ich muss jetzt die Ruder prüfen. Royd und ich machen das normalerweise zusammen, aber …« Mit einem Kopfnicken wies Stewart das Schiff entlang. »Er ist damit beschäftigt, die Takelage neu einzustellen. Würden Sie gern einspringen und seinen Part übernehmen?«
»Nichts lieber als das. Es wäre mir ein Vergnügen.« Zielstrebig ging sie auf ihn zu. Sie blickte ihm in die aufgerissenen Augen, mit denen er sie ungläubig anstarrte. »Keine Angst, ich werde nicht über Bord gehen.«
Er grinste verlegen und überließ ihr das Steuerrad. Während sie es drehte und kurz in den üblichen Stellungen hielt, prüfte er, ob das Ruder frei reagieren konnte.
Als sie fertig waren, rief Royd: »Leinen los!« Er schritt über das Deck und kam die Leiter herauf. Oben angekommen, richtete er sich auf und sah sie am Steuer stehen.
Sie genoss kurz seine Überraschung, dann trat sie zur Seite und wies auf den leeren Platz. »Das Steuer gehört Ihnen, Käpt’n.«
Royd warf ihr einen irritierten Blick zu, doch in dem Moment, als seine Hand das glatte Eichenholz des Steuers berührte, war er augenblicklich hochkonzentriert. Die Taue waren gelöst. Er sah Liam Stewart an, der sich an seine Seite neben das Steuerrad stellte.
»Also gut, Stewart – dann wollen wir mal.«
Stewart grinste. »Aye, aye, Käpt’n.«
Isobel hielt sich an der Reling fest und sah zu, wie Royd mit Stewart, der ihn lotste, The Corsair vom Anlegeplatz lenkte. Dazu nutzte er nur das Focksegel.
Als er das Schiff an den anderen Schiffen vorbei im Hafenbecken in Segelstellung brachte, ließ er weitere Segel setzen, aber gab ihnen nur so viel Spiel, dass das Schiff ganz langsam vorwärtsglitt. Kurz darauf sahen sie die Mündung des River Dee vor sich. Royd ließ die Hauptsegel setzen. Dann folgten die Toppsegel und Bramsegel und schließlich die Royalsegel …
Mit einem Mal fühlte es sich an, als würde das Schiff sich ein Stückchen aus dem Wasser heben. Und es wurde tatsächlich ein wenig angehoben, als die Segel vom Wind gebläht wurden und das Schiff Fahrt aufnahm.
Isobel spürte, wie der Wind an ihrer Haube zerrte. Sie schob sie zurück, auf diese Weise konnte sie das Gefühl der Geschwindigkeit, den Nervenkitzel, besser genießen.
Und sie wurden noch schneller, als die Himmelssegel sich entfalteten.
Sie lauschte mit halbem Ohr den schnell aufeinanderfolgenden Befehlen, ein Segel straffzuziehen und ein anderes zu lockern, als das Schiff, das inzwischen schon weit vom Ufer entfernt war, in Richtung Süden krängte.
Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er kurz zu ihr herüberschaute.
Das hatten sie schon immer geteilt und teilten es offensichtlich noch – diese Liebe zum Meer, die Freude daran, über die Wellen zu jagen, den Wind zu nutzen und sich von ihm mitnehmen zu lassen.
Ein weiterer Faden in dem Netz, das sie noch immer verband.
Sobald Royd das Schiff aus der Flussmündung ins offene Meer gelenkt und das Gefühl hatte, dass die Segel richtig gesetzt waren, übergab er für gewöhnlich das Steuerrad an Liam. Liam übernahm meistens die erste Wache, wenn sie den Hafen hinter sich gelassen hatten. Jetzt dagegen schüttelte Royd, als sein Stellvertreter ihm einen fragenden Blick zuwarf, den Kopf und blieb, wo er war – die Hände am Steuer, Isobel in der Nähe.
Wenn sie ihn während ihrer Testfahrten begleitet hatte, hatte sie fast nie in seiner Nähe gestanden. Sie war aufs Achterdeck gegangen, sodass er sie vom Steuerrad aus nicht hatte sehen können.
Obwohl sie in den vergangenen Jahren oft mit ihm gesegelt war, war das hier etwas ganz anderes. Er wollte den Moment ausdehnen, wollte in der besonderen Verbindung zu ihr, in der gemeinsamen Leidenschaft schwelgen, die sie noch immer einte. Er wollte die Magie auskosten, die noch immer ihre Seelen erreichte, wollte auskosten, dass sie beide den Wind in ihren Haaren und das Wogen des Decks unter ihren Füßen so sehr genossen.
Sie sah ihn nicht an – er hätte ihren Blick auf sich gespürt – , also sah er ab und an zu ihr hinüber. Er nahm ihre Freude in sich auf und empfand in seinem Innersten das gleiche Glück. In diesem Augenblick fühlte er sich ihr näher als in den ganzen vergangenen Jahren.
Offensichtlich gab es diese Zusammengehörigkeit noch – sie war lebendig und sehr real, stark und anscheinend unerschütterlich. Wenn die Fülle an geteilten Bedürfnissen und Wünschen, die sie dazu gebracht hatte, sich die Ehe zu versprechen, all diese Jahre unverändert überstanden hatte, was war dann noch geblieben?
Das fragte er sich. Und er dachte über die letzten acht Jahre nach, in denen sie getrennt gewesen waren.
Warum hatte sie sich von ihm abgewandt?
Und warum hatte er es zugelassen?
Die letzte Frage war eine Frage, die ihm bisher noch nicht in den Sinn gekommen war, aber … Als er hier so neben ihr stand und sich seiner Gefühle bewusst wurde, fand er, dass es eine durchaus berechtigte Frage war.
Irgendwann brachte ihr Kurs sie immer weiter vom Land weg und aufs Meer hinaus, und zögerlich bereitete er dem magischen Moment ein Ende. Mit ein paar Worten übergab er das Steuerrad an Liam und wandte sich Isobel zu.
Instinktiv drehte Isobel sich zu Royd um. Ihre Sinne waren mit einem Schlag hellwach, und ihr wurde bewusst, dass es ein taktischer Fehler gewesen war, in seiner Nähe zu bleiben. Andererseits … War das hier nicht genau das, was sie wollte? Herauszufinden, was zwischen ihnen noch war und es dann in einen nüchterneren Kontext zu stellen, um so hoffentlich ihre lächerliche Anfälligkeit für seine Nähe zu verdrängen? Sie konnte ihre Gefühle nicht ändern und neu ausrichten, wenn sie sich nicht erlaubte, mit ihm zu kommunizieren – ob mit oder ohne Worte.
Sie löste sich von der Reling. »Vielleicht kann mir jemand meine Kabine zeigen?«
Aus langer Erfahrung wusste sie, dass es im Umgang mit Royd nicht nur am besten war, die Zügel in der Hand zu halten, sondern sie auch zu benutzen.
Sein Gesichtsausdruck war wie fast immer beinahe unergründlich. An seiner Miene konnte sie nichts ablesen, als er nun nickte. »Selbstverständlich.« Er wies mit der Hand zur Treppe. Sie stieg schnell hinunter. Er folgte ihr und sprang leichtfüßig neben ihr aufs Deck. Sie hatte angenommen, dass er einen seiner Männer – seinen Steward Bellamy zum Beispiel – schicken und sie in seine Obhut übergeben würde. Doch stattdessen trat er zu der Tür, hinter der sich der Niedergang befand, öffnete sie und bedeutete ihr hinunterzusteigen. »Ich habe meine Sachen aus der Hauptkabine in der Kapitänskajüte geräumt. Für die Dauer der Überfahrt gehört sie dir.«
»Danke.« Mit einem majestätischen Kopfnicken kletterte sie die Stiegen hinunter, trat in den Korridor und lief in Richtung Heck. »Wo wirst du übernachten?«
Da sie in den vergangenen Jahren oft an The Corsair gearbeitet hatte, kannte sie den Aufbau des Schiffes. Anders als die anderen Segler dieser Klasse besaß Royds Schiff nicht so viele Kabinen, dafür waren sie geräumiger. Die Kapitänskajüte war ungewöhnlich tief und breit.
»Ich bin in der rechten Kabine untergebracht.«
Die Kapitänskajüte hatte Türen, die die Hauptkabine mit je einer Kabine zur linken und zur rechten Seite verband. Auf diese Weise entstand eine große Zimmerflucht. Man konnte die Nebenkabinen auch vom Korridor aus erreichen. Sie nahm an, dass ein solches Platzangebot und die luxuriöse Einrichtung der Art der Passagiere geschuldet waren, die Royd gelegentlich an Bord hatte. Er tat selten etwas ohne Berechnung oder Absicht. Außerdem gab es je einen Zugang zum Korridor.
Ganz ruhig ging sie den Korridor entlang und bemühte sich, sich nichts anmerken zu lassen, auch wenn ihre Sinne im Bewusstsein, dass er ihr direkt folgte, hellwach waren.
Offenbar hatte sie noch einen weiten Weg vor sich, wenn sie die Anfälligkeit für Royd hinter sich lassen wollte.
Sie kamen auf die Tür zur Heckkabine zu, und Isobel wurde langsamer. Als Royd an ihr vorbei nach dem Türknauf griff, ihn drehte und die Tür weit aufstieß, erstarrte sie innerlich.
Sie ignorierte den wohlig warmen Schauer, der über ihren Rücken rieselte, drängte die Emotionen zurück, die in ihr aufwallten, neigte dankend den Kopf und ging in die Kajüte.
Und dann fiel ihr Blick auf die Person, die auf einem Stuhl am Fenster kniete und die Küste beobachtete, die allmählich in der Ferne verschwand. Jetzt drehte sie den Kopf und sah sie an.
Isobel blieb wie angewurzelt stehen.
Panik ergriff sie. Heftige Panik.
Sie machte auf dem Absatz kehrt, stemmte die Hände gegen Royds Brust und versuchte, ihn zurückzudrängen …
Zu spät.
Er war in der Tür stehen geblieben. Er rührte sich nicht, stand wie versteinert da. Ein Blick in sein Gesicht reichte, um zu bestätigen, dass er gebannt zu der Gestalt am Fenster starrte.
Ihr Puls hämmerte. Sie konnte die Augen nicht von seinem Gesicht lösen und wagte es auch gar nicht. Und so erlebte sie mit, wie ihm die Erkenntnis kam, wie er das Geheimnis durchschaute, das sie in den letzten acht Jahren vor ihm verborgen hatte … Sie beobachtete, wie sich ein schockierter Ausdruck auf seinem Gesicht breitmachte, der alle Regungslosigkeit verdrängte.
Er blickte sie an. Wut – Wut – brannte in seinen Augen.
Vermischt mit Ungläubigkeit.
Ihr Hals war wie zugeschnürt.
Über das Rauschen des Blutes in ihren Ohren hinweg hörte sie ein dumpfes Geräusch. Duncan war vom Stuhl auf den Boden gesprungen.
»Mummy?«
Royd stockte der Atem. Er verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und schaute wieder zu Isobel.
Sie starrte ihn an. So viele Emotionen standen in ihren Augen – Wut, Vorwürfe, Schmerz. Und dann fiel ihr der Kopf in den Nacken, und sie sackte in sich zusammen …
Mit einem unterdrückten Fluchen fing er sie auf. Es dauerte eine Sekunde, ehe er begriff, dass sie tatsächlich ohnmächtig geworden war. Er hatte das noch nie erlebt. Panik ergriff ihn, sie vermischte sich mit den Gefühlen, die in ihm tobten.
Er glaubte zu schwanken, aber dieser Eindruck hatte nichts mit den Bewegungen des Schiffes zu tun.
Schnelle kleine Schritte näherten sich. »Was hast du mit ihr gemacht?« Der Junge blieb eine Armeslänge von ihm entfernt stehen. Er sah Royd aus den Augen, die Isobels Augen so ähnlich waren, mit einem Blick an, der hätte töten können. Sein junges Gesicht war blass geworden – so blass wie das von Isobel. Den Kiefer hatte er jedoch auf eine Art angespannt, die Royd bekannt vorkam … Mit zu Fäusten geballten Händen stand der Junge vor ihm und funkelte ihn an. »Lass sie los.«
Der Befehlston, in dem er die Worte hervorstieß, kam ihm ebenfalls bekannt vor.
Royd holte tief Luft. In ein Gesicht zu blicken, das dem seinen so ähnlich war, steigerte seine Verwirrung nur noch. »Sie hat das Bewusstsein verloren.« Momentan war das das kritischste Problem. Er hielt sie fest an seine Brust gedrückt. »Wir sollten sie hinlegen.«
Der wütende Blick des Jungen wurde kaum sanfter. »Oh.« Er sah sich um. »Und wohin?«
»Auf das Bett.« Mit einem Kopfnicken wies Royd auf eine Nische. »Zieh bitte die Vorhänge zur Seite.«
Der Junge beeilte sich zu tun, was ihm aufgetragen worden war. Er packte den schweren Stoff und zog den einen Vorhang nach links, den anderen nach rechts. Zum Vorschein kam ein Bett mit einer dicken Matratze und großen Kissen.
Royd legte Isobel vorsichtig hin, den Kopf und die Schultern bettete er auf die Kissen. Er hatte es noch nie mit einer ohnmächtigen Frau zu tun gehabt, und dass es sich ausgerechnet um Isobel handelte, steigerte seine Panik nur noch. Er löste die Bänder ihrer Haube, hob sacht ihren Kopf an, zog die Haube darunter hervor und legte sie zur Seite. Behutsam legte er ihren Kopf wieder auf das Kissen und löste dann die Schnürung ihres Umhangs. Vorsichtig strich er ihr das Haar aus dem Gesicht.
Sie wachte nicht auf.
Der Junge krabbelte vom Fußende des Bettes hinauf, um sich neben seine Mutter zu knien. Er betrachtete ängstlich ihr Gesicht. »Mummy?«
Royd setzte sich auf die Bettkante. Er ergriff Isobels Hand, zog ihr den Handschuh aus und rieb ihre Finger zwischen seinen Händen. Er hatte einmal gesehen, wie irgendjemand das in einer solchen Situation getan hatte.
Der Junge beobachtete genau, was Royd tat. Dann nahm er Isobels andere Hand, zog ihr ebenfalls den Handschuh aus und massierte ihre Finger. Sein Blick war auf ihr Gesicht gerichtet, als wollte er sie so dazu bringen aufzuwachen.
Royd ertappte sich dabei, dass sein Blick zum Gesicht des Jungen wanderte und dass er sein Profil betrachtete. Das seltsame Gefühl, sich selbst als Kind zu sehen, war einfach zu verstörend. Er zwang sich, Isobel anzuschauen.
»Fällt sie oft in Ohnmacht?«, fragte er.
Der Junge presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. »Ich habe das noch nie erlebt. Und die Großmütter haben auch nie etwas darüber gesagt. Dabei jammern sie ständig über solche Dinge.«
Großmütter. Plural. Royd nahm sich vor, später herauszufinden, was es damit auf sich hatte.
»Wird sie wieder gesund?« In den leisen Worten des Jungen schwangen große Besorgnis und Angst mit.
Royd wollte ihn beruhigen, aber er war sich nicht sicher, was er sagen sollte. Oder tun. Nachdem er den Nebel, der seinen Verstand umhüllte, etwas vertrieben und sich einigermaßen gesammelt hatte, tastete er an Isobels Handgelenk nach ihrem Puls. Ihr Herz schlug gleichmäßig und kräftig. Erleichterung überkam ihn.
»Ihr Herzschlag ist regelmäßig. Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist.« Der Junge schien noch nicht überzeugt … »Hier. Ich zeige es dir.« Royd hob Isobels Hand aus den Händen des Jungen. Er strich die Ader entlang, die sich unter der zarten Haut abzeichnete. »Leg deine Fingerspitzen hierhin. Drück ein wenig, dann kannst du ihren Herzschlag spüren.«
Er wartete, während der Junge es versuchte. Die Miene des Kleinen hellte sich auf, als er das beruhigende Pochen des Herzens seiner Mutter fühlte.
»Wie ist dein Name?«, fragte Royd.
Der Junge warf ihm einen flüchtigen Blick zu. »Duncan.«
Royd zwang sich zu einem Nicken, als wäre es keine weltbewegende Offenbarung. Die erstgeborenen Söhne der Frobishers trugen im Wechsel immer einen der folgenden Namen: Fergus, Murgatroyd und Duncan.
Er ließ seinen Blick über den Jungen gleiten. Der Kleine hatte lange, dünne Gliedmaßen und knochige Knie, war schlaksig wie ein Hengstfohlen. Er selbst hatte als Kind genauso ausgesehen. Und Isobel ebenfalls.
»Wie alt bist du?«
»Ich werde im Oktober acht.«
Als hätte er es geahnt …
Er betrachtete Isobels noch immer regloses Gesicht. Er hatte so viele Fragen an sie und wusste kaum, wo er anfangen sollte. Was tat man, um eine Frau, die in Ohnmacht gefallen war, wieder aufzuwecken?
»Ich habe kein Riechsalz.« Bellamy hatte vielleicht irgendwo welches, doch Isobel würde es nicht gefallen, wenn die Mannschaft etwas von dieser für sie vollkommen untypischen Schwäche mitbekam. »Ein kaltes Tuch auf ihrer Stirn wird aber bestimmt auch helfen.«
»Ja.«
Er erhob sich, durchquerte den Raum, um zum Waschtisch zu gehen, und tauchte ein kleines Handtuch in den Wasserkrug. Nachdem er das Tuch ausgewrungen hatte, kehrte er zum Bett zurück. Duncan half ihm, das Stück Stoff auf Isobels Stirn zu legen. Dann setzte er sich auf seine Fersen und wartete gespannt ab.
Isobel rührte sich nicht.
»Lass uns versuchen, ihre Füße ein wenig anzuheben.« Royd nahm zwei Kissen, die am Fußende des Bettes lagen, und reichte sie Duncan. »Ich hebe ihre Knöchel an – du schiebst die Kissen unter ihre Beine.«
»Gut, das kann ich.«
Sobald das geschafft war, warteten sie noch eine Minute, aber Isobel blieb bewusstlos.
Royd runzelte die Stirn. »Ich bin mir sicher, dass sie nur ohnmächtig ist.« Sie war nur so schockiert gewesen beim Anblick ihres Sohnes. Er sah den Jungen an. »Ich schlage vor, wir lassen sie in Ruhe, damit sie zu sich kommen kann. In der Zwischenzeit können wir beide ein bisschen frische Luft schnappen.«
Er musste durchatmen. Er musste den Wind auf seinem Gesicht spüren, musste von der frischen Brise den Nebel vertreiben lassen, der seinen Kopf zu umhüllen schien.
Und dann musste er versuchen zu begreifen, dass er einen Sohn hatte, von dem er all die Jahre nichts gewusst hatte.
Duncan richtete seine Aufmerksamkeit ganz auf ihn. »Du meinst, wir gehen hinauf? An Deck?«
Royd sah seinem Sohn in die Augen. »Da du zu jung bist, um in die Takelage zu klettern … Ja. Wir gehen an Deck.«
Eine Sekunde lang zögerte Duncan. Dann schob er sich rückwärts vom Bett und hüpfte hinunter. Er richtete sich auf und zupfte die kurze Jacke zurecht, die er trug.
Nach einem letzten Blick auf Isobel ging Royd zur Tür.
Duncan folgte ihm.
Als er die Tür erreichte, sah Royd, dass auch Duncan noch einmal zum Bett zurückblickte.
»Sie wird doch wieder gesund, oder?«, fragte der Junge leise.
»Ist sie denn oft krank?« Royd wollte wetten, dass die Antwort Nein lautete.
»So gut wie nie.«
»Tja, dann.« Er öffnete die Tür und ging voran. »Sie wird sich erholen.« Etwas leiser fügte er hinzu: »Vielleicht braucht sie es, jetzt ein bisschen allein zu sein und zu schlafen.«
Denn sie würde hellwach und ausgeruht sein müssen, wenn er sie zur Rede stellen würde.
Fünfzehn Minuten später hatte Royd unter anderem erfahren, dass das hier Duncans Jungfernfahrt war. Kein Wunder, dass der Junge so begierig darauf war, alles zu sehen und auszuprobieren. Royd hatte ihn bis zum Achterdeck gebracht und zu Duncans offenkundiger Freude das Ruder wieder übernommen. Nun klammerte der Kleine sich an der Reling fest, blickte übers Deck und löcherte Royd mit Fragen.
Plötzlich flog die Tür zum Niedergang auf, und Isobel erschien.
»Brach aus den Tiefen hervor« traf es eher. Royd hatte sie schon ein paarmal aufgewühlt erlebt, doch so … erzürnt hatte er sie noch nie gesehen.
Mit einem seltsam leeren Ausdruck in den Augen stürmte sie zur Leiter. Trotz ihrer langen Röcke war sie im nächsten Moment oben. Sie trat aufs Achterdeck, den Blick unverwandt auf ihren Sohn gerichtet.
Dass Duncan in den vergangenen Minuten so viel geplappert hatte, zeigte deutlich, dass dem Jungen bisher alles, was mit der Seefahrt zu tun hatte, vorenthalten worden war. Das Verlangen, auf See zu sein und zu segeln, lag ihm jedoch im Blut. Was hatte Isobel sich nur dabei gedacht, ihn vom Meer fernzuhalten?
Diese Frage würde er sich allerdings für später aufsparen müssen. Zuerst würde er sich nur ansehen, wie sie mit ihrem gemeinsamen Sohn umging. Denn abgesehen von allem anderen war sie im Moment so auf den Kleinen fixiert, dass sie nichts anderes um sich herum wahrzunehmen schien. Selbst ihn nicht – noch eine Überraschung, die er verdauen musste.
Duncan drehte sich zu seiner Mutter um. Aus den Augenwinkeln sah Royd, wie der Junge die Schultern straffte, sich aufrecht hielt. Er ließ den Kopf nicht hängen. Im Gegenteil – er hob sein Kinn noch ein Stückchen an. Royd kannte diese Kopfhaltung ganz genau. Es fiel ihm schwer, sich ein Grinsen zu verkneifen.
Er war oft genug mit Isobel zusammengestoßen, um die Zeichen zu erkennen. Unauffällig behielt er Mutter und Sohn im Blick.
Isobel blieb vor Duncan stehen, ballte die Hände zu Fäusten und stemmte diese in die Hüften. »Was machst du hier?«
Ihr Tonfall ließ ihn vermuten, dass sie kurz davorstand, in die Luft zu gehen.
Ruhig und furchtlos erwiderte der Junge: »Du hast gesagt, dass du auf diese Reise gehen würdest, dass es nicht gefährlich werden würde.« Er sah kurz zu Royd, als würde er, nachdem er Royd nun kennengelernt hatte, ihre Aufrichtigkeit noch einmal neu bewerten. Dann sah er wieder zurück zu ihr, und seine Miene wurde ernst. »Ich habe schon seit Wochen Sommerferien, und du weißt, dass ich immer mal auf eine Segeltour mitwollte. Wenn es nicht gefährlich ist, dann gibt es keinen Grund, warum ich nicht mit dir zusammen segeln sollte.«
Royd hielt den Blick geradeaus gerichtet und ließ sich nichts anmerken.
Aber seiner Meinung nach war Isobel gerade mit ihren eigenen Waffen geschlagen worden.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Also bist du als blinder Passagier an Bord gekommen. Wie?«
»In deinem Koffer. Dem braunen.«
Aus den Augenwinkeln sah Royd, wie sie erstarrte.
»Was ist mit den Kleidern und Schuhen, die sich ursprünglich darin befanden?« Ihre sonst so ruhige Stimme klang eine Oktave höher. »Grundgütiger … Wo sind die Sachen?«
»In deinen anderen Koffern. Ich habe das, was schon drin war, fester hineingestopft. Es hat alles gepasst … Und es war noch jede Menge Platz.«
Isobel starrte ihren umtriebigen Sprössling an und wusste nicht, was sie sagen sollte – jetzt, da sein Vater, der gerade erst von ihm erfahren hatte, direkt hinter ihm stand. Doch zumindest war Duncan vernünftig genug gewesen, ihre Kleider nicht einfach wieder in ihrem Schrank zu Hause zu verstauen. Zerknitterte Kleidung konnte man bügeln. Angesichts ihrer Körpergröße wäre es dagegen schwierig geworden, sich neue zu besorgen. Sie sah ihn an. »Was ist mit Anziehsachen für dich?«
»Ich habe zwei Garnituren in meinen Ranzen gepackt. Und meinen Kamm.«
Ihr kam ein furchtbarer Gedanke. »Himmel, hilf … Was ist mit den Leuten zu Hause? Hast du daran gedacht …«
»Ich habe eine Nachricht hinterlassen, die Urgroßmutter überbracht wird.« Duncans Worte klangen so, als müssten sie von einem Augenrollen begleitet werden, doch er hütete sich davor, das zu tun. »Sie wird die Mitteilung inzwischen gelesen haben.«
In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Ihre Atmung ging auch jetzt noch viel zu schnell – sie ließ sich durch seine Offenbarungen völlig durcheinanderbringen. Isobel holte tief Luft, atmete dann langsam wieder aus und wiederholte den Vorgang noch einmal bewusst. Sie würde nicht wieder in Ohnmacht fallen.
Sie registrierte, dass zwei Augenpaare sie genau beobachteten – mit dem gleichen Ausdruck. Er legte nahe, dass ebendiese Beobachter bereit waren zu handeln, falls sie wieder ohnmächtig werden sollte. Die Lippen aufeinandergepresst fixierte sie Duncan mit einem strengen Blick.
»Geh unter Deck und warte in der Kabine auf mich.« Sie bemerkte, wie ernst seine Miene wurde, wie verschlossen er mit einem Mal wirkte, und beeilte sich einzulenken. »Oder dort hinten, wenn dir das lieber ist.« Mit einer Handbewegung wies sie zum Hauptdeck. »Ich muss mit Kapitän Frobisher reden …«
»Sag es ihm …« Sie zuckte innerlich zusammen. Royds Worte klangen wie ein Befehl. Sie starrte ihn an und erwiderte den unerbittlichen Blick aus seinen grauen Augen. Bevor sie auch nur ihre Gedanken sammeln konnte, bekräftigte er: »Sag es ihm jetzt.«
Sie spürte die Stärke seines Willens … Sie konnte sich ihm widersetzen, aber zu welchem Preis … Auf ihrer beider Kosten? Und auf Kosten Duncans?
Außerdem fürchtete sie, dass Duncan es längst erraten hatte … Hatte es also überhaupt noch Sinn, den Moment länger hinauszuzögern?
Angesichts des Zeitpunkts von Duncans Geburt hatte es nie einen Zweifel daran gegeben, wer Duncans Vater war, doch sie hatte sich standhaft geweigert, den Namen zu nennen, hatte es weder bestätigt noch dementiert. Das hatte es den Leuten leichter gemacht, die Sache auf sich beruhen zu lassen und ihren Sohn zu behandeln, als gäbe es nur sie. Aber sie hatte Duncan noch nie belogen – und sie konnte auch Royd nicht belügen.
Und seine Miene machte deutlich, dass er sie erst von Deck gehen lassen würde, wenn sie reinen Tisch gemacht hatte.
Sie holte bedächtig tief Luft. Ohne weiter darauf zu achten, wie schnell ihr Herz schlug, faltete sie die Hände und blickte Duncan, der sie mehr als neugierig fixierte, in die Augen – ihre Augen im Gesicht des jungen Royd.
»Ich habe dir versprochen, dass ich dir eines Tages erzählen werde, wer dein Vater ist. Es sieht so aus, als wäre dieser Tag heute gekommen.« Ihre Stimme drohte zu versagen. Es würde sich so vieles verändern, wenn sie es ausgesprochen hätte. Aber sie riss sich zusammen und zwang sich dazu, ruhig zu klingen. »Kapitän Royd Frobisher ist dein Vater.«
Duncans Blick fuhr zu Royd. Er betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen. »Wirklich?«, fragte er ihn. In seinem Tonfall schwangen Neugier, Interesse und ein Funke Hoffnung mit.
Royd sah seinen Sohn an. »Ja. Und … nein. Ich wusste es bis heute auch nicht.«
Vater und Sohn sahen zu ihr, und sie bemerkte, dass sie im Fokus der anklagenden Blicke der beiden stand.
Sie hatte keine Ahnung, wie sie darauf reagieren sollte. Sie fühlte sich, als würde sie entgegen der Bewegungen des Schiffes schwanken. Das Atmen fiel ihr wieder schwer. Sie räusperte sich.
»Dann lasse ich euch beide wohl am besten allein, damit ihr euch kennenlernen könnt. Ich glaube, ich muss mich noch einmal hinlegen.«
Sie drehte sich um und ergriff feige die Flucht. Steif ging sie zur Leiter und kletterte hinunter.
Royd sah ihr hinterher. Verwirrt runzelte er die Stirn. Er hatte sie noch nie vor einer Sache fliehen sehen. Erst recht nicht vor einer potenziellen Auseinandersetzung. In dramatischen Situationen blühte sie regelrecht auf.
Er blickte zu Duncan und bemerkte die gleiche Verwirrung auf dem ausdrucksstarken Gesicht des Jungen – seines Sohnes. Ganz offensichtlich kannte Duncan die Art seiner Mutter genauso gut wie er und empfand ihren Rückzug ebenfalls als seltsam.
Royd sah über das Deck. Keiner der Besatzungsmitglieder war nahe genug gewesen, um das Gespräch auf dem Achterdeck mitbekommen zu haben.
Duncan hatte die Hände wieder auf die Reling gelegt. Er starrte nachdenklich in die Ferne. Royd wartete. Er rechnete eigentlich damit, dass der Kleine Fragen stellen würde, nachdem ihr Verhältnis nun geklärt war. Als das Schweigen jedoch anhielt, überlegte er irritiert, was er am besten sagen könnte.
Im nächsten Moment sah der Junge zu ihm. Duncans Miene wirkte wie versteinert. Wie ein Schutzschild für seine Gedanken.
Royd zog die Augenbrauen hoch. Es war eine unausgesprochene Einladung an den Jungen.
Duncan straffte die Schultern, holte Luft und fragte schließlich: »Bist du verheiratet? Mit jemand anderem, meine ich.«
Royd blinzelte. »Was?« Eine Sekunde lang war er ratlos. Was hatte Duncan dazu getrieben, diese Frage zu stellen? Doch dann wurde es ihm klar. »Grundgütiger, nein!« Sein Tonfall unterstrich sein Nein in sehr überzeugender Weise. Er hielt kurz inne, um über die Zusammenhänge nachzudenken, die er mit einem Mal ganz deutlich erkannte. Schnell sann er über die Situation nach, die sich hier ergeben hatte, und darüber, ob er alles richtig verstanden hatte. Schließlich sagte er eher zu sich selbst als zu Duncan: »Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich mit deiner Mutter verheiratet.«
Jedenfalls so gut wie, oder?
Und das war zu einem großen Teil der Grund, warum sie ihm nie von Duncan erzählt hatte.
Den Rest des Tages verbrachte Royd damit, zahllose Fragen seines Sohnes zu beantworten. Bei den meisten ging es ums Segeln, doch ab und zu auch um die Frobishers. Nachdem der Junge von ihm zugesichert bekommen hatte, dass er jederzeit jedes Schiff der Frobisher-Flotte im Hafen erkunden dürfe, war Royd sicher, dass Duncan keinen Umstand akzeptieren würde, der ihn daran hinderte, diese Einladung anzunehmen.
Als er es schaffte, einmal eine seiner eigenen Fragen dazwischenzubekommen, erfuhr er, dass Duncan auf Carmody Place lebte und bisher mit anderen Kindern zusammen auf dem riesigen Anwesen von einem Kindermädchen erzogen sowie einem Hauslehrer unterrichtet worden war, doch dass darüber diskutiert wurde, ob er im nächsten Jahr auf eine öffentliche Schule gehen sollte.
Royd und seine Brüder waren in Aberdeen zur Schule gegangen. Er nahm sich vor, Isobel mitzuteilen, dass er Duncan gern auch dort unterrichten lassen würde. Es gab keinen Grund, den Jungen wegzuschicken – eine Entscheidung, die Duncan sicher glücklich machte.
Royd bekam erst die Gelegenheit, mit Isobel zu sprechen, als die Nacht bereits hereingebrochen war. Erst nachdem er und sie mit ihrem Sohn zusammen in der Kapitänskajüte zum Essen Platz genommen hatten. Wie eine normale Familie. Tatsächlich verlief das Essen ohne einen peinlichen, unangenehmen Moment. Duncan wies die Richtung, und seine Eltern folgten. Später brachte Isobel den Kleinen in die linke der Nebenkabinen und half ihm, sich bettfertig zu machen.
Royd sah ihnen von der Tür aus zu und spürte die Liebe zwischen Mutter und Sohn, die die beiden – ganz unabhängig von der Situation – offensichtlich miteinander verband. Als Isobel die Öllampe dimmte, wies Royd mit einem Kopfnicken zur Tür. »Ich werde an Deck auf dich warten.«
Sie erwiderte seinen Blick und nickte.
Er ging hinauf zum Achterdeck, um mit seinem Navigator William Kelly zu reden, der gerade am Ruder stand. Sie sprachen über ihre Route gen Süden und verfielen dann in ein freundschaftliches Schweigen.