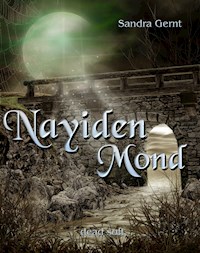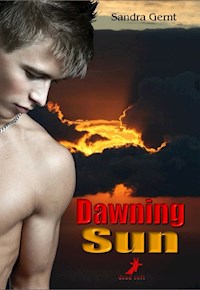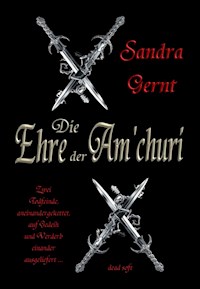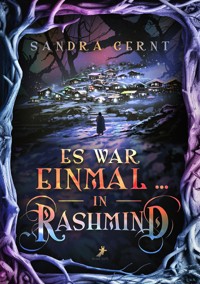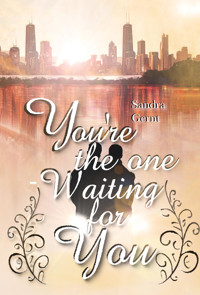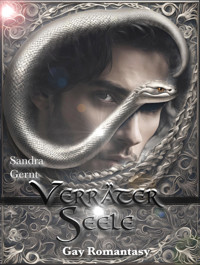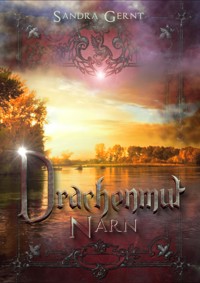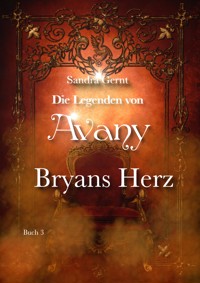6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Einen Brief wollte Roji überbringen, als ihn eine Verkettung unglücklicher Geschehnisse in ein düsteres altes Haus treibt. Und plötzlich befindet er sich in einer fremden Welt voller merkwürdiger Kreaturen und wird von einem Mann gefangen gehalten, der verwirrender und widersprüchlicher nicht sein könnte. Bald schon ist er in einen Kampf verwickelt, der ihn nichts angeht – und quer durch die Zeiten führt. Enthält: Komplexe Zeitparadoxa, Zeitreisen, Kämpfe auf Leben und Tod, magische Kreaturen, sehr viel Magie, zwei Männer, die sich lieben, weise Eulen, schlecht gelaunte Drachen … und mehr. Ca. 105.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 515 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Einen Brief wollte Roji überbringen, als ihn eine Verkettung unglücklicher Geschehnisse in ein düsteres altes Haus treibt. Und plötzlich befindet er sich in einer fremden Welt voller merkwürdiger Kreaturen und wird von einem Mann gefangen gehalten, der verwirrender und widersprüchlicher nicht sein könnte. Bald schon ist er in einen Kampf verwickelt, der ihn nichts angeht – und quer durch die Zeiten führt.
Enthält: Komplexe Zeitparadoxa, Zeitreisen, Kämpfe auf Leben und Tod, magische Kreaturen, sehr viel Magie, zwei Männer, die sich lieben, weise Eulen, schlecht gelaunte Drachen … und mehr.
Ca. 105.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 515 Seiten.
von
Sandra Gernt
Inhalt
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Ein Jahr voller Fantasy …
100!
Willkommen, liebe Leser, zu meinem Vorwort anlässlich meiner 100. Veröffentlichung.
Am 15. November 2009 habe ich mein offiziell 1. Verlagsbuch herausgebracht: „Die Ehre der Am’churi“.
(Fast) Genau zehn Jahre ist es nun also her und ich bin überglücklich, dass es mit der einhundertsten Geschichte so pünktlich gepasst hat.
In diesen zehn Jahren bin ich als Autorin einen weiten Weg gegangen. Zunächst mit dem Dead Soft Verlag, später als Selfpublisherin. Das Spektrum reicht von Kurzgeschichten und Kurzromanen bis zum epischen Wälzer von 1400 Seiten, Einzelromanen, Serien und Gemeinschaftsproduktionen und sogar ein Sachbuch, von der Kindergeschichte über High Fantasy (Hetero) zu Gay Romance, Gay Fantasy, Gay Krimis und (Hardcore-)Thriller.
Sicher ist, dass ich keinen einzigen Schritt dieses Weges ohne euch Leser gegangen wäre. Nur und ausschließlich weil ihr mir die Treue haltet, jeder Veröffentlichung genauso entgegenfiebert wie ich selbst, mich mit Rezensionen und Feedback beschenkt und jeden meiner Helden liebend in die Arme schließt, kann ich diesem schönsten aller Berufe nachgehen. Wohin der Weg mich noch führen wird, das kann und will ich nicht voraussehen. Heute sage ich erst einmal: Danke! Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ihr seid die besten Leser, die ein Autor sich nur wünschen kann.
Auf bald,
eure Sandra
Tirú erwachte.
Er streckte sich gründlich und ließ sich dann noch einmal in das Kissen zurücksinken, um die Decke seines Schlafraums zu betrachten. Sein Vater war ein reicher Mann, der sich ein großes Haus gebaut hatte, um dies jeden wissen zu lassen. Nur reiche Leute benötigten fünfundzwanzig Schlafzimmer und drei Diener für eine sechsköpfige Familie.
Jedenfalls pflegte Dara solche Dinge zu sagen, die Köchin und Hausdienerin. Tirú bekam seinen Vater kaum je zu Gesicht, der war stets sehr beschäftigt mit Arbeit. Welche Arbeit genau, das sagte niemand. Sie brachte ihm wohl viel Geld ein, damit seine Familie dieses riesige Haus hatte, für das ihm selbst keine Zeit blieb. Jedenfalls gab er Dara regelmäßig Silbermünzen, die sie und die beiden anderen Diener dann sorgsam polieren mussten.
Tirús Mutter hingegen musste als Frau eines reichen Mannes nicht arbeiten und hatte mehr als genug Zeit, um ihre Kunstwerke zu erschaffen. Er sah sie selten anders als mit Farbklecksen auf Nase, Stirn und Händen. Meist lag sie stundenlang auf himmelhohen Gerüsten und bearbeitete die Zimmerdecken. Immer dann, wenn sie nicht in ihrem Atelier stand und große Leinwände bemalte, die anschließend gerahmt und aufgehängt wurden. Auch dafür musste das Haus derartig riesig werden, es wurden viele, viele Wände für die Bilder benötigt. Und viele Decken.
Tirú liebte das Bild an seiner Zimmerdecke. Es zeigte die verwunschene Welt, von der Hilla, seine Amme, ihm jeden Abend Geschichten erzählte. Merkwürdige Kreaturen und gewöhnliche Waldtiere mischten sich auf einer sonnenbeschienen Lichtung, wo sie sich zu einem Picknick versammelt hatten. Weiße Häschen tranken mit possierlich gerümpften Nasen aus ebenso weißen Porzellantassen, Eichhörnchen jagten hinter einem blaupelzigen Bär mit zu vielen Ohren her, der mit einer Handvoll Nüssen zu entkommen versuchte. Seit Jahren studierte Tirú dieses Bild und dennoch fielen ihm fast täglich neue Details daran auf. Fast als würde das Bild sich über Nacht minimal verändern, gerade noch so wenig, dass er sich nicht sicher sein konnte, ob es eine Veränderung gab oder ob er diese spezielle Kleinigkeit bislang übersehen hatte. Die roten Blumen am Rand der Lichtung neigten einander die Köpfe zu, als würden sie sich etwas zuflüstern. Und das Äffchen in der Mitte, das auf einem Baumstumpf saß, wirkte seltsam traurig, während seine Freunde um ihn herum lachten und aßen und spielten, zu einer unhörbaren Melodie tanzten und auf jegliche Weise fröhlich waren.
Tirú beschloss spontan, seine Mutter zu suchen und sie zu fragen, warum genau das Äffchen traurig war und welches Geheimnis die roten Blumen miteinander teilten. Sie mochte es, wenn er sie Details zu den Bildern fragte. Das waren die Gelegenheiten, bei denen er sie jederzeit stören und ausfragen durfte. Bei jedem anderen Vorwand, ihre Nähe zu suchen, antwortete sie schlichtweg gar nicht, bis er sich wieder davonschlich, oder sie rief ungeduldig nach Hilla, damit das nervige Kind entfernt wurde. So waren ihre Worte dabei.
Tirú stolperte fast über ein Kissen, als er aus dem hohen Bett kletterte. Er war nun schon so viel gewachsen und mit seinen sieben Jahren wirklich kein Säugling mehr. Dennoch war er zu klein für diesen riesigen Kasten aus schwarzem Holz. Wenn er schlafen gehen wollte, musste er eine Leiter mit drei Stufen hochsteigen. Seine älteren Geschwister lachten ihn dafür aus. Besonders Nakim, sein zwei Jahre älterer Bruder, ließ keine Gelegenheit aus, ihm mitzuteilen, wie lächerlich er doch war. Dafür verbündeten sie sich regelmäßig, wenn sie in der gemeinsamen Studierzeit am Morgen Gegenwind von ihren großen Schwestern bekamen. Elara und Fira waren bereits zwölf beziehungsweise fünfzehn Jahre alt und damit fast erwachsen. Die beiden behandelten Nakim und Tirú oft genug wie Wickelkinder und schienen es für eine Zumutung zu halten, überhaupt Brüder haben zu müssen. Was man davon denken sollte, zwei kichernde, geheimnistuerische und besserwissende Schwestern zu besitzen, danach fragte niemand.
Missmutig warf Tirú das Kissen hoch auf das Bett, griff nach dem blauen Leinenhemd, das er vor dem Mittagsschlaf ausgezogen hatte und streifte es sich über.
Eigentlich war er längst zu alt für den Mittagsschlaf, doch Hilla hatte ihn dazu gezwungen. Alles bloß, weil er Anfang der Woche beim Spielen in den großen Teich gefallen war. In dem eisigen Wasser war ihm nichts weiter zugestoßen, abgesehen von einer leichten Erkältung. Dennoch hatte Hilla sich entsetzlich aufgeregt, so als wäre er dem Ertrinkungstod nah gewesen, und hatte sämtliche Bediensteten angeschrien. Obwohl von denen keiner dabei gewesen war und sie darum keine Schuld an dem Nicht-Unglück tragen konnten. Seitdem durfte er nicht mehr in den Park gehen und musste wieder Mittagsschlaf halten wie ein Säugling.
Vielleicht traf er seine Mutter in besonders guter Laune an, wenn er ihr gleich Fragen zu den Bildern stellte. Dann legte sie womöglich ein gutes Wort für ihn bei Hilla ein und erlaubte, dass er wieder draußen spielen gehen konnte. Es war Frühherbst, er wollte die Kastanienzeit nicht verpassen!
Tirú hüpfte durch die endlosen Gänge seines Zuhauses. Wie so oft war es viel zu still in diesem Gemäuer. Das Gestein fraß die Geräusche der Lebenden und spuckte sie danach als Geister aus. Geister, die nachts lärmten, wenn man eigentlich schlafen wollte. Das behauptete jedenfalls Tirús Bruder. Hilla sagte zwar, dass Nakim nichts als Unsinn erzählte. Aber es war eine gute Erklärung, warum es nachts ständig knackte und knirschte und manchmal sogar Heulen und Stöhnen zu hören war.
„Sht – Tirú!“
Er hielt verblüfft in seinem Hüpfen inne, als sein Name erklang.
„Hier oben!“, ließ sich die dünne Stimme erneut vernehmen. Aus einem der viel zu vielen holzgerahmten Landschaftsgemälden, die an jedem verfügbaren Fleckchen Wand hingen, winkte ein dürrer Arm, der große Ähnlichkeit mit einem knorrigen braunen Zweig besaß.
„Warum bist du wach, Agus?“, fragte Tirú besorgt.
Agus war einer der drei Hauswächter. Gnome waren das, die tagsüber zu winzigen, wehrlosen, knorrigen Gestalten zusammenschrumpften, nachts hingegen zu gewaltigen Riesen heranwuchsen, die draußen auf dem Gelände patrouillierten und jeden Eindringling abwehren konnten. Sobald die Sonne schien, wurde ihr Dienst nicht mehr benötigt. Tirús Mutter konnte jeden der gelegentlich hereinfallenden Feinde besiegen, dazu musste sie lediglich wach sein. Die Tage verschliefen die Wächter darum meist vollständig in geschützten Winkeln und gerade in den frühen Nachmittagsstunden war es ungewöhnlich, ihnen zu begegnen.
Agus sprang vom Holzrahmen herab. Selbstverständlich hatte er oben draufgesessen und nicht im Bild selbst gehockt, auch wenn es so ausgesehen hatte. Kein Gnom wäre dumm genug, ein Gemälde von Tirús Mutter zu beschädigen. Er kam bedächtig zu Tirú heran und streckte eine seiner winzigen Fäuste in die Höhe.
„Es ist mir sehr peinlich“, murmelte Agus. „Vorhin hatte ich im Arbeitszimmer des Herrn, deines Vaters geschlafen. Auf dem Schreibpult lag etwas plötzlich Silbernes, nachdem es zuvor gepoltert hat. Das war es, was mich weckte. Es glitzerte so hübsch in der Sonne, die durch das Fenster fiel … Irgendwie muss es sich in meinen Fingern verhakt haben, ich kann es mir nicht anders erklären.“
Tirú gluckste. Gnome stahlen wie die Elstern, das wusste jeder. Selbst er, obwohl seine Schwestern hartnäckig behaupteten, er wüsste gar nichts. Hinterher tat es den Gnomen meistens leid und sie gaben ihr Diebesgut in der Regel unbeschädigt zurück. Es war lediglich dieser Moment der Gier, gegen den sie nicht ankamen.
Als er erkannte, was sich da in Agus‘ Faust befand, erschrak Tirú – die silberne Taschenuhr seines Vaters! Die trug er ständig bei sich und nahm sie sogar nachts mit an sein Bett. Was machte sie vergessen auf dem Schreibpult? Zumal mitten am Tag, wenn Tirús Vater für gewöhnlich noch nicht zu Hause war?
Vorsichtig nahm er die Uhr an sich. Aus dieser Nähe hatte er sie noch nie zuvor anschauen dürfen. Beeindruckend, wie lebensecht die Eule wirkte, die in den Deckel eingraviert war. Jedes Detail der Flügel war filigran ausgearbeitet.
Eulen gehörten zu den Lieblingsmotiven seiner Mutter. Sie malte in jedes ihrer Gemälde irgendwo eine Eule hinein, auch wenn man manchmal lange suchen musste, bis man sie irgendwo entdeckte, sei es versteckt im Blätterwerk eines Baumes, sei es halb verborgen hinter einem Stein. Jedes Bild in diesem Haus besaß eine solche Eule. Das Deckenbild in seinem Zimmer war die einzige Ausnahme, die er kannte. In den Gute Nacht-Geschichten vom verwunschenen Land galten Eulen als sehr weise und treu. Sie dienten als Ratgeber und retteten nicht selten diejenigen, die ihren Weg verloren hatten. Hilla betonte allerdings auch, dass in der normalen Welt Eulen Einzelgänger waren und Menschen eher einen Finger abbeißen als ihnen helfen würden.
Hm – vielleicht war diese wunderschöne, kostbare Uhr ein Geschenk von Tirús Mutter gewesen? Es wäre jedenfalls etwas, das sie aussuchen würde.
„Ich wollte zu meiner Mutter, sie arbeitet an der Decke im kleinen Saal“, sagte Tirú und steckte die Uhr in die Hosentasche. „Ich gebe sie ihr. Ist sicher besser, wenn nicht ich meinem Vater die Uhr zurückgebe.“ Ihm schauderte es bereits bei der Vorstellung, seinem Vater gegenüberzutreten. Das war vergleichbar mit der Idee, einfach in die Hose zu machen. So etwas tat man nicht. Niemals und unter gar keinen Umständen, selbst wenn man völlig verzweifelt war.
Tirús Vater hatte noch keines seiner Kinder jemals geschlagen oder angeschrien. Wozu auch? Bei ihm genügte ein einziger strenger Blick, und Familie, Bedienstete und Gnome rannten um ihr Leben. Nur Tirús Mutter nicht. Die lachte bloß, wenn einer dieser Blicke sie versehentlich traf. Aber sie war ja auch die Herrin des Hauses und damit die eine Macht, die Tirús Vater überlegen war.
Er marschierte weiter in Richtung des kleinen Saals, der ziemlich genau in der Mitte des Hauses lag. Langsam und vorsichtig ging er nun, statt wie zuvor zu hüpfen, jetzt wo er einen kostbaren Schatz bei sich trug. Eine Hand beließ er in der Hosentasche, damit ihm die Uhr nicht versehentlich hinausfallen konnte. Agus folgte ihm, leise vor sich hinmurmelnd.
„Was sagst du?“, fragte Tirú nach einer Weile. Das Gemurmel war seltsam entnervend in der allumfassenden Stille des Hauses, die sich wie Nebelschleier auf der Haut anfühlten. Ein körperliches, greifbares Schweigen, das sich spüren, bloß nicht festhalten ließ.
„Es ist zu kalt“, antwortete Agus. „Viel kälter als es sein sollte. Die Kälte beißt mir ins Herz. Und das Schweigen in diesen Mauern fühlt sich nach Trauer an. Ich fürchte mich, junger Herr Tirú. In meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie gefürchtet, und das dauert bereits mehr Jahrhunderte, als du an Jahren zählst.“
Erschrocken blieb Tirú stehen und starrte den kahlköpfigen, wurzelartigen Gnom an. Gnome froren nicht. Niemals. Selbst im grässlichsten Schneesturm, wenn es kalt genug wurde, dass sich sogar Felsbrocken spalteten, versahen sie treu und fröhlich ihren nächtlichen Wachdienst. Warum also sollte Agus zu kalt sein? Und Trauer … Bedeutete das Wort nicht, dass ein Unglück geschehen war? Dass ein Leben geendet hatte, welches nun fehlte?
Tirú begann zu laufen, die Uhr seines Vaters hielt er beschützend in der Hand. Dort war die Tür des kleinen Saals. Eine dünne Eisschicht überzog das reich verzierte, wunderschön geschnitzte Eschenholz.
„Zurück, Tirú!“, kreischte Agus, packte ihn am Zipfel des blauen Leinenhemds und zog ihn mit energischer Gnomenkraft zu Boden. Auch wenn er tagsüber nicht einmal einen Bruchteil seiner Stärke und Größe wie in der Nacht besaß, war er dennoch kräftig genug, um einen Jungen wie Tirú mit dem ausgestreckten Zeigefinger hochzuheben.
„Gefahr, Gefahr!“, zischte Agus und rannte vor Aufregung mehrere Runden im Kreis. Tirú blieb auf dem kalten, schwarzgemusterten Marmorfußboden sitzen und sah ihm regungslos zu. Dann legte der Gnom seine beiden knorrigen Hände trichterförmig vor den Mund und stieß laute, kehlige Schreie aus. Dreimal hintereinander, in kurzer Folge. Diese Schreie erschütterten Tirús Knochen und er zweifelte nicht, dass sie die Wände und Böden des Hauses bis in den letzten Winkel durchdrangen. Nie zuvor hatte Tirú einen der Gnome auf diese Weise schreien gehört und trotzdem benötigte er keine Erklärung. Es war ein Alarmruf, der Agus‘ Gefährten herbeiholen sollte. Etwas Schreckliches musste geschehen sein. Etwas, was noch nie zuvor geschehen war.
Tirú saß vollkommen erstarrt da und sah seinen Händen beim Zittern zu. Die Uhr lag auf den Steinplatten. Warum kam seine Mutter nicht erbost durch diese eisüberzogene Tür gerauscht und stauchte Agus für den Lärm zusammen, der sie in der Konzentration störte? Warum hatte sie nicht verhindert, dass dieses schreckliche Etwas geschah, wie es ihre Aufgabe war?
„Hilla …“, wimmerte Tirú und schlang die Arme um seinen Körper. Er wollte Hilla. Jetzt. Sofort. Sie sollte ihm über den Kopf streicheln und nach Kräutern und Wolle und Alter riechen und ihm sagen, dass alles wieder gut werden würde.
Doch Hilla kam nicht.
Dafür erschienen Fjork und Madrow, die beiden anderen Hauswächter. Grimmig versammelten sich die drei vor der vereisten Tür, die ein wenig im Licht der Sonne glitzerte, das durch die endlos hohen Fenster fiel.
„Das hätte niemals geschehen dürfen“, flüsterte Fjork. „Der Feind hat kaum Möglichkeiten, uns auf dieser Seite anzugreifen und die Herrin war sich sicher, dass die Schutzzauber ausreichen, die sie letztes Jahr verhängte.“
„Und dennoch ist es geschehen. Wir müssen nachsehen, wie groß der Verlust ist, und den Jungen beschützen“, entgegnete Agus. Er wandte sich zu Tirú um, der inzwischen von Kopf bis Fuß schlotterte. Diese Angst, die in ihm wütete, musste eines von Mutters gemalten Kreaturen sein. Vielleicht ein Ypha, ein igelgroßes, nimmersattes Raubtier aus der verwunschenen Welt, das alles fraß, was ihm begegnete, auch Bäume und Gestein. Ein solches Ypha saß wohl in Tirús Bauch und zerriss mit wütender Gier, was es erreichen konnte.
Die drei Wächter rückten nah an ihn heran. Agus legte ihm eine Hand auf die Schulter.
„Du musst jetzt tapfer sein, Tirú“, sagte er mit warmer, einfühlsamer Stimme. „Meine Brüder werden gleich diese Tür öffnen. Sollte dahinter ein Feind auf uns lauern, werden sie sterben, damit ich mit dir fliehen kann. Das Blutbündnis zwischen uns und deiner Familie verpflichtet uns, alles für euch zu geben, mit unserem Leben für euch zu kämpfen, bis auch der Letzte von beiden Seiten gestorben ist. Darum werde ich für dich kämpfen, solange wir beide atmen, darauf kannst du dich verlassen. Wahrscheinlich warten jedoch nur die Toten in dem kleinen Saal auf uns und der Feind ist längst verschwunden. Was du jetzt tun musst: Nimm die Uhr deines Vaters und lass sie unter keinen Umständen los. Bleib am Boden sitzen. Sollte ich dich gleich packen und forttragen, wehre dich nicht dagegen. Du darfst schreien, zappeln und strampeln hingegen nicht. Mach dich so klein wie möglich. Hast du das alles verstanden?“
„Ja“, flüsterte Tirú bebend. „Nicht zappeln, nicht strampeln, nicht die Uhr loslassen.“ Er tastete blindlings nach dem silbernen Kleinod, atmete zutiefst erleichtert auf, als sich seine Finger darum schlossen. Das kühle Metall brannte regelrecht auf seinen schwitzigen, überhitzten Handflächen. Er konnte nicht denken, kaum etwas sehen. In ihm summte und hämmerte alles wie verrückt und eine stählerne Faust versuchte, seine Brust zu zerquetschen, was das Atmen fast unmöglich werden ließ. Was geschah hier? Warum wollten ihn Feinde angreifen? Was meinte Agus mit dem Blutbündnis und all dem Gerede über das Kämpfen bis zum Tod?
„Bereit?“, wisperte Madrow.
„Bereit!“, entgegneten Fjork und Agus zugleich.
Fjork öffnete die Tür. Tirú hielt den Kopf gesenkt, kämpfte darum, Luft in seine Lungen zu treiben und sich nicht zu übergeben. Sein Schädel drohte jeden Moment zu platzen, so stark war das Hämmern seines Herzens. Er hörte Fjork aufschreien – ein Klagelaut, erfüllt von Grauen, wie es Tirú sich nicht einmal vorstellen konnte. Ein Laut, wie er ihn noch von keinem Lebewesen je gehört hatte. Ein Laut, der ihn gegen seinen Willen auf die Beine trieb.
Fjork kam durch die Tür getaumelt, kehrte zu ihnen zurück. Für einen Moment glaubte Tirú, der Gnom wäre verletzt. Doch es war kein Blut zu sehen und keine monströse Schreckensgestalt folgte ihm aus dem Saal heraus.
„Wie viele?“, fragte Madrow, dessen Gesicht eisgrau geworden war.
„Alle“, flüsterte Fjork und würgte heftig an diesem Wort.
„Was heißt das?“, stieß Tirú krächzend hervor. „Ist meine Mutter da drinnen? Was meint ihr mit alle? Wovor habt ihr solche Angst?“ Die Gnome achteten nicht auf ihn. Das ewige Schicksal des Kindes, es wurde übergangen und selbst diese Kreaturen, die mehr als einen Kopf kleiner als er waren, sprachen über den seinen hinweg, als wäre er unsichtbar.
„Er muss reingehen“, sagte Madrow und gab Agus einen entschlossenen Wink. „Egal wie grausam das ist. Es wird ihn zerstören. Wenn er nicht mit eigenen Augen sieht, was geschehen ist, würde es ihn noch viel gründlicher zerstören, denn dann zweifelt er für den Rest seines Lebens an der Wahrheit und er wird gegen uns ankämpfen. Das wäre sein Untergang.“
„Wovon sprecht ihr?“ Tirú heulte auf vor Angst und Hilflosigkeit.
„Deine Familie, mein Junge“, sagte Agus, nahm ihn unendlich zart an der Hand und führte ihn Schritt für widerstrebenden Schritt auf die Tür zu. „Deine gesamte Familie ist tot. Dazu die Diener und auch Hilla. Es tut mir unglaublich leid. Jeder Mensch, der in diesem Haus gewohnt hat, befindet sich auf der anderen Seite der Tür. Jeder von ihnen ist tot.“
„Was heißt tot?“, würgte Tirú hervor. Sinnlose Worte. Er konnte, er wollte nicht begreifen, was die Gnome ihm zu sagen versuchten, die ihn behutsam wie ein neugeborenes Lamm vorantrieben. „Wie tot sind sie denn? Sie können nicht völlig tot sein. Heute Mittag ging es ihnen ja gut.“
Sein eigenes Gestammel verwirrte ihn. Mittlerweile standen sie auf der Türschwelle. Er sah nichts, denn die Tränen, die wie Sturzbäche aus seinen Augen flossen, verhinderten jegliche Sicht.
„Hilla zuerst“, hörte er Agus sagen. Oh ja. Er wollte zu Hilla. Sie war der Mittelpunkt seiner gesamten Welt. Sein sicherer Hafen. Sie würde ihn in ihre Arme schließen, nach Kräutern, Wolle und Alter riechend, und er würde sicher sein und vergessen, warum es einen Grund zum Weinen gab. Ihre Nähe allein würde den Ypha aus seinem Bauch verjagen, der schon wieder mit Zähnen und Klauen in ihm wütete.
Agus‘ Hand zitterte.
„Komm, Kleiner“, wisperte er. Man hörte deutlich, dass er weinte. Was konnte einen Gnom zum Weinen bringen, der älter als sieben Jahrhunderte war? „Hier. Knie dich hin. Hilla liegt vor dir auf dem Boden.“
Folgsam kauerte Tirú sich nieder. Er nahm den vertrauten Duft war, der zu seiner Amme gehörte. Warum sprach sie nicht zu ihm? Warum stand sie nicht auf? Sie war zu alt, um auf den eisigen Marmorplatten zu liegen! Energisch rubbelte er sich mit dem Hemdsärmel über das Gesicht, wischte Tränen und Rotz ab und erwartete, dafür scharf getadelt zu werden. Hilla war vollgestopft mit Ermahnungen und Verboten, sie schimpfte den gesamten Tag mit ihm. Wie konnte sie jetzt stumm bleiben?
Tirús Sicht klärte sich. Er blickte verständnislos auf die Hilla-Puppe herab. Ihr Gesicht war grau, die Augen kalt und leer. Ganz wie die Puppen, mit denen Elara und Fira früher gespielt hatten und die jetzt vergessen auf einem Regal saßen, wo das Dienstmädchen sie regelmäßig abstaubte.
„Das ist nicht Hilla“, sagte Tirú. Er wollte aufstehen und fortlaufen. In ihm wurde es ebenfalls eisig und still, genauso kalt und still wie die Puppe dort auf dem Boden.
„Sie ist tot“, entgegnete Agus geduldig und führte Tirús Hand zum Hals der Puppe. Schlaff und faltig, genau wie Hillas Hals. Dazu viel zu kalt und still. „Sie atmet nicht mehr, spürst du das, mein Junge? Das ist Hillas toter Körper. Ihre Seele ist fortgegangen.“
Tirú hatte längst bemerkt, dass noch viele weitere Puppen auf dem Boden lagen. Lebensgroß und beinahe echt. Sie trugen die Kleidung von Dara, dem schmalen, beinahe hageren Hausmädchen, von Nakim, seinem Bruder, von seinen beiden Schwestern, seinem Vater … Alle Bewohner des Hauses hatten sich in Puppen verwandelt, die nicht atmeten und sich nicht bewegten und deren Augen still und kalt und leer ins Nichts blickten. Einen Grund dafür konnte er nicht sehen. Kein Blut. Die Puppen waren nicht zerbrochen. Friedlich lagen sie da, auf eine Weise erschlafft, die keinen Vergleich mit Schlaf zuließen. Menschen schliefen und sahen dabei lebendig aus. Diese Puppen waren einfach nur … tot.
Schweigend ließ sich Tirú zu jedem von ihnen führen. Die Gnome sorgten dafür, dass er keinen ausließ und jeden von ihnen berührte. Er richtete Nakims Hemdkragen, der wie so oft eingerollt war, und strich Elaras Locken aus ihrer Stirn, wie sie selbst es stets tat. Sein Vater wirkte seltsam klein, jung und schwach, das verwirrte ihn sehr. Jegliche Härte und Strenge waren aus dem Gesicht gewichen. Der schwarze Vollbart, waren da schon immer die vielen Silberfäden hineingewoben gewesen? Er schien Tirú fremd, genau wie alle anderen. Das war nicht sein Vater. Lediglich eine Puppe.
Auf der Suche nach seiner Mutter schaute er zu dem Gerüst hinauf, auf dem sie immer lag, um an der Decke arbeiten zu können. Die Gnome folgten seinem Blick.
„Dort oben ist sie“, sagte Agus. Er packte Tirú und hob ihn ohne Mühe hoch. Aus dem Stand überwand er die Distanz mit einem Sprung und landete auf den stabilen dicken Brettern, noch bevor Tirú Zeit hatte, verängstigt aufzuschreien. Fjork und Madrow folgten ihnen. Seine Mutter lag auf dem Bauch statt wie alle anderen auf dem Rücken. Raureif überzog ihr brünettes Haar, das unordentlich war statt wie sonst streng zusammengebunden. Ihre Haarnadel lag neben ihr. Tirú starrte darauf nieder. Diese Nadel war ein Heiligtum. Niemand, kein Diener, nicht einmal sein Vater durfte sie berühren, nur seiner Mutter war das erlaubt.
„Es steckt noch ein wenig Leben in ihr!“, rief Agus erschrocken, als er sie an der Schulter berührte. Rasch drehte er sie. Ihr Anblick traf Tirú wie ein Keulenhieb. Sie war keine Puppe. Sie lebte, sie war echt! Doch ihr Gesicht war ähnlich grau wie das der anderen und kaum ein Atemzug war zu spüren, als er seine zitternde Hand auf ihre eiskalte Stirn legte.
„Sie stirbt, niemand kann sie mehr retten“, flüsterte Fjork.
In diesem Moment öffneten sich ihre Augen, unendlich langsam, als müsste sie gegen ein Gebirge ankämpfen, das sie niederdrückte.
„Zytlor“, hauchte sie. „Es war ein … ein Zytlor. Wie viele …?“ Sie blickte Agus an, dessen Unterlippe bebte, als würde er gleich wie ein kleines Kind zu weinen beginnen.
„Alle, Herrin“, antwortete er. „Auch Euer Gemahl. Nur wir und Tirú sind entkommen. Er hat die Uhr.“
„Dann besteht Hoffnung.“ Sie rang um Atem, doch als sie nun Tirús Hand umklammerte, zeigte sie noch einmal viel von der Kraft und Härte, die ihr sonst so selbstverständlich zu eigen waren. „Der Zytlor wurde von unserem Feind geschickt. Ich war zu langsam, mein Schutzzauber hat nicht ausgereicht. Du wirst das verstehen, wenn du älter bist. Im Augenblick zählt nur, dass du überlebst. Die Gnome werden dich ins Verwunschland bringen und dort beschützen, wo ihre Macht am größten ist. Ihr vier konntet überleben, weil ihr geschlafen habt. Auch das wirst du verstehen lernen. Gehorche den Wächtern! Überleben ist das Ziel, auf das du dich die nächsten Jahre konzentrieren musst. Überleben und lernen. Es sind Dinge geschehen, die niemals hätten geschehen dürfen. Bewahre die Uhr. Sie ist der Schlüssel. Bewahre und überlebe.“ Sie röchelte, ihre Lider sanken herab. Dann verkrampften sich ihre Finger schmerzhaft um Tirús Hand und sie kämpfte sich noch einmal zurück. Ihr herumirrender Blick fand Agus, Fjork und Madrow.
„Nehmt das Bild in meinem Schlafzimmer. Ihr kennt den Weg. Gedenket eures Schwurs! Lasst ihn niemals allein.“
Ihre Stimme war so leise, dass die gehauchten Worte kaum zu hören waren. Der stählerne Griff löste sich von Tirús Handgelenk. Ihr Kopf sank zur Seite. Ihr Gesicht verwandelte sich in das tote Antlitz einer Puppe.
„Nein. Nein. Nein!“, schrie Tirú und suchte hektisch nach Atemzügen. Nach Wärme. Sollte sie ihn finster anstarren. Sollte sie nach Hilla rufen und verlangen, dass das anstrengende, nervige Kind augenblicklich entfernt wurde. Sollte sie ihn von sich stoßen, weil ihre ewigen Bilder so viel wichtiger für sie waren als alles andere. Hauptsache sie lebte und ließ ihn nicht allein. Sie durfte sich nicht in eine Puppe verwandeln! Sie durfte nicht auch noch gehen, nachdem der kleine Saal bereits mit toten Menschen überfüllt war.
„Wir müssen gehen. Sofort!“, zischte Agus und zerrte ihn gewaltsam mit sich, fort von seiner Mutter, mit einem Sprung in die Tiefe zurück auf den Boden. „Ein Zytlor ist ein tödlicher Feind, gegen den wir machtlos sind, zumindest hier in dieser Welt. Falls noch ein Angreifer folgen sollte, wäre er noch mächtiger als dieser Dämon. Wir müssen sofort in das Verwunschland überwechseln.“
„Aber … aber das sind bloß Geschichten!“, stammelte Tirú hilflos. „Geschichten vom verwunschenen Land.“
„Jede dieser Geschichten war die Wahrheit“, entgegnete Fjork grimmig. „Und es heißt Verwunschland.“
„Ich will nicht fort! Ich will nicht in diese … diese Welt! Hilla! Hilla! Nakim! Mutter! Elara, Fira! HILLA!“ Er schrie und weinte und zappelte und strampelte. Nichts davon half ihm weiter. Unerbittlich zerrten die Gnome ihn mit sich, in das Schlafgemach seiner Mutter hinein, das sie in den vielen Nächten nutzte, in denen sein Vater nicht heimkehrte, weil dieser zu lange arbeiten musste. Hier waren die Wände nicht mit einzelnen gerahmten Gemälden bedeckt. Stattdessen waren sie von Boden bis Decke mit einer umlaufenden Szenerie bemalt. Tirú mochte dieses Bild nicht, denn es zeigte einen dunklen Wald, in dessen Mitte sich eine noch dunklere Trutzburg erhob. Alles war düster und wirkte gefährlich, abweisend und bedrohlich. Dazu veränderte es sich ständig, noch während man hinschaute. Manchmal schien auf dem Bild die Sonne. Meistens war es Nacht. Der einzige Lichtfleck war die Eule, die auch in diesem Werk nicht fehlen durfte. Sie flog offen im Vordergrund der Burg, statt sich wie sonst üblich zu verstecken, und blickte den Betrachter direkt an. Sie war lebensecht gemalt, wie üblich bei den Bildern seiner Mutter, wo stets alles so wirkte, als wäre die wahrhaftige Welt auf eine Leinwand gespiegelt worden.
Die Gnome brachten ihn bis zu dieser Stelle, wo die Eule schwebte. Agus ergriff Tirús Hand.
„Es tut mir sehr, sehr leid“, sagte er entschuldigend – und ritzte mit dem langen, scharfen Nagel seines Zeigefingers Tirús Handfläche auf. Verblüfft und schockiert starrte er auf das Blut, das aus der oberflächlichen Wunde quoll. Agus hatte ihn verletzt! Aber der Gnom war doch sein Freund, warum tat er so etwas?
Ohne weitere Erklärung presste Agus die blutige Hand auf den Körper der Eule. Einige zittrige Atemzüge lang geschah nichts.
Dann begannen die Augen der Eule zu glitzern und ihr Kopf bewegte sich.
„Tretet ein!“, krächzte sie.
„Wir hätten womöglich kurz innehalten sollen, um Vorräte und Kleidung für den Jungen mitzunehmen“, murmelte Madrow.
„Zu spät! Zu spät!“, krächzte die Eule. Es wurde dunkel und Tirú schrie vor Entsetzen, als es einen Ruck gab und er in die Leere fiel.
Ein, zwei Herzschläge lang.
Dann wurde er hochgehoben. Um ihn herum war es stockfinstere Nacht geworden. Die Gnome hatten sich in Riesen verwandelt. Es war Agus, der ihn beschützend an seine baumartige breite Brust drückte.
Sturmwind trieb Wolken über den nächtlichen Himmel und schüttelte die Bäume des Waldes, durch den sie wanderten. Vor ihnen, auf einem hohen Berg, lag ein riesiges, finsteres Gemäuer – die Trutzburg aus dem Gemälde. Tirú wimmerte leise, zu erschöpft, zu weit getrieben, um sich noch wundern oder fürchten zu können.
„Willkommen im Verwunschland“, sagte Agus dröhnend. „Willkommen daheim.“
Roji zog kräftig an dem Seil. Es quietschte erbärmlich und die Rolle blockierte schon wieder. Er musste sich nachher endlich Zeit dafür nehmen, das in Ordnung zu bringen, bevor irgendetwas zerriss und der Reparaturaufwand noch größer werden würde. Es wäre ansonsten recht mühsam, an Wasser zu gelangen, denn der nächste Fluss war weit entfernt.
Endlich war der Eimer oben. Auch der hatte bereits bessere Jahre gesehen, hielt sich allerdings noch.
„Was sagst du dazu?“, fragte er missmutig die alte Eiche, die neben dem Brunnen stand, gerade weit genug entfernt, dass ihre Blätter und Eicheln nicht allesamt im Wasser landeten. Er liebte diesen Baum, der so merkwürdig gewachsen war, dass man auf dem ersten Blick die Gestalt eines hutzeligen Mannes in ihr erkennen konnte. Vater hatte schon mehr als einmal damit gedroht, den Baum zu fällen und zu Feuerholz zu verarbeiten, doch er ließ sich stets von Rojis Bitten erweichen, der auf den Anblick des Eichenmanns nicht verzichten wollte. Leider dankte es ihm der Baum nicht, indem er ihn mit einer weisen Antwort beglückte, sondern schwieg wie üblich majestätisch.
Roji seufzte und schleppte das Wasser zurück ins Haus. Ein schönes Haus war es, aus weißem Gestein erbaut, das Dach war frisch mit Reet eingedeckt und die runden Butzenfenster glänzten in der Morgensonne. Es war Luxus, einen eigenen Brunnen zu besitzen. Ihre Nachbarn mussten alle zum Dorfplatz von Mühlenheim laufen, der über eine Meile entfernt lag. Sein Vater wurde nicht müde zu predigen, dass Besitz Verantwortung bedeutete und man hart arbeiten musste, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Leider hieß das nichts weiter, als dass Roji den lieben langen Tag hart arbeiten musste, um Haus, Gemüsegarten und Brunnen zu bearbeiten, kleine Schäden zu reparieren und dafür zu sorgen, dass er und sein Vater und ihre Tiere genug zu essen hatten. Darum füllte er nun den Wassertrog für die Ziegen, nachdem er ihren Stall gesäubert hatte, und gab den Hühnern ihr Futter, bevor er in die Küche ging, um nach dem Sauerteig für die Brote zu sehen. Heute war Freitag, da konnten die Dörfler für ein kleines Entgelt den großen Ofen des Müllers Wilbur benutzen, um ihre Brote zu backen.
„Guten Morgen!“
Roji blickte sich um, als er die Stimme der alten Hilla hörte, die am offenen Fenster stand. Sie war eine Nachbarin, ein wenig verrückt und seltsam und älter als die Himmelsmächte selbst. Jedenfalls erzählten sich das die Dorfjungen und lachten dabei über die zahnlose, hutzelige, tief gebeugte Alte, die vor etwa dreißig Jahren ins Dorf gezogen war. Niemand wusste viel über sie, außer, dass sie ihre gesamte Familie verloren hatte und fortgegangen war, um zu vergessen. Man wusste nicht einmal, ob Hilla tatsächlich ihr Name war. Da jede dritte Frau so hieß, hatte es keine weitere Bedeutung. Die arme Alte konnte die meisten Arbeiten nicht mehr selbst bewältigen und schlich ein- bis zweimal die Woche durch das Dorf, um jedem einen guten Tag zu wünschen und sich herzlich zu bedanken, wenn man ihr dafür etwas zu essen in ihren verschlissenen Weidenkorb legte.
„Guten Morgen, Hilla!“, rief Roji und griff nach dem Stück Ziegenkäse, das er bereits für sie bereitgelegt hatte.
„Den Himmelsmächten befohlen, guter Junge. Den Mächten befohlen …“, murmelte sie und streichelte ihm mit ihren hageren, altersfleckigen Fingern über den Kopf. Sie roch mehr als streng und ihr verfallener Anblick war nicht leicht zu ertragen. Lagenweise trug sie Kleider übereinander, um ihren ausgemergelten Körper warm zu halten, und unter dem riesigen schwarzen Kopftuch verbarg sie sicherlich einiges an Ungeziefer. Dennoch lächelte Roji und wünschte ihr einen schönen Tag.
„Deine Mutter wäre stolz auf dich. Ein guter, solch ein guter Junge“, flüsterte sie wie so häufig, bevor sie langsam davonschlich. Roji schloss das Fenster, damit die Gestankswolke aus uraltem Schweiß und nasser Wolle und Holzasche und Zwiebeln und Ziegenfett nicht ins Haus eindringen konnte.
Deine Mutter wäre stolz auf dich.
Es gab nur noch ihn und seinen Vater. Seine Mutter war bei der Geburt der kleinen Schwester gestorben, als Roji zwei Jahre alt gewesen war. Danach wollte sein Vater keine neue Frau in seinem Leben und er hatte ihn allein großgezogen. Er arbeitete als Schreiber für den Landesherrn, womit er mehr als genug zu tun hatte, um den ganzen Tag beschäftigt zu sein, allerdings auch ausreichend verdiente, damit sie sich keine Sorgen um ihr Auskommen machen mussten. Auf der anderen Seite bedeutete es, dass Roji sehr viel allein war und sein Leben mit Kochen, Waschen, Putzen und sämtlichen anderen Arbeiten in Haus und Hof zubrachte. Auf der guten Seite stand, dass sein Vater ihn das Lesen und Schreiben gelehrt hatte, was sonst im Dorf fast niemand beherrschte, dass er häufig üben und manchmal sogar kleine Schreibarbeiten für seinen Vater übernehmen durfte und er eines hoffentlich fernen Tages seinen Platz in der Welt sicher hatte. Er betete, dass sein alter Herr noch lange seine ruhige Hand und das Adlerauge behielt, denn Roji war keineswegs erpicht darauf, die Briefe und Verträge und sonstige Korrespondenz des Landesherrn schreiben zu müssen. Dann flickte er lieber morsche Seile und schälte Steckrüben für das Abendessen.
Ein weiterer Höhepunkt jeden Tages. Roji liebte es, mit seinem Vater zusammen am Tisch zu sitzen, gemeinsam zu essen, zu reden, sich über die vielen kleinen Begebenheiten auszutauschen, die ihnen widerfahren waren. Also ja: Sein Leben war mühsam, aber übersichtlich und die meiste Zeit gab es keinen Grund zur Klage. Ausgenommen die Einsamkeit, die sich nicht leugnen ließ … Durch die Sonderstellung seines Vaters in der Dorfgemeinschaft gehörte auch er nicht wirklich dazu. Er hatte keine Freunde, keinen Vertrauten. Bei den Dorffesten, wo alle zusammenkamen, machten ihm seit einigen Jahren die Mädchen schöne Augen. Sonderling hin oder her, er war eine gute Partie mit seinem gesicherten Einkommen, dem Haus, das nur er erben konnte – und groß war die Auswahl für die heiratswilligen Damen sowieso nicht in dieser Gegend. Sein Vater erinnerte ihn gelegentlich, dass er Roji nicht hindern würde, sich zu verlieben, zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Immerhin war er bereits zwanzig, als zu jung konnte man ihn nicht mehr bezeichnen. So ganz klar war ihm nicht, was genau ihn zurückhielt. Er fand die Mädchen allesamt hübsch und manche von ihnen sehr nett. Ein oder zwei besaßen sogar Verstand und man konnte sich mit ihnen unterhalten. Doch nicht einmal mit denen wollte er näher zusammenkommen und wenn er versuchte, an Heirat und eigene Kinder zu denken ….
Vergangenen Sommer hatte Roji mit dem Dorfpriester über dieses Problem gesprochen. Eben dass er nicht recht wusste, was er mit einer Frau anfangen sollte und er darum vor dem Thema Hochzeit zurückschreckte. Der Priester, ein graubärtiger, dicker, gemütlicher alter Mann, der immer nach Pfeifentabak roch, hatte ihm lächelnd auf den Rücken geklopft und gesagt: „Das gibt sich, mein Junge. Manche sind schon mit zwölf Jahren reif und wissen alles über die Welt. Andere, so wie du, sind eben langsamer. Es ist ein gutes Ding, langsam und bedächtig an etwas so Wichtiges heranzugehen wie die Entscheidung, mit welchem Menschen man den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und gerade weil deine Mutter bei der Geburt eines Kindes starb, hast du sicherlich auch Hemmungen und Sorgen … Lass dir Zeit. Du wirst wissen, welche Frau die Richtige für dich ist, wenn du bereit dafür bist. Hab auch Vertrauen in die Himmelsmächte. Sie werden dich leiten und beschützen und auf jedem deiner Wege begleiten.“
Womöglich hatte Priester Lutbald mit den Dörflern darüber geredet, dass Roji langsamer und besorgt war. Jedenfalls waren die jungen Frauen bei den letzten Festen ein wenig mehr auf Abstand bedacht gewesen und hatten ihn nicht so stark bedrängt wie zuvor.
Er schüttelte die dummen Gedanken ab und band sich das blonde Haar neu, damit es ihm nicht ins Gesicht hing. Völlig Unrecht hatte der gute Priester ja nicht. Immerhin hatte sein Vater ihm gezeigt, wie lange Schmerz und Trauer das eigene Leben überschatten konnte. Das Gefühl von Schuld, weil man selbst daran beteiligt war, die Schwangerschaft herbeizuführen, sich mit auf das Kind gefreut hatte und dann die geliebte Frau und das neu geborene Töchterchen begraben musste. Solch einen Schmerz wollte Roji nicht durchmachen müssen und vielleicht war es also diese Angst, die ihn davon abhielt, sich zu verlieben.
Gerade wollte er den Korb mit den Brotrohlingen nehmen und zur Mühle marschieren, als plötzlich Tajan, der Hofhund, freudig anschlug. Diesen Tonfall besaß er nur, wenn Rojis Vater heimkehrte. Verwirrt setzte Roji den Korb ab und eilte hinaus. Sein Vater war vor kaum einer Stunde zur Burg des Landesherrn aufgebrochen, was wollte er jetzt bereits daheim?
„Ah, welch ein Glück, dass ich dich noch erwische, Junge!“, rief sein Vater, der auf seinem Wallach, eine Leihgabe des Fürsten, in den Hof geritten kam. „Lass die Brote sein. Ich habe Wilbur gebeten, dass er die Rohlinge nachher abholt, backt und für mich aufbewahrt, bis ich sie heute Abend holen kann. Du musst sofort nach Glorbyn aufbrechen und diesen Brief an den Dorfvorsteher überbringen. Auf Antwort musst du nicht warten, es geht um Anweisungen, wie mit einem Wilderer und Mörder zu verfahren ist, der gefangengenommen wurde. Das duldet keinen Aufschub! Keiner der Männer unseres Landesherrn ist abkömmlich, darum habe ich vorgeschlagen, dass du die Auslieferung übernimmst.“
Roji seufzte innerlich. Es war nicht das erste Mal, dass er einen solchen Auftrag übernehmen musste, gerade während der Aussaat- und Erntezeit kamen solche Dinge vor. Im Moment stand die Apfel- und Pflaumenernte an, was zeitraubend war, die Felder mussten für den Winter vorbereitet, das Vieh von den hochgelegenen Weideflächen in die Täler heruntergeholt werden. Da wurde jedes Paar Hände gebraucht, was er durchaus verstand. Er war allerdings auf diesem Hof ebenfalls unabkömmlich und er würde mit Sicherheit vier, fünf Tage brauchen, um den Zeitverlust nachzuarbeiten. Wilbur, der Müller, würde es sich mit guter Münze bezahlen lassen, dass er ihnen einen Sonderdienst erwies und überhaupt, es war eine lästige Angelegenheit. Darüber klagen half nicht viel, darum begann er schweigend, sich etwas Wegzehrung und Wasser einzupacken, während sein Vater den Korb mit den Brotrohlingen hinaustrug und fest zugedeckt auf den Tisch stellte, an dem er und Roji im Sommer gerne draußen saßen, um ihr Abendessen zu genießen. Tajan kannte Wilbur, er würde den Müller darum an den Tisch lassen, wenn auch nicht ins Haus.
„Nimm etwas Geld mit“, sagte sein Vater und legte ihm eine Handvoll Münzen auf den Tisch. „Es hat die letzten Tage scheußlich viel geregnet und möglicherweise ist die Straße in solch schlechtem Zustand, dass du nur langsam vorwärts kommst. In dem Fall übernachtest du bitte im Gasthaus von Glorbyn.“
„Aber Vater, wer kümmert sich dann um die Tiere? Und was ich dadurch an Zeit verliere …“
Sein Vater hob eine Hand und schüttelte energisch den Kopf. Er saß auf der Bank vor dem Haus, ruhte sich einen Moment aus. Der Jüngste war er nicht mehr. Silberfäden durchzogen seinen Bart, das blonde Haar wurde heller und war schütterer als noch vor einigen Jahren. Die feine, weit geschnittene Leinenkleidung konnte nicht verbergen, dass er zu viel Zeit in schlecht beleuchteten Kammern verbrachte, um an leidlich bequemen Schreibpulten zu arbeiten – er war recht kräftig um die Leibesmitte und seine Haut auffällig blass. Seine blauen Augen, die Roji von ihm geerbt hatte, blickten besorgt zu ihm hoch, als er nun Rojis Arm umfasste.
„Besser ist es, dass du mit der Arbeit in den Rückstand gerätst, als dass du dein Leben verlierst, Junge! In der Dunkelheit auf der schlechten Straße, da brichst du dir beide Beine und erfrierst, bevor dich jemand findet. Die Nächte werden schon sehr kalt. Also pack dir gute, warme Kleidung ein, ausreichend zu Essen für zwei Tage und pass auf dich auf. Zum Glück müssen wir uns um Strauchdiebe und Wegelagerer nicht weiter sorgen.“
Die wagten sich nicht in diesen Landstrich, dafür hatte Fürst Halbyn, der Landesherr, zu viele bestens ausgebildete Soldaten unter Eid stehen, die die Dörfer und Gehöfte in zwanzig Meilen Umkreis verteidigten. Für fahrende Händler und Reisende wurde es erst jenseits dieser Grenzen wieder zum gefährlichen Wagnis, die Hauptstraßen zu benutzen.
Auch Raubtiere galt es zu dieser Jahreszeit noch nicht zu fürchten. Wölfe wurden allenfalls im Winter aufdringlich, wenn der Schnee hoch lag und der Hunger drängend wurde. Bären und Wildschweine hielten sich von Menschen fern, solange man nicht über sie stolperte und die Jungtiere bedrohte. Roji war entschlossen, die Strecke an einem Tag zu schaffen. Da er die Bedenken seines Vaters verstand und respektierte, packte er sich dennoch Vorräte und warme Kleidung für zwei Tage ein und nahm auch Feuerstein, Zunder und eine Wolldecke mit. Reisen waren ein gefährliches Unterfangen, selbst zu besten Zeiten und in ruhiger Landschaft.
„Die Tiere sind versorgt“, sagte er und umarmte seinen Vater herzlich. „Essen konnte ich noch nicht für dich vorbereiten.“
„Mach dir keine Gedanken, Roji. Ich darf auf der Burg mitessen und werde Antjek bitten, dass er ein Auge auf unsere Hühner und Ziegen hält und ihnen morgen früh Futter und frisches Wasser gibt. Pass gut auf dich auf.“
„Das verspreche ich. Ich werde kein unnötiges Risiko eingehen. Nicht für diesen Brief und auch nicht, um schneller heimzukehren, als die Straße es hergibt.“
Er nahm Abschied von seinem Vater, dem Haus und Tajan, der traurig winselte und den Kopf hängen ließ, wie stets, wenn er allein zurückgelassen wurde.
„Ich komme bald wieder“, murmelte Roji und schulterte sein Bündel, nachdem er den Hund tröstend gekrault und getätschelt hatte. „Du wirst sehen, ich bin zurück, bevor du mich richtig vermissen konntest.“
„Vielen Dank, junger Mann. Wenn ich einen ungefragten Rat geben darf: Bleibt besser über Nacht in unserem Gasthaus. Das Wetter wird sich stark verschlechtern und Ihr würdet es nicht vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause schaffen.“
Missmutig blickte Roji durch das Fenster in den Himmel, der bleigrau über ihren Köpfen hing und aussah, als würde er jeden Moment den ersten schweren Herbststurm des Jahres losbrechen lassen. Er hatte es befürchtet. Schon auf dem Hinweg war er schlecht vorangekommen. Die Straße hatte sich in eine einzige Schlammkuhle verwandelt, darum musste er abseits des Weges laufen, was ihn ewig aufgehalten hatte. Zwölf Meilen waren auch so keine Kleinigkeit, die sich mühelos und schnell bewältigen ließen und selbst ohne Sturm und Regen war es unwahrscheinlich, dass er rechtzeitig vor der Dunkelheit zu Hause ankäme.
Der Dorfvorsteher schenkte ihm einen mitfühlenden Blick.
„Habt Ihr ausreichend Geld bei Euch, um Euch ein Zimmer mieten zu können? Ich nehme Euch gerne für die Nacht in meinem Haus auf, allerdings wäre es recht beengt. Meine Frau und ich haben mehr Kinder als Zimmer …“
„Oh nein, bitte, bemüht Euch nicht“, entgegnete Roji schnell. „Ich war auf diesen Fall vorbereitet und werde in dem Gasthaus übernachten. Auch mit Essen bin ich gut versorgt.“
„Meine Tochter wird Euch den Weg weisen“, sagte der Vorsteher und nickte dem etwa zehnjährigen Mädchen zu, das gerade den Raum betrat, der als Arbeitszimmer und Amtssitz, anscheinend aber auch für die Familienmahlzeiten genutzt wurde, falls die Geschirrvitrine ein Anhaltspunkt war.
Das Mädchen hatte nussbraune Locken, ebenso dunkle Augen und trug ein weißes Kleid, das sie sehr hübsch aussehen ließ. Sie trug ein Kästchen mit angespitzten Federkielen, das sie auf dem Schreibpult abstellte.
„Liebes, ich hätte eine Bitte an dich“, sagte ihr Vater. „Dieser Bote des Fürsten hat mir eine wichtige Nachricht überbracht. Sein Heimweg ist sehr lang und wie man sieht, wird das Wetter mit jedem Atemzug schlechter. Bitte begleite ihn zum Gasthaus.“
Der Blick der Kleinen drückte ein überdeutliches Muss das sein? aus. Doch sie protestierte nicht und nickte brav.
„Ich danke Euch“, sagte Roji.
„Mögen die Himmelsmächte Eure Reise segnen und Euch unbeschadet heimführen“, entgegnete der Dorfvorsteher. „Und du, Liebes, gib gut acht und trödle nicht. Das Wetter sieht beängstigend aus.“
„Ja, Vater“, sagte das Mädchen und lief neben Roji her, als sie gemeinsam das Haus verließen und die Dorfstraße hinabgingen.
„Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Warum warst du da?“ Ihre Neugier kannte plötzlich keine Grenzen mehr und sie schoss Frage um Frage ab, was Roji sich geduldig gefallen ließ.
„Mein Name ist übrigens Naria. Hast du auch Kinder? Söhne oder Töchter?“
„Nein, ich habe keine Kinder und ich bin noch nicht verheiratet. Dein Name ist übrigens wunderschön, liebe Naria. Könntest du mir bitte sagen, ob es noch weit bis zum Gasthaus ist?“, fragte Roji. Erste Sturmböen rüttelten an Bäumen und Dächern und feiner Nieselregen sprühte ihnen in die Gesichter.
„Nein, nicht sehr.“ Falls Naria beleidigt war, weil er ihren Redefluss unterbrochen hatte, ließ sie es sich nicht anmerken. „Wir müssen bloß den Hügel dort herunter. Die Straße ist ziemlich schlecht, also pass auf. Ich bin nicht schuld, wenn du dir ein Bein brichst.“ Sie lächelte niedlich, trotz ihrer etwas herzlosen Worte. Vermutlich war sie deutlich jünger als gedacht, wohl eher acht als zehn Jahre alt, und meinte das wörtlich statt irgendwie böse. Es würde auch ihre unhöfliche Art erklären, mit einem Fremden zu reden.
Während sie den Hügel auf einem von Regen unterspülten Weg hinabschlitterten, der mehr aus Schlamm und Löchern als erkennbarem Boden bestand, frischte der Wind erheblich auf. Stetig heftigere Sturmböen zerrten an ihren Haaren und Kleidern.
„Du solltest besser umkehren und rasch nach Hause laufen“, sagte Roji beunruhigt. Die pechschwarzen, tiefhängenden Wolken verhießen nichts Gutes und das Unwetter bewegte sich sehr viel schneller auf sie zu, als er vermutet hätte. Blitze zuckten, ein unirdisches Grollen hing in der Luft.
„Ich glaube, ich will lieber bei dir bleiben und mich im Gasthaus unterstellen“, erwiderte Naria und ergriff seine Hand mit entwaffnender Selbstverständlichkeit. Sie eilten den Weg hinab. Mit jedem Schritt wurde es dunkler um sie herum, der Wind heulte wie ein Rudel Wölfe und ohne jede Vorwarnung prasselten unvermittelt Hagelkörner auf sie herab.
Roji hob sich das Kind auf die Hüfte, schützte Narias Kopf mit seinem Reiseumhang und rannte blindlings drauflos. Sie erreichten den Fuß des Hügels, wodurch es leichter wurde, da Roji nun an den Wegrand wechseln konnte, wo er Gras unter den Stiefeln hatte. Weil Naria durchaus Gewicht besaß und er vor lauter Dunkelheit, Wasser in den Augen und dem dichten Vorhang aus schmerzenden Hagelkörnern vermischt mit Regen kaum etwas sah, fühlte es sich dennoch an, als würde er kaum einen Schritt vorankommen. Ein Blitz zuckte über ihren Köpfen und erhellte die Welt auf schaurige Weise; dicht gefolgt von einem Donnerschlag, laut genug, dass Roji vor Angst kurz in die Knie ging.
„Nur noch ein kleines Stück!“, schrie Naria gegen den heulenden Wind an und wies auf ein hohes Steinhaus, das beim nächsten Blitz sichtbar wurde. Die Fensterläden waren fest verschlossen, sodass kein Lichtschein nach außen fiel, darum war es nicht aus der Ferne zu erkennen gewesen. Es war kaum noch einen Steinwurf entfernt, stellte Roji zutiefst erleichtert fest. Er war durchnässt und schlammbedeckt. Solch ein Ärger! Zum Glück war sein Reisebündel wasserdicht und würde sogar einem Bad im Fluss standhalten. Noch einmal zusammenreißen, dann konnte er sich an einem behaglichen Feuer aufwärmen und umziehen. Vermutlich war der Spuk in einer Viertelstunde schon wieder beendet. Er musste lediglich …
„Aaah!“ Roji fand sich verdutzt am Boden liegend wieder. Er war über irgendetwas gestolpert. Beim Versuch, aufzustehen, schoss heiß-sengender Schmerz durch seinen linken Fuß. Verdammt! Hoffentlich war da nichts kaputt gegangen, das würde ihm jetzt zu seinem Glück fehlen.
„Alles in Ordnung?“, rief er Naria zu, während er am Boden hockenblieb, sein Bein umklammerte und wartete, dass der Schmerz nachließ. Es war derartig finster, die Regenwand so dicht, dass er sie kaum als Silhouette ausmachen konnte, obwohl sie direkt vor ihm stand.
„Alles gut!“, brüllte sie zurück.
„Ich hab mir den Fuß verdreht. Lauf du schon mal ins Haus, ich komme sofort hinterher.“
„Ist gut.“ Sie zögerte kurz, dann rannte sie auf das Gasthaus zu. Roji sah im Licht eines Blitzes, wie sie die Tür erreichte. Ein heller Fleck leuchtete im Dunkeln auf und verschwand. Das Mädchen war in Sicherheit. Sehr schön. Da wollte er nun auch hin. Es war nicht bloß unglaublich unangenehm, im kalten, nassen Dreck zu sitzen und von eisigem Regen überschüttet zu werden, der mittlerweile vorherrschte, während der Hagel nachließ; es war zudem extrem beängstigend, da Blitz und Donner sich weiterhin gegenseitig jagten. Den entfesselten Urgewalten ausgeliefert zu sein schuf Demut. Probehalber stampfte Roji mit dem verletzten Fuß auf. Es sollte gehen, wenn er ihn nicht voll belastete! Darum quälte er sich in die Höhe, orientierte sich und humpelte mit eingezogenem Kopf auf das Gasthaus zu. Dreißig Schritte, mehr konnten es nicht sein. Wenn es bloß etwas heller wäre, oder die Sturmböen nachlassen könnten! Grässlich war es hier. Wirklich grässlich. Er duckte sich, als der nächste Blitz zuckte, sofort gefolgt von Donner, laut genug, dass es in seinen Ohren schallte und ein seltsames, quälendes Fiepen zurückblieb. Wie weit noch? Roji blickte hoch, suchte das Gasthaus. Nichts zu sehen, es war zu dunkel. Verflucht! Hoffentlich war er nicht seitlich daran vorbeigerannt, ohne es zu bemerken. Er schaute in alle Richtungen, versuchte seine Augen vor dem Regen abzuschirmen, um mehr erkennen zu können. Kein Haus. Nirgends, kein Haus! So ein Unfug. Probehalber lief er ein paar Schritte weiter nach rechts. Immer noch nichts. Fluchend und lauthals zeternd versuchte Roji, exakt den Weg zurückzulaufen, den er gekommen war. Konnte doch nicht sein, dass er sich auf solch einer geringen Distanz unrettbar verlief!
Was sowieso nicht möglich war. Glorbyn war ein Dorf, umgeben von Feldern und lichtem Wald, keine undurchdringliche Wildnis. Schlimmstenfalls musste er in dem Sturm draußen ausharren und sobald es hell genug wurde, den nächstbesten Weg ansteuern, dann würde er zurückfinden. Jetzt galt es erst einmal, irgendeine Art von Schutz zu suchen. Bäume waren nicht empfehlenswert in diesem Wetter. Vielleicht würde er eine Scheune oder wenigstens eine Grenzmauer aufspüren, wenn er noch ein bisschen aufs Geratewohl durch die Finsternis irrte. Roji wollte ungern in dem eisigen Regen stehenbleiben und sich dabei eine Lungenentzündung einfangen. Ein Gutes hatte die Kälte allerdings: Er konnte seinen verstauchten Knöchel nicht mehr spüren.
Schritt für Schritt humpelte er über matschiges Gras voran, kämpfte gegen den heulenden Wind, der sich durch die Haut bis in die Knochen fraß und jedes bisschen Wärme stahl, das er jemals besessen hatte. Das Wasser war mittlerweile überall. In seinem Mund, seinen Ohren, den Nasenlöchern, Stiefeln. Sogar sein Leibtuch war durchweicht. Roji fror erbärmlich und er spürte, wie ihm mit jedem Schritt die Kraft weniger wurde. Nicht mehr lange, und er konnte gar nicht mehr gegen Sturm und Regen bestehen. Was lächerlich war. Er war jung, kräftig, gesund!
Wie lange irrte er eigentlich schon umher? Jegliches Zeitgefühl war ihm verloren gegangen.
In diesem Moment prallte er gegen ein hartes Hindernis. Ein schmiedeeisernes Tor war es, das sich beim nächsten Blitz enthüllte. Prachtvoll musste es einst gewesen sein, mindestens drei Schritt hoch, in eine gewaltige Steinmauer eingelassen. Doch nicht einmal die nachtdunkle Finsternis und der Regen konnten gänzlich verbergen, dass alles von Unkraut überwuchert war und das Tor unter Rost und Verfall litt. Konnte es sein? Roji erinnerte sich an Erzählungen von einer Familie, die etwa eine Meile von Glorbyn entfernt ein Anwesen besessen haben sollte, auf das selbst der Landesfürst neidisch gewesen war. Ein großes Haus von schlossähnlichen Ausmaßen, Dienern, ein riesiger Park. Niemand wusste, woher der Reichtum dieser Familie stammte oder was das überhaupt für Leute waren, denn sie ließen sich nicht im Dorf sehen und die Diener erzählten nichts von ihren Herrschaften, wenn sie zum Wochenmarkt kamen, um Lebensmittel einzukaufen. Vor etwa dreißig Jahren musste irgendetwas geschehen sein, denn niemand kam mehr zum Wochenmarkt und das große Tor wurde nicht mehr geöffnet. Angeblich sollten seither dutzende und aberdutzende Diebe und Glücksritter versucht haben, in das Haus einzubrechen, um sich dort umzuschauen und Schätze zu stehlen. Niemand hatte es je geschafft, Türen oder Fenster aufzubrechen. Zumindest wurde das behauptet. Anscheinend sollte Roji gleich mehr darüber herausfinden – das große Tor war jedenfalls nicht versperrt, es öffnete sich mit einem schauderhaften Quietschen, als er daran rüttelte. Wenn Aussicht bestand, endlich dem peitschenden Sturm zu entkommen, dann wollte er es gerne mit einem verwunschenen, möglicherweise auch verfluchten Haus aufnehmen, das seit drei Jahrzehnten leerstand!
Eine Windböe ließ das Tor zuschlagen, kaum dass Roji hindurchgetreten war. Ihn schauderte es, zu sehr fühlte es sich an, als wäre er plötzlich eingesperrt. Das war Unsinn, außerdem trieb ihn der anhaltende Sturm auf den Überresten eines Kieswegs entlang, der zwar ebenfalls mit Unkraut und jungen Bäumen überwuchert war, aber dennoch ein leichteres Laufen ermöglichte als zuvor auf Wiesen und Waldboden. Hatte der Wind etwas nachgelassen? Möglicherweise half die hohe Mauer in seinem Rücken und schützte ihn. Roji fasste Mut und eilte den Weg entlang. Die Parkanlage war tatsächlich erstaunlich weitläufig. Blitze enthüllten das herrschaftliche Haus, das mindestens eine halbe Meile vom Tor entfernt lag. Diese Familie musste wirklich unglaublich reich gewesen sein, um sich ein solches Haus bauen zu können. Selbst aus der Ferne war zu erkennen, dass jedes einzelne Bauernhaus von Glorbyn in diesem Palast Platz finden würde. Jedes. Das Haus war gewaltig.
Roji hoffte sehr, dass er irgendwo unterkriechen konnte. Vielleicht nicht im Haupthaus, doch sicherlich gab es Stallungen, die nicht verriegelt worden waren. Selbst eine verlassene Hundehütte wäre ihm im Moment recht, Hauptsache, er kam aus diesem Unwetter raus! Noch nie in seinem Leben hatte er so sehr frieren müssen, Hände und Füße schienen abgestorben, sein Gesicht fühlte sich an, als wäre die Haut abgezogen worden. Ein Ende des Sturms war nicht in Sicht, Blitz und Donner hatten sich scheinbar festgesetzt, der Regen stürzte mit unverminderter Macht auf ihn herab.
Endlich erreichte er das Gebäude. Fünf Stockwerke rötlich-braunes Backstein. Von solch riesigen Häusern hatte Roji bislang bloß gelesen und fahrende Händler darüber sprechen gehört. Selbst in dieser von Blitzen durchzuckten Finsternis konnte man leicht erkennen, wie großartig und gewaltig das Gebäude sein musste. Ein Brunnen mit unförmigen Gestalten erhob sich davor, das Licht genügte nicht, um zu erkennen, welche Fabelwesen der Künstler gewählt hatte. Zentauren vielleicht, oder Meeresmenschen? Es war Roji herzlich gleichgültig, obwohl er solche Kunst an jedem anderen Tag stundenlang bestaunt hätte. Stattdessen hastete er die Steintreppe hinauf zur großen Eingangstür. Vielleicht waren die Einbrecher entgegen der Legende erfolgreich gewesen und hatten ein Loch hineingeschlagen?
Nun, ein Loch konnte er nicht entdecken. Doch als er sich gegen das schwere dunkle Holz lehnte, im verzweifelten Versuch, ein bisschen Schutz vor der Witterung zu finden, gab die Tür zu seiner maßlosen Verblüffung nach. Er konnte hinein! Vor Glück jauchzend quetschte sich Roji durch den Spalt und warf die Tür hinter sich sofort zu. Sturm und Regen blieben draußen.
Stille empfing ihn. Stille, dazu warme, abgestandene Luft und absolute Dunkelheit. Roji sank zu Tode erschöpft auf den Boden nieder, der mit Steinplatten ausgelegt war. Er musste sich bewegen, das war ihm klar. Roji zerrte sich das Tragbündel vom Rücken und sämtliche Kleidung vom Leib. Das war Schwerstarbeit, so durchnässt wie alles war klebte es ihm an der Haut. Bei den Stiefeln musste Roji dermaßen arbeiten, dass ihm fast schon wieder warm wurde. Danach kämpfte er gegen die Verschnürung seines Bündels, der Knoten wehrte sich gegen seine tauben, gefühllosen Finger. Er schrie vor Frust und Kälte, fluchte derber als jeder fahrende Kesselflicker und Scherenschleifer, bis das Gebinde endlich nachgab. Zutiefst erleichtert hüllte er sich in die Wolldecke, rollte sich eng auf dem Boden zusammen. Ein Feuer konnte er nicht entzünden, er hatte kein Holz bei sich. Die trockene Ersatzkleidung wollte er in einigen Minuten überstreifen, wenn er etwas wärmer und trockener geworden war. Erst einmal zu Atem kommen. Bei allen Himmelsmächten, was für ein scheußliches Wetter! Er hatte den einen oder anderen Moment durchlitten, wo er nicht sicher gewesen war, ob er diesem Sturm lebendig entkommen würde! Aber jetzt war alles gut. Er würde sich aufwärmen, etwas essen, später nachschauen, ob er die Küche fand und dort ein Feuer im Ofen entzünden konnte, damit auch seine Stiefel und der Umhang trocknen konnten. Zitternd und bebend lag Roji am Boden und lauschte dem Gewitter und Sturmgeheul. Es klang weit entfernt und hier, mit einem sicheren Dach über dem Kopf, gab es auch keinen Grund, sich zu fürchten. Ein wenig störte es ihn, dass er so dumm gewesen war, das Gasthaus zu verfehlen. Die arme Naria! Sie hatte den Leuten in der Herberge zweifellos von ihm erzählt. Sobald der Sturm vorüber war, musste er sich beeilen, um zurückzukehren, denn selbstverständlich würde man nach ihm suchen. Er wollte nicht, dass sich die Leute Sorgen um ihn machten. Mit ausreichend Pech musste er allerdings über Nacht in diesem Haus bleiben, denn er würde nicht noch einmal in der Finsternis durch unbekanntes Gelände stolpern.
Langsam sollte er wohl die Augen öffnen und sich die Ersatzkleidung überstreifen. Wenn er bloß nicht so müde wäre … Er musste sich bewegen. Hinsetzen. Anziehen. Jetzt! Jetzt … gleich …
Roji schlug die Augen auf. Sein Kopf schien mit einer zähen, trägen Nebelmasse gefüllt, in der jeder Gedanke steckenblieb und zu ertrinken drohte. Wo war er? Was war geschehen?Sehr langsam fanden sich erste Erinnerungen ein. Der Brief. Der Marsch nach Glorbyn. Das Unwetter. Das kleine Mädchen, das es sicher ins Gasthaus geschafft hatte, während er sich wie ein Narr in der stürmischen Dunkelheit verlief, bis er in einem verlassenen Haus Unterschlupf gefunden hatte.
Ja. Genau dort lag er noch immer auf dem Steinfußboden herum, nackt unter einer klammen Wolldecke. Zumindest spürte er seine Finger und Zehen wieder und schlotterte nicht mehr länger wie ein Fieberkranker.
Vorsichtig setzte er sich auf. Ihm war etwas schwindelig und seine Muskeln fühlten sich steif und verhärtet an, nachdem er vermutlich stundenlang in dieser Zwangshaltung wie ein Toter geschlafen hatte. Strecken half, damit die Schmerzen und der Schwindel nachließen. Insgesamt ging es ihm besser als befürchtet. Von irgendwoher kam Licht, er konnte zumindest halbwegs erkennen, was sich um ihn herum befand. Ohne Mühe entdeckte er sein Tragbündel und hüllte sich rasch in frische, saubere Kleidung.
Das nasse Zeug hatte er vorhin überall verteilt. Roji beschloss, es erst einmal liegen zu lassen und sich umzuschauen, ob er die Küche oder einen anderen Raum mit einer Feuerstelle fand, wo im besten Fall noch Holz gelagert war. Er trank seinen Wasservorrat leer und aß von der Pastete, die er eingesteckt hatte. Sparen wollte er nichts, es war sinnvoller, für neue Kraft zu sorgen. Glorbyn war etwa eine Meile entfernt von hier und er würde sobald wie möglich zu dem Gasthaus zurückkehren. Dort konnte er sich ein Zimmer mieten, Essen kaufen und wenn danach noch Münzen übrig waren, sogar nach einem Badezuber fragen. Nun aber würde er erst einmal schauen, wie es in diesem verlassenen Gemäuer aussah. Das Gewitter war fortgezogen, jedenfalls donnerte es nicht mehr. Der Sturmwind hingegen heulte mit unverminderter Kraft und rüttelte an der großen, schweren Eingangstür. An Heimkehr war also noch nicht zu denken.