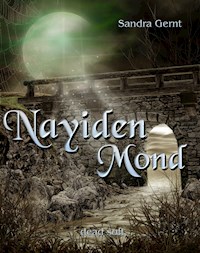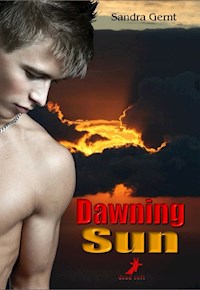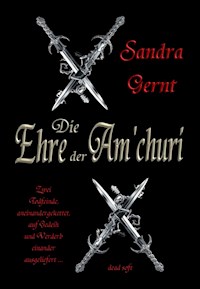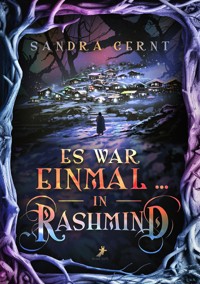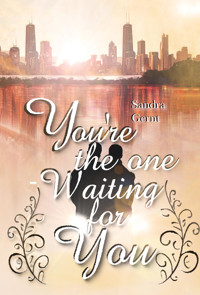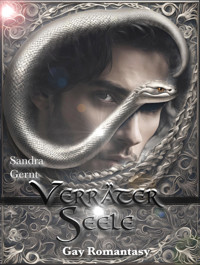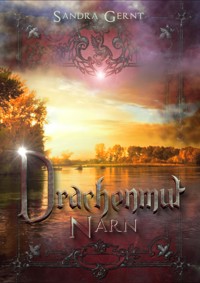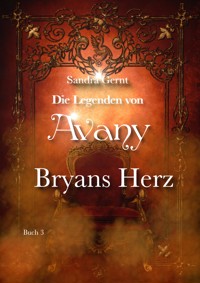4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Abschluss der Vielleicht … Trilogie! Nach einem heftigen Streit mit seinen Großeltern fährt Fabian spontan in den hohen Norden, um seinen Kumpel André zu besuchen. Der besucht gerade die Großfamilie seines Freundes Tobi und mitten im Trubel erhält Fabi ein spannendes Angebot: Er darf für sechs Wochen in einem ehemaligen Leuchtturm wohnen. Die Einsamkeit direkt am Meer – was könnte besser sein, um über das Leben nachzudenken und sich klar zu machen, was er damit überhaupt anfangen will? Dann begegnet ihm Leif. Ein scheuer, wortkarger junger Mann mit gewaltigen Problemen. Und schon bald muss er sich fragen: Kann man im Leben überhaupt irgendetwas endgültig planen, festlegen, ausschließen? Kann man dem Herz befehlen, was es fühlen darf und was nicht? Warnung: In dieser Geschichte werden der Suizid einer Nebenfigur, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten und extreme Essstörungen thematisiert. Dieses Buch schließt chronologisch an die Ereignisse von „Vielleicht … mit dir“ und „Vielleicht … beim zweiten Versuch“ an. Es handelt sich um ein anderes Liebespaar und ist eigenständig lesbar. Spoiler aus den vorherigen Büchern sind allerdings nicht zu vermeiden. Ca. 53.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 260 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Abschluss der Vielleicht … Trilogie!
Nach einem heftigen Streit mit seinen Großeltern fährt Fabian spontan in den hohen Norden, um seinen Kumpel André zu besuchen. Der besucht gerade die Großfamilie seines Freundes Tobi und mitten im Trubel erhält Fabi ein spannendes Angebot: Er darf für sechs Wochen in einem ehemaligen Leuchtturm wohnen. Die Einsamkeit direkt am Meer – was könnte besser sein, um über das Leben nachzudenken und sich klar zu machen, was er damit überhaupt anfangen will?
Dann begegnet ihm Leif. Ein scheuer, wortkarger junger Mann mit gewaltigen Problemen. Und schon bald muss er sich fragen: Kann man im Leben überhaupt irgendetwas endgültig planen, festlegen, ausschließen? Kann man dem Herz befehlen, was es fühlen darf und was nicht?
Warnung: In dieser Geschichte werden der Suizid einer Nebenfigur, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten und extreme Essstörungen thematisiert.
Dieses Buch schließt chronologisch an die Ereignisse von „Vielleicht … mit dir“ und „Vielleicht … beim zweiten Versuch“ an. Es handelt sich um ein anderes Liebespaar und ist eigenständig lesbar. Spoiler aus den vorherigen Büchern sind allerdings nicht zu vermeiden.
Ca. 53.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 260 Seiten.
von
Sandra Gernt
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Epilog
Ein Jahr voller Fantasy …
„Life is life … nanananana.“ Fabi trällerte den mehr als bekannten und berühmten Song vor sich hin, seit er aus der Straßenbahn gestiegen war. Der Typ neben ihm hatte das Lied auf seiner Handy-Playliste gehabt und Fabi mit einem grausamen Ohrwurm versorgt. Da er keine Ahnung hatte, ob er sich gerade großartig oder absolut furchtbar fühlte, passte das Lied auch noch hervorragend zu ihm.
Tja.
Wie fühlte er sich? Das Wetter war schön. Angenehm warm dafür, dass es gerade einmal Anfang April war. Nicht zu kalt, nicht zu heiß. Die Gärten blühten auf, die Bäume trugen die ersten Knospen. Ein Grund zur Freude.
Er hatte eine weitreichende Entscheidung getroffen, die sein gesamtes Leben auf den Kopf stellte. Das war … beängstigend. Und befreiend. Vorher war alles beschissen gewesen. Jetzt bestand Hoffnung, dass es besser werden könnte.
Er wühlte seine Schlüssel aus den Tiefen des Rucksacks hervor und marschierte auf das kleine Reihenendhaus zu, in dem er lebte. Das Haus seiner Großeltern, inklusive penibel gepflegtem Vorgarten, diversen Hartplastikfiguren in Form von Fröschen, Enten, Gänsen; selbstgezimmertem Vogelhäuschen, handgetöpfertem Namensschild neben der Tür. Spießiges Kleinbürgertum in einem idyllischen Vorort von Köln. Sein Zuhause.
Ihn empfingen Kochdüfte im Flur, der von typischen Glasbausteinelementen aus den Spätsiebzigern erhellt wurde. Heute hatte es Milchbohnensuppe gegeben, wie seine Nase ihm verriet. Oma liebte es klassisch. Und Fabi liebte seine Oma. Den Opa natürlich auch, allerdings war die Beziehung in den letzten Jahren schwieriger geworden. Seit seiner Entscheidung rumorte es tief im Bauch. Er musste es den beiden irgendwie beichten. Das würde anstrengend werden, dessen war er sich voll bewusst. Eigentlich wäre es klug, eine vernünftige Strategie aufzubauen. Leider war sein Kopf vollkommen leer und jeder Versuch, über das Thema nachzudenken, endete in Übelkeit.
Was insgesamt die Frage beantwortete, wie genau es ihm gerade ging: beschissen. Er hatte Panik. Hoffentlich endete dieser Tag nicht noch in einer totalen Katastrophe!
Seine Oma blickte überrascht auf, als er das Wohnzimmer betrat, wo sie auf der beigefarbenen Couch saß und sich ihrem neuesten Hobby hingab. Diamant Painting. Man musste winzige farbige Steinchen auf eine vorgemalte Leinwand kleben, um am Ende ein prächtiges Bild zu erhalten. Drei Bilder hingen bereits im Wohnzimmer. Zwischen Fabi und seinem Opa liefen Wetten, ob ihr zuerst die Wände ausgehen oder sie ein neues Hobby finden würde. Im Hintergrund lief der Fernseher, irgendeine politische Talkshow. Oma war stets voll informiert, was in der Welt geschah und es konnte übel ausgehen, mit ihr eine Diskussion beginnen zu wollen.
„Was machst du denn schon so früh hier?“, fragte sie ihn, schob vorsichtig die Schale mit den Miniatursteinchen beiseite und stand auf. „Sonst kommst du doch erst nach 18.00 Uhr? Hast du Hunger? Ich wärme dir dein Essen auf.“
Es war früher Nachmittag und damit nicht die beste Uhrzeit für ein Essen und Fabi hatte absolut keinen Hunger. Trotzdem nickte er. Solange er sich an einem Löffel festklammern konnte, musste er nicht reden.
Wenige Minuten später saß er mit sorgfältig gewaschenen Händen am Esszimmertisch und blickte seufzend auf seinen Teller. Normalerweise mochte er Milchbohnensuppe. Heute hätte es genauso gut auch Pappe sein können. Er begann trotzdem zu essen, damit Oma sich keine Gedanken machte. Damit würde sie noch früh genug beginnen.
Opa stieß zu ihnen. Er hatte im Garten gearbeitet. Man sah den beiden nicht an, dass sie bereits Mittsiebziger waren. Sie färbten sich die grauen Haare weg, Oma trug wie die letzten vierzig Jahre Dauerwelle. Beide waren schlank und sportlich-fit, gingen viel spazieren, hatten ihre Hobbys, die sie beschäftigt und den Kopf aktiv hielten. Manche Fünfzigjährigen konnten nicht mit ihnen mithalten.
„Fabi. Ist schon wieder die Hälfte des Unterrichts ausgefallen?“, fragte Opa und schüttelte den Kopf. „Du musst übrigens bei Rainer vorbeischauen. Er schrieb vorhin, dass er Post für dich hat.“
Rainer, das war Fabis Vater. Oder eher gesagt, sein Erzeuger.
Als Fabi knapp drei Jahre alt gewesen war, hatte seine Mutter von heute auf morgen beschlossen, einfach abzuhauen und ihre Familie zurückzulassen. Sie war mit einem anderen Kerl durchgebrannt, von dem sie innerhalb kürzester Zeit wieder schwanger geworden war. Davon wusste Fabi auch nur, weil sie ihn einmal angerufen hatte, als er bereits zehn geworden war. Schwer betrunken hatte sie ihm von seinen Halbgeschwistern erzählt und wie beschissen ihr neues Leben war. Er hatte ins Telefon geheult, dass sie kommen und ihn holen sollte. Da hatte sie aufgelegt und sich nie wieder gemeldet. Sein Vater war damit nicht klar gekommen, dass seine Frau ihn auf diese Weise verlassen hatte. Einen Tag später hatte er Fabi mit all seinen Klamotten und Spielsachen im Haus der Großeltern abgesetzt und war auf Tour gegangen. Saufen bis zum Koma. Vermutlich waren auch Frauen involviert gewesen.
Fabi kannte seinen Erzeuger eigentlich bloß besoffen. Er vegetierte auf Hartz IV vor sich hin, lag meistens mehr oder weniger ohnmächtig auf der vergammelten Couch und lebte ausschließlich von Alkohol und dem Essen, das Fabis Großeltern vorbeibrachten. Seine Oma verhinderte zudem, dass die Wohnung in Dreck und Chaos versank. Es war schwer für die beiden. Schwer hinzunehmen, dass der eigene Sohn – der einzige Sohn – ein solcher Versager geworden war. Abgestürzt, ohne Aussicht auf Rettung. Man konnte getrost davon ausgehen, dass er im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre an den Folgen seiner Alkoholsucht krepieren würde. Spätestens. Schon jetzt war sein Herz deutlich angegriffen, die Leber nahezu zerstört, die Bauchspeicheldrüse chronisch entzündet, Magen und Speiseröhre ebenfalls. Er litt an Bluthochdruck, Diabetes, schwersten Depressionen … Ach, die Liste war endlos. Es war erstaunlich genug, dass er heute wach genug war, um selbst daran zu denken, nach der Post zu schauen, und zu bemerken, dass einer der Briefe nicht für ihn bestimmt war.
Fabi seufzte innerlich. Er hasste es, zu seinem Erzeuger gehen zu müssen. Seine Kindheit war ohne ihn gut verlaufen. Die Großeltern hatten ihn liebevoll aufgezogen. Ja, sie waren eher konservativ-spießig. Wenig, was man ihm durchgehen ließ. Leistung wurde gefordert und zugleich als selbstverständlich vorausgesetzt. Trotzdem waren sie mehr als gut zu ihm, zeigten ihm stets, dass sie stolz auf ihn waren. Welche Ängste sie hegten, sie könnten noch einmal versagen. Auf keinen Fall sollte er werden wie sein Vater.
Das alles machte es noch viel schwieriger, mit der Wahrheit herauszurücken. Ihnen zu beichten, welche Entscheidung er getroffen hatte.
O Gott.
Opa würde ihn umbringen!
Unmöglich, auch nur einen weiteren Löffel Suppe herunterzuwürgen. Ihm war so übel, dass er jeden Moment auf den Tisch spucken würde.
„Fabi? Bist du krank?“, fragte Oma besorgt und legte ihm eine Hand auf die Stirn.
„Nein. Nein, alles gut“, murmelte er.
„Du bist aber blass wie ein Laken. Halsweh? Bauchschmerzen?“
„Hannah, er sagte doch, dass es ihm gut geht“, brummte Opa.
Abrupt legte Fabi den Löffel ab und schob den Teller von sich.
„Ich muss mit euch reden“, sagte er. In ihm zitterte und krampfte alles und schlagartig war ihm brütend heiß. Warum konnte er keine Ameise sein und sich unter irgendeinem Stein verkriechen?
Auch seine Großeltern wirkten schlagartig alarmiert.
„Was ist los, Junge?“ Oma fasste ihn am Handgelenk. Opa beugte sich zu ihm vor.
„Ich … ich habe mich heute … ich bin exmatrikuliert“, stieß er hervor.
„Was heißt das?“ Oma kannte sich nicht aus, sie durfte lediglich die Volksschule besuchen, wie sie oft genug betonte, obwohl sie in manchen Bereichen, vor allem in Politik, mehr wusste als einige Professoren.
„Das Studium ist beendet“, übersetzte Opa und nahm dabei einen grimmigen Ausdruck an. „Wie zur Hölle konnte das denn geschehen?“, fuhr er im gleichen Atemzug fort und hämmerte die Faust auf den Tisch, dass der halbvolle Teller klirrte. „Hast du die Semestergebühr zu spät überwiesen? Eine Leistung nicht vollbracht? Die können dich nicht einfach ohne Grund rausschmeißen! Wenn es eine Banksache ist, die schiefgelaufen sein sollte, dann kannst du …“
„Ich selbst habe den Antrag gestellt“, flüsterte Fabi. „Es ging einfach nicht mehr. Ich habe jeden Tag in der Uni gehasst. Jeden einzelnen.“
„Aber du bist doch erst seit September dabei, am Anfang hat man es immer ein bisschen schwer. Du kannst doch nicht direkt aufgeben!“, sagte Oma kopfschüttelnd.
„Es ist April, das ist mehr als ein halbes Jahr. Ich habe mir das monatelang überlegt. Es war von Anfang an schrecklich. Nicht bloß wegen der Dozenten, die größtenteils vollkommen desillusioniert sind und ihre Vorträge runterleiern, ohne auf Fragen einzugehen oder sich darum zu kümmern, ob die Leute überhaupt mitkommen. Nein es war … Ich hätte mich niemals einschreiben dürfen. Ich wusste von vorneherein, dass es ein Fehler sein würde, denn ich wollte nie Architektur studieren und noch weniger wollte ich ein Architekt sein.“ Mit jedem Wort wurde er leiser. Mit jedem Wort verfärbte sich Opas Gesicht in ungesündere Rottöne. Mit dem letzten Wort sprang Opa auf und packte ihn heftig am Kragen. Das hatte er in den siebzehn Jahren, die Fabi in diesem Haus lebte, noch kein einziges Mal getan.
„Ein Fehler? Ein FEHLER? DU WOLLTEST ARCHITEKT WERDEN! Seit etlichen Jahren sagst du, dass es dein Traumberuf ist und du dir nichts anderes vorstellen könntest. Wie kannst du da auf einmal behaupten, dass sei ein Fehler?“
Seltsamerweise wurde Fabi ruhiger, je wütender sein Opa sich gebärdete. Es gab ihm die Kraft, endlich das auszusprechen, das seit viel zu langer Zeit in ihm gärte:
„Es war dein Traum, dass ich genau wie du ein Architekt werden soll. Du hast davon gesprochen, seit ich in der ersten Klasse das erste wacklige Quadrat gezeichnet habe. Du warst stolz, wenn ich gute Noten in Mathe hatte – schau, der Junge kommt ganz nach mir, der wird mal ein großer Architekt! Du warst stolz, wenn ich mit Lego gebaut habe und hast mich zu all diesen Jugend forscht-Teilnahmen gedrängt, um dort Brückenmodelle einzureichen. Du warst immer froh, weil ich Begabung in Mathe besitze, nicht so bin wie mein Vater. Und ich wollte, dass du stolz bist. Ich wollte nie etwas anderes, als dich und Oma stolz zu sehen. Euch beweisen, dass ich kein Versager bin. Darum hatte ich auch nie einen anderen Plan geschmiedet, weil es praktisch von Geburt an beschlossene Sache war, dass ich Architekt sein muss. Und dann kam ich an die Uni, nachdem ich so hart dafür gearbeitet hatte, ein tolles Abitur hinzulegen … Und musste feststellen, dass ich vielleicht ganz fein rechnen kann und Geometrie kein Problem ist, ich aber nicht das geringste bisschen kreative Vision für Gebäude besitze. Dass ich es hasse, mit CAD zu arbeiten. Dass mich Bauphysik und Baumanagement, Tragwerkslehre und Heiztechnik nicht die Bohne interessiert. Ich saß in den Vorträgen und wollte nach Hause. Ich musste ständig irgendwelche Projekte entwerfen und basteln und mich mit Leuten absprechen, die irgendwie von anderen Planeten zu stammen scheinen, denn ich hatte nicht die geringste gemeinsame Basis mit ihnen. Ich musste die Wochenenden durcharbeiten, um diese blöden Projekte abzuschließen und dir erzählen, wie toll das alles ist, damit du weiter stolz sein kannst. Dabei hatte ich ehrlich gesagt hundert Mal so viel Freude am Aushilfskellnern, um die Studiengebühren und das alles zu finanzieren, als bei diesem Studium … Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Monatelang Bauchschmerzen und Durchfall und schlaflose Nächte und Kopfschmerzen. Als ich den Vordruck für die Exmatrikulation heute ausgefüllt und abgegeben habe, war ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in der Lage, frei zu atmen.“ Er zögerte, bevor er hinzufügte: „Es tut mir leid. Ich habe einfach viel zu lange gebraucht, um zu begreifen, dass ich versuche, deinen Traum zu leben, statt mir klar zu machen, was ich selbst vom Leben will.“
Opa war mittlerweile eisgrau im Gesicht. Er ließ Fabi los, als wäre er zu schwach, um ihn noch länger festhalten zu können. Langsam ließ er sich auf seinen Stuhl niedersinken. Einige Minuten lang herrschte eisiges Schweigen, untermalt vom Ticken der schweren Wanduhr, die Oma damals als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte.
Fabi setzte sich ebenfalls. Er fühlte sich klein, seltsam leer, wie eine geplatzte Papiertüte. Mindestens ebenso nutzlos auf jeden Fall. Zudem wurde ihm mit jedem Atemzug kälter.
„Du hast uns monatelang belogen, wenn wir dich gefragt haben, ob alles gut läuft“, murmelte Opa tonlos. „Immer war es großartig. Die Projekte toll. Die Komilitonen echte Kumpel. Die Dozenten ganz gut. Das hier kommt wie ein Atombombenanschlag, ist dir das überhaupt klar? Du hättest viel früher etwas sagen können. Etwas sagen müssen. Ich bin fassungslos … Und wie geht es jetzt weiter? Willst du Profikellner werden?“
„Nein, natürlich nicht“, begann Fabi, doch nun hatte Opa sich frei geredet und legte erst richtig los.
„Du bist genauso wie dein Vater! Bei ihm hat es auch mit Lügen begonnen. Mit dem Abbruch des Studiums. Dann hat er drei Ausbildungen geschmissen. War ihm zu anstrengend, zu langweilig, der Chef zu gemein, alles uninteressant. Dass ihm die Frau weggelaufen ist, war dann nur der letzte Todesstoß. Da ist doch irgendwas kaputt! Lehrjahre sind keine Herrenjahre, man muss sich auch mal durchbeißen! Das macht keinen Spaß, na und? Arbeitslos auf der Couch durchhängen und sich zu Tode saufen ist ja so viel lustiger!“ Er sprang auf, mit jedem Wort wurde er lauter. „Du packst dein Zeug. Zieh zurück zu deinem nutzlosen Vater und setz dich zu ihm auf die Couch. Dann könnt ihr gemeinsam saufen und euch leid tun, weil das Leben so unfair ist und man euch Träume aufzwingt, die euch gar nicht wirklich gefallen. Du hattest zig Jahre Zeit, mal die Klappe aufzureißen und was zu sagen. Niemand hat dich gezwungen, dieses Studium zu beginnen, das weißt du selbst. Ich hätte niemals geschimpft, wenn du mir gesagt hättest, dass du lieber Mathelehrer, Biologe oder meinetwegen auch Dachdecker werden willst. Das ist alles lächerlich! Lächerlich!“ Er schlug mehrfach mit der Faust auf den Tisch, gab Fabi nicht die geringste Möglichkeit, selbst etwas zu sagen. „Es ist mein absoluter Ernst!“, brüllte er nun, so heftig, dass Fabi in Sorge geriet, sein Opa könnte einen Herzinfarkt erleiden. „Du packst deine Sachen und verschwindest aus meinem Haus! Ich will dich nie wieder sehen!“
„HORST!“, schrie Oma.
Fabi wandte sich ab.
Wie auf Watte lief er, verließ den Raum. Wankte die Treppe hoch zu seinem Zimmer. In ihm war alles verknotet. Er fühlte … nichts. Da müssten tausend Empfindungen sein, aber die waren wie mit Panzertape zusammengeschnürt. Darüber war er froh, denn so konnte er in vollkommener Ruhe Kleidung aus dem Schrank ziehen und in die große Sporttasche werfen. Klamotten, Schuhe, Rasierer, Zahnbürste, Duschgel, Shampoo, Deo. Ausweis und Krankenkarte hatte er stets bei sich. Genau wie den Studentenausweis, den er aus der Brieftasche nahm und sorgsam in Stücke riss, bevor er die Reste in den Papierkorb warf. Was brauchte er noch? Impfpass. Schadete nicht, fraß keinen Platz. Handy, klar, Ladekabel auch. Geld hatte er einiges auf dem Konto. Keine üppigen Summen, aber er hatte die Semesterferien durchgekellnert und gutes Trinkgeld abgestaubt. Sein Laptop musste mit. Das Notizbuch mit den Adressen und Telefonnummern von Freunden und Familie? Na gut. Auch das. Mehr fiel ihm nicht ein. Wenn man sich auf das Allernötigste beschränkte, brauchte man nicht viel. Zeugnisse und Praktikabescheinigungen warf er schließlich noch dazu. Er würde Bewerbungen schreiben müssen. Irgendwie musste es weitergehen.
Wohin genau er jetzt gehen wollte, war ihm zwar noch ein Rätsel, aber er sollte sich in Bewegung setzen. Nicht dass Opa ihn rauswarf, bevor er wirklich an alles gedacht hatte, was wichtig sein konnte. Eine prall gefüllte Sporttasche und seinen großen Wanderrucksack hatte er gepackt. Auf Decken oder einen Schlafsack verzichtete er. Absolut ausgeschlossen, dass er im Freien übernachten würde! Irgendeine Jugendherberge oder ein Billighotel würden sich schon finden lassen, jawohl!
Er rannte beinahe Oma über den Haufen, als er sein Zimmer schließlich verließ.
„Wohin willst du gehen?“, fragte sie und nahm ihn in die Arme. Sie hatte geweint, sprach aber mit gefestigter Stimme.
„Ich weiß noch nicht. Kurz bei meinem Vater vorbeischauen und ihm sagen, dass ich die nächste Zeit unterwegs bin. Dann rufe ich mal bei meinen Freunden an, ob ich da irgendwo auf einer Couch schlafen kann. Zur Not nehme ich mir ein günstiges Zimmer.“
„Du passt auf dich auf!“, befahl sie drohend. „Und meldest dich, sobald du irgendwo untergekommen bist. In der Zwischenzeit bearbeite ich deinen Opa. Er hat das alles nicht so gemeint, das war der Schock und die Enttäuschung.“
„Ich wollte euch nicht enttäuschen“, murmelte Fabi. Die dicke Eispanzerschicht in seinem Inneren bekam Risse, das konnte er deutlich spüren.
„Natürlich wolltest du das nicht, genau dadurch ist diese lächerliche Situation doch erst entstanden! Und natürlich wissen wir, dass du nicht wie Rainer bist. Du kannst dich durchbeißen. Und du hast noch nie beim Alkohol übertrieben, im Gegenteil, du magst das Zeug überhaupt nicht. Wir sind stolz auf dich. Wenn du einen Fehler hast, dann dass du es allen anderen immer Recht machen willst. Jetzt geh erst einmal und überleg dir gut, wie du das Chaos wieder in den Griff bekommst. Wenn du dich nicht bis heute Abend gemeldet hast, schick ich die Polizei los!“
Die würde gar nichts tun, immerhin war er volljährig. Trotzdem tat es gut zu spüren, dass sie ihn nach wie vor bedingungslos liebte. Und sich riesige Sorgen machte.
„Sag Opa, dass ich ihn lieb habe. Und dass es mir leid tut. Ich melde mich, sobald ich weiß, wo es langgehen wird, versprochen.“ Fabi gab ihr einen dicken Kuss auf die Wange, drückte sie noch einmal an sich. Dann schulterte er sein Zeug und marschierte die Treppe hinab.
Wohin? Das war jetzt die Frage aller Fragen …
Fabi ließ seine Sachen im Wohnungsflur stehen. Er besaß einen Haustürschlüssel für die Wohnung seines Vaters. Weniger weil dieser ihm von Herzen vertraute, sondern weil der Kerl schlicht nicht die Kraft und Lust besaß, auf die Klingel zu reagieren. Vorsichtig lugte Fabi um die Ecke, um ins Wohnzimmer zu schauen. Schon mehr als einmal hatte sein Vater mit Flaschen nach ihm geworfen, wenn er sich gestört gefühlt hatte. Der Fernseher plärrte. Auf dem Tisch standen mehrere Bier- und Weinflaschen. Sein Vater lag ausgestreckt auf der Couch und schnarchte. Alles gut. Es war sicher, den Raum zu betreten.
Der Brief befand sich ebenfalls auf dem Tisch. Fabi war bei seinen Großeltern gemeldet. Wenn Post bei seinem Vater landete, dann nur, weil der Postbote sich manchmal irrte. Das lag keineswegs am Namen, sondern weil einer der Boten mit seinem Vater in die Schule gegangen war. Nicht dass das irgendwie Sinn ergab, aber solche Dinge geschahen eben. Es war ein Brief von der Krankenkasse. Bei der musste er noch das Ende seines Studiums vermelden, das war wichtig. Der Brief selbst beinhaltete bloß Werbung, wie er sich das schon gedacht hatte. Er nutzte den Umschlag, um seinem Vater eine kurze Nachricht zu hinterlassen, dass er hier gewesen war und in nächster Zeit bei Freunden übernachten würde. Es würde ihn nicht interessieren, vermutlich vergaß er es zwei Minuten, nachdem er es gelesen hatte. Falls er es überhaupt las. Kopfschüttelnd blickte Fabi auf die niedergestreckte Gestalt hinab. Sein Vater war sowohl hager und ausgezehrt als auch aufgeschwemmt zugleich. Der Hautton gelbstichig. Ein Blinder konnte sehen, wie krank er war. Ohne die Fürsorge von Oma, die ihm täglich Essen brachte und die Wohnung putzte, ihn zum Duschen und Rasieren und regelmäßigen Wäschewechsel zwang, wäre dieser Mann längst gestorben. Was für sämtliche Beteiligte besser gewesen wäre. Ein solches Dasein, über Jahrzehnte dahinvegetieren … Warum sprang man da nicht einfach aus dem Fenster und hatte es sofort hinter sich? Warum nahm man die zahlreichen Hilfsangebote nicht an und zog sich aus dem Sumpf? Es war schwer zu begreifen, selbst wenn man es hautnah mitverfolgen musste. Beinahe am schwersten war es zu verstehen, wie Oma das aushielt. Wie sie jeden Tag herkommen und auf die vielen Flaschen blicken und den Verfall ihres eigenen Sohnes beobachten konnte, ohne selbst in Depressionen zu versinken.
Vielleicht hatte sie deshalb ständig neue Hobbys? Es war jedenfalls kein einfaches Leben, das ihr aufgezwungen worden war.
Und ich hatte nichts besseres zu tun, als ihr noch mehr Kummer und Sorgen aufzuhalsen.
Beschämt wandte er sich ab. Wenn hier einer ganz bestimmt kein Recht hatte, arrogant auf seinen Vater niederzublicken, dann er. Rasch verließ er die Wohnung und marschierte die Straße hinab, um sich eine niedrige Mauer zu suchen, auf der er sitzen konnte. Dann begann er durch seine Handykontakte zu scrollen. Der einzige Kumpel, bei dem er blind zu jeder Tages- und Nachtzeit hätte anrufen und um Notunterkunft hätte bitten können, war André. Leider wohnte der inzwischen im hohen Norden in Husum, war superglücklich mit seinem Freund Tobi und kam mit seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten gut voran. Ansonsten sah es irgendwie mau aus, wie er sich eingestehen musste. Seine wenigen wirklich guten Freunde, diejenigen, auf die Verlass war, hatten ausnahmslos die Stadt verlassen, um irgendwo im In- oder Ausland zu studieren. Nicht weil Köln keine guten Möglichkeiten bot, sondern um vom Elternhaus wegzukommen. Auf eigenen Beinen zu stehen, sich frei zu entfalten. Er war hier geblieben. Nun ja, einen Unterschied hätte es nicht gemacht. Es war ein Fehler gewesen, dieses Studium zu beginnen. Offenbar einer, den er erst einmal machen musste, um zu verstehen, wie falsch es wirklich gewesen war. Alles daran war seine eigene Schuld.
Egal. Er musste jetzt zusehen, wie es mit ihm weitergehen würde, und das zügig. Statt zu telefonieren, starrte er hingegen wie festgefroren ins Nichts. Es war ein solch immenser Schock gewesen, dieser Streit mit Opa, er wusste gerade tatsächlich nicht mehr weiter. Sicherlich eine Stunde saß er da, regungslos, beobachtete die Leute, die an ihm vorbeizogen. Teenager mit der Nase auf dem Handybildschirm. Mütter mit Kinderwagen oder Kleinchen an der Hand. Männer im Anzug, die eilig liefen, den Kopf Richtung Boden gewandt, den Rücken gebeugt. Hundebesitzer jeden Alters und Geschlechts. Niemand achtete auf ihn. Er war halt ein Typ mit Sporttasche und Rucksack, der auf einer Mauer saß. Zu ordentlich, um obdachlos zu sein. Obwohl er genau das war. Ein Obdachloser. Ein arbeitsloser Studienabbrecher. Ein Versager.
O Mann …
Irgendwann gelang es ihm, sich aus den taumelnden Gedanken zu reißen und zückte erneut sein Handy. Er besaß eine Mitgliedskarte für Deutschlands Jugendherbergen. Vor Studienbeginn war er mit Benny, seinem damaligen Freund, auf Wandertour durch die Eifel gegangen. Jeden Tag hatten sie in einer anderen Jugendherberge übernachtet und es war großartig gewesen. Bis Ben ihm gestanden hatte, dass er nicht treu sein konnte und immer mal wieder etwas nebenbei laufen haben musste. Danach war diese Beziehung beendet und Fabi hatte sich geschworen, den Unfug mit dem Verlieben jetzt ein für alle Mal sein zu lassen.
Jedenfalls konnte er sich ohne Mühe in Jugendherbergen einchecken und die kosteten nicht viel. Fabi suchte die nächstgelegene heraus. Er brauchte ein Dach über dem Kopf, sonst nichts. Eine Viertelstunde mit der S-Bahn, danach ein kurzer Fußmarsch, und er war da. In der Nähe gab es einen Imbiss, wie ihm sein Smartphone verriet. Prima. Abendessen gesichert, sofern sein Bauch sich mit der Idee anfreunden konnte, wieder Essen zuzulassen. Er würde eine Nacht ins Kissen heulen und danach schauen, wie es weiterging. Vielleicht hatte sich Opa ja bis morgen beruhigt und er durfte nach Hause zurückkehren. Zumindest für ein vernünftiges Gespräch darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellte. Er wusste noch nicht, was er jetzt beruflich machen sollte. Ein anderes Studium war nicht ausgeschlossen. Vielleicht aber auch eine Ausbildung. Darüber würde er sich in den nächsten Wochen und Monaten klar werden. In der Zwischenzeit natürlich jeden Tag jobben gehen. Der Gedanke, gar nichts zu tun, kein eigenes Geld zu verdienen, seinen Großeltern auf der Tasche zu liegen, der hatte ihn schon als Jugendlicher angewidert. Das alles musste er Opa klarmachen. Er wollte auf keinen Fall so enden wie sein Vater. Eher würde er aus dem Fenster springen.
Ohne weiteren Verzug marschierte er zur nächsten S-Bahn-Station und stieg ein, als sein Anschluss kam. Er wollte so schnell wie möglich Oma kontaktieren und ihr die Sorge nehmen, dass er die Nacht irgendwo unter einer Brücke nächtigen musste.
Kaum saß er auf einem Platz weit hinten, da tippte ihm jemand auf die Schulter.
„Hey Fabi.“ Eine Frauenstimme. Irritiert drehte er sich um, lächelte dann allerdings, als er Yvonne erkannte, die ältere Halbschwester von seinem Kumpel André. Sie hatte Einkaufstaschen bei sich und fuhr anscheinend gerade nach Hause.
„Was ist denn mit dir los? Du siehst echt beschissen aus.“
Zögernd wechselte er den Platz und setzte sich zu ihr. Eigentlich wollte er sie nicht mit seinen Problemen belästigen, so gut kannte er sie schließlich nicht. Doch dann genügte ein Blick von ihr und alles platzte aus ihm heraus, noch bevor die nächste Haltestelle erreicht war.
„Okay“, sagte sie, als sie gemeinsam ausstiegen. Ganz Gentleman griff er sich eine ihrer Einkaufstaschen, obwohl er selbst schwer beladen war. Sie nahm es mit einem Seufzen hin. „Dein Opa ist enttäuscht. Bei deiner Familiengeschichte nicht völlig unverständlich. Er hat überreagiert und ich bin mir absolut sicher, dass es ihm jetzt schon wahnsinnig leid tut. Hängt jetzt davon ab, wie stur er ist und ob er einen Fehler zugeben kann … Du hast deinen Fehler ja zugegeben. Klar war das nicht geschickt, dich schweigend durchzuquälen, aber nun, manche Dinge lernt man eben auf die harte Tour. Jedenfalls lasse ich nicht zu, dass du in einer Jugendherberge abhängst. Nicht nach dem Schock, den du heute erlebt hast. Du kommst mit zu uns. Wir haben ein schönes Gästezimmer. Meine Töchter können dich ablenken, ich koche ein feines Abendessen. So bist du unter Leuten, schläfst dich aus und morgen nach dem Frühstück gehst du nach Hause und sprichst dich mit deinen Großeltern aus. Übrigens haben wir heute Abend Gäste, das wird bestimmt lustig. Kennst du Ben und Sven?“
„Persönlich nicht, nein. Ben ist der Bruder von Andrés Freund Tobi, oder?“
„Nein, der Cousin. Sie wohnen in der Nähe und kommen gelegentlich zum Essen und quatschen. Manchmal genießen wir einen Spieleabend, manchmal erzählen wir einfach nur. Die beiden sind supernett und wir machen es uns gemütlich. Was sagst du?“
„Ich weiß nicht, ob ich heute gute Gesellschaft bin“, murmelte Fabi unentschlossen.
„Ach was. Wenn es dir zu viel wird, kannst du jederzeit in die Küche fliehen. Oder dich ins Gästezimmer verziehen. Ist alles okay. Wichtig ist, dass du Menschen in der Nähe hast, mit denen du reden kannst. Ein Nein akzeptiere ich übrigens nicht. Ich würde mir riesige Sorgen machen, wenn du in dieser Verfassung allein in der Fremde übernachtest.“ Yvonne meinte es ernst und er war definitiv zu müde, um mit ihr zu streiten. Zumal ihm keine Argumente einfielen, warum er das tun sollte, denn natürlich war ein Gästezimmer bei netten Leuten so viel besser als ein Bett in einer Jugendherberge.
„Okay … Dann kann ich wohl nur noch danke sagen.“
Sie lächelte, als hätte er ihr gerade eine Riesenfreude bereitet.
Keine halbe Stunde später saß er auf der Terrasse, hatte eine Tasse Tee vor sich stehen – er vertraute seinem Magen nicht genug, um ihn mit irgendwelchen Süßgetränken zu belasten und Wasser pur schmeckte ihm nicht sonderlich, sofern er die Wahl hatte. Yvonnes Kinder, zwei Mädchen namens Jessica und Tabeah, tobten im Garten umher und er durfte einfach still dasitzen und müde sein, während Yvonne das Gästezimmer herrichtete, Essen vorbereitete und jede Hilfe rigoros abgelehnt hatte. Ihr Mann Daniel hatte auf seine Anwesenheit völlig entspannt reagiert.
„Meine Frau findet alle Streuner, sie zieht sie magisch an“, hatte er mit einem liebevollen Grinsen in ihre Richtung gesagt. „Egal ob verwaiste Kätzchen, aus dem Nest geschubste Küken oder obdachlose Jungs, Yvonne findet sie garantiert. Mach es dir bequem, Fabi, und mach dir bloß keine Sorgen. Das renkt sich alles wieder ein.“
Er holte sein Handy hervor und wählte Omas Nummer. Auch sie besaß ein Smartphone und es dauerte keine zwei Sekunden, bevor sie ranging.
„Fabi? Ist alles gut mit dir?“, fragte sie sofort.
„Alles gut, Oma“, sagte er so beruhigend wie möglich. „Ich kann bei Yvonne bleiben, bin ihr zufällig in der S-Bahn begegnet. Das ist die ältere Schwester von André. Sie hat ein Haus mit Garten, Mann und Kinder und vor allem ein großes Gästezimmer. Da übernachte ich heute.“
„Ach Fabi, was bin ich froh.“ Sie klang, als wäre sie den Tränen nah, was ihm wiederum die Kehle zuschnürte.
„Es tut mir leid, Oma. Das alles. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass so etwas passieren könnte. Ich wollte euch wirklich keinen Kummer machen.“
„Es ist nicht deine Schuld, Junge“, murmelte sie. „Im Prinzip ist es Rainers Schuld. Wäre er nicht das, was er ist, dann wäre dein Opa nicht vollkommen durchgedreht. Nicht über eine normale Sache wie einen Studienabbruch. Das machen viele junge Leute, manchmal muss man eben einen Fehler machen dürfen, um zu verstehen, was man wirklich braucht und will. Es tut ihm auch leid. Und du sollst dir jetzt keine Vorwürfe machen, sondern in Ruhe überlegen, wie es weitergeht, ja? Das ist eigentlich alles, was wichtig ist.“
„Das mache ich. Fest versprochen. Ich will ja gar nicht auf der Straße liegenbleiben, ich will einen guten Job haben.“
„Das wissen wir. Wir wissen, dass du nicht wie dein Vater bist. Und nun schau bitte, dass du ordentlich was isst. Ich bin sehr, sehr beruhigt, dass du einen guten Platz für heute Nacht gefunden hast.“
Er musste schon wieder gegen den harten Knoten in seiner Kehle anschlucken.
„Schau du, dass du heute Nacht selbst in Ruhe schlafen kannst, Oma“, flüsterte er. „Mir geht es gut, wirklich.“ Sie sprachen noch ein wenig, bevor Oma das Gespräch beendete. Danach blieb Fabi sitzen, wo er war. Die Familie ließ ihn in Frieden und ihm tat es gut. Diese Stille, nur gelegentlich unterbrochen von fröhlichem Kindergeschrei und Vogelgezwitscher. Es tat gut. Er ließ sich gedanklich treiben, schwebte ein bisschen über den Dingen, döste sogar für einige Minuten.
Als es irgendwann an der Haustür klingelte, fühlte er sich erholt genug, um Gesellschaft ertragen zu können. Dementsprechend lächelte er, als Yvonne und Daniel auf die Terrasse kamen, beladen mit Essensschüsseln, Geschirr und Besteck. Zwei Männer folgten ihnen, etwas älter als er selbst. Ihre mitfühlend-besorgten Blicke in seine Richtung machten klar, dass sie seine Geschichte bereits kannten. Das war gut. Es ersparte ihm lästige Erklärungen.
„Hi, ich bin Ben und das ist mein Freund Sven. Keine Ahnung, ob dein Kumpel André uns mal erwähnt hat?“ Sympathische Gesichter. Freundliche Stimmen.