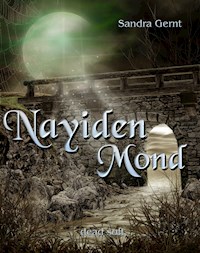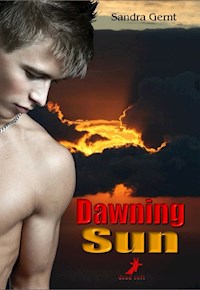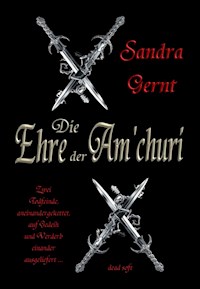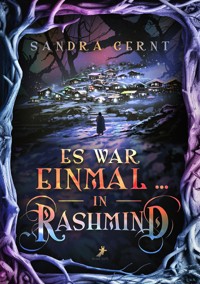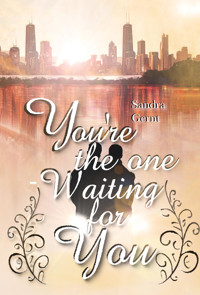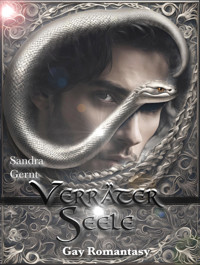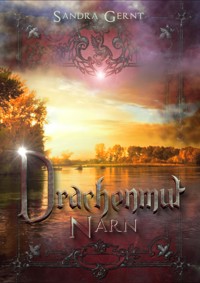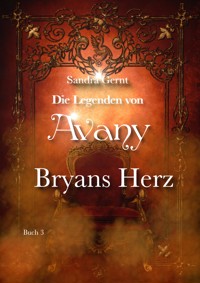4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eineinhalb Jahre. So lange ist es her, seit Tobi beinahe sein Leben verloren hätte, weil sein damaliger Freund ihn im Drogenrausch angriff. Der Weg zurück ans Licht ist hart und steinig. Tobi funktioniert, hat seinen Alltag meistens – nicht immer – im Griff. Doch einen echten Grund zum Weitermachen, der fehlt ihm nach wie vor. Er braucht Hilfe, das ist ihm bewusst. Nur: Wie soll er diese Hilfe annehmen, selbst wenn sie sich ihm bieten würde? André ist nicht freiwillig mit seinen Eltern in den hohen Norden gezogen und würde am liebsten sofort zurück in seine alte Heimat fliehen, wenn er sich das irgendwie leisten könnte. Als er wortwörtlich über Tobi stolpert, findet er einen Freund, der ihn mit seiner neuen Lebenssituation versöhnt. Tobi erscheint ihm in seinen schlimmsten Stunden wie ein halb ertrunkenes Kätzchen: verzweifelt, auf Rettung angewiesen und trotzdem werden die Krallen ausgefahren, sobald man es berührt. Was könnte dankbarer sein, als Katzenbabys zu retten? Doch wenn sie eine Chance auf Gemeinsamkeit haben wollen, müssen sie beide lernen: Tobi muss bereit sein, Hilfe anzunehmen und André muss begreifen, dass er selbst gelegentlich Hilfe benötigt. Dieses Buch schließt chronologisch an die Ereignisse von „Vielleicht … mit dir“ an. Es handelt sich um ein anderes Liebespaar und ist eigenständig lesbar. Spoiler aus dem ersten Buch sind allerdings nicht zu vermeiden. Ca. 55.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 270 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eineinhalb Jahre.
So lange ist es her, seit Tobi beinahe sein Leben verloren hätte, weil sein damaliger Freund ihn im Drogenrausch angriff.
Der Weg zurück ans Licht ist hart und steinig. Tobi funktioniert, hat seinen Alltag meistens – nicht immer – im Griff. Doch einen echten Grund zum Weitermachen, der fehlt ihm nach wie vor. Er braucht Hilfe, das ist ihm bewusst. Nur: Wie soll er diese Hilfe annehmen, selbst wenn sie sich ihm bieten würde?
André ist nicht freiwillig mit seinen Eltern in den hohen Norden gezogen und würde am liebsten sofort zurück in seine alte Heimat fliehen, wenn er sich das irgendwie leisten könnte. Als er wortwörtlich über Tobi stolpert, findet er einen Freund, der ihn mit seiner neuen Lebenssituation versöhnt. Tobi erscheint ihm in seinen schlimmsten Stunden wie ein halb ertrunkenes Kätzchen: verzweifelt, auf Rettung angewiesen und trotzdem werden die Krallen ausgefahren, sobald man es berührt. Was könnte dankbarer sein, als Katzenbabys zu retten?
Doch wenn sie eine Chance auf Gemeinsamkeit haben wollen, müssen sie beide lernen: Tobi muss bereit sein, Hilfe anzunehmen und André muss begreifen, dass er selbst gelegentlich Hilfe benötigt.
Dieses Buch schließt chronologisch an die Ereignisse von „Vielleicht … mit dir“ an. Es handelt sich um ein anderes Liebespaar und ist eigenständig lesbar. Spoiler aus dem ersten Buch sind allerdings nicht zu vermeiden.
Ca. 55.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 270 Seiten.
von
Sandra Gernt
„Das war eine Scheißidee!“, zischte André nun bereits zum zwölften Mal. „Geh mal vor die Tür, hat sie gesagt. Nimm das Fahrrad. Bewegung macht Spaß und frische Luft tut gut, hat sie gesagt. Und wie komm ich jetzt nach Hause?“
Sie, das war seine Mutter. Eigentlich hatte er die Idee gemocht, die Gegend mit dem Fahrrad zu erkunden. Denn ja, frische Luft und Bewegung waren fein und er kannte sich nach wie vor kaum aus, obwohl sie vor über zwei Monaten in dieses gottverlassene Nest gezogen waren. Hier waren sie am Ende der Welt, noch einmal links abgebogen. Unglaublich! So viel Einsamkeit auf einem Haufen hatte er sich nicht einmal vorstellen können, und nun lebte er mittendrin. Weil sein Vater einen neuen Job annehmen musste und sie darum umgezogen waren. In die hinterste Pampas, wo selbst Fuchs und Hase längst die Flucht ergriffen hatten und bloß Schafe und einige Möwen übriggeblieben waren. Nicht einmal Handynetzverbindung hatte er hier. Jedenfalls nicht im Freien, zu Hause schon.
André fuhr seit mindestens einer Stunde orientierungslos über holprige Wege und versuchte, zurück nach Hause zu finden. Wenn er wenigstens jemandem begegnen würde, der ihm die Richtung weisen könnte! Aber nein, er war vollkommen allein. Bilder stiegen auf. Vorstellungen, wie er hier verhungert und verdurstet am Wegesrand liegenbleiben würde, bis man zehn Jahre später zufällig sein Skelett fand und nur anhand der Seriennummer auf seinem Fahrrad noch herausfinden konnte, wer er gewesen war. Er sollte weniger Krimis lesen. Und nicht so viel fernsehen. Leider hatte er im Moment totalen Leerlauf, denn seine neue Ausbildung begann erst im September. Was sollte man da sonst großartig unternehmen, außer lesen, am Handy daddeln und fernsehen? Und ein bisschen Sport zwischendurch, damit man nicht durchdrehte. Keine Menschenseele kannte er bislang hier in der neuen Heimat, die definitiv nicht die seine war. Die Nachbarn grüßten nicht einmal, selbst ein Nicken war zu viel verlangt. Es war deutlich, wie wenig die Nordlichter von den Eindringlingen hielten.
Nun denn. André musste drei Jahre lang durchhalten. Danach konnte er abhauen und nach Köln zurück. Dort war er geboren. Da waren seine Wurzeln und noch jede Menge Familie. Seine Omas, Tanten, Onkel, Cousinen … Und seine fünfzehn Jahre ältere Halbschwester mit Mann und Kindern. Er vermisste die Bande. Vermisste sie so sehr, dass er echte Schwierigkeiten hatte, mit seinem Vater zu reden, denn nein! Es fiel ihm keineswegs leicht, ihm zu verzeihen, dass er sie hinaus in die Wildnis verschleppt hatte.
Konnte es echt möglich sein, dass hier jeder Grashalm exakt gleich aussah? Oder stellte er sich lediglich blöd an und fand deswegen nicht mehr den Weg nach Hause? Vielleicht fuhr er aber auch schon die ganze Zeit im Kreis? Wobei nein, dort vorne gab es eine Weggabelung, die hatte er bislang noch nicht gehabt.
André hielt an. Sollte er links oder rechts abbiegen? Sein Bauchgefühl riet zu rechts. Ja, eindeutig. Es wollte vehement, dass er nach rechts fuhr. Damit war der Fall entschieden – er bog links ab. Sein Bauchgefühl hatte leider nicht die Spur eines Orientierungssinns und lag unfehlbar immer falsch. Es war darum garantiert die klügste Entscheidung, es zu ignorieren und das Gegenteil zu versuchen.
Rund zehn Minuten folgte er dem Weg, der in erster Linie aus Gras und Steinen bestand. Dann hörte er plötzlich etwas. Eine Stimme! Da vorne war jemand! André fuhr schneller, nahm eine weitere Abbiegung. Verborgen von einigen vereinzelten Sträuchern entdeckte er schließlich eine Szenerie, die ihn verwirrte. Er hielt an, stieg ab und trat näher heran, versuchte zu begreifen, was dort geschah:
Ein Mensch lag am Boden. Ein junger Mann, wie es schien. Klein zusammengerollt, den Kopf in den Armen geborgen. Er zitterte heftig und stieß dabei seltsame Klagelaute aus, die André unter die Haut krochen. Diese Laute sprachen von großem Schmerz und heilloser, entsetzlicher Angst. Er wusste das, denn er hatte solche Laute mehr als einmal hören müssen.
Neben dem Mann hockten vier Hunde. Jack Russel Terrier, wenn er sich nicht irrte. Sehr kleine Tiere, womöglich waren es noch Welpen? Sie drängten sich winselnd an den Mann und leckten ihm über die Hände. Ein, zwei Schritte entfernt hockte ein Mädchen auf einem Stein. Sie war vielleicht acht Jahre alt, gab sich völlig unbeeindruckt und sprach auf den Mann ein.
„Die Vanessa findet übrigens, dass Geige das beste Instrument überhaupt ist. Ich finde ja, Geige ist total langweilig. Genau wie Ballett. So was machen nur absolute Spießer, okay? Meine Schwester zum Beispiel. Die ist auch so ein Spießer. Denkt, sie wäre wer weiß wie cool, weil sie schon zwölf ist und ihr doofes Ballett macht und Geige spielt. Meine Eltern wollen, dass ich das auch mache, aber ich bin kein Spießer. Ich mach Judo. Dafür muss Papa mich zwar in die Stadt fahren, aber er müsste mich ja auch fahren, wenn ich Ballett und Geige machen würde.“
Sie hielt in ihrem fortwährenden Geplapper inne, als sie André bemerkte. Prüfend schaute sie ihn an.
„Du bist nicht von hier“, stellte sie fest. „Bist du ein Tourist?“
„Nein. Ich wohne hier. Seit kurzem. Also irgendwo in der Umgebung, ich hab mich leider völlig verfahren.“ Er trat langsam näher heran, hielt die Hunde im Blick. Die reagierten nicht weiter auf ihn, darum kniete er sich neben dem Mann nieder. Der steckte noch immer in seinem Anfall, krampfte zuckend und weinend, der Welt offenkundig entrückt. Blonde Haarsträhnen klebten an Stirn und Wangen, zusammen mit Gras und Sand. Er trug blaue Jeans, rote Sneaker, ein weißes T-Shirt und eine ebenfalls blaue Jeansjacke. Grashalme bedeckten auch seine Arme. Verletzungen waren nicht offenkundig zu sehen.
„Was ist mit ihm?“, fragte André das Mädchen.
„Ach, der hat das öfter“, entgegnete sie unbekümmert. „Ist ein Typ aus der Nachbarschaft. Er geht hier manchmal rum, wenn er mit den Hunden läuft. Sind nicht seine, sondern die seiner Tante. Meine Mama meint, wenn ich ihn so vorfinde, soll ich einfach in der Nähe bleiben und mit ihm reden. Er hört auch wieder auf. Danach kann ich gehen und seinen Eltern oder der Tante Bescheid sagen. Tante Maria. Sie ist nicht meine Tante, ich darf sie trotzdem so nennen. Macht fast jeder so. Die lässt mich manchmal die Hunde streicheln. Ich heiße Samantha, und du? Die meisten nennen mich Sammy. Der da heißt übrigens Tobi. Ich bin gerne allein unterwegs und denke mir Abenteuergeschichten aus, darum finde ich ihn immer mal wieder. Hatte er jetzt aber wohl länger nicht mehr. In den letzten Wochen ist er mit den Hunden unterwegs gewesen und hat mich bloß nett gegrüßt.“
„Hallo Samantha“, sagte André rasch, als die Kleine eine Atempause einlegte. Sie war ziemlich vertrauensselig und konnte quatschen, als würde sie dafür bezahlt werden. „Ich bin André.“ Er legte eine Hand auf Tobis Schulter, wollte sich bemerkbar machen, dem armen Kerl zeigen, dass er nicht allein war. Der begann in grauenhaft hohen, schneidenden Tönen zu schreien, darum zuckte André erschrocken vor ihm zurück.
„Schlechte Idee“, kommentierte Samantha trocken. „Den darf man nicht anfassen, wenn er so drauf ist. Da bekommt er so richtig Panik. Deshalb sitze ich ja hier und erzähle, was mir gerade einfällt. Dann ist mir nicht so langweilig. Ich langweile mich echt nicht gern. Mama hasst es, wenn ich das tue.“
„Okay … Du könntest Hilfe holen gehen. Ich bin da und kann mich genau wie du hinsetzen und mit ihm reden.“
„Du bist fremd.“ Sie musterte ihn erneut sehr kritisch.
„Du bist ziemlich direkt“, entgegnete André. „Wie alt bist du denn?“
„Schon sechs! Im August komme ich in die Schule!“ Sie reckte sich stolz. Er hätte sie wirklich für älter gehalten, aber das lag wohl an ihrer selbstbewussten, forschen Art.
„Ich bin fast zwanzig“, sagte er. „Und auch wenn ich fremd bin, ich glaube, ich bin alt genug, um auf Tobi aufzupassen, bis es ihm besser geht. Oder du mit seiner Familie herkommst, je nachdem, was zuerst geschieht.“
„Na gut. Mir war sowieso gerade langweilig geworden. Obwohl ich erzählt habe. Ich nehme die Hunde mit. Tante Maria würde es gar nicht mögen, wenn die Welpen bei einem Fremden bleiben.“ Sie schnappte sich die Leinen der Winzlinge und zog sie mit sich. Irgendetwas an ihrer Logik war da nicht gänzlich sauber. Jedenfalls hoffte André, dass diese Maria sich mehr um ihren Neffen als um Hundewelpen sorgen würde. Zudem hoffte er, dass diese Familie in der Nähe wohnte und man ihm anschließend helfen konnte, den Weg nach Hause zu finden. Bis es soweit war, musste er bei Tobi bleiben. Was konnte dem armen Kerl widerfahren sein, dass er solch grausige Flashbacks durchmachen musste? Für den Kriegseinsatz war er garantiert noch nicht alt genug. Ziemlich schmal wirkte er. Entweder war er mächtig unterernährt oder auch jünger, als André auf den ersten Blick vermutet hatte, ohne dass er das Gesicht sehen konnte.
Wie aufs Stichwort ließ Tobi plötzlich die Hände sinken. Die Wangen waren rot angelaufen vom Weinen. Die blauen Augen wirkten riesig in dem schmalen Gesicht, und er war offenkundig kaum älter als André, wenn überhaupt. Zutiefst erschöpft schien er zu sein. Der Blick, mit dem er André musterte, zeugte von milder Verwirrung. Auf der Hut vor neuen Panikreaktionen kam André wieder näher und hockte sich zu ihm hin.
„Hi“, sagte er leise. „Geht es dir besser?“
Tobi befand sich noch in diesem Stadium orientierungsloser Bewegungsunfähigkeit, zudem viel zu erschöpft, um reden zu können. Der Flashback hatte ihn aus heiterem Himmel erwischt. Gerade noch war er mit den Hunden gelaufen und hatte über den Wind nachgedacht, der ihm kalt durch die Jacke drang und für Ende Mai sowieso zu frisch war. Einen Moment später waren seine Gedanken übergesprungen, wie er es für sich nannte. Normalerweise hatte er das gut im Griff. Es war schließlich schon eineinhalb Jahre her. Er hatte wie verrückt an sich gearbeitet. Mit seinen Therapeuten. In der Psychiatrie. Daheim mit seiner Familie. An fast allen Tagen spürte er, wenn ein Übersprung drohte und konnte es verhindern. Manchmal aber entglitt ihm die Selbstkontrolle und er stürzte einfach ab. Ohne Vorwarnung, ohne Rückhalt.
Und nun lag er hier irgendwo im Freien herum und ein Fremder beugte sich über ihn und er wollte am liebsten schreiend und brüllend fortlaufen, um sich in einer dunklen Höhle zu verkriechen. Nicht einmal das war ihm vergönnt. Keine Höhle weit und breit. Keine Kraft für die Flucht.
Also blickte er den Kerl an, der ihn vermutlich gleich mit Sorge und Mitleid und tausend Fragen und Notarzt-Angeboten überhäufen würde. Nichts hasste Tobi mehr, als mitleidige Fremde, die ihm einen Krankenwagen rufen wollten.
Wobei … Dieser Fremde wirkte sachlicher als die meisten anderen. Nicht so hektisch und spürbar bedroht. Es war in der Regel Hilflosigkeit und Überforderung mit einer Situation, die sonst nie vorkam, wenn Fremde ihm alles versprachen, vom Glas Wasser zum Notarzt bis hin zur Intubation mit der Kugelschreibermine; Hauptsache, er hörte auf, sich unkontrolliert zu verhalten und damit ihr Wohlbefinden zu bedrohen. Der Typ hier schien sich nicht bedroht zu fühlen. Vielleicht war er Krankenpfleger?
Groß war er, soweit Tobi das aus seiner Perspektive abschätzen konnte. Groß und recht sportlich. Nicht auf die „Ich gehe sieben Tage die Woche in den Fitnessclub“-Art, mit aufgepumpten Muskeln und riesigen Schultern. Eher athletisch-schlank. Blaue Strähnchen mischten sich in das dunkle, modisch geschnittene Haar. Auch der extrem sorgfältig getrimmte, kurz gehaltene Bart war dunkel. Vermutlich gefärbt. Vom hellen Hauttyp her würde Tobi ihn eher blond einschätzen. Augenbrauenpiercing. Tattoo am Hals und ein weiteres am rechten Unterarm. Er konnte nicht erkennen, um welche Motive es sich dabei handelte. Die Klamotten wirkten teuer und betont lässig. Zusammengefasst: Wahrscheinlich ein Tourist, den es eher aus Versehen an die Nordsee statt nach Ibiza verschlagen hatte. Er schien niemand zu sein, der sich auf dem Land wohlfühlte. Zu städtisch, zu modern, zu auffällig kam er herüber.
Na ja. Das konnte täuschen … Und es war irrelevant. Seine Augen gefielen Tobi. Ein warm leuchtendes Grau-Blau. Freundlich blickten sie auf ihn herab.
„Nun? Geht es besser?“, wiederholte der Fremde geduldig seine Frage.
Tobi nickte hastig. Er kämpfte sich durch den zähen Morast, in dem seine Gedanken und Erinnerungen versunken waren. So war es immer nach einem Anfall. Der Weg zurück ins Leben kostete irrsinnig viel Kraft, der heutige Tag war gelaufen. Wo befand er sich gerade? Nicht weit von zu Hause, oder? Ja, er entdeckte einen Strauch, den er kannte. Er war also höchstens fünfhundert Meter von daheim entfernt. Das war gut, denn die musste er gleich irgendwie bewältigen, wenn er hier draußen nicht übernachten wollte.
Und warum genau lag er eigentlich im Freien herum? Tobi ging sehr selten allein und ohne jeden Grund spazieren. Das schöne Wetter war es nicht gewesen, das ihn gelockt hatte. Schließlich hatte er über den kalten Wind nachgegrübelt, was zu dem Aussetzer geführt hatte. Er war … Ja, genau, die Welpen … Oha …
„Mein Gott!“ Er fuhr erschrocken hoch und packte den Fremden am Arm. „Welpen!“, stieß er aufgelöst hervor. „Hier laufen vier kleine Welpen herum. Jack Russel Terrier, sie sind winzig und unerfahren und können sich ernstlich verletzen. Ich brauche Hilfe! Sie müssen die Hunde suchen!“
„Ganz ruhig!“, rief der Fremde und berührte ihn nach kurzem Zögern beruhigend am Arm. „Den Hunden geht es gut. Da war ein kleines Mädchen. Samantha. Sie war bei dir, als ich zufällig vorbeikam und bringt die Welpen gerade zu Tante Maria. Es ist alles gut, niemand ist verletzt.“
„Dem Himmel sei Dank.“ Stöhnend sackte Tobi zurück zu Boden und legte den Arm schützend über das Gesicht. Der immense Schreck war Gift für seinen Körper, der sich noch lange nicht von der Panikattacke erholt hatte. Hart musste er kämpfen, um nicht vor Erleichterung loszuheulen und die Übelkeit niederzukämpfen, die der Adrenalinschub mit sich gebracht hatte.
„So ein Glück, dass Sammy da war …“, murmelte er schließlich. „Die ist cool. Und tough. Maria hätte mich zwei Köpfe kürzer gemacht, wenn ihren Welpen etwas zugestoßen wäre.“
„Das glaub ich nicht. Ist doch nicht deine Schuld, dass du umgefallen bist. Ich heiße übrigens André.“
„Tobi.“ Er nahm den Arm beiseite und versuchte sich an einem Lächeln. „Du kennst offenkundig meine Tante nicht … Danke, dass du hiergeblieben bist. Ist mir mega-peinlich.“
„Das muss es nicht. Ich glaube übrigens, da kommt deine Tante.“
Tobi riss den Blick von dem extrem sympathischen Lächeln los und hob den Kopf. Tatsächlich, da kam Tante Maria angestapft, mit energischen, weit ausgreifenden Schritten, wie üblich. Ihre graue Wollstrickjacke, die sie offen trug, wehte von links nach rechts. Leider war sie allein. Sie war kräftig und ausdauernd und Tobi keineswegs ein Schwergewicht, doch so erschöpft, wie er war, würde es ein mühsamer Heimweg werden.
„Ah, du bist ja schon wieder wach!“, rief sie, noch bevor sie angekommen war. „Und Sie müssen André sein“, fuhr sie fort, und reichte ihm die Hand, kaum dass sie vor ihm stand. „Samantha hat mir von Ihnen erzählt. Danke, dass Sie meinem Neffen beigestanden haben.“
Tobi spürte, wie seine Wangen zu brennen begannen. Er hasste es, praktisch invalide zu sein. Ein Grund für Erklärungen und Entschuldigungen.
„Hast du dich verletzt?“, fragte sie als Nächstes, an ihn gewandt. Sie war nicht wütend auf ihn, ihre burschikose, energische Art war typisch für sie.
„Alles heil“, murmelte er. „Bloß ausgewrungen. Hatte Papa keine Zeit, mitzukommen?“
„Dein Vater ist mit Gunnar unterwegs und deine Mutter ist bei den Schafen. Auch sonst war gerade niemand abkömmlich. Aber wir schaffen das. Hoch mit dir!“ Sie beugte sich herab und hievte ihn wie einen Kartoffelsack in den Stand. Tobi schwankte, und wenn Tante Maria und André nicht zeitgleich zugepackt hätten, wäre er ruhmlos wieder zusammengebrochen.
Sein Kreislauf machte nicht mit. Immenser Druck baute sich im Hinterkopf und Nacken auf, ihm wurde schwindelig und übel. Stöhnend sackte er nach vorne und blieb in Marias gnadenlosem Griff hängen wie ein nasser Lappen. Er wollte schreien, so sehr hasste er das alles hier. Er hasste es! Ein Schwächling war er! Kaputt und nutzlos!
„Schön tief atmen“, kommandierte André plötzlich. „Ruhig ein- und ausatmen. Das ist der wichtigste Part. Nicht verkrampfen, nicht dagegen ankämpfen. Einfach bloß atmen. Dann wird es gleich besser.“ Kräftige Hände zogen ihn aus Marias Armen. André war mindestens einen ganzen Kopf größer als er.
„Wenn Sie mein Fahrrad übernehmen würden, könnte ich Tobi nach Hause bringen.“
„Okay“, entgegnete Tante Maria nach kurzem Zögern. „Sie scheinen sich auszukennen? Sind Sie Krankenpfleger?“
„Nein. Ich beginne im Herbst eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Aber ich habe einen schwerstbehinderten Bruder und helfe praktisch seit dem ersten Atemzug mit, ihn zu versorgen. Schön ruhig weiteratmen!“
Die letzten Worte galten Tobi. Er hatte sich tatsächlich wieder verkrampfen wollen, weil ihn das Wort schwerstbehindert unangenehm triggerte. Zumindest konnte er jetzt wieder etwas sehen, die roten Kreise waren verschwunden und der Druck, der ihn in die Knie hatte zwingen wollen – bei Kreislaufkollaps war man nun einmal am Boden am besten aufgehoben – ließ ebenfalls nach.
Langsam, mit kraftlosen Schritten, ging es voran. André hielt ihn fest und sicher und ohne jede Kontaktscheu. Das war gut, denn Tobi musste sich ihm gänzlich anvertrauen, ob er das nun wollte oder nicht. Es war nicht weit. Daran musste er sich klammern. Schritt für Schritt.
Schon bald kam er ins Stöhnen und Jammern. Dagegen konnte er nichts tun, es lag vollständig außerhalb seiner Kontrolle. Sein Körper revoltierte gegen die Anstrengung, für die keinerlei Energie übrig war. Er schwitzte wie verrückt, ihm war so schlecht, und keine Gedanken waren mehr in seinem hämmernden Kopf übrig. Nichts als Schmerzen und das wilde Pochen seines Herzens, das zugehörige Rauschen in den Ohren, das Brennen in der Brust, weil er schlicht nicht genug Sauerstoff in die Lungen ziehen konnte.
„Schön weiter! Du machst das großartig. Nun komm! Ein Drittel ist geschafft, der Rest wird ein Kinderspiel. Noch ein Schritt. Du schaffst das! Und immer atmen, nie die Luft anhalten.“
André befeuerte ihn wie ein verdammter Cheerleader. Jeder einzelne verwackelte Tippelschritt wurde beklatscht. Am liebsten wollte Tobi ihn dafür anbrüllen, damit der Kerl endlich das Maul hielt und ihn in Ruhe am Wegesrand abwarf, damit Tobi dort in Frieden sterben konnte. Stattdessen kämpfte er weiter. Es nervte ihn ungemein, wie viel Krach er machte. All das Wimmern und Ächzen und Winseln, es war so unglaublich demütigend. Sein Körper war ein Verräter. Seine Psyche war ein Verräter. Er war all diesen Betrügern und Verrätern hilflos ausgeliefert und konnte ihnen nicht entkommen. Nicht einmal, wenn er schneller als ein Gepard laufen könnte, wäre das möglich.
Leider war er nicht schnell, davon konnte er bloß träumen. Er schleppte sich wie ein uralter Greis nach Hause, wimmernd, mittlerweile sogar trocken schluchzend. André trug ihn fast und hörte nicht auf, ihn geduldig anzufeuern.
„Fast da! Da vorne ist die Haustür. Deine Tante schließt sie gerade auf. Das ist ein irre schönes Haus, ich kenne es sogar. Jetzt weiß ich nämlich wieder, wo ich mich befinde, ich wohne keine zweihundert Meter von hier entfernt. Erst seit Kurzem, meine Familie und ich sind neu hergezogen. Das Haus hier kenne ich aber schon, es ist mir sofort aufgefallen. Komm, nicht auf den letzten Zentimetern aufgeben! Füße hoch und laufen! Noch ein Schritt! Gleich sind wir über der Schwelle – ja, geschafft! Großartig! Du bist ein Kämpfer, du machst das wirklich toll. Und weiter, weiter! Wir sind im Wohnzimmer. Guten Tag, nicht erschrecken! Ich bin bloß der Transporteur.“
„Maria? Was ist mit dem Jungen?“, erklang die erschrockene und recht verschlafene Stimme von Oma Fiene. Sie war wohl wieder beim Fernsehen in ihrem Rollstuhl eingedöst.
„Alles gut, Mama“, entgegnete Tante Maria. „Tobi ist beim Spazierengehen mit den Welpen umgefallen. Der nette junge Mann dort hilft uns. André, da vorn zur Couch, genau. Da kann sich Tobi ausruhen. Seine Eltern sind nicht daheim, darum ist er bei uns gerade am besten aufgehoben.“
Tobi landete auf einer Couch. Er war dreckig und schämte sich, weil er jetzt alles mit Sand und Gras beschmutzte. Das war allerdings bloß ein sehr, sehr kleiner Gedanke im Hintergrundrauschen des allumfassenden Elends. André sorgte dafür, dass er bequem liegen konnte. Das tat so wahnsinnig gut! Unwillkürlich tastete er nach einem Taschentuch, um sich Rotz und Tränen aus dem Gesicht zu wischen. Doch zuerst zog ihm jemand die Schuhe aus und dann wurde ein Kissen unter seinen Kopf geschoben und eine warme, kuschelweiche Wolldecke über ihn ausgebreitet. Sie roch nach Waschmittel und Sonne und salziger Luft. Vertraut. Nach Heimat.
Tobi schniefte matt. Die Schmerzen ließen endlich nach. Die Erschöpfung wusch in Wellen über ihn hinweg. Ein Tuch wischte über sein Gesicht. Es war Tante Maria, die ihm behilflich war.
„Angekommen“, sagte sie sanft. „Ruh dich schön aus. Oma ist hier und deine Mutter kommt in etwa einer Stunde nach Hause, sie weiß schon Bescheid.“
Von draußen erklangen Rufe.
„Maria? Du musst mal kommen!“
Das war Onkel Marten, der Bruder von Tobis Vater. Der hatte eine Werkstatt auf dem Gelände, wo er Traktoren und anderes landwirtschaftliches Gerät reparierte. Linus und Jonas, seine Söhne und Tobis Cousins, vollzogen beide im elterlichen Betrieb die Mechanikerausbildung. Beziehungsweise Linus würde sehr bald damit beginnen, noch besuchte er die Schule, sollte aber im Sommer seinen Realschulabschluss in der Tasche haben und dann offiziell loslegen können, während er im Moment noch quasi in seiner Freizeit an Motoren schrauben durfte.
„Hach, nie hat man Ruhe!“, knurrte Tante Maria. „André, kann ich Sie bitten, noch einen Moment zu bleiben? Mama, benimm dich bitte. Biete unserem Gast etwas zu trinken an.“
„Ich benehme mich immer“, knurrte Oma zurück, was ignoriert wurde. Tante Maria eilte nach draußen.
„Setzen Sie sich doch“, sagte Oma liebenswürdig zu André. „Wie nett von Ihnen, dass Sie unserem Tobi geholfen haben. Sind Sie hier in Urlaub?“
„Nein, ich bin zugezogen.“ André erzählte ein bisschen von seinem Vater, der als Ingenieur in der Erdölindustrie arbeitete und aktuell einen leitenden Posten innehatte. Zuvor hatte er irgendetwas anderes gemacht, Tobi bekam nicht alle Details mit, weil sein Bewusstsein zwischen Wachen und Schlaf hin und her driftete. Anscheinend kam die Familie aus Köln, was Oma sehr lustig fand –
„Mein Enkel, Marias Sohn Ben, ist vergangenes Jahr mit seinem reizenden Freund Sven nach Köln gezogen. Und Sie ziehen aus Köln hierher. Wenn das kein gelungener Austausch ist. Wobei, Sie müssen sich noch ein bisschen anpassen. Hier auf dem Land muss man sich nicht so lächerlich aufbretzeln, um bemerkt zu werden.“
„Ich mag meine Haare“, entgegnete André hörbar amüsiert. „Das mache ich alles nicht, um aufzufallen, sondern weil ich das schön finde.“
„Aha.“ Oma klang skeptisch. „Sind Sie zufällig schwul?“
„Oma!“, murmelte Tobi.
„Du schlaf mal schön weiter, Junge! Ich unterhalte mich mit diesem netten jungen Mann. Unser Tobi hier ist schwul, müssen Sie wissen. Aber er hatte großes Pech. Sein letzter Freund hat ihn schlimm verprügelt und für drei Tage in einen Schrank eingesperrt, wo der Junge fast verdurstet wäre. Seitdem geht es ihm so schlecht und er fällt immer mal wieder um und …“
„OMA!“ Entsetzt riss Tobi die Augen auf. Er hatte Ewigkeiten gebraucht, bis er der Familie erzählen konnte, was ihm widerfahren war. Was Hinnerk ihm angetan hatte. Wie konnte sie das einfach irgendeinem Fremden erzählen?
„Es ist kein Geheimnis mehr. Und kein Grund, sich zu schämen“, sagte Oma besänftigend. „Du kannst ja nichts dafür, dass der Kerl so furchtbar zu dir war. Dem würde ich gerne mal die Meinung sagen. Möchten Sie Kekse? Mein Schwiegersohn hat gebacken, und das kann er wie ein junger Gott, obwohl er gar kein Konditor ist.“
„Ein Keks wäre nett“, murmelte André und ließ sich zu der Schachtel schicken, wo Gunnar die Kekse aufbewahrte. Er brachte auch für Oma einen mit, sowie ein Glas Wasser für Tobi.
„Sicherlich hast du großen Durst?“, fragte er. Als Tobi nickte, stützte André ihn ohne weitere Umstände hoch und half ihm, das halbe Glas zu leeren. Es tat gut.
„Tut mir leid“, wisperte André ihm zu. „Das war nicht für meine Ohren bestimmt … Es tut mir leid …“
„Ist okay“, antwortete Tobi ebenso leise, froh, als er wieder auf dem Kissen ruhen durfte. „Oma hat das nicht immer im Griff, was angemessen und höflich ist.“
„Bekomme ich bitte noch einen Keks? Ihr braucht auch gar nicht zu tuscheln“, kam es von Oma. In diesem Moment kehrte Tante Maria zurück.
„Du hattest schon mehr als genug Kekse!“, sagte sie streng. „Du wirst zu fett. Tut mir leid, André, dass es einen Tick länger gedauert hatte. Noch einmal vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie finden jetzt den Weg nach Hause?“
„Ich komme klar. Alles Gute, Tobi.“ Er versetzte ihm einen herzlichen Klaps gegen den Oberarm, verabschiedete sich von Oma und Tante Maria und verschwand. Sicherlich war er froh, aus diesem Irrenhaus entkommen zu sein.
Tobi wandte den Kopf zur anderen Seite und zog die Decke höher. Er war gar nicht froh, dass André nun wieder fort war. Das war seltsam und ließ sich durch nichts erklären. Denn eigentlich war er genau in der Stimmung, das am besten alle Menschen verschwinden und ihn in Ruhe lassen könnten. Seine Familie an erster Stelle. Er liebte sie zwar wie verrückt, doch er wusste, welche Last er für sie war. Für jeden von ihnen. André kannte ihn nicht. Wahrscheinlich war das der Grund, warum Tobi sich wünschte, er wäre noch länger geblieben. Mit einem Fremden zu reden konnte so viel entspannter sein …
André schob sein Fahrrad in die Garage und trat ins Haus. Es war schon fast Abendessenszeit, sogar sein Vater war bereits daheim. Er hörte Stimmen aus der Küche und ging hinüber.
„Warte gefälligst, bis alles fertig ist!“, sagte seine Mutter gerade und gab seinem Vater einen spielerischen Klaps auf die Hand.
„Es schmeckt aber lecker!“
„Es wird trotzdem gewartet.“ Seine Mutter schob ihn energisch in Richtung Küchentür. Ihr Blick fiel auf André.
„Hey, Schatz. War die Radtour schön?“
„Überraschend aufregend“, entgegnete er. „Erzähl ich nachher. Was gibt es Gutes?“
„Bratfisch, Kartoffeln, buntes Gemüse, Salat und einmal Cremesauce spezial à la Mama. Dazu selbst gebackenes Fladenbrot. Noch Fragen? Wer deckt den Tisch?“
„Moment! Gibt es Nachtisch?“, fuhr sein Vater dazwischen, bevor André etwas sagen konnte.
„Eventuell hat hier jemand ein Zitronensorbet gemacht. Ganz sicher erfahren wirst du es nie, wenn du jetzt nicht endlich mitsamt deinem Sohn aus der Küche verschwindest. Abflug! Ich brauche Konzentration, sonst versalze ich am Ende noch alles.“
„Du hast es gehört, Sohn. Abflug!“ André wurde am Handgelenk gepackt und energisch mitgezogen.
Er liebte es, wie seine Eltern miteinander umgingen. Sie hatten sich eine Art von teenagerhafter Verliebtheit bewahrt, obwohl sie sich beide der magischen Fünfzig näherten und nächstes Jahr Silberhochzeit feiern würden. Dieses sehr liebevolle, verspielte Miteinander machte den recht harten Alltag erträglich.
„Ich decke den Tisch und du schaust mal nach Chris?“ Sein Vater drückte ihn kurz an sich, bevor er ins Esszimmer ging. Folgsam betrat André den Raum seines Zwillingsbruders, der sich ebenfalls im Erdgeschoss befand. Christian war bei der Geburt fast gestorben, zudem war er unterentwickelt gewesen. Sie waren beide Frühchen gewesen, in der achtundzwanzigsten Woche zur Welt gekommen. Während André gut drauf war, bereits ein ordentliches Geburtsgewicht von fast tausendzweihundert Gramm besessen hatte und damit sogar schwerer als Durchschnitt, hatte Chris kaum vierhundertachtzig Gramm zusammengebracht und war mit seinen knapp über fünfundzwanzig Zentimetern ein gutes Stück kleiner als André. Niemand rechnete damit, dass er durchkommen würde. Er erlitt Hirnblutungen, Atemstillstände, eine Niere versagte. Am Ende schaffte er es doch – als vollständiger Pflegefall. Chris war blind, ohne seine Hörgeräte nahezu taub, artikulierte sich lediglich durch Lallen. Er musste Tag und Nacht betreut werden, da er regelmäßig Krampfanfälle erlitt, und gerade im Tiefschlaf oft Atemaussetzer hatte. Darum wurde ein Monitor benötigt.
Mit der höchstmöglichen Pflegestufe und Papas gutem Gehalt konnten sie sich eine Pflegekraft für die Nächte leisten. Tagsüber kümmerte sich Mama um Chris, was ein sehr harter Job war, bei dem André und Papa sie nach Kräften unterstützten. Da Chris nicht viel Animation brauchte, sondern in erster Linie Pflege, Beobachtung und sehr viel Liebe, nutzte Mama die Zeit, neben ihm zu sitzen und französische Literaturübersetzungen vorzunehmen – sie war gelernte Fremdsprachensekretärin. Damit verdiente sie ein wenig, hatte Ablenkung, das Gefühl, auch noch andere Dinge leisten zu können. Alles das brauchte sie dringend. Zweimal die Woche kam auch tagsüber eine Pflegekraft und ermöglichte es Mama, sich stundenweise zu entfernen. Shopping, Friseur, Fitnessstudio. Oder einfach bloß ein Spaziergang mit Cafébesuch. So konnte sie sich weiterhin als attraktive Frau fühlen, mal abschalten, zu sich selbst finden, statt ununterbrochen einem fast zwanzigjährigen, kräftigen jungen Mann die Windeln zu wechseln, ihn mit Streichelmassagen zu Bewegungen zu animieren, ihn füttern, stundenweise in einen Spezialstuhl zu hieven, damit er auch mal aufrecht saß, seine Verbände wechseln – trotz intensivster Pflege neigte er zu Druckgeschwüren – und alles zu tun, was sonst noch notwendig war.
Es war nicht einfach, doch sie liebten Chris und kämpften gerne für ihn.
„Hey, Bruderherz!“, rief André laut, als er sah, dass Chris wach war. Er schenkte Doris ein Lächeln. Sie war die heutige Nachtschwester. Wenn sie da war, verschob sich der Rhythmus immer etwas, da sie lieber eine Stunde früher anfing, schon um 17.00 Uhr, und dafür gegen halb sechs Feierabend machte. Mama war damit einverstanden und nutzte die Zeit gerne, um etwas aufwändiger als sonst zu kochen. Das erklärte den Nachtisch. Doris war eine alterfahrene Endvierzigerin und es war ein absoluter Glücksfall, dass sie sie so rasch nach ihrem Umzug gefunden hatten. Doris hatte sich mit mehreren Krimis und Strickzeug für die Nacht gerüstet. Meistens blieb es ruhig, Chris schlief gerne und viel, und die epileptischen Anfälle bei weitem nicht mehr so häufig und schwer wie früher.
Sein Bruder reagierte auf Andrés Ruf. Er wandte ihm den Kopf zu und lächelte breit, lallte dazu auf eine Weise, die er ausschließlich für André reserviert hatte. Als André sich zu ihm auf die Bettkante setzte und ihn umarmte, erwiderte er die Geste und drückte ihn fest an sich.
„Ich freu mich auch, dass ich zurück bin. Ich hab heute eine Radtour gemacht und mich soooo was von verfahren!“ Er kitzelte Chris, der das mochte und heiser lachte. André erzählte von kaltem Wind, eintöniger Graslandschaft, Möwen am Himmel und Schafe in der Ferne, hörte dabei nicht auf, ihn zu kitzeln und zu knuffen, bis seine Mutter ihn zum Essen rief.
„Ich muss gehen“, sagte er laut und wuschelte Chris durch die Haare. Das war das Abschiedszeichen, Chris kannte das. Er murrte traurig, aber bloß kurz, denn André versprach ihm, vor dem Schlafengehen noch einmal wiederzukommen. Ein weiterer Satz, den sein Bruder sehr genau verstand. Es stimmte ihn friedlich und er ließ André gehen.
„Bis später, Doris“, sagte er freundlich. Sie winkte ihm nachlässig zu, mit der Nase schon wieder in ihrem Krimi.
Beim Essen erzählte André, was sich heute ereignet hatte. Seine Eltern reagierten beide sehr betroffen, als sie erfuhren, warum Tobi diese Anfälle erlitt.
„Unvorstellbar, so etwas!“, rief seine Mutter. „Das sind Dinge, die liest man sonst höchstens mal in der Zeitung.“
„Oder in einem Thriller“, brummte sein Vater. „Da erholen sich die Leute dann allerdings nach spätestens zwei Wochen und haben schlimmstenfalls mal ein paar Albträume.“
„Im wahren Leben erleiden Menschen schwere Traumata, nachdem ihnen auf offener Straße die Brieftasche unter Androhung von Gewalt geraubt wurde, und das ohne jede körperliche Verletzung. Viele haben danach noch jahrelang Angststörungen und Panikattacken. Die Dinge, die Helden in Filmen und Büchern durchleiden und mit einem Schulterzucken wegwischen …“ Mama schüttelte den Kopf. „Willst du morgen noch einmal nach ihm sehen?“, fragte sie dann.
„Meinst du, das wäre nicht zu aufdringlich?“ Er nahm sich noch eine Portion Fisch und Gemüse. Nach wie vor war er wie ausgehungert hier oben in der raueren Luft, obwohl der Umzug schon zwei Monate her war.
„Du hast sowieso gerade nicht viel zu tun und es klingt, als könnte der arme Junge einen Freund gebrauchen. Wenn er das nicht will, wird er es dir schon deutlich sagen.“
Damit hatte sie hoffentlich recht. André sehnte sich verzweifelt nach Freunden, zumal seine Leute in der alten Heimat allmählich den Handykontakt abbrechen ließen.