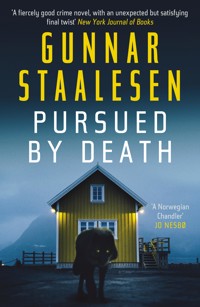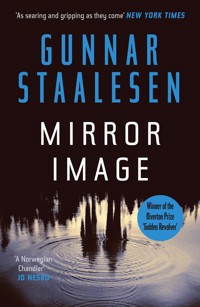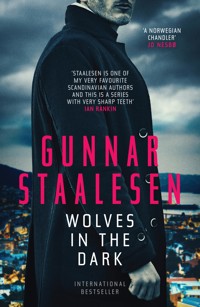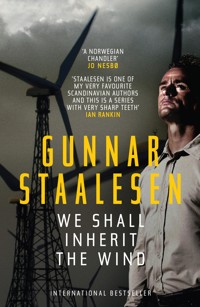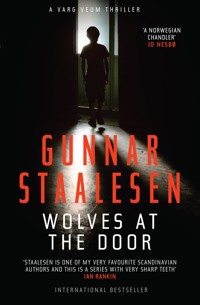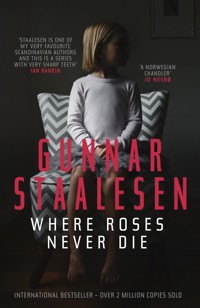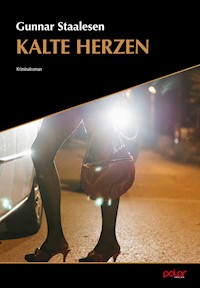3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Varg Veum
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dieser Titel gehört zu einer Romanreihe, auf der die bekannte Krimifernsehserie ›Der Wolf‹ um den Privatdetektiv Varg Veum basiert. Die Erstausstrahlung der beiden Staffeln erfolgte in Deutschland 2008 bei Das Erste und 2013/2014 beim ZDF. Varg Veum ist entsetzt: In seinem Vorzimmer sitzt ein toter Mann. Wie ist er dort hingekommen? Und was hat er von dem Privatdetektiv gewollt? Veum findet heraus, dass sein stiller Gast auf eigene Faust Nachforschungen über einen rätselhaften Fall angestellt hatte – ein Fall, der vierzehn Jahre zurückliegt ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Ähnliche
Gunnar Staalesen
Von Angesicht zu Angesicht
Krimi
Aus dem Norwegischen von Kerstin Hartmann
FISCHER E-Books
Inhalt
1
In meinem Wartezimmer saß ein Toter.
Es war Ende Oktober, und ich kam gerade von einem Auftrag zurück, der mich nach Ølve geführt hatte, einen der Orte im Vestlandet, wo Gott Perlen vor die Säue geworfen und sie dann vergessen hatte. Dennoch hatte man ihm erstaunlicherweise auch in Ølve eine Kirche errichtet, wo der Pfarrer sonntags manchmal zum Gottesdienst rief, wenn sein Tourneeplan ihn in die Gegend verschlug. Manchmal war es auch eine »Sie«, was man in Ølve mit unverhohlener Skepsis betrachtete.
Mein Auftrag dort war eher akademischer Natur gewesen. Es ging um irgendwelche Grenzpfähle, die irgendjemand nachts immer wieder versetzte. Ich hatte zwei Nächte in einem abgelegenen Kuhstall verbracht, in der Hoffnung, den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Doch der Grund für die Pfahlmanipulationen hatte so tiefe Wurzeln in der langen Familiengeschichte der beiden Nachbarhöfe, dass ich meinem Auftraggeber vorschlug, sich stattdessen an den staatlichen Denkmalpfleger zu wenden. Ich selbst begnügte mich mit dem Vorschuss, der auf der Rückfahrt zumindest die Fährkosten von Vage nach Halhjem deckte.
Eine westnorwegische Herbstlandschaft im Regen ist nicht viele schöne Worte wert. Heftige Stürme am Anfang des Monats hatten die meisten Blätter von den Bäumen gefegt. Die Hügelkuppen zwischen Halhjem und Ulven waren graubraun und wirkten verwaschen, und der Himmel hing wie eine brüchige Hängematte über dem Ganzen. Ich hörte die Vormittagssendung von NRK-Hordaland im Autoradio, die allerdings auch nicht dazu angetan war, meine Stimmung zu heben. Zwischen fünf- und sechstausend Studenten hatten gegen den Staatshaushalt demonstriert, und die Verwaltungsbüros der Universität Bergen waren von studentischen Aktivisten besetzt worden. In Bergen stritten sich die Politiker, ob sie die Vergabe der Schankrechte ausdehnen sollten.
Als ich in die Stadt kam, beschloss ich, noch kurz ins Büro zu gehen und den Anrufbeantworter abzuhören. Ich parkte in der Strandgaten, steckte das nötige Kleingeld in die Parkuhr und eilte durch den Regen Fortunen hinunter und dann um die Ecke zum Strandkaien. Vor der Tür der Hausnummer Zwei hielt ich einen Moment inne und schüttelte den grünen Südwester aus, rollte ihn zusammen und steckte ihn in die Tasche. Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare, bevor ich den Fahrstuhl betrat. Man konnte nie wissen. Vielleicht tauchte ja plötzlich eine Journalistin aus Alesund auf.
Aus alter Gewohnheit öffnete ich die Tür zum Wartezimmer, um von dort aus in mein Büro zu gelangen. In der Türöffnung blieb ich stehen. Zum ersten Mal seit langer Zeit saß dort ein potenzieller Klient. Doch die Chance hatte ich verpasst, noch ehe ich ihn überhaupt nach seinem Anliegen hatte fragen können. Ich hatte ihn noch nie gesehen, und ich brauchte nicht lange, um festzustellen, dass er tot war.
Mein Wartezimmer war noch nie ein besonders gemütlicher Aufenthaltsort gewesen. Hätte es nicht zum Büro gehört, hätte ich es niemals so lange behalten. Die Wochenzeitschriften, die ich im Sommer 1975 vom vorherigen Mieter geerbt hatte, waren mittlerweile so alt, dass sie jeden Tag im Wert stiegen. Für den abgenutzten Teakholztisch fürchtete ich das Gegenteil, und die klassischen Wartezimmerstühle aus Chrom und moskaurotem Kunstleder luden auch nicht gerade zu einem längeren Aufenthalt ein. So saßen dort denn auch immer weniger Leute. Der tote Mann auf dem Sofa war seit vielen Wochen der erste.
Es bestand kein Zweifel daran, dass er tot war. Sein Puls entsprach dem einer Beethoven-Büste. Wer er war, damit wollte ich mich überhaupt nicht befassen, jedenfalls nicht, bevor die Polizei da gewesen war. Was konnte ich sonst tun? Es würde sicher sowieso kompliziert genug werden.
Ich rief sie auf dem Handy an, ohne den Toten aus den Augen zu lassen, als hätte ich Angst, er könnte sich aus dem Staub machen. Sie sagten, sie würden sofort ausrücken. Und es dauerte auch nicht lange, da hörte ich sie draußen auf dem Korridor.
In der Zwischenzeit hatte ich mir den Mann etwas genauer angesehen. Er war Anfang vierzig und von gewöhnlichem Aussehen, fast ein bisschen farblos. Sein Gesicht war länglich und seine Kleidung alltäglich: weißes Hemd, braune Hose, graues Jackett, aber kein Schlips. Sein Haar war bräunlich fahl und dünn. Er saß schief auf dem roten Sofa, mit ausdruckslosem Gesicht, als sei er von einem plötzlichen Einfall ergriffen worden und eingenickt. Es gab keine äußeren Zeichen dafür, was seinen Tod verursacht hatte.
Also wer war er? Und was machte er in meinem Wartezimmer?
Viel weiter kam ich nicht mit meinen Überlegungen, denn es klopfte laut an der Tür. Ich öffnete sie, mit einem Taschentuch um den Griff.
Kommissar Jakob E. Hamre führte den Trupp an. »Ich dachte, ich rücke lieber selber aus, als ich hörte, dass du angerufen hast, Veum«, sagte er und ließ seinen Blick schnell durch den Raum hinter mir gleiten. Draußen auf dem Korridor warteten Polizeiinspektorin Annemette Bergesen, die Wachtmeister Bjarne Solheim und Arne Melvær und zwei weitere uniformierte Beamte den Lauf der Dinge ab.
»Nur das Beste ist gut genug«, sagte ich und trat zur Seite. »Ich weiß nicht, wie ihr den Tatort definieren wollt, aber …«
Hamre betrachtete den Toten auf dem Sofa grimmig. »Und du bist sicher, dass er wirklich tot ist?«
»Ich habe bei Beerdigungen schon lebendigere gesehen.«
»Ja, ja, unter den Hinterbliebenen …«, murmelte er.
Bergesen räusperte sich hinter ihm. Er sah entschuldigend in ihre Richtung und sagte schnell: »Ja, wir müssen – genauer nachsehen, natürlich.«
Langsam betraten sie den Raum, abgesehen von den beiden Beamten, die draußen Stellung bezogen. Weitere Klienten würde ich an diesem Tag wohl nicht bekommen, fürchtete ich.
»Und du hast keine Ahnung, wann …?«
»Nein. Ich bin hier vor …« Ich sah auf die Uhr, »ungefähr einer Viertelstunde angekommen.«
»Gegen dreizehn Uhr fünfzehn, mit anderen Worten?«, sagte Bergesen.
Ich nickte. »So etwa.«
Sie gab Solheim ein kleines Zeichen, woraufhin dieser es auf seinem Block notierte.
»Und du weißt auch nicht, wer er ist?«
»Ich habe ihn noch nie gesehen.«
»Hm.«
Die vier Kriminalbeamten standen da und betrachteten den Toten mit unterschiedlich routinierter Miene. Hamre und Bergesen zeigten gemäßigtes Interesse; die Gesichter der beiden jüngeren Beamten verrieten, dass sie sich in der Situation weitaus unbehaglicher fühlten, besonders der junge Melvær. Er schluckte und schluckte, als sei ihm etwas im Halse stecken geblieben. Solheims Haare standen zu Berge, doch das lag an seiner Frisur und war kein Zeichen von Erschütterung. Ich stellte fest, dass Hamre, obwohl er nur wenige Jahre älter war als ich, deutlich grauere Haare bekommen hatte. Mit sechzig würde er weiß sein. Annemette Bergesen sah hingegen unverschämt gut aus, frisch verheiratet wie sie war – mit einem Biotechnologen vom Institut für Forschung und Hochtechnologie in Bergen, wenn ich mich richtig erinnerte, und immer noch braun gebrannt von ihrer Hochzeitsreise – die sie wahrscheinlich in einen exotischen Teil der Welt geführt hatte, wie es zurzeit üblich war.
»Wir sollten vielleicht die Spurensicherung gründlich den Ort absuchen lassen, bevor wir weitere Schritte unternehmen«, überlegte Hamre laut. Er wandte sich an Melvær und Solheim. »Sind sie benachrichtigt?«
Solheim nickte. »Sie sind unterwegs.«
»Trotzdem …« Er gab den anderen ein Zeichen, dass sie sich zurückhalten sollten, und trat dann vorsichtig an den Toten heran. Ohne den Tisch zu berühren, beugte er sich vor, schob die Hand vorsichtig unter das Jackett und fischte eine abgegriffene Brieftasche heraus. Dann zog er seine Hand rasch zurück, als fürchte er Proteste, und klappte die Brieftasche auf.
»Obwohl ich so eine Ahnung habe, dass es bei dir schlecht läuft, Veum, ein Raubmord war es jedenfalls nicht«, stellte er fest und zeigte uns mehrere große Geldscheine. »Aber hier … die EC-Karte ist nützlich, besonders wenn man tot in irgendeinem Wartezimmer gefunden wird.«
Wir sahen ihn erwartungsvoll an. Er las laut von der Karte ab: »Erlend Ekerhovd. Sagt dir der Name etwas, Veum?«
»Völlig unbekannt.«
»Tja.« Er blätterte einen Haufen Ermäßigungskarten und Mitgliedsausweise, alte Quittungen, kleine Klebezettel mit verschiedenen Notizen und Mitteilungen und ein paar benutzte Theaterkarten durch. »Er ist Mitglied bei den Freunden von Bryggen, Alt-Bergen, vom Bergenser Kunstverein«, zählte er auf. »Ermäßigungskarten für zwei zentrale Buchhandlungen. Ein kulturinteressierter Mensch, davon können wir wohl ausgehen.« Er nahm wieder mich ins Visier. »Was zum Teufel hat er also hier gemacht? Die einzige Kultur, mit der du dich umgibst, sind die alten Wochenzeitschriften da auf dem Tisch.«
»Er hätte sie mit Freuden alle haben können, wenn er nur nicht in meinem Wartezimmer gestorben wäre«, sagte ich. Dann wandte ich mich an Annemette Bergesen. »Wollen Sie sehen, wo ich arbeite?«
»Warum nicht?« Sie sah Hamre an, der nickte.
»Kommen Sie rein«, sagte ich und schloss die Zwischentür auf. »Ich gebe Ihnen mein Telefonbuch.«
Sie überprüfte mit einem Finger das Schloss. »Sie gehen das Risiko ein, das Wartezimmer offen zu lassen, auch wenn Sie gar nicht da sind?«
»Das war noch nie ein Problem. Die Leute reißen sich nicht gerade um die Sitzplätze.«
»Schlagt mal unter Ekerhovd nach!«, rief Hamre uns hinterher.
»Genau das hatte ich vor«, antwortete ich.
Annemette Bergesen sah sich auf die gleiche Weise um wie die meisten anderen auch, wenn sie mich das erste Mal besuchten: mit einer Mischung aus Neugier und deutlicher Skepsis. »Also von hier aus steuern Sie Ihre umfassenden Ermittlungen?«, kommentierte sie spöttelnd.
»Das hier ist die Kommandozentrale, ja«, sagte ich und zeigte mit einer Handbewegung auf das Telefon mit dem Anrufbeantworter, der nachdrücklich blinkte, den Archivschrank, einen aktuellen Wandkalender mit einem Foto von den Bergenser Bergen, das Waschbecken, das Regal für die Gläser, die Stühle, den kleinen Tisch und die Hauptattraktion des Raumes, den großen Schreibtisch, auf dem sich auf der einen Seite ungeöffnete Rechnungen, ungelöste Fälle und nutzlose Notizen stapelten, auf der anderen Schreibsachen und diverse andere Requisiten sowie ein benutztes Glas.
Sie nickte zum Anrufbeantworter. »Sie sollten ihn abhören. Vielleicht ist eine Nachricht vom Toten drauf.«
»Es sind meistens nur anonyme Liebeserklärungen, leider.«
»Leider?«
»Ja, weil sie anonym sind, meine ich.«
»Ach so.«
Durch die offene Tür hörte ich, wie Hamre sich leise mit den beiden Kollegen besprach. Ich nickte. »Aber Sie haben natürlich Recht.«
Ich spulte den etwas altmodischen Anrufbeantworter zurück und hörte die Nachrichten ab. Zwei waren von der klassischen, wortlosen Sorte: Jemand hatte sich die Botschaft vom Band angehört, hatte einen Moment nachgedacht und wieder aufgelegt. Die dritte war von einem Mann, der wissen wollte, ob er die richtige Nummer gewählt habe. Als er keine Antwort bekam, schnaubte er ärgerlich und legte auf. »Da sehen Sie’s«, murmelte ich. »Nichts als Klagen.«
Die vierte war anders. Eine leicht nervöse, zögernde Männerstimme sagte: »Veum? Es ist … Mittwochmorgen. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Ich komme heute vorbei, in der großen Pause. Abgemacht?« Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: »Danke.« Dann legte er auf.
»In der großen Pause?«, murmelte ich.
»Sie kannten die Stimme nicht?«
»Nein.«
»Dumm, dass er nicht gesagt hat, wie er heißt!«
»Ein Lehrer vielleicht?« Ich griff nach dem Telefonbuch und blätterte. Dann nickte ich ihr zu. »Hier haben wir ihn. Ekerhovd, Erlend, Studienrat. Kjenndalsåsen, das ist eine von den neuen Straßen ganz unten in Sanddalen, wenn ich mich nicht irre.«
»Keine Ahnung«, sagte sie. »Ich kenne mich hier in der Gegend noch nicht so gut aus, fürchte ich.«
»Haben Sie schon eine Wohnung gefunden?«
»Vorläufig haben wir eine kleine Bude im Jonas Lies Vei. Aber wir sind auf der Suche nach etwas Größerem.«
Hamre war in der Türöffnung erschienen. »Und worüber plaudert ihr hier so gemütlich, wenn man fragen darf? Zeigst du der Kollegin deine Briefmarkensammlung, Veum?«
»Vorläufig sind wir erst bei den französischen Postkarten.«
»Oho!«
»Aber wir haben rausgefunden, wo der Verstorbene gewohnt hat.« Ich hielt ihm das Telefonbuch hin.
»Na, dann ruf ihn doch an!«
»Im Ernst?«
»Natürlich.«
Ich wählte die Nummer, die ich hinter seinem Namen im Telefonbuch gefunden hatte. Die beiden sahen mich erwartungsvoll an. Doch es klingelte nur lange. Niemand nahm ab. Er war nicht zu Hause.
2
Nachdem die Leute von der Spurensuche mein Wartezimmer mit ihren feuchten Kondomfingern abgetastet hatten und Melvær zurück ins Präsidium geschickt worden war, um von dort aus Dinge in Gang zu setzen, nutzten wir mein Büro als Aufwärmstube, während wir auf den Arzt warteten.
»Hier hast du es aber gemütlich, Veum«, sagte Hamre, bürstete den Staub von einem der Klientenstühle und setzte sich vorsichtig auf den äußersten Rand.
»Ich tue mein Bestes, damit sich die Gäste wohl fühlen«, antwortete ich. »Möchte jemand eine Tasse Kaffee?«
Bergesen und Solheim nickten, Hamre schüttelte den Kopf. Ich füllte Wasser in den Kocher und schaltete ihn ein. Dann spülte ich drei Tassen aus, setzte den Kaffeefilter auf eine Thermoskanne und füllte Kaffeepulver hinein. Was ich nicht tat, war zu fragen, ob jemand etwas zum Kaffee dazu haben wollte. Das geschah aus reiner Not. Milch hatte ich nicht, und den kleinen Schluck Aquavit, der in der linken unteren Schublade lag, wollte ich für mich allein haben, wenn sie gegangen waren.
»Also, was haben wir?«, fragte Hamre und sah seine Kollegen an.
»Einen Toten«, sagte Bergesen. »Vorläufig identifiziert als Erlend Ekerhovd. Studienrat, wenn es derselbe Erlend Ekerhovd ist, den wir im Telefonbuch gefunden haben. Wohnhaft in …« Sie sah mich an.
»Kjenndalsåsen.«
Hamre nickte.
»Und er geht nicht ans Telefon«, fügte ich hinzu.
Es klopfte an der Tür zum Korridor. Ich ging hin und öffnete. Draußen stand eine junge Frau mit kurzem, dunklem Haar. Sie lächelte professionell. »Ich bin Doktor Eggesbø. Die Polizei hat mich herbeordert.«
»Kommen Sie rein. Sie werden schon erwartet.«
Die Ärztin gab Bergesen und Solheim, die sie offensichtlich schon kannte, die Hand und nickte Hamre zu, der ihr schnell die Situation erklärte und sie durch die Seitentür ins Wartezimmer führte.
Das Wasser kochte. Ich goss es vorsichtig in den Filter, und der Duft frischen Kaffees breitete sich im Raum aus. Solheim fuhr sich ungeduldig durch die Haare. Bergesen saß mit einer nachdenklichen Falte in der Stirn da. Da klingelte das Telefon.
Ich nahm den Hörer ab. »Ja? Hier ist Veum.«
»Melvær hier. Ist Hamre noch da?«
»Er plaudert gerade mit der Leiche. Können Sie sich mit Bergesen begnügen?«
»Ja, ja – natürlich.«
Ich reichte ihr den Hörer und sie lächelte säuerlich zurück. »Ja, hallo?«
Sie lauschte eine Weile. Mit einem kleinen Seitenblick auf mich nahm sie einen Kugelschreiber vom Schreibtisch und notierte etwas auf einen Klebezettelblock. »Ich verstehe. Danke dir … Nein, ich werde mal Jakob fragen. Wahrscheinlich entweder er oder ich … Ja, tu das. Tschüss.«
Sie legte auf, nickte nachdenklich, riss den Zettel vom Block und sagte: »Arne, also – Melvær hat herausgefunden, dass der Tote an der Kathedralschule gearbeitet hat. Als er dort anrief, sagte man ihm, Studienrat Ekerhovd sei in der großen Pause weggegangen und danach nicht zurückgekommen. Die Kinder hätten sie nach Hause geschickt und sie hätten keine Ahnung, was passiert sei. Seine Frau wüsste auch nichts.«
»Wie heißt sie?«
Sie sah mich nachdenklich an. »Ich glaube, wir warten auf Hamre, Veum.«
Ich zuckte mit den Schultern und hob die Kaffeetasse zum Gruß: »Bruder Jakob, Bruder Jakob – schläfst du noch, schläfst du noch?«
Solheim lächelte schief. »Kann ich irgendetwas tun?«
»Ich glaube, wir beide sollten abwarten …« Sie nickte zur Wartezimmertür.
Ich sah kurz zu Solheim. »Und wo wohnen Sie?«
»Hä?«
»Sorry. Noch einmal und etwas langsamer. Wo wohnen Sie?«
»In Sandviken. Warum fragen Sie?«
»Reine Höflichkeit. Um das Gespräch in Gang zu halten. Gehirnjogging. Wissen Sie …«
Hamre tauchte wieder in der Wartezimmertür auf. Ohne mich anzusehen, sagte er: »Sie kann keine äußerliche Todesursache feststellen.«
»Ein stiller Tod«, sagte ich.
»Nicht einmal einen akuten Anfall von Stauballergie.«
Dr. Eggesbø erschien hinter ihm. »Die Obduktion wird die nötigen Informationen liefern, denke ich.«
Hamre nickte. »Das wollen wir hoffen.«
»Dann gehe ich jetzt weiter«, sagte die Ärztin. »Rufen Sie den Krankenwagen?«
»Wir werden ihn schon auf die Bahre kriegen. Wetzen Sie ruhig schon mal Ihre Skalpelle.«
Sie schenkte mir ein weiteres professionelles Lächeln und reichte es dann an die anderen weiter.
»Nicht einmal ein Nadelstich?«
»Nicht, soweit ich sehen konnte«, sagte sie und verließ den Raum ohne einen weiteren Kommentar.
»Tja …« Hamre sah seine Kollegen an.
»Wir haben was Neues«, sagte Bergesen.
»Aha?«
»Melvær hat angerufen. Ekerhovd ist Lehrer an der Kathe- … wie nennt ihr sie hier in der Stadt noch …?«
»Kathedralschule?«
»Genau. Er ist nach der großen Pause nicht zurückgekommen, also sollte das wohl ein weiterer Beweis dafür sein, dass er es ist, der hier nebenan liegt.«
»Wahrscheinlich.«
»Er ist verheiratet mit …«
»Ja?«
Sie sah mich an.
Hamre folgte ihrem Blick. »Kümmer dich nicht um ihn. Er wird es schon aushalten.«
»Ich habe schon mal von Leuten gehört, die miteinander verheiratet waren, ja«, versetzte ich.
»Mit einer Frau namens Tonje Svarstad. Krankenschwester am Krankenhaus Haukeland.«
»Hat jemand sie informiert?«
»Nein. Ich wusste nicht, ob du selbst …«
Er seufzte schwer. »Doch. Wir sollten es vielleicht zusammen machen. Wo du schließlich …«
»Eine Frau bist?«
»So ähnlich.«
»Wie aufmerksam«, kommentierte ich und nickte anerkennend.
»Noch weniger Grund hierzubleiben«, sagte Hamre. »Ich hoffe, du kannst für ein paar Tage auf dein Wartezimmer verzichten, Veum. Wenn unsere Leute mit ihren Untersuchungen fertig sind, muss der Raum versiegelt werden, bis du weitere Nachricht von uns bekommst. Ist das okay?«
»Bezahlt ihr die Miete für die Zeit, in der ich es nicht benutze?«
»Schick uns eine Rechnung, Veum. Wir haben große Papierkörbe.« Er wandte sich wieder an seine Kollegen. »Ja, dann … Wenn ihr euren Kaffee ausgetrunken habt und Veum uns nichts mehr anvertrauen will, dann sollten wir wohl mal los, oder?«
Bergesen und Solheim stellten gehorsam ihre Tassen ab.
»Und du kümmerst dich um den Abwasch, Veum?«
Alle drei gingen zur Tür. Hamre hielt sie für Solheim auf. »Du bleibst hier, falls den Leuten da drinnen was einfallen sollte, was sofort erledigt werden muss. Außerdem trägst du die Verantwortung dafür, dass die Tür verschlossen wird, wenn sie fertig sind. Veum kann dich sicher in der Zwischenzeit mit Geschichten aus seinem spannenden Leben als Leichenfinder der Nation unterhalten.«
»Wir sehen uns«, sagte ich.
»Ich fürchte, das lässt sich nicht vermeiden«, antwortete Hamre.
Bergesen lächelte leicht und folgte ihm hinaus.
Ich drehte mich zu Solheim herum. »Noch eine Tasse Kaffee vielleicht?«
»Ja, bitte.«
»Wo sollen wir anfangen?«
»Fang doch mit damals an, als du beim Jugendamt gefeuert worden bist.«
»Du hast also davon gehört?«
»Hamre hat es nebenbei einmal erwähnt.«
»Tja, also dann …«
Also erzählte ich ihm die alte Geschichte. Doch er hörte nur mit einem halben Ohr zu, und ich legte auch nicht viel Eifer hinein. Später gingen sie alle. Ich leerte den allerletzten Tropfen aus meiner Aquavitflasche und beschloss sofort, auf eine neue zu sparen.
3
Es kam so, wie Hamre gesagt hatte. Es vergingen einige Tage, bis ich mein Wartezimmer zurückbekam. Nicht dass ich es in der Zwischenzeit besonders gebraucht hätte. Die Schlange der Klienten war bescheiden kurz. Die meisten, die mich kontaktierten, benutzten das Telefon. Aber auch da liefen die Drähte nicht gerade heiß.
Es war eine ruhige Jahreszeit; zu früh im Schuljahr, als dass die Kinder, die öfter rastlos wurden und von zu Hause abhauten, schon einen großen Freiheitsdrang verspürten; zu spät im Herbst, als dass Versicherungsbetrüger noch Autos im Osterfjord versenkten. Die einen wie die anderen warteten auf den Frühling. Ich bekam nicht einmal ein Angebot der Art von Fällen, die ich aus Prinzip nicht annahm. Die Ehen, die die Sommerferien überlebt hatten, hielten noch; die nächste Hürde war der Weihnachsstress. Manchmal fragte ich mich ernsthaft, wovon ich eigentlich lebte. Wenn das so weiterging, würde ich mich auch in diesem Jahr wieder um einen Job als Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum bemühen müssen.
Alles, was ich tun konnte, war aufmerksam Zeitung zu lesen.
Erlend Ekerhovds Tod wurde bis dahin diskret behandelt. MANN TOT IN INNENSTADTBÜRO GEFUNDEN hieß es am ersten Tag, mit der Zusatzinformation »die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen«. Ein paar Tage später las ich: KEIN GRUND FÜRERMITTLUNGEN. Es war Kriminalkommissar Hamre, der dies geäußert hatte, allerdings »unter dem Vorbehalt, dass das Ergebnis der Obduktion noch nicht vorliegt«. Es gebe jedoch, so Hamre, nichts, was dafür spreche, den Todesfall als »verdächtig« zu bezeichnen.
Das passte nicht zu meiner eigenen Beobachtung. Allein die Tatsache, dass der Mann am selben Tag tot in meinem Wartezimmer gefunden wurde, an dem er versucht hatte, einen Termin mit mir zu vereinbaren, wegen etwas, das ihm offenbar wichtig war, ließ meine Alarmlampen bedrohlich rot aufleuchten.
Am Montag stand die Todesanzeige in der Zeitung. Nach meiner Deutung hinterließ »mein geliebter Mann, unser lieber, teurer Vater, unser guter Sohn und Schwiegersohn« zusätzlich zur »übrigen Familie« und »Freunden« sowohl Ehefrau und Kinder als auch eigene Eltern und Schwiegereltern. »Ist plötzlich und unerwartet von uns gegangen«, hieß es außerdem. Es stand verständlicherweise nichts darüber da, wann die Beisetzung stattfinden sollte, da sich der Verstorbene noch immer zu näheren Untersuchungen in der Gerichtsmedizin befand.
Neugierig, wie ich war, konnte ich es nicht lassen, einen alten Bekannten von mir anzurufen. Svein Strømme war auch Lehrer an der Kathedralschule, und ich quetschte ihn ein bisschen über seinen verstorbenen Kollegen aus.
»Erlend? Ein stiller Typ. Norwegisch, Geschichte, Gesellschaftskunde.«
»Hast du eine Ahnung … Hast du ihm vielleicht empfohlen, sich an mich zu wenden?«
»Nein, warum sollte ich?«
»Tja, keine Ahnung.«
»Er hat sich also an dich gewendet?«
»Er ist sogar hier gestorben. In meinem Wartezimmer.«
»Was? Au, Scheiße!«
»Du weißt nicht zufällig was über seine … familiäre Situation?«
»Nein, Tonje und er – ich hatte nie das Gefühl, dass es bei denen irgendwelche Probleme gab.«
»Und seine Beziehung zu den Schülern?«
»Zu den Schülern? Ausgezeichnet, glaube ich wenigstens. Hab nie was anderes gehört. Er war vielleicht nicht der allerspritzigste Pädagoge, aber … Irgendwie hatte Erlend immer etwas Graues und Funktionärhaftes an sich.«
»Funktionärhaft?«
»Ja. Während des Studiums hatte er eine zentrale Position bei den Marxisten-Leninisten.«
»Aha … War er immer noch in dieser Richtung politisch aktiv?«
»Ich glaube nicht, dass er seine Grundeinstellung wesentlich geändert hat. Aber direkt aktiv war er nicht mehr. Jedenfalls nicht, soweit ich weiß.«
»Mit anderen Worten, es gab nicht die geringste Andeutung eines Konflikts mit irgendwem?«
»Ich fürchte, dass ich dir da tatsächlich nicht weiterhelfen kann.«
»Trotzdem, danke. Wenn dir etwas einfallen sollte, weißt du, wo du mich findest.«
Ich rief sogar bei der Polizei an. Allerdings wählte ich den Weg des geringsten Widerstands und versuchte es zunächst bei Annemette Bergesen.
»Bergesen.«
»Veum.«
»Oh, hallo …«
»Ich wollte nur mal fragen … weil er ja bei mir gefunden wurde … Gibt es etwas Neues von der Gerichtsmedizin?«
Sie zögerte ein wenig.
»Na ja, was Neues …«
»Es gibt also etwas?«
»Ich möchte nicht darüber sprechen. Noch nicht. Aber eben deshalb … Wir versuchen, den Ball flach zu halten, Veum. Wir wollen auf keinen Fall einen Presserummel, bevor wir etwas Sicheres wissen.«
»Aber einen Verdacht habt ihr?«
»Hören Sie … Ehrlich gesagt, Veum, ich glaube, Sie sollten mit Hamre reden.«
»Es ist aber viel netter, mit Ihnen zu sprechen.«
»Nur schade, dass ich Ihnen nicht dasselbe sagen kann.«
»Oh …«
»Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine nur … Hamre ist der Chef. Allen Außenstehenden gegenüber führt er das Wort.«
»Na ja, dann … Können Sie mich mit ihm verbinden?«
Daraufhin hatte ich den Chef persönlich in der Leitung.
»Hamre.«
»Hier ist Veum.«
»Und womit kann ich dienen?«
Ich trug ihm noch einmal mein Anliegen vor und wartete dann seine Reaktion ab. Sie kam, auf die nachdenkliche, manchmal etwas subtile Weise, die schon immer typisch für ihn gewesen war.
»Ich verstehe sehr wohl, worauf du hinaus willst, Veum. Aber wir warten immer noch auf den Bericht von Dr. Eggesbø aus dem Schlachthaus.«
»Rufst du mich an, wenn ihr das endgültige Ergebnis habt?«
»Und warum zum Teufel sollten wir das tun?«
»Na ja … Um mich zu beruhigen?«
»Du magst also nicht mehr durch dein Wartezimmer gehen? Hast du Angst, dass dir jemand hinter der Tür auflauert?«
»Das ist tatsächlich schon mal vorgekommen.«
»Schade, dass es nicht geklappt hat, Veum. Nein, geh du lieber in die Stadt und spüre eine entlaufene Katze auf. Und überlass Fälle wie diesen uns. Okay?«
Dann legte er ohne Abschiedsgruß auf.
Danach machte ich mir ein paar Notizen und stellte fest, dass er allem Anschein nach Recht hatte. Ich sollte die Finger von dem Fall lassen.
Vielleicht hätte ich das auch getan, wenn ich nicht am Tag darauf Besuch bekommen hätte; diesmal von jemandem, der nicht vorhatte, da draußen zu sterben.
Es klopfte an die Zwischentür. Ich rief: »Herein!«
Die Frau blieb in der Türöffnung stehen und wartete, als habe sie Angst, abgewiesen zu werden. Sie trug einen einfachen, hellen Regenmantel und hatte halblange, blonde Haare, die sie im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Ihr Gesicht war oval und sie hatte eine frische Hautfarbe, blaue Augen und helle Augenbrauen.
Ich stand vom Schreibtisch auf und lächelte mein liebenswürdigstes Lächeln. »Kommen Sie doch herein! Was kann ich für Sie tun?«
»Mein Name ist Tonje Svarstad«, sagte sie ruhig. »Ich wollte fragen, ob ich kurz mit Ihnen sprechen könnte.«
»Selbstverständlich! Kommen Sie herein, und setzen Sie sich.«
»Ich weiß nicht, ob …«
»Doch, ich weiß, wer Sie sind. Mein herzliches Beileid.«
»Danke.« Sie senkte plötzlich den Blick, öffnete ihre Umhängetasche und zog ein Taschentuch hervor. »Es tut noch so weh …«
»Jetzt setzen Sie sich erst einmal hin. Lassen Sie mich …« Ich half ihr aus dem Regenmantel und hängte ihn an den Ständer bei der Tür. Darunter trug sie eine dunkelblaue Bluse und schwarze Jeans. »Kann ich Ihnen etwas anbieten? Eine Tasse Tee? Kaffee?«
»Nein, danke. Ich … Ich muss einfach mit jemandem reden …«
Ich hielt ihr den Stuhl hin. Sie setzte sich, und ich ging wieder um den Schreibtisch herum. »Dafür bin ich da.«
Sie sah mich fragend an. »Dass Leute kommen und mit Ihnen reden?«
»Unter anderem.«
4
Ich wartete, bis sie sich ausgeweint und ihre Tränen getrocknet hatte. Allerdings holte sie keinen Taschenspiegel hervor, um ihr Aussehen zu richten. Da gab es auch nichts zu richten. Soweit ich sehen konnte, benutzte sie keinerlei Make-up.
Als sie sich schließlich gefasst hatte, saß sie mit dem Taschentuch in der geballten Faust da und sah sich suchend um. »Die Polizei hat mir … Erlends Nachricht vorgespielt.«
»Ja, sie haben das ganze Band mitgenommen.«
»Dass er gern mit Ihnen sprechen wollte, in der großen Pause …«
»Ja, aber ich habe die Nachricht leider erst bekommen, als es zu spät war. Er war schon hier, als ich kam.«
Sie wandte den Kopf halb zur Tür, durch die sie hereingekommen war. »Da drüben … haben Sie ihn gefunden?«
»Ja. Er war schon tot, als ich ankam.«
Ein kleiner Schluchzer entwich ihren Lippen. »Es ist einfach so sinnlos!«
»Ja, das ist es.«
»Aber Sie … Sie haben vorher noch nie mit ihm gesprochen?«
»Nein. Ich kannte noch nicht einmal seinen Namen. Und leider habe ich keine Ahnung, was er von mir wollte.«
Sie streifte mich mit ihrem Blick und fixierte dann einen Punkt in der Luft vor meinem Fenster. »Nein, ich verstehe. Aber was das angeht … Vielleicht kann ich Ihnen ein paar Informationen geben.«
Ich beugte mich nach vorn. »Bevor Sie weiterreden: Ich hoffe, Sie haben auch mit der Polizei darüber gesprochen?«
Sie nickte leicht. »Ja, ich … Aber sie schienen nicht sonderlich interessiert. In ihren Augen ist das hier offenbar ein ganz gewöhnlicher Todesfall.«
»Und das glauben Sie nicht?«
»Nein, natürlich nicht! Und ich habe meine Gründe.«
»Aha.«
»Das Ganze fing an mit der Begegnung mit Tor. – Tor Steinestø«, fügte sie hinzu, als würde das alles erklären.
Ich wartete. Sie kämpfte ganz offensichtlich mit sich selbst, um nicht wieder in Tränen auszubrechen. Schließlich sah sie mir direkt in die Augen und sagte: »Sagt Ihnen der Name Hildegunn Høgset etwas?«
»Nicht das Geringste.«
»… das war wohl auch nicht zu erwarten. Außerdem ist sie tot. Seit 1979, wenn ich mich nicht irre.« Hastig fügte sie hinzu: »Ich bin ihr auch nie begegnet. Wir sind erst später … zusammen gekommen, Erlend und ich.«
»Vielleicht sollten Sie mir das Ganze etwas genauer erklären.«
»Ja, natürlich.« Sie nickte. »Ich werde …« Sie schluckte und nahm sich sichtlich zusammen. »Es war während seines – ihres Studiums.«
»Sie sprechen von Erlend?«
»Ja. Er wohnte in einer Kommune, oben in der Edvardsens Gate. Sie wissen, wo das ist?«
»In Øvre Sandviken, zwischen Meyermarken und Ladegården.«
»Ja. Sie hatten ein ganzes Haus da oben, in den Siebzigern. Eine Gruppe von sieben oder acht Leuten. Es variierte ein wenig, je nachdem, wie viele Paare es waren, und wer gerade Single war.«
»Und darunter waren Ihr Mann und diese – Hildegunn Høgset?«
»Ja, aber nicht … Also, sie waren kein Paar. Nicht, soweit ich weiß …« Den letzten Satz flüsterte sie fast, als könne ihre Stimme diese Worte kaum tragen.
»Erinnern Sie sich an Namen?«
»Ich weiß nicht, ob Astrid Hauso Ihnen etwas sagt?«
Ich zögerte.
»Sie hat in einer Band gesungen, die sich damals Fiskerjenten nannte. Sie waren eine Zeit lang ziemlich populär.«
»Doch, jetzt, wo Sie es sagen … Aber davon abgesehen sagt mir der Name nichts.«
»Aber Hedda Mikalsen kennen Sie?«
Ich sah sie verwundert an. »Etwa die Hedda Mikalsen? Die Kommunalrätin?«
»Genau.«
»Ich weiß natürlich, wer sie ist, aber ich bin ihr nie begegnet.«
»Ich auch nicht. Und dann gab es eben noch Tor Steinestø, ein Sandkastenfreund von Erlend. Er ist jetzt bei der Polizei.«
»Aha! Ich glaube nicht, dass ich ihn kenne. Wissen Sie, in welcher Abteilung er arbeitet?«
»Nein, sie hatten zuletzt keinen Kontakt mehr.«
»Na gut … Das lässt sich herausfinden. Aber Sie sagten etwas von einer Begegnung zwischen Tor Steinesto und Ihrem Mann?«
»Ja. Vor vierzehn Tagen kam er nach Hause und sagte, er hätte Tor getroffen und sie hätten sich unterhalten. Über früher geredet. Aber ich habe gemerkt … Er war den ganzen Abend irgendwie unruhig, als hätte das Gespräch mit Tor alte Erinnerungen wieder wach gerufen, vielleicht auch manche unangenehmen. In den Tagen danach war er ganz in sich zurückgezogen. Als ich versucht habe, mit ihm zu sprechen, hat er nur einsilbig geantwortet. Jedenfalls sind das die Namen, an die ich mich erinnern kann, dass er sie erwähnt hat. Und diese Hildegunn Høgset.«
»Die tot ist, wie Sie sagten.«
»Ja, sie beging Selbstmord, hieß es. Sie sei ins Wasser gegangen, irgendwo da oben an der Møreküste Ende der siebziger Jahre. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er sagte, es sei 1979 gewesen.«
»Ihr Mann.«
»Ja.« Ein Zittern lief über ihr Gesicht. »Erlend … Er war … Viele haben ihn sicher als grau und trocken und langweilig erlebt. Aber so war er nicht. Das war nur seine Art, die Kontrolle zu behalten. Sie müssen mir glauben, Veum, ich kannte ihn ganz anders. Wechselhaft, verletzlich … Erlend hatte tiefe Abgründe in sich, die nicht alle erkannt haben.«
»Wechselhaft, sagen Sie?«
»Ja, er hatte starke Stimmungsschwankungen. Meistens war er froh und zufrieden, jedenfalls immer, wenn er mit den Kindern zusammen war. Aber manchmal, zwischendurch, kam plötzlich das Dunkle zum Vorschein, das er in sich trug. Dann war es, als ob sich ein Schatten über ihn legte, und ich wusste – mit jeder Faser meines Körpers –, dass es in solchen Phasen wichtig war, nichts zu sagen, die Stimme nicht zu erheben, sondern so zu tun, als sei alles in Ordnung … Dann ging es vorbei.«
»Wie groß sind Ihre Kinder?«
Die erste Andeutung eines Lächelns, wenn auch eines wehmütigen, huschte über ihre Lippen. »Wir haben zwei, Silje und Stian. Silje ist neun und Stian sechs. Es ist ganz furchtbar für sie, die Armen! So plötzlich den Vater zu verlieren, und so klein …« Sie brach wieder in Tränen aus.
Ich ließ sie weinen. Diskret schwang ich meinen Stuhl herum und sah aus dem Fenster. Die Wolkendecke hing tief und regenschwer über der Stadt. Der obere Kamm des Fløien war in dichtes Grau gehüllt. Es lag eine schwermütige Atmosphäre von sterbendem Oktober in der Luft.
Als sie sich ausgeweint hatte, drehte ich mich vorsichtig wieder in ihre Richtung. »Dieser Selbstmord …«
»Ja, das war genau der Punkt. Mehrmals, wenn er in diesem niedergeschlagenen Zustand war, kam er darauf zu sprechen. – Sie hat sich nicht das Leben genommen!, sagte er dann manchmal. – Sie haben sie umgebracht!«
»Sie?«
»Ja. Aber mehr hat er nie gesagt, und ich habe auch nicht gefragt.«
»Sie haben nicht gefragt, obwohl er über etwas sprach, das vielleicht ein Mord war?«
»Wie ich vorhin schon gesagt habe … Wenn er in diesen Phasen war, musste man so zurückhaltend wie möglich sein. Wenn er dann wieder er selbst war, wollte er nicht mehr darüber sprechen.«
»Haben Sie es versucht?«
»Ein paar Mal nur. Die Signale waren deutlich genug. Er wollte nicht darüber sprechen.«
»Aber … glauben Sie, dass er mich deshalb aufgesucht hat?«
Sie sah aufgewühlt aus. »Die Sache ist die, Veum: Er hatte gerade eine solche Phase. Düster, traurig, unruhig. Und sie war noch nicht vorbei. Ich habe in diesen Phasen oft Angst bekommen. Er wirkte manchmal so – lebensmüde, wenn Sie verstehen. Aber das hier war ja wohl auch kein Selbstmord, oder?«
»Es deutet nichts darauf hin.«
»Genau. Er ist nicht einfach so gestorben. Das ergäbe überhaupt keinen Sinn.« Wieder wirkte sie völlig verzweifelt und ratlos. »Es war kein natürlicher Tod, Veum! Auf keinen Fall!«
»Was ist, wenn diese Begegnung mit Tor Steinestø seine Zweifel an den Umständen dieses Todesfalls von damals wieder geweckt hat? Könnte ihn das dazu gebracht haben, zu versuchen, seinen Verdacht bestätigt zu bekommen?«
Sie sah mich durch einen Tränenschleier hindurch an. »Das ist gut möglich.«
»Und dafür hätte er natürlich jemanden wie mich brauchen können.«
»Eben.«
»Das klingt alles immer mehr nach einem Fall für die Polizei.«
»Aber die wollen es ja nicht ernst nehmen!«
»Wenn das Ergebnis der Obduktion vorliegt und sich eventuell herausstellt, dass da etwas Verdächtiges passiert ist, bin ich sicher, dass sie alles tun werden, was in ihrer Macht steht, um es aufzuklären.«
»Ja, aber ich kann nicht so lange warten! Verstehen Sie denn nicht? Was ist, wenn … Was ist, wenn er dabei war, etwas herauszufinden? Was ist, wenn die, die seinerzeit Hildegunn Hogset umgebracht haben, jetzt ihn umgebracht haben? Auf wen werden sie es das nächste Mal absehen? Auf mich? Auf die Kinder?«
»Wenn Sie so etwas befürchten, haben Sie ein Recht auf Polizeischutz, aber …«
»Aber?« Sie sah mich mit Verzweiflung im Blick an. »Sagen Sie ruhig, was Sie denken! Die Frau ist hysterisch. Mir glaubt doch keiner, weder Sie noch diese Leute bei der Polizei. Aber an wen soll ich mich denn wenden? Können Sie mir das sagen?«
Einen Moment lang sahen wir uns stumm an.
Ich seufzte tief. »Hören Sie … Ich versuche nur, die Situation realistisch zu betrachten. Die Polizei hat einen großen Apparat zur Verfügung. Ich habe nur mich selbst. Was sollte ich Ihrer Meinung nach tun?«
Sie hatte das Taschentuch wieder hervorgeholt. Jetzt trocknete sie ihre Tränen und schluckte die Verzweiflung hinunter. »Was ich mir im Moment vorstellen könnte, wäre, Sie zu bitten, über die Sache nachzudenken, zu sehen, ob Sie vielleicht etwas darüber rausfinden können, was damals passiert ist. In der Situation, in der sich unsere Familie im Moment befindet, kann ich Ihnen keinen großen Vorschuss versprechen, aber … Wir hatten jedenfalls eine ziemlich hohe Lebensversicherung. Wenn die ausbezahlt wird, werde ich selbstverständlich für Ihre Arbeit aufkommen. Wäre das für Sie vorstellbar?«
Ich dachte mit Besorgnis an den ständig anwachsenden Stapel unbezahlter Rechnungen. Doch dann sagte ich zu mir selbst: Es gibt Dinge im Leben, die sind schlimmer als die Sorge um ungeduldige Kreditoren. Laut sagte ich: »Geben Sie mir ein paar Tage für einleitende Nachforschungen, dann werde ich Ihnen die Ergebnisse mitteilen.«
Es war kein großes Lächeln, was sie mir schenkte, aber es blitzte jedenfalls in ihren Augen. »Ich danke Ihnen, Veum. Danke, dass Sie mich nicht abweisen … wie die anderen.«
»Bedanken Sie sich nicht zu früh. Dabei haben sich schon andere Leute in den Finger geschnitten.«
Ich begleitete sie hinaus. Als wir durch das Wartezimmer gingen, sah sie sich scheu um. Doch sie fragte nicht, wo ich ihn gefunden hatte, und ich fand es noch zu früh, um es ihr zu erzählen.
5
Nachdem Tonje Svarstad gegangen war, saß ich eine Weile nachdenklich an meinem Schreibtisch.
Ein Todesfall vor vierzehn oder fünfzehn Jahren, irgendwo an der Küste von Møre, höchstwahrscheinlich als Unfall klassifiziert – oder als »persönliche Tragödie«, wie die Presse es gerne nannte, wenn es sich um einen Selbstmord handelte. Hildegunn Høgset und noch ein paar andere Namen – es gab nicht viel, wo ich ansetzen konnte. Und zuverlässige Kontakte in Møre hatte ich auch nicht.
Erlend Ekerhovd hatte unter anderem mit einer lokalen Politikerin namens Hedda Mikalsen, einem Polizisten namens Tor Steinestø und einer unbedeutenden Sängerin namens Astrid Hauso in einer Kommune in der Edvardsens Gate gewohnt. Über Tor Steinestø wusste ich nichts. Hedda Mikalsen war ich nie begegnet, aber da sie seit ein paar Jahren zu den profiliertesten Politikerinnen der Stadt gehörte, hatte ich automatisch durch verschiedene Zeitungsartikel und politische Kampagnen ein wenig über sie erfahren. Viele sagten ihr eine zukünftige Karriere in der Landespolitik voraus. In der Presse war sie als potenzielle Anwärterin auf einen Ministersessel gehandelt worden. Von Astrid Hauso und Fiskerjenten hatte ich zwar mal gehört, aber ihre Karriere war wohl, soweit ich es mitbekommen hatte, alles andere als viel versprechend gewesen, wenn man sich einmal die öffentliche Resonanz betrachtete.
Offensichtlich hatte eine Begegnung mit Tor Steinestø das Ganze in Gang gesetzt. Ich schlug im Telefonbuch nach. Steinestø wohnte in Søvikneset, was meiner Erinnerung nach beim Nordnesvannet lag, zwischen Steinsviken und Søreide. Es stand keine Berufsbezeichnung dabei, aber da er bei der Polizei arbeitete, sollte es nicht schwer sein, ihn zu finden. Astrid Hauso wohnte im Skivebakken. Hedda Mikalsen war nicht eingetragen. Wahrscheinlich hatte sie eine Geheimnummer, um unangenehme Anrufe von unzufriedenen Wählern um zwei Uhr nachts zu vermeiden.
Ich notierte mir die Nummern der beiden ersten. Dann rief ich bei der Auskunft an und bekam die Nummer der Hauptredaktion von Sunnmørsposten in Alesund. Meine Anfrage wurde endlos durchs System geschoben, bis ich schließlich bei einer jungen, dünnen Mädchenstimme landete, die niemanden mehr unter sich hatte, an den sie mich weiterreichen konnte. Ich notierte mir ihren Namen: Lisa Henning.
»Sie sind Journalistin?«
»Ja-a«, sagte sie zögerlich. »Nur als Vertretung, vorläufig.«
»Ich wollte wissen, ob Sie mir helfen können, Informationen über ein Ereignis aus den Siebziger Jahren zu finden … möglicherweise von 1979.«
»1979!« Sie klang, als sei das lange vor ihrer Geburt gewesen.
»Ja. Eine Frau soll ertrunken sein.« Ich erzählte ihr das Wenige, was ich wusste, und sie versprach, nachzusehen, was sie finden konnte. Ich versprach ihr nichts, und dafür hatte sie offensichtlich vollstes Verständnis.
Der nächste auf meiner Liste war Tor Steinestø, doch als ich im Polizeipräsidium anrief, teilte man mir mit, er sei verreist und werde erst am nächsten Tag gegen zehn Uhr zurückerwartet. Ob ich eine Nachricht hinterlassen wolle? Nein, antwortete ich, ich würde wieder anrufen. Ich wollte ihm nicht die Chance geben, mir auszuweichen.
Dann war Hedda Mikalsen an der Reihe. Ich hätte natürlich auch im Rathaus anrufen können, doch ich hatte den Verdacht, dass man mich dort nicht besonders freundlich behandeln würde. Meistens war es schwieriger, Leute abzuweisen, wenn sie schon vor dem Büro standen. Außerdem konnte ich etwas frische Luft gebrauchen, soweit man den Smog in Bergen Ende Oktober mit so positiven Worten beschreiben konnte.
Das Rathaus von Bergen liegt am Rande der großen Brandstelle von 1916, als großartiges Monument des goldenen Zeitalters der modernen Architektur – der legendären 1970er Jahre –, als keine Fassade zu hässlich, kein Hochhaus zu überdimensional war, um nicht gebaut zu werden. Das Bauwerk war 1974 fertig gestellt worden, und seitdem hatte niemand umhin gekonnt, es zu bemerken. Böse Zungen behaupteten, dass es – ebenso wie die Chinesische Mauer – vom Mond aus zu sehen sein müsse.
Es lag außerdem in einer historischen Umgebung. Einen Steinwurf entfernt befand sich die alte Ratsstube der Stadt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts und zeugte stumm von einer Zeit, als die Stadtpolitiker nicht in die Höhe bauen mussten, um sich über das gemeine Volk zu erheben. Der nächste Nachbar im Süden war das weiß gekalkte Manufakturenhaus, ehemals Zwangsanstalt und Zuchthaus, und jetzt von den Zwangsarbeitern der modernen Zeit, den Bürokraten, bevölkert.
Hedda Mikalsens Büro lag im zehnten Stock. Nachdem ich unbeschadet an der Rezeption im Erdgeschoss vorbeigekommen war, musste ich bei der Chefsekretärin oben deutlich mehr Energie und Geschick aufwenden. Die Kommunalrätin sei den ganzen Vormittag beschäftigt, konnte sie berichten. Sie brauchte nicht einmal nachzufragen.
»Fragen Sie sie, ob sie fünf Minuten Zeit für einen alten Freund hat.«
Sie maß mich mit kritischem Blick. »Und wie war Ihr Name?«
»Veum.«
Sie rief an und überbrachte der Kommunalrätin die Botschaft. Dann lauschte sie Hedda Mikalsens Kommentar und sah mich wieder mit stechendem Blick an. »Die Kommunalrätin kennt keinen Veum, sagt sie.«
»Nein, aber – sagen Sie ihr, es ginge um Erlend Ekerhovd.«
Dieselbe Prozedur.
»Erlend Ekerhovd ist tot, sagt sie.«
»Genau darum geht es.«
Die Chefsekretärin seufzte tief und verdrehte die Augen, rief aber noch einmal an und wiederholte, was ich gesagt hatte. Da nahm die Kommunalrätin die Sache selbst in die Hand und trat auf den Korridor heraus. Ihr Büro lag weit hinten, und ich hatte das Vergnügen, sie mit gutem Abstand betrachten zu können, während sie auf mich zukam.
Hedda Mikalsen war eine gedrungene Frau mit kurzem, kupferfarbenem Haar, energischem Gang und einer dynamischen Kinnpartie. Sie trug ein einfaches Kostüm, dunkelgrau und elegant geschnitten. In der einen Hand hielt sie ein zusammengeheftetes Dokument, wie um zu zeigen, dass sie absolut keine Zeit hatte. Als sie direkt vor mir stand, sagte sie kurz: »Ja?«
Ich reichte ihr die Hand: »Varg Veum.«
Sie schüttelte sie routinemäßig. Ein Lächeln hatte sie jedoch nicht im Angebot.
»Es geht, wie ich Ihrer liebenswürdigen Sekretärin schon gesagt habe, um Erlend Ekerhovd.«
»Ja, das habe ich mitbekommen. Was ist mit ihm?«
»Er …«
Sie unterbrach mich. »Ja, ich habe die Todesanzeige gesehen, aber es ist viele Jahre her, dass wir zuletzt Kontakt hatten, also … Was ist der Grund für Ihren Besuch?«
»Ich bin Privat …«
»Ja, ich weiß, wer Sie sind«, sagte sie schnell.
»Ach ja?«
»Ich habe den Anspruch, soviel wie möglich darüber zu wissen, was hier in der Stadt vorgeht – und wer hier operiert.«
»Tja, nun bin ich nicht gerade bekannt für meine chirurgische Präzision …«
Sie sah auf die Uhr. »Außerdem habe ich überhaupt keine Zeit, hier herumzustehen und mir schlechte Witze anzuhören. Wenn Sie also bitte zur Sache kommen könnten?«
»Hildegunn Høgset.«
Das brachte sie jedenfalls aus der Fassung, für eine oder zwei Sekunden. »Hildegunn? Aber das ist doch – wie viele Jahre her?« Sie blickte unsicher zur Seite, als habe jemand es an die Wand geschrieben, um ihr zu helfen.
»Haben Sie fünf Minuten Zeit für mich?«
»Na gut! Kommen Sie mit.«
Ich wechselte einen kurzen Blick mit der Chefsekretärin, ohne viel Verständnis zu ernten, und folgte Hedda Mikalsen.
Das Büro lag nach Norden hinaus. Im Westen lag Askøy als Schutz vor dem Meer. Unter uns lag das Konglomerat aus Gebäuden zwischen der Rådhusgaten und der Torgallmenningen, eine Landschaft aus Dächern und Türmen und Hinterhöfen, die man sonst nie sah.
Hedda Mikalsen nahm hinter ihrem Schreibtisch Platz und wies mich auf einen weniger komfortablen Stuhl auf der Wählerseite des Tisches. Sie war nicht besonders groß und wirkte im Sitzen noch kleiner. Doch ihr Blick war fest und blau hinter den leichten, schmalen Brillengläsern. »Zehn Minuten, Veum. Maximal eine Viertelstunde. Kommen Sie zur Sache.«
»Ich werde so direkt zur Sache kommen, wie ich kann. Erlend Ekerhovd ist am letzten Mittwoch in meinem Büro gestorben.«
»In Ihrem …«
»Oder, besser gesagt, in meinem Wartezimmer. Bevor ich mit ihm sprechen konnte.«
»Aber was … wie …«
»Wir warten noch auf das Ergebnis der Obduktion. Vorläufig ist es unmöglich zu sagen, was geschehen ist.«
»Aber er wurde nicht – ermordet?«
»Es gab keine eindeutigen Anzeichen dafür. Aber man kann nie wissen. Wie gesagt – es liegt noch kein offizielles Ergebnis vor.«
»Du lieber Gott! Das ist so traurig. Er war doch nur ein paar Jahre älter als ich.«
»Einundvierzig, hat man mir gesagt.«
Sie nickte leicht. »So ungefähr.«
»Seine Frau … Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen?«
»Nur flüchtig. Sie haben sich kennen gelernt, nachdem wir – auseinander gegangen sind.«
»Ja, ich habe es so verstanden, dass Sie und Erlend Ekerhovd in den siebziger Jahren zusammen in einer Wohngemeinschaft gelebt haben?«
»Ja, aber wir waren nicht … nicht er und ich.«
»Nein?«
»Nein! Aber Sie haben Hildegunn erwähnt.«
»Ja. Waren Erlend und sie vielleicht zusammen?«
Ihr Blick ging in die Ferne. »Ja, das waren sie wohl. Eine Weile. Es gab ja so viele …« Sie zuckte mit den Schultern. »Wie soll ich es nennen? Allianzen.«
»Beziehungen?«
»Tja … Aber wie ich gesagt habe … das wissen Sie sicher. Hildegunn ist tot, seit vielen Jahren.«
»Seit 1979, hat man mir gesagt.«
»Ich begreife immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen, Veum. Was kann ich für Sie tun?«
»Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum Ekerhovd in meinem Büro aufgetaucht ist, oder?«
»Sicher, aber …« Sie hob resigniert die Hände.
»Tonje Svarstad, seine Frau, ist heute Morgen bei mir gewesen. Sie hat erzählt, dass ihr Mann aller Wahrscheinlichkeit nach Nachforschungen angestellt hatte über die Art und Weise, wie Hildegunn Høgset verschwand.«
»Art und Weise? Sie ist ins Wasser gegangen, oder etwa nicht? Ich habe es immer so verstanden, dass man es für einen Selbstmord gehalten hat. Gibt es einen Grund, etwas anderes zu vermuten?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe gerade erst begonnen, in dieser Angelegenheit zu recherchieren. Deshalb hatte ich gehofft, Sie wüssten etwas, was mir vielleicht weiterhelfen könnte.«
»Aber ich habe sie nicht besser gekannt als all die anderen!«
»Und diese Wohngemeinschaft? Können Sie mir etwas darüber erzählen? Wer wohnte sonst noch da zum Beispiel? Es war in der Edvardsensgate, stimmt’s?«
»Ja … wir haben uns zusammen getan, eine Gruppe von Studenten – das muss im Herbst 1974 gewesen sein.«
Sie war zwanzig Jahre alt gewesen, hatte das Vorstudium abgeschlossen und gerade mit dem Hauptstudium begonnen. Erlend und Atle hatten die Idee gehabt, und sie hatten die anderen dafür begeistert – Elisabeth, mit der Atle zusammen war, sie selbst, Tor, Astrid, Kari und Nils. Den größten Teil des Septembers hatten sie nach einer passenden Wohnung gesucht, bis sie dann auf dieses Haus in der Edvardsens Gate stießen, das zum Verkauf stand.
»Ein ganzes Haus?«, hatte sie gesagt. »Aber das muss doch schrecklich teuer sein?«
»Nein, nein«, hatte Erlend argumentiert. »Für umso mehr Leute haben wir Platz. Ein Haus von der Größe in diesem Stadtteil … Die Verantwortlichen bei der Bank würden sich nur die Hände reiben, falls wir es nicht schaffen, den Kredit abzuzahlen.«
»Aber das schaffen wir«, hatte Atle gesagt.
»Zweifellos …« Erlend war so überzeugend gewesen, dass jegliche Skepsis schnell bekämpft war, und am nächsten Tag waren sie alle gemeinsam zur Besichtigung angetreten.
Es war ein richtiges Märchenschloss gewesen. Mit großen Augen waren sie von Raum zu Raum gegangen.
»Das hier ist echt toll, Atle!«, hatte Elisabeth gesagt und ihren Arm vorsichtig unter seinen geschoben.
»Unser erstes gemeinsames Zuhause?«, hatte er erwidert, mit einem etwas schiefen Lächeln.
»Im Geiste des Kollektivismus!«, hatte Erlend hinzugefügt.
»Natürlich! Aber Elisabeth gehört mir«, hatte Atle geantwortet und sie eng an sich gezogen. Alle hatten gelacht.
Ursprünglich war das Haus, seiner Größe nach zu urteilen, in sechs oder sieben, vielleicht sogar noch mehr Wohnungen aufgeteilt gewesen. Es lag in einem Stadtteil, in dem, als es um 1880