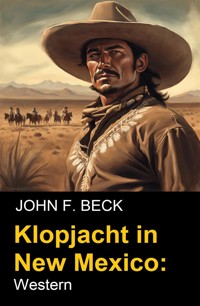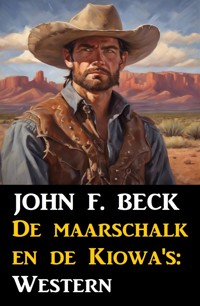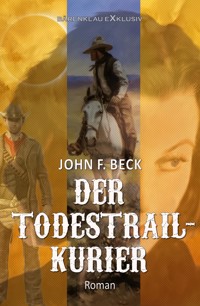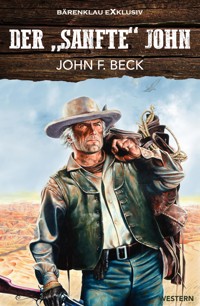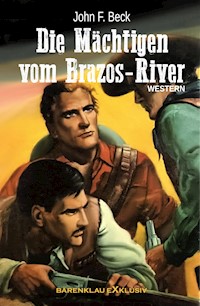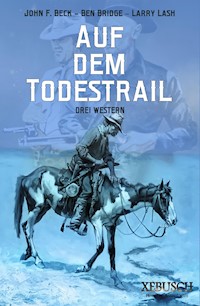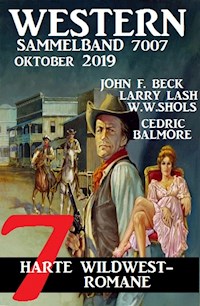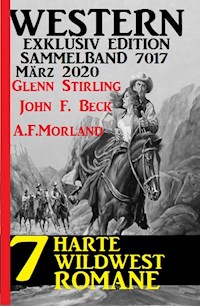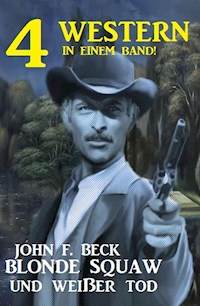3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Dieser Band enthält folgende Western: Durchbruch nach Miles City (Glenn Stirling) Moonhawk (John F. Beck) Verfolgt von Indianern und schwer verletzt rettet sich ein Mann zur Farm von Clay und Nakima Wheeler. Er hat Goldnuggets bei sich und löst dadurch einen Run auf die vermeintliche Fundstelle aus. Die ganze Bevölkerung der kleinen Stadt macht sich auf den Weg ins Indianerland, um Gold zu finden, Clay soll sie führen - sonst muss seine Frau sterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Ähnliche
Glenn Stirling, John F. Beck
Inhaltsverzeichnis
Von Indianern verfolgt: Cowboy Western Doppelband 2 Romane
Copyright
Durchbruch nach Miles City
Moonhawk
Von Indianern verfolgt: Cowboy Western Doppelband 2 Romane
John F. Beck, Glenn Stirling
Dieser Band enthält folgende Western:
Durchbruch nach Miles City (Glenn Stirling)
Moonhawk (John F. Beck)
Verfolgt von Indianern und schwer verletzt rettet sich ein Mann zur Farm von Clay und Nakima Wheeler. Er hat Goldnuggets bei sich und löst dadurch einen Run auf die vermeintliche Fundstelle aus. Die ganze Bevölkerung der kleinen Stadt macht sich auf den Weg ins Indianerland, um Gold zu finden, Clay soll sie führen – sonst muss seine Frau sterben.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author / Cover 2021: Firuz Askin
Redaktion und Korrektorat: Alfred Wallon
© dieser Ausgabe 2019 by Alfred Bekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
www.AlfredBekker.de
**
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen, Preisaktionen und Hintergründe!
Durchbruch nach Miles City
Glenn Stirling
Als ich die Spuren im Schnee entdeckte, begriff ich, dass es die Cheyennes auf den Siedlertreck abgesehen hatten. Und die ahnten noch nicht einmal etwas davon, weil sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren und ums Überleben in diesem harten Winter kämpfen mussten. Ich konnte die Siedler zwar noch warnen, aber die Cheyennes griffen trotzdem an. Hätten Captain Binding und ich ihnen nicht beigestanden und ihnen dabei geholfen, sich zu wehren, dann hätte die letzte Stunde für die Siedler geschlagen. Denn sie waren Quäker, gottesfürchtige Menschen, die jede Gewalt ablehnten. Aber auch sie mussten sehr schnell erkennen, dass Bibeltreue nur eine Seite der Medaille war – und der Kampf ums eigene Schicksal eine ganz andere ...
Wir hatten die Spuren von Ochsengespannen entdeckt. Das war nicht ungewöhnlich. Ein Siedlerzug unterwegs.
Aber dann sahen wir im gefrorenen Uferschlamm die erstarrten Abdrücke von unbeschlagenen Pferdehufen. Indianermustangs! Und diese Spuren lagen zum Teil über denen der Ochsen und Wagenräder.
Indianer verfolgten einen Siedlerzug. Viele Indianer. Hunderte!
„Warren“, sagte ich zu Captain Binding, der mich begleitete, „die Cheyennes sind hinter den Siedlern her. Hoffentlich ist nicht schon alles vorbei!“
„Den Spuren nach, Callahan!“, erwiderte Binding.
Wir ritten auf den Spuren, und dann hatten wir die Indianer plötzlich vor uns...
Sie waren überall, aber wir sahen nicht einen von ihnen. Und doch hatte jeder von uns begriffen, dass wir nur einen einzigen Schritt aus unserer Deckung heraus zu tun brauchten, um ihren Feuerzauber zu erleben.
Ich warf einen kurzen Blick auf Binding, der neben mir kniete. Er hatte die Augen zusammengekniffen und spähte hinaus auf das vom Frost erstarrte Land. In seinem Bart hingen Eiskristalle. Nase und Wange zeigten schon die ersten Spuren von Erfrierungen. Er hatte seinen Mantelkragen hochgeschlagen, zog sich jetzt mit den Zähnen die Handschuhe herunter und hauchte die starren Finger an. Der Atem quoll dabei aus seinem Mund wie der Dampf aus einer Lokomotive.
Er sah mich an. „Schön sehen wir aus. Wie wollen wir hier jemals wieder wegkommen?“
„Es ist doch nicht die erste Tinte, in der wir stecken“, erwiderte ich und versuchte zu lächeln. Ich spürte, wie meine Haut in der Kälte spannte. Als ich meine Nase rieb, schmerzte es.
„Wie viele werden es sein?“, fragte er und ließ seinen Blick über das nur mit Büschen bestandene Gelände schweifen. Es reichte eine knappe Meile weit, dann begann wieder der Wald. Hier vor uns war alles irgendwann in einem Sommer abgebrannt. Erst allmählich begann sich der Wald wieder zu erheben. Drüben auf der anderen Seite des Flusses, der jetzt fast zugefroren war, bedeckten Wälder das Hügelland bis hinauf zum Missouri.
„Wenn mich nicht alles täuscht, müssen es mindestens vierhundert sein. Sie haben sich daran festgebissen, das Camp zu packen. Ich glaube nicht, dass wir diesen Ring sprengen und zu unseren Leuten durchkommen.“
Binding nickte. „Aber sie sind noch hier. Das ist doch schon verdammt viel. Unsere Leute sind also noch am Leben.“
„Sind sie“, gab ich zu. „Es fragt sich nur, wie lange sie es noch durchhalten, und zweitens, ob wir es je schaffen können, zu ihnen zu stoßen.“
Binding sah mich an. Sein Gesicht verzog sich zur Grimasse. „Und ob wir es schaffen!“
Ja, dachte ich, Binding und ich, wir beide haben schon manches erreicht, scheinbar Unmögliches bewältigt, aber Wunder können wir beim besten Willen auch keine bewirken.
Ich blickte hinunter zum Fluss. Der Uferschlamm war gefroren, aber in ihm zeichneten sich noch die Trittsiegel der Pferde und Ochsen und die Spuren der großen Wagenräder deutlich ab. Der Frost hatte es festgehalten. Jene Menschen, denen die Pferde und die Wagen gehörten, mussten sich irgendwo dort vorn im Wald befinden, umlagert von den Indianern. Das alte Militärlager, in das sie sich möglicherweise zurückgezogen hatten, war nur schlecht geschützt. Die Befestigungen bestanden aus Palisaden. Es gab weder Erdwälle noch Gräben. Falls von den Blockhütten überhaupt noch etwas übrig war, so boten sie bestenfalls zwei Dutzend Menschen Schutz und Unterkunft und niemals jenen an die fünfzig Frauen, Kindern und Männern. Dazu kamen noch die Pferde ihrer Wagen.
Binding schien wohl ähnliche Gedanken zu haben wie ich.
„Glaubst du“, fragte er, ohne mich dabei anzusehen, „dass sie noch am Leben sind?“
„Ich nehme es an. Die Indianer sind so ruhig. Sie würden sich nicht so vorsichtig bewegen. Siehst du da drüben links? Da ist eine ganze Gruppe mit Pferden. Ich bin sicher, sie haben von unserer Existenz keine Ahnung. Jetzt kommen sie ja aus dem Loch heraus. Siehst du sie? Da links drüben sind sie. Fünfzehn, sechzehn sind es. Gib mir dein Fernrohr!“
Er reichte mir sein Spektiv. Ich zog es auseinander, hielt es ans Auge, konnte jetzt ganz deutlich sechzehn berittene Indianer sehen, die aus einer Senke herauskamen, zwischen zwei Buschreihen hindurchritten und nun ganz offen über das freie Land zum Fluss ritten.
„Ich glaube jetzt doch, dass niemand mehr lebt. Sie würden sich nicht so offen zeigen. Sie müssen ja damit rechnen, beschossen zu werden.“
„Vielleicht haben unsere Freunde keine Munition mehr. Soviel ich weiß, hatten sie ohnehin nicht viel Gewehre. Zwei, glaube ich. und dann die sechs der begleitenden Soldaten.“
„Diese Quäker sind ja verrückt, wenn sie glauben, dass ihnen die Indianer nichts tun, nur weil sie selbst für die Gewaltlosigkeit sind!“ Er spuckte wütend aus. „Woher sollen die Cheyennes denn wissen, woran die Quäker glauben?“
Ich wollte jetzt nicht darauf eingehen und sagte:
„Wir warten, bis es dunkel wird. Vorher können wir nicht durch. Und dann brauchen wir noch eine gehörige Portion Glück.“
Den restlichen Nachmittag lagen wir noch herum. Wir konnten uns nicht zeigen. Unsere Pferde hatten sich auf Kommando gelegt. Die Büsche hinter uns verdeckten sie. Die Tiere wurden unruhig, sie wollten aufstehen, wollten grasen. Aber das konnten wir ihnen jetzt nicht erlauben. Wir wären auf der Stelle entdeckt worden.
Von zwei Seiten näherten sich Reitergruppen. Ich beobachtete sie durch das Fernrohr von Binding. Deutlich konnte ich die Indianer auf ihren Pferden erkennen, aber es waren nicht die Mustangs, die sie sonst ritten. Diese Tiere dort, die ich sah, wirkten größer, stämmiger. Sie sahen fast wie Wagenpferde aus.
Ein übles Gefühl würgte mich in der Kehle. Sollte wirklich alles schon vorbei sein, und wir hofften noch, jene fünfzig Weiße lebend vorzufinden?
Die Indianer sammelten sich unten am Fluss. Ich zählte mehr als dreißig. Dann verschwand diese Gruppe.
Wenig später tauchten wieder welche auf. Sie kamen zu Fuß, und es waren viele. Sie mussten gar nicht weit von uns an unserem Versteck vorbeigekommen sein und hatten offenbar das hartgefrorene Ufer des Flusses als Marschweg benutzt.
Jetzt hatte Binding das Fernrohr, und er zählte leise. Er kam auf über hundert, und, wie er behauptete, sollten es alles kräftige junge Männer sein.
Wir beide waren nicht hier, um mit den Indianern Krieg zu führet, aber es würde uns wohl nichts übrigbleiben, als dass wir mit ihnen zusammengerieten.
„Sie sind nur auf dieser Seite des Flusses, ist dir das aufgefallen? Von denen will auch keiner mit seinem Pferd durchs kalte Wasser“, meinte Binding.
„Und du folgerst daraus, wir sollten den Fluss überqueren, um von der anderen Seite her noch bei Tag an das Lager heranzukommen? Hast du denn Lust, durchs kalte Wasser zu schwimmen? Der Fluss ist ziemlich tief.“
Er sah mich an und grinste. „Na ja, es war nur ein Vorschlag. Was denkst du denn?“'
Ich spähte zum Himmel empor. Der begann sich zu bewölken.
„Es ist wärmer geworden“, sagte ich, „und es sieht nach Schnee aus. Schnee wäre gut für uns.“
„Schnee ist auch gut für die Indianer“, erwiderte er.
„Wir müssen auf die Nacht warten. Vielleicht schneit es bis dahin.“
*
Meine Prognose war gut. Es begann, als es dämmerte, zu schneien. Die Dämmerung währte ziemlich lange. Aber durch den Schnee war die Sicht beizeiten schlecht. Und das war der Augenblick, wo wir die Deckung verließen, unsere Pferde am Zügel nahmen und herausführten aus dem Dickicht. Wir saßen auf, und den beiden Tieren schien die Bewegung willkommen zu sein. Mein Brauner schnaubte. Aber es machte nichts aus, denn der Wind kam aus der Richtung, in die wir reiten wollten, und wenn Indianer dort waren, hatten sie bestimmt das Schnauben nicht gehört.
Trotz des warmen Mantels und der gefütterten Pelzstiefel war mir eiskalt, ein Zeichen dafür, dass die Luftfeuchtigkeit gestiegen war. Vorher war mir bei niedrigeren Temperaturen nicht kalt gewesen.
Plötzlich tauchten sie auf. Und obgleich ich die ganze Zeit mit ihnen gerechnet hatte, erschrak ich und zuckte zusammen.
Sie waren drei, und sie kamen zu Fuß. Unser Anblick verwirrte sie so sehr, dass sie zunächst überhaupt nichts taten und uns nur anstarrten.
Alle drei hatten Gewehre. Der Mittlere besaß einen langläufigen Vorderlader, die beiden anderen hielten Winchester in den Händen. Es waren moderne Winchester 66, genau die gleichen Waffen, die auch wir besaßen, und damit waren uns mindestens die beiden ebenbürtig, was ihre Feuerkraft anging.
Ich drückte meinem Braunen die Hacken in die Seiten und preschte nach vorn auf die Indianer zu. Mein Vorteil, dass sie zu Fuß waren; .ihr Vorteil, dass sie so sicherer schießen konnten. Aber die Entfernung war zu kurz, als dass sie damit ihren Vorteil hätten richtig nutzen können.
Binding feuerte zuerst. Dann krachte der urige Vorderlader des einen Indianers, der in der Mitte stand.
Ich sah, wie der mit dem Patronengurt einen Satz zur Seite machte, sich zusammenkrümmte und schoss. Ich hatte schon geglaubt, er sei getroffen worden, aber seine Bewegungen waren nur ein geübter Trick, um einem Schuss zu entgehen und selbst in Ruhe schießen zu können.
Ich drückte ab, repetierte fast automatisch, schoss wieder, hörte rechts Binding schreien und das schrille Aufwiehern seines Pferdes.
Mein Brauner machte vor Schreck einen Sprung zur Seite, dass ich fast aus dem Sattel gestürzt wäre. Dann sah ich, wie der große Indianer mit dem langen Gewehr zusammenbrach. Ich schoss wieder auf den dritten Mann, der am Boden kniete und das Gewehr hob.
Er war nicht schnell genug. Meine längere Übung und die Erfahrung mit einer solchen Waffe brachten den Vorteil. Er schaute mich noch an. Seine Augen waren weit aufgerissen. Es war, als wollte er einen Schrei ausstoßen, aber er brach lautlos zusammen.
Ich verdammte diesen Krieg, den wir mit ihnen führten, ein Krieg, der nicht der meine war und der auch nicht der Krieg dieser fünfzig Quäker sein konnte, die da irgendwo vorn im Wald in dieser fragwürdigen Befestigung hockten und auf Hilfe hofften. Es würde keine Hilfe geben, so wenig wie für diese drei Indianer, die da vor uns im Schnee zusammengebrochen waren.
Ich blickte auf Binding, dessen Schrei ich vorhin gehört hatte. Und da sah ich ihn. Sein Pferd war zusammengebrochen, er selbst schien aber nichts abbekommen zu haben. Er sprang gerade auf, packte seine Winchester und sah sich verwegen nach allen Seiten um. Aber die Gefahr war im Augenblick gebannt.
Sein Pferd musste von dem Vorderlader getroffen worden sein. Das großkalibrige Geschoss hatte das Tier auf der Stelle getötet.
Ich hörte Schreie von links.
,,Los, mach schnell!“, rief ich Binding zu. „Die Satteltasche!“
Er zog die Satteltasche unter dem gestürzten Tier heraus, rannte dann auf mich zu, und ich half ihm hinter mir aufs Pferd. Dann jagten wir los.
Mein Brauner musste zwar die doppelte Last tragen, aber irgendwie ahnte er wohl, dass es jetzt ums Ganze ging. Binnen weniger Minuten würde es hier an dieser Stelle von Indianern nur so wimmeln.
Wir ritten in der alten Richtung weiter, und vielleicht ist das der Grund, warum sie uns im Augenblick nicht behelligten.
Ich glaube, sie mussten angenommen haben, dass wir zu dem Wagenzug gehörten und ausbrechen wollten. Und deshalb suchten sie in genau der Richtung, aus der wir gekommen waren, jedenfalls hörten wir die Rufe. Es war die einzige Möglichkeit für sie, sich zu verständigen, denn mittlerweile war es wirklich dunkel geworden.
Aber nun hatten wir den Wald erreicht. Die Gefahr, plötzlich abermals vor Indianern zu stehen, war erheblich größer als bisher, denn sie hielten ja dieses alte Militärlager umstellt, und da es sich auf einer großen Lichtung befand, konnte ich fest davon ausgehen, dass hier im Wald, der die Lichtung umschloss, die Streitmacht der Indianer verteilt war.
Wir hielten an, saßen ab, dazu bedurfte es keiner Diskussion. Binding und ich wussten, was in solchen Augenblicken zu tun war.
Ich führte das Pferd, und er ging ein Stück weiter rechts, blieb dann stehen und sicherte nach hinten.
Ich arbeitete mich in der Dunkelheit zwischen den Bäumen weiter. Hier fiel wenigstens nicht so viel Schnee. Die Sicht war ein wenig besser. Aber weiter hinten erblickte ich einen hellen Fleck. Es war, als brenne dort ein Feuer. Deshalb konnte ich auch die Bäume sehen und prallte nicht dagegen. Ich führte das Pferd noch ein Stück, dann band ich es an einem Baum fest und ging, das Gewehr entsichert und den Finger am Abzug, langsam weiter. Irgendwo hinter mir war Binding. Er würde das Pferd wieder losbinden und mir folgen.
Ungehindert erreichte ich den Rand des Waldes vor der Lichtung. Dann sah ich die Feuer.
Sie brannten direkt vor dem Palisadenzaun, der das befestigte Camp umgab. Ich zählte zwölf Feuer. Fünf davon waren auf meiner Seite. Von hier aus war die Lichtung etwa hundert Schritt breit. Aber während dieser hundert Schritt würden mich nicht nur die Menschen hinter den Palisaden erkennen, sondern auch mögliche Indianer, die hier noch in der Nähe waren.
Sie hatten die Feuer angelegt, um angreifende Indianer früher sehen zu können, aber für uns war das schlecht. Ich überlegte, wie wir herankommen konnten.
Hinter mir näherte sich Binding mit dem Pferd. Das Tier trat auf Äste, die unter den Hufen knackten. Mir war es, als würde der Lärm meilenweit zu hören sein.
Der Geruch des verbrennenden Holzes wehte mir anheimelnd in die Nase. Mit einem mal verspürte ich Hunger und Durst und die Kälte, diese nasse Kälte, die bis auf die Knochen zu gehen schien.
„Die Feuer sind schlecht für uns“, raunte mir Binding zu. „Kein Indianer zu sehen?“
„Nichts“, erwiderte ich leise und lauschte nach beiden Seiten. Wir spähten den Waldrand entlang, sahen aber keinerlei verdächtige Bewegung. Wenn das Indianer waren, hatten sie, tausend Möglichkeiten, sich zu verstecken, ohne von uns gesehen zu werden, aber sie würden rechtzeitig da sein, wenn sie einen von uns beiden beim Überqueren der freien Strecke bemerken sollten. Und dann war noch die Gefahr, dass die Menschen im Camp uns womöglich verkannten und für Indianer hielten. Wir mussten sie vorher warnen. Taten wir das, hatten wir die Indianer auf dem Pelz.
Die Bäume, zwischen denen wir standen, waren Douglastannen. Schwere, ausladende Äste hatten sie hier am Rand der Lichtung. Sie luden die Indianer geradezu ein, auf sie zu steigen. Als Baumschütze hier am Rande der Lichtung konnte ein Indianer selbst mit Pfeil und Bogen die ganze Fläche bis hinüber zum Palisadenzaun bestreichen.
Es gab für uns, nun da wir so weit waren, gar keine Wahl mehr. Wir mussten hinüber, wir mussten durchbrechen. Wir mussten es einfach riskieren.
Ich schnallte mein Deckenbündel los, nahm die Rolle, gab mein Gewehr Binding, trat einen Schritt vor und holte aus. Dann schleuderte ich, so weit ich konnte, diese Rolle durch die Luft, hinüber in den Schnee. Wenn irgendwo ein Posten war, musste er die Bewegung sehen. Und er sah sie.
Plötzlich krachten Schüsse. Sie fielen von den Palisaden aus, aber es knallten auch zwei rechts von uns, und, wie ich schon gedacht hatte, sie kamen von schräg oben. Schließlich fiel noch ein einzelner Schuss von weiter links. Die Mündungsblitze hatten den Standort des Schützen verraten. Uns beiden reichte das. Ich machte hastig das Pferd fest und rannte nach rechts. Binding stürmte nach links.
Drüben vor den Palisaden sprühten die Feuerfunken bis hoch in den Himmel. Offenbar hatte jemand neues Brennmaterial von den Palisaden aus hineingeworfen. Die Flammen schlugen höher. Es wurde mit einem mal viel heller, und damit schwanden auch unsere Aussichten, ungesehen von den Indianern bis zu den Palisaden zu kommen.
Ich hörte ein Schreien weiter hinten im Wald. Offenbar kamen jetzt noch mehr Indianer von dort nach hier. Und der Mann oben im Baum schoss wieder. Ich sah das Mündungsfeuer, konnte aber von hier aus nicht sicher treffen, robbte etwas vor und schoss. Im selben Augenblick, als ich es getan hatte, klatschte etwas dicht über mir in die Rinde des Stammes, neben dem ich lag. Das Holz der Rinde prasselte mir ins Gesicht. Aber da krachte ein zweiter Schuss, und ich sah das Mündungsfeuer aus dem Wald heraus aufblitzen.
So rasch ich konnte, robbte ich zurück, blieb am Boden liegen und spähte nun in den Wald hinein. Aber von dem Schützen dort sah ich nichts mehr. Statt dessen krachten fünf Gewehre von den Palisaden aus, und die Schüsse prasselten oben ins Geäst der Bäume. Manchmal kamen die Geschosse auch ziemlich dicht über mich weg.
Ich fluchte in mich hinein und wagte nicht, den Kopf zu heben. Jetzt saß ich richtig in der Falle. Ich hatte ein würgendes Gefühl im Hals. Sollte es hier aus und vorbei sein? Jetzt war ich wirklich wie festgenagelt, konnte weder vor noch zurück und musste jede Sekunde damit rechnen, von den Indianern zusammengeschossen zu werden.
Die Indianer schossen jetzt mit Pfeilen, und sie taten es ganz sicher nicht, um Munition zu sparen, sondern um ihren Standort wegen des Mündungsfeuers nicht zu verraten. Aber ihre Schüsse gingen hinüber zu den Palisaden. Einmal hörte ich dort einen Mann aufschreien. Danach fiel kein Schuss mehr. Der Wald schien jetzt voller Indianer zu sein. Ich hörte Stimmen, nahm das Knacken von Ästen wahr, wagte mich aber selbst nicht zu rühren.
Ich spurte das kalte Metall meines Gewehrlaufes unter mir. Ich lag direkt auf der Waffe.
Der Schnee wehte von der Lichtung aus bis in den Wald hinein. Ich konnte nur hoffen, dass er mich zudeckte.
Zeit gewinnen war jetzt alles. Was mochte mit Binding sein? Sicher hatten sie inzwischen auch mein Pferd gefunden. Ich dachte an all das, was sich in meiner Satteltasche befand, genaugenommen meine ganze Habe. Aber was waren schon materielle Dinge gegen das nackte Leben? Die Sachen konnte ich mir neu anschaffen, aber mein Leben hatte ich nur einmal.
Es schneite immer stärker. Ich war entschlossen, mich erst einmal einschneien zu lassen. Das hatte ich schon mehrmals in gefährlichen Situationen mit Erfolg getan. Wenn man erst einmal unter dem Schnee liegt, ist es nicht mehr so kalt. Gefährlich ist nur die Übergangszeit. Da droht man sich die Glieder zu erfrieren, und ich durfte mich nicht bewegen.
Plötzlich hörte ich Schreie. Sie kamen von der Stelle her, wo sich mein Pferd befand. Aha, dachte ich, jetzt haben sie es gefunden. Ich riskierte es, den Kopf zu heben, und konnte über die freie Fläche bis zu den Palisaden hinübersehen, und da gewahrte ich plötzlich mein Pferd.
Es raste im Galopp auf die Palisaden zu, reiterlos, wie es schien.
Von den Palisaden aus schossen sie, aber nicht aufs Pferd, sondern hinüber auf den Waldrand.
Das Pferd kam durch, und da musste so etwas wie ein Tor sein, das sie öffneten. Das Pferd preschte in diese Öffnung hinein und verschwand. Ich hörte Jubelschreie drüben im Camp.
Da wusste ich Bescheid. Binding hatte sich wie ein Indianer an die Seite des Pferdes gehängt und war durchgekommen.
Also sind meine Sachen gerettet, dachte ich. Aber ich sitze hier fest. Immerhin, wenn Binding drüben ist, habe ich Hoffnung.
Ich lag wieder still. Ich konnte über die Lichtung blicken. Aber allmählich wuchs die Schneedecke auf meinem Rücken immer höher; kalt und nass kroch es mir in den Nacken, aber ich musste ruhig bleiben.
Plötzlich fielen Schüsse auf der anderen Seite des Camps. Das konnte ich von hier aus nicht sehen, nur hören. Männer brüllten. Es waren die Stimmen von Weißen.
In meiner Nähe raschelte es. Dann rief eine gutturale Stimme etwas, das ich nicht verstand. Ich beherrschte den Dialekt der Cheyennes nicht. Wieder rief ein Indianer. Er war gar nicht weit von mir weg.
Unaufhörlich krachten drüben auf der anderen Lichtungsseite die Schüsse.
Plötzlich gewahrte ich rechts von mir im Lichtschein der weit entfernten Feuer Gestalten. Die Flammen schlugen so hoch, dass es bis weit in den Wald hinein leuchtete, und ich konnte die dahin huschenden Indianer sehen, erst zwei, dann noch zwei, und dann kamen fünf. Ihnen folgten nach einer Weile noch einmal sechs, die alle in die Richtung liefen, wo mein Pferd gestanden hatte. Vielleicht wollten sie im Schutz des Waldes zur anderen Seite der Lichtung gelangen.
Aber sie hatten etwas anderes vor. Sie sammelten sich ungefähr da, wo mein Pferd gestanden haben musste. Ich hörte einen von ihnen etwas sagen, und dann ertönten die Geräusche, wie wenn Pfeile abgeschossen werden. Die Bogen geben einen eigenartigen Schwinglaut ab, und die Pfeile pfeifen. Ich hörte sie auch wie ein Stakkato drüben in den Palisadenzaun und in andere Gegenstände einschlagen.
Aber die Schüsse wurden nicht erwidert, vielmehr krachte es fortlaufend auf der anderen Seite.
Da entschlossen sich die Indianer auch ihrerseits zum Angriff. Kreischend und mit überschnappenden Stimmen feuerten sie sich gegenseitig an und stürzten sich aus dem schützenden Wald heraus ins Freie. Und sie feuerten. Von dem Bäumen aus wurden sie durch Baumschützen unterstützt.
Das war der Augenblick, wo es für mich galt. Jetzt oder nie!
*
Brüllend hasteten, sprangen und ritten die angreifenden Indianer über die freie Strecke auf die Palisaden zu. Und dort fiel kein einziger Schuss - noch nicht.
Ich war aufgesprungen, hastete jetzt in die selbe Richtung, als gehörte ich zu den Indianern.
Ich hätte von hinten auf sie schießen und so direkt in den Kampf eingreifen können. Aber so groß war mein Hass nicht. Ich wollte durchkommen, aber das gelang mir vielleicht auch, ohne einigen von denen in den Rücken zu schießen.
Ich hatte fast die Stelle erreicht, wo die Feuer brannten, also dicht vor dem Palisadenzaun. Plötzlich fielen von den Palisaden herunter Schüsse.Aus sieben Gewehren knallte den angreifenden Indianern eine Salve entgegen.
Ich stand direkt neben einem Feuer und fürchtete, von ihnen als Indianer erkannt zu werden.
„He, ich bin einer von euch!“, schrie ich und jagte auf die Palisaden zu.
„Jungs, ein Weißer! Da ist der zweite Mann!“, hörte ich eine Bassstimme brüllen. Und danach schossen sie wieder.
Die Indianer warfen, als sie den Palisaden nahe genug waren, Brandfackeln über die Palisadenspitzen. Doch es war ein fast idiotischer Heldenmut, den die Werfer dazu aufbringen mussten. Denn sie standen voll im Sichtfeld der Weißen. Der Feuerschutz ihrer Baumschützen half den wagemutigen Fackelwerfern auch nicht. Zwei von ihnen fielen sofort im Feuerhagel der Schüsse. Ein dritter brach getroffen zusammen, versuchte dann aber noch wegzukriechen. Ein weiterer Schuss raffte ihn hin.
Die Ablenkung nützte mir. Ich sprang gegen den Zaun, von oben wurde ein Seil herübergeworfen. Ich packte zu, und schon wurde ich emporgezogen.
Genau in diesem Augenblick fauchte etwas haarscharf an meinem Kopf vorbei und knallte mit einem eigenartigen Geräusch ins Holz des Palisadenzaunes. Ein schwingender Ton entstand, und ich sah schemenhaft eine Bewegung wie das Stakkato von Trommelstöcken.
Ein Pfeil, und er steckte dicht neben meiner linken Hand im Holz.
Rasch war ich über den Zaun weg, und wieder pfiff etwas so dicht an mir vorbei, dass ich die Berührung spürte. Aber ich war schon auf der anderen Seite, als ein regelrechtes Geknatter von einschlagenden Pfeilen gegen die Palisaden erfolgte.
Zuerst sah ich nur eine Gestalt, die mir auf die Beine half. Ein riesiger Bursche, der mindestens einen Kopf größer war als ich; und ein kleiner Mann bin ich ja nun bei Gott nicht. Auch nicht gerade schmal in den Schultern, aber dieser Bursche vor mir, der mir seinen dampfenden Atem ins Gesicht blies wie ein angriffslustiger Stier, war mindestens doppelt so breit wie ich.
Er hatte keine Zeit mehr, sich um mich zu kümmern. Mir ging es nicht anders. Ich besaß ja mein Gewehr und meinen Revolver noch.
„Hast du eine Waffe, Bruder?“, fragte er mit einer abgrundtiefen Stimme.
Ich drückte ihm meinen Colt in die Hand. „Fünf Schuss sind drin. Nachher gebe ich dir mehr.“
Dann standen wir schon auf dem Laufbrett des Palisadenzaunes, sahen die Indianer auf der hellen Fläche des Schnees und schossen.
Sie oder wir, eine andere Frage stellte sich da zunächst gar nicht.
Mit den Brandfackeln boten sie für uns ein gutes Ziel, und das begriffen sie rasch. Ihnen wurde klar, dass die Weißen sie hereingelegt hatten, als die Schüsse auf der anderen Seite den Anschein erwecken sollten, auf der Seite hier sei keiner der Verteidiger. Und ich verstand nun, warum das alles bewerkstelligt worden war: Man wollte mir die Möglichkeit bieten, eine Chance zu haben, bis zu den Palisaden zu gelangen.
Ich hatte diese Chance genutzt und war hier. Aber bedeutete das im Grunde nicht sogar, dass ich endgültig in der Falle saß? Zwar waren Binding und ich nicht mehr allein, dafür aber hatten wir die Möglichkeit, einer Konfrontation mit den Indianern zu entgehen, vergeben.
Das konnten wir allerdings auch nicht, wenn wir uns noch einmal selbst im Spiegel besehen wollten, ohne vor Scham rot zu werden. Denn Binding und ich waren auf die Spuren der Quäker gestoßen und hatten erkannt, dass sie und ihre Eskorte geradewegs in diese indianische Falle geraten mussten. Weder die Soldaten noch die Quäker hatten einen einzigen ortskundigen Führer. Es war ein Wunder, dass sie wenigstens bis zu diesem schützenden Camp vorgedrungen waren.
Lange würde das Camp aber der indianischen Übermacht keinen Schutz mehr bieten können. Wenn wir auch die Gegend kannten und damit als Scouts den Eingeschlossenen im Falle eines Ausbruchs helfen würden ... im Augenblick steckten wir alle in dieser Falle, und es sah nicht so aus, als sollte es eine günstige Gelegenheit zum Ausbruch geben.
Wie schlimm die Lage aber schon war, hörte ich, als die Indianer vorerst ihren Angriff einstellten und sich in den schützenden Wald zurückzogen.
Der bullige Mann, der mir über die Palisaden geholfen hatte, sagte es in einem einzigen Satz:
„Ihr beide seid uns vielleicht eine Hilfe, glaube ich, aber ihr seid auch, verdammt noch mal, zwei Esser mehr.“
Er blickte mich besorgt an. Im Schein einer am Boden harmlos verbrennenden Brandfackel sah ich sein breites bärtiges Gesicht. Es erinnerte mich an einen Bernhardiner, und die Augen sahen mich genauso traurig an.
*
Sie trugen weitrandige Hüte mit flachem Kopf. Die Krempe war wie bei den Hüten der Kansas-Cowboys geschwungen. Ihre Mäntel reichten fast bis zum Boden. Es waren Männer, deren hornige Hände bewiesen, dass sie arbeiten konnten.
Ihre Frauen trugen schwarze Kleider mit blauen Schürzen; das Haar hatten sie zu straffen Knoten gebunden, und darüber wanden sie blaue oder schwarze Wolltücher, unter denen sich weiße Kopftücher befanden. Alle wirkten sehr sauber. Hier in diesem Camp gehörte zu solcher Körperhygiene viel, denn es gab kein Wasser. Eis musste im Feuer aufgetaut werden. Der Brunnen war zugefroren, und zum Fluss war es zu weit. Zwischen ihm und dem Camp lauerten die Indianer hinter den Büschen, die am Ufer standen. Der Wald war einmal zum Fluss hin weggeschlagen worden, musste wohl im Lauf der Jahre, die dieses Camp bedeutungslos gewesen war, nachgewachsen sein. Zwar standen keine hohen Bäume da, aber verfilztes Unterholz, das keine Übersicht bot. Nur direkt vor den Palisaden war dieses Unterholz gerodet, und es sah aus, als hätte das jemand erst vor kurzem getan.
Es wimmelte im Camp von Kindern. Sie waren trotz aller traurigen Zukunftsaussichten absolut keine bedauernswerten Wesen. Die Eltern kümmerten sich sehr um ihre Kinder, lebten praktisch für sie und gaben ihnen eine Nestwärme, die ich als Kind nie bekommen hatte.
Ihre Familien waren groß. Manche Eltern hatten bis zu zehn Kindern. Und es gab Halbwüchsige wie auch Babys.
Vier Tote hatten sie seit der Belagerung. Drei Männer und eine Frau lagen verletzt im einzigen wirklich noch ganz erhaltenen Blockhaus, dessen Dach auch bei eventuell einsetzendem Tauwetter dicht bleiben würde.
Einer der Verletzten war ohne jede Hoffnung; er wusste, dass ihm niemand mehr helfen konnte ... dennoch halfen ihm die Frauen, die sich um die Verletzten kümmerten. Sie gaben ihm von dem, was sie hatten, das beste Essen, obgleich er ganz sicher keine Woche mehr leben würde.
Sie alle waren bis auf die drei noch lebenden Soldaten Quäker. Sie nannten sich selbst Gesellschaft der Freunde, und sie waren das auch. Richtige hilfreiche gute Freunde. Das Wort Quäker (Zitterer) empfanden sie dennoch nicht als Schimpfname.
Sie waren gegen den Eid, den Militärdienst, den Krieg, den Kampf mit der Waffe, sie tauften keine Kinder, sondern nur Erwachsene, und sie lehnten einige kirchliche Zeremonien wie das Abendmahl kategorisch ab. Aber sie waren sehr gläubige Christen.
Es wurde bei ihnen nicht getanzt, und sie waren überhaupt gegen alle Lustbarkeiten, und trotzdem fand ich, dass sie sehr fröhliche Menschen sein konnten.
Als es Tag geworden war nach dieser nächtlichen Schießerei, konnte ich das Lager übersehen. Mir erschien es als ein Wunder, dass sie sich bis jetzt hatten halten können.
Ihre Wagen standen zur Wagenburg aufgefahren um die drei noch intakten Blockhäuser herum. Offenbar wohnten die meisten der Familien nach wie vor in ihren Wagen.
Im Inneren der Wagenburg, also zwischen den Blockhäusern, standen ihre Zugtiere. Ich sah mit einem Blick, dass es kaum mehr so viele waren, um mehr als sechs oder sieben Wagen damit ziehen zu können. Offenbar hatten sie einige der Ochsen schon geschlachtet und von ihrem Fleisch gelebt.
Binding und ich wurden ihrem Ältesten vorgestellt. Der Älteste war ein Patriarch, der die absolute Befehlsgewalt über sie alle besaß. Das sagte uns auf dem Weg zu ihm jener bullige Bursche, durch dessen Hilfe ich über die Palisaden gekommen war.
Dieser Älteste erwartete Binding und mich in einer der Holzhütten, und im gleichen Raum waren die wichtigsten Vorräte der Quäkersippe aufgestapelt. Zwei kräftige junge Männer unterstützten den Ältesten beim Bewachen dieser Nahrungsmittel.
Er war ein mittelgroßer, sehr breitschultriger Mann mit langem weißem Bart, buschigen dunklen Augenbrauen und ansonsten absolut so gekleidet wie die meisten der Männer: breitkrempiger Hut, langer Mantel.
Er strahlte eine Würde aus, die mich beeindruckte. Binding grüßte sogar, als stünde er seinem leibhaftigen General gegenüber.
Der Alte - ich schätzte ihn auf mindestens siebzig Jahre - nickte huldvoll und deutete auf ein paar Baumstammrollen, die etwa Stuhlhöhe hatten und Stühle wohl ersetzen sollten, wie das hier in der Wildnis oft der Fall war. Der runde Tisch in der Mitte war aus Wagenbrettern gebaut und stammte ganz sicher noch aus der Zeit, da dieses Camp militärisch genutzt worden war.
Herzstück des Hauses war der alte, aus Felssteinen gebaute Ofen. Er befand sich in der Mitte und spendete ein wenig Wärme.
Als ich darauf sah, sagte der Patriarch: „Wir können hier wegen der Lebensmittel nicht viel heizen. Außerdem ist Brennstoff knapp.“