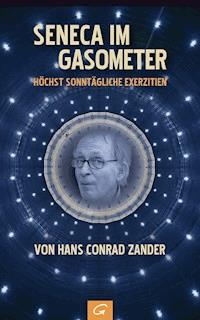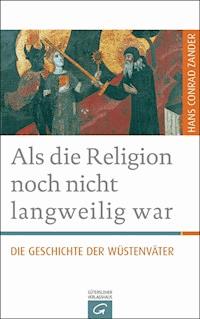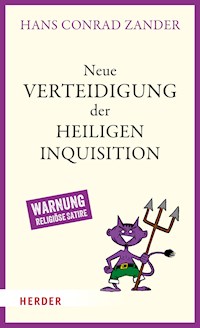Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonifatius Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt auch in der Religion so etwas wie Stimmung. Die katholische Stimmung aber ist derzeit so schlecht wie nie zuvor. Hans Conrad Zander hält dem ein katholisches Selbstverständnis entgegen, das nach dem Vorbild Dantes die Religion als Divina Commedia versteht, als ein Schauspiel von hinreißendem, ja göttlichem Unterhaltungswert. Um einem Irrtum vorzubeugen: Zanders gute Laune entspringt nicht etwa der vielstrapazierten "Fröhlichkeit im Herrn", sondern im Gegenteil einer dem jüdischen Humor angelehnten "selbstironischen Katholizität". Von den dreißig Geschichten sind fünfzehn dem vergriffenen Band "Warum waren die Mönche so dick?" entnommen und sorgfältig überarbeitet. Zu diesen klassischen Geschichten hinzugefügt sind fünfzehn neue, bisher ungedruckte Texte aus der WDR-Serie "Zeitzeichen". "Nicht wenige Bücher von Hans Conrad Zander habe ich begleitet. Doch keines scheint mir so dringend nötig wie dieses." Thomas Schmitz, Herausgeber
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS CONRAD ZANDER
Warum es so schwierig ist,in die Hölle zu kommen
Himmlische Komödienaus der Geschichte der Religion
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Covergestaltung: Weiss Werkstatt München,www.werkstattmuenchen.com
Covermotiv: © gettyimages/ilbusca
eISBN 978-3-89710-958-2
© 2021 by Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Druck: cpi-print.de
Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn
Notiz des Herausgebers
Nicht wenige Bücher von Hans Conrad Zander habe ich begleitet. Doch keines scheint mir so dringend nötig wie dieses. Denn es gibt auch in der Religion so etwas wie Stimmung. Die katholische Stimmung aber ist derzeit so schlecht wie nie zuvor. Hans Conrad Zander hält dem ein katholisches Selbstverständnis entgegen, das nach dem Vorbild Dantes die Religion als Divina Commedia versteht, als ein Schauspiel von hinreißendem, ja göttlichem Unterhaltungswert. Um einem Irrtum vorzubeugen: Zanders gute Laune entspringt nicht etwa der vielstrapazierten „Fröhlichkeit im Herrn“, sondern im Gegenteil einer „selbstironischen Katholizität“, die sich die jüdische Selbstironie zum Vorbild nimmt. Von den dreißig Geschichten zur Geschichte der Religion, die dieses Buch vorstellt, sind fünfzehn dem vergriffenen Band „Warum waren die Mönche so dick?“ entnommen und sorgfältig überarbeitet. Zu diesen klassischen Geschichten hinzugefügt sind fünfzehn neue, bisher ungedruckte Texte aus der WDR-Serie „Zeitzeichen“.
Thomas Schmitz
Inhalt
I. Statt eines Vorworts ein Wort vor dem Tor zur Hölle
Worin uns Dante die böse Überraschung beschert, dass es unendlich schwierig ist, in die Hölle zu kommen.
II. Himmlische Momente der katholischen Antike
Wie die heilige Paula den Zölibat erfand
Worin wir den heiligen Hieronymus näher kennen lernen.
Die Versuchungen des heiligen Antonius
Worin wir lernen, wovor ein echter Mann die Flucht ergreifen soll.
Kassian in der Wüste
Worin wir eine dynamische Methode der Keuschheit kennen lernen.
Wie das kleine Zirkusmädchen Theodora eine mächtige Heilige wurde
Worin Frauen lernen, wie frau den Papst absetzen kann.
„Adieu in alle Ewigkeit, mi Cicero!“
Worin wir von Petrarca lernen, wie man alte weiße Männer kulturell cancelt.
Gregor der Große und die ewige katholische Krise
Worin wir erfahren, wie die schlimmste aller katholischen Krisen in himmlischer Schönheit endete.
III. Himmlische Momente des katholischen Mittelalters
Bruder Franz und Schwester Armut
Worin wir lernen, unsere Vorurteile gegen die Heilige Inquisition zu überwinden.
Johannes Calvin und Schwester Reichtum
Worin wir lernen, unsere Vorurteile gegen die Schweiz abzubauen.
Rechnen konnte Luther nicht
Worin wir lernen, wie der Bettelmönch Martin zum reichsten Mann von Wittenberg wurde.
Der Computer des heiligen Dominikus
Worin wir lernen, digital zu beten.
Wie der kleine Knabe Heinrich Seuse ein großer Mystiker wurde.
Worin wir den himmlischen Patron der LGBTX-Christ*innen lieben lernen.
Katharina von Siena und drei Päpste auf einmal
Worin wir der Versuchung widerstehen, uns über empörte Jungfrauen zu empören.
Die Unfälle der heiligen Franziska von Rom
Worin Frauen Autofahren lernen.
Vom grässlichen Chaos des heiligen Gallus zur schöpferischen Ordnung des heiligen Otmar
Worin es uns gelingt, das Gesetz der katholischen Dekadenz zu widerlegen.
IV. Himmlische Momente der katholischen Neuzeit, sinnvoll ergänzt durch nicht weniger himmlische evangelische Momente
Francis Drake hinter einem Kaktus in Panama
Worin wir den ökumenischen Dialog wärmstens empfehlen.
Der heilige Ignatius von Loyola auf dem Örtchen
Worin wir lernen, dem absoluten Chef aufs Wörtchen zu gehorchen.
Franz Xaver auf den Molukken
Worin wir lernen, Heiden gar nicht erst zu missionieren.
Wie der katholische Terrorist Guy Fawkes den König von England in die Luft sprengen wollte
Worin wir lernen, die Friedfertigen selig zu preisen.
Kaiser Karl V in tiefer Einsamkeit
Worin wir lernen, dass ein kleiner Finger wichtiger ist als ein Weltreich.
Papst Pius V und die Schokolade
Worin wir fasten lernen.
Wie Robinson Crusoe sich nach dem Zölibat sehnte.
Worin wir die unendliche Einsamkeit der protestantischen Seele kennen und verstehen lernen.
Pastor Hans Egedes norwegische Irrfahrt nach Grönland
Worin wir erfahren, dass die alten Wikinger stockkatholisch waren.
Die Nerven der heiligen Theresia
Worin wir lernen, ohne Psychotherapie selig zu werden.
Ninon de Lenclos und das Evangelium nach Lukas
Worin wir uns für die Lebensbeichte der verführerischsten Frau von Paris interessieren.
Madame de Maintenon mit Ludwig XIV auf dem Betschemel
Worin wir Zeugen werden, wie ein Bettlermädchen den Sonnenkönig um den frommen Finger wickelte.
„Ich bin weder Jüdin noch Christin. Ich bin römisch-katholisch.“
Worin wir hautnah erleben, wie die Ermordung des Erzbischofs von Paris in Sarah Bernhardt den Sinn fürs Tragische weckte.
David Hume in allen Bars von Edinburgh
Worin uns klar wird, wie ein Atheist zum Heiligen werden konnte.
Wie Dominique Pire zum Nobelpreis kam
Worin wir am Stelldichein zwischen einem parfümierten Mönch und einer linksradikalen Königinmutter verständnisvoll teilnehmen.
V. Statt eines Nachworts
Noch reitet der heilige Bernhard
Worin wir die Komik der Religion lieben lernen.
I. Statt eines Vorworts ein Wort vor dem Tor zur Hölle
Worin uns Dante die böse Überraschung beschert, dass es unendlich schwierig ist, in die Hölle zu kommen.
Kommt einer heute zu dir und behauptet, er habe Dante gelesen, die „Göttliche Komödie“, Hölle, Fegfeuer, Himmel, alle drei Bände gelesen, dann glaub´s ihm besser nicht. Nicht einmal mir brauchst du das zu glauben. Dabei steht die „Göttliche Komödie“ seit mehr als fünfzig Jahren unmittelbar neben meinem Schreibtisch. Und wie viel habe ich schon geschrieben über dieses größte Meisterwerk der italienischen Literatur. Greife ich aber heute zu allen drei Bänden, so fällt mir etwas Bestürzendes auf. Hier zuerst Band I, das Inferno, der Umschlag längst zerrissen, der Schnitt abgegriffen und grau verschmutzt, auf allen Seiten Fingerspuren, das ganze Buch zerlesen. Jetzt aber Band III, das Paradiso, der Himmel: der Schnitt noch immer blütenweiß, Lesespuren kaum zu finden. Jeder Antiquar würde mein Exemplar von Dantes Himmel anbieten als „wie neu“.
So geht es nicht nur mir, sondern fast allen. Selbst theologische Kommentare besprechen Dantes Himmel nur lustlos kurz. Das Inferno dagegen hat sie alle fasziniert.
„Am Rande erst des schmerzenvollen Tales, das widerhallt von Klagen ohne Ende“, fallen wir schon mit Dante vor Schreck in Ohnmacht, „den Geist von Schweiß gebadet“. Wieder zu Sinnen kommen wir im zweiten Höllenschlund. Mit schrillen Schreien „Gottes Macht verfluchend“ büßt hier in ewiger Qual die ruchloseste aller Frauen: die lüsterne Kleopatra (hundert Männer in einer Nacht). Ein rasender Orkan wirbelt sie herum, uns wirbelt er hinab in den dritten Höllenkreis, wo sich die schlimmen Schlemmer schlammbedeckt in einem ewigen Eisregen stöhnend wälzen.
Unerträgliches Gedränge aber herrscht im vierten Schmerzensschlund, wo jene büßen, die auf Erden dem Prinzip „Geiz ist geil“ gehuldigt haben. Päpste, Kardinäle, Bischöfe, Mönche müssen wir hier in großer Zahl treffen.
Im fünften Höllenkreis büßen die Zornigen, in alle Ewigkeit „sich Stück um Stück zerfleischend mit den Zähnen“.
Alles nur Vorspiel. Über das „Wasser des Grauens“, den Höllenstrom Styx, fahren wir zum Tor der Inneren Hölle. Rot vom ewigen Feuer, das drinnen glüht, leuchten ihre gewaltigen Mauern. Tausend Teufel wachen auf ihren Zinnen. Und wer dort bewacht das Tor zur inneren Hölle? O Gott, es ist die Furie Medusa:
„Den blutgefärbten Leib umgürteten
Grasgrüne Wasserschlangen und ihr Haar
War gift´ge Natternbrut.“
Medusas Blick allein genügt, um einen Mann zu Stein erstarren zu lassen. Ein Engel Gottes muss uns vor ihr schützen. Und weiter geht es abwärts in den finsteren Trichter des sechsten Höllenschlundes, wo in Flammengräbern, lodernd ewiglich, die Ketzer brennen.
Und jetzt, noch schauriger, der siebte Höllenkreis. Da brodelt die „riviera del sangue“:
„Ein Strom von Blut, in dem gesotten werden,Die mit Gewalt an andern sich vergangen.“
Dann beginnt selbst Dante zu stöhnen:
„Di nuova pena mi convien far versi.
Von neuen Qualen muss ich dichten.“
Von den skandalösen Päpsten muss er dichten, die im achten Höllenkreis tief in Flammenlöchern stecken.
Rasch eilen wir vorbei an all den Betrügern, Schwindlern, Fälschern, die Oberteufel Malatesta, einen nach dem andern, in siedendes Pech taucht, und dann an riesigen Spießen brät.
Ganz anders ergeht es im neunten Höllenkreis jenen italienischen Politikern, die Dante aus Florenz verjagt und zum heimatlos umherirrenden Flüchtling gemacht haben. In einem Eismeer sind sie bis zum Schädel eingefroren.
Und immer kälter wird es, je weiter wir abwärts steigen, bis in den alleruntersten, den zehnten Höllenschlund. Da hockt im ewigen Eis, als tiefgefrorener Moloch, der Satan selbst. Aus dem Eis ragen nur seine drei Mäuler. Mit blutgemischtem Geifer zermalmen sie die drei schlimmsten Verräter der Menschheit: Brutus, Cassius und Judas.
Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Raus aus der innersten Hölle? Dante hat die Erde keineswegs für eine Scheibe gehalten, sondern für eine Kugel. Durch einen Spalt, der von der Satanshölle hinaufführt zur südlichen, damals noch unerforschten Hälfte des Globus, steigt Dante, geführt von dem antiken Dichter Vergil, empor.
„Dann traten wir hinaus und sahn die Sterne.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.“
Dies ist, ganz leise, sotto voce, gesprochen, der schönste Vers der Göttlichen Komödie. Und es ist ihr wahrer Schluss. Zu Ende ist das höllische Abenteuer. Was kann jetzt noch kommen?
Es kommt Band II, das Purgatorio, der Berg der Läuterung für jene, die noch ein Weilchen büßen müssen, bevor sie aufsteigen dürfen in den Himmel. Kein deutsches „Fegefeuer“ ist das. In sanften Pastellfarben malt Dante das Purgatorio, so langweilig wie die Empfangshalle eines amerikanischen First-Class-Hotels.
Und erst Band III: der Himmel! Da wird nur noch gesungen. Lauter Chöre reiner Jungfrauen singen himmlische Choräle. Singen ist gewiss schön. Aber immerdar nur singen, das ist so tödlich langweilig, dass es selbst Dantes Führerin im Himmel, die edle Beatrice, auf die Dauer nicht aushält. Wenn sie aber mit Singen innehält, dann fängt sie leider an zu predigen. Vor ihrem schmachtenden Bewunderer Dante hält sie unverständliche Predigten, mal über das Wesen des himmlischen Lichts, mal über die Natur der Engel. Welcher Leser sehnt sich da nicht in die Hölle, zu Kleopatra, zurück?
Es gilt jetzt, einen Verdacht auszuräumen. Dante Alighieri ist im Jahr 1265 geboren. Wenn dieser Italiener des 13. Jahrhunderts die Hölle so viel packender inszeniert als den Himmel, tut er dies etwa, um seine Zeitgenossen mit Höllenängsten der katholischen Kirche gefügig zu machen?
Diese Vermutung ist politisch korrekt, aber sachlich falsch. Wie so viele Katholiken damals und heute war Dante zwar katholisch, aber antiklerikal. In seiner Hölle winden sich Päpste, Bischöfe, Mönche ohne Zahl. Im ganzen Paradiso dagegen stoßen wir lediglich auf vier Päpste. Es sind die ersten Päpste nach Petrus, die noch als Märtyrer gestorben sind. Mit schlimmen Vorwürfen überschütten sie ihre späteren Nachfolger auf dem Stuhl Petri. Schlimmer noch wird es, wenn Dante einen Blick hinabwirft in das irdische Rom seiner Tage. Da erscheint ihm die katholische Kirche als nackte babylonische Hure. Poetische Propaganda für den machtlüsternen Klerus ist das nicht.
Drei Jahrhunderte nach Dante hat der größte protestantische Dichter gelebt: John Milton, der blinde englische Homer. „Paradise lost“, „das verlorene Paradies“, heißt sein grandioses Epos, das zumindest an Dramatik Dante übertrifft. Warum? Weil Milton dem Teufel nicht erst am Ende eines langen Abstiegs in die Hölle begegnet. Bei ihm fängt die Handlung zuallerunterst in der Hölle an. Und viel eindrucksvoller, viel achtenswerter als bei Dante ist in Miltons calvinistischem Gesang der Teufel. Ein kosmischer Revolutionär ist das, der furchtlos immer wieder aufsteht gegen „die Tyrannei des Himmels“. Auf seinen schwarzen Schwingen trägt uns Miltons Satan durch ein chaotisch finsteres Universum von Abenteuer zu Abenteuer.
Doch dann kommt der Augenblick, in dem der Teufel die Regie über Miltons Geschichte verliert. Die Menschheit wird erlöst, und sofort sinkt das Epos ab in die Langeweile einer protestantischen Bibelstunde.
Noch mehr klassische Langeweile gefällig? Verglichen mit dem Satan bei Dante und bei Milton ist Goethes Mephisto eine fast harmlose Spielfigur. Und doch können wir es schon im „Prolog im Himmel“ kaum erwarten, dass endlich Mephisto auftritt und in den Tiefsinn teuflische Action bringt. Selbst in der zunehmenden Langeweile von Faust II sorgt er immer noch für Spannung. Etwa wenn er den vertrockneten Gelehrten Faust verkuppelt mit der ruchlos schönen Helena. Bis dann Faust, statt mit Mephisto vertragsgemäß zur Hölle zu fahren, an Gretchens frommen Rockschößen entschwebt in die ewige Langeweile des „Ewig-Weiblichen“.
Keiner hat in unseren Tagen so leidenschaftlich gegen die Hölle gekämpft wie der katholische Theologe Herbert Vorgrimler aus Münster. Um dem gläubigen Volk den Teufelsglauben vollends auszutreiben, hat er ein Buch von fast fünfhundert Seiten geschrieben. Doch der dicke theologische Wälzer ist so spannend zu lesen wie ein Kriminalroman. Dann freilich, wohl aus Gründen der Symmetrie, hat Vorgrimler noch ein ähnlich dickes Buch über den Himmel geschrieben. Es ist ihm arg misslungen. Aus jeder Zeile spricht die Unlust, mit welcher selbst ein Theologe sich beim Gedanken an den Himmel quält. Woran das liegen mag?
Hat vielleicht Immanuel Kant recht mit seiner Vermutung, dass jeder Mensch, auf dem Grund seiner Seele, ein „radical Böses“ in sich trägt? Hat der Apostel Paulus recht, wenn er im 2. Brief an die Thessalonicher die Macht des Bösen in uns beklagt? Eine wirkliche Erklärung findet der Apostel allerdings nicht. Sein verworrener Gedankengang erschöpft sich in der Rede vom „mysterium iniquitatis“, vom „Geheimnis des Bösen“. Gar viele Geheimnisse hat die Religion. Doch keines zieht offenbar so viele so geheimnisvoll an wie das „Geheimnis des Bösen“.
Es ist jetzt Zeit für eine Warnung. So mancher hat ja schon geprahlt, er habe vor der Hölle keine Angst, wenn er denn müsse, wolle er da gern hinein. Da seien schließlich alle interessanten Leute. So ein Aufschneider beweist nur eines: dass er nicht einmal den Anfang von Dantes Inferno gelesen hat. Dort, noch vor dem Abstieg zu den Verdammten, hat Dante etwas erlebt, was an Beklemmung die Hölle übertrifft.
„In sternenloser Finsternis“, unmittelbar vor dem Höllentor, treiben Menschen ohne Zahl jammervoll im Kreise, „wie Sand gejagt in einem Wirbelsturme“. Das sind, schreibt Dante, „die lauen Seelen“. Menschen, die sich im Leben nie für etwas eingesetzt haben, weder für das Gute, noch für das Böse. Immerzu waren sie nur darauf bedacht, sich zum eigenen Vorteil aus allem Streit der Welt schlau herauszuhalten. Jetzt, im Jenseits, irren die „lauen Seelen“ ewig heimatlos herum. „Der Himmel“, sagt Dante wörtlich, „will sich nicht mit ihnen schänden.“ Doch auch den Teufel ekelt´s vor solchen Menschen so, dass er vor ihnen das Höllentor zuschlägt. Mit wilden Schmerzenslauten, bald gellend, bald heiser, betteln sie verzweifelt, vergeblich um Einlass.
Dies ist die Gefahr, die allzu viele Menschen verkennen: nicht, dass sie in die Hölle müssen, sondern, im Gegenteil, dass sie niemals hineindürfen in die Hölle.
Mein Rat an alle, die keine Chance haben, selber in die Hölle zu kommen: Lest Dante. Lest die „Göttliche Komödie“. Aber nur den ersten Band. Nur das Inferno. Dreiunddreißig Gesänge voll höllischer Phantasie, jedoch gefasst in so himmlisch schöne Verse, wie sie kein anderer jemals schrieb:
„Lasciate ogni speranza – Trittst du hier ein, lass alle Hoffnung fahren!“
II. Himmlische Momente der katholischen Antike
Wie die heilige Paula den Zölibat erfand
Worin wir den heiligen Hieronymus näher kennen lernen.
Ungeheuer war, anno 385, die Aufregung in Rom. Auf den Straßen tobten die Heiden, in den Kirchen tobten die Christen. Ganz Rom schien zu toben gegen einen einzigen Mann. Ich spreche seinen Namen mit Ehrfurcht aus: Eusebius Sophronius Hieronymus.
Der heilige Hieronymus gilt heute als der größte Gelehrte der späten Antike. Als „Kirchenvater“ und als „Kirchenlehrer“ verehren wir ihn. Als einer der größten Heiligen des Altertums wird er auf allen Altären der katholischen Welt gefeiert. Warum dann trat im August 385 eigens ein römisches Konzil zusammen, um einen so großen Heiligen mit Schimpf und Schande aus der Heiligen Stadt zu verbannen?
Das liegt daran, dass der heilige Hieronymus, mitten in Rom, eine Sache vertreten hat, die wenig Freunde kennt. Wenig Freunde unter den Heiden, wenig Freunde, ach, auch unter den Christen. Der heilige Hieronymus war ein leidenschaftlicher Prediger der Keuschheit. In die Kirchengeschichte ist er eingegangen als Apostel des Zölibats.
Freilich wissen wir aus der feministischen Theologie, dass überall dort, wo ein Mann als Heiliger verehrt wird, das wirkliche Verdienst einer heiligen Frau zukommt, die zu Unrecht in seinem Schatten stand. Betrachten wir die römischen Kampfjahre des heiligen Hieronymus unter diesem feministischen Gesichtspunkt, so fällt etwas Verblüffendes auf: Im Schatten dieses großen Zölibatsapostels hat nicht etwa nur eine Frau gestanden, sondern eine ganze Frauenbewegung.
Die heilige Marcella und die heilige Lea, die heilige Albina und die heilige Principia, die heilige Blaesilla und die heilige Asella, die heilige Praetextata und die heilige Fabiola, die heilige Titiana und die heilige Furia – nicht irgendwelche Betschwestern waren das um den heiligen Hieronymus, sondern die reichsten, die mächtigsten, die gebildetsten Frauen von Rom. Doch keine war so reich, so mächtig, so gebildet wie die Frau, die im gemeinsamen Kampf für den Zölibat zu seiner Lebensgefährtin werden sollte. Das ist die heilige Paula.
Aus dem Geschlecht der Scipionen und der Gracchen stammte Paula. In dieser unerhört tapferen und intelligenten Frau, so urteilt Montalembert, hat sich der Geist der römischen Republik ein letztes Mal verkörpert. Was konnte eine Frau von solchem Format, von solchem Reichtum bewegen, einen Keuschheitsprediger zu betreuen, einen Zölibatsapostel zu finanzieren?
Wer eine Antwort auf diese Frage sucht, der fahre nach Pompeji und schaue sich dort mit eigenen Augen in der späten Antike um. Sex von oben, Sex von unten, Sex von vorne, Sex von hinten, an allen Wänden nichts als Sex. Kitschiger Sex, ordinärer Sex – was auffällt, ist der schlechte Geschmack, die billige Aufdringlichkeit all dieser Fresken und Graffiti. Der berühmte „Phallus auf der Waage“ zum Beispiel ist bestenfalls eine Illustration zur These des Erasmus von Rotterdam, dass der Penis das „dümmste aller Glieder“ des Menschen sei.
Nicht an den Orgien eines Nero, nicht an den Ausschweifungen eines Caligula ist Rom zugrunde gegangen. Viel unerträglicher war jener banale sexuelle Alltag der späten Antike, wie er in Pompeji anschaulich erhalten ist: dieser geistlose Konformismus allgemeiner Sexgläubigkeit, diese grinsende Allgegenwart des Ordinären, diese spießige Normalität des Obszönen, für die britische Historiker den Begriff „lascivious rectitude“ geprägt haben. Das heißt auf Deutsch „Geilheits-Konformismus“.
Die meisten Frauen mussten sich das gefallen lassen. Aber nicht alle. Nicht die Frauen, die finanziell unabhängig waren. Das waren die unverheirateten Frauen mit Geld, vor allem die steinreichen Witwen aus dem römischen Patriziat. Wie zum Beispiel Marcella und Paula.
Maßlos war die Erbitterung dieser Frauen aus den großen alten republikanischen Familien. Der Niedergang Roms in der politischen Diktatur und im Konformismus der Sexgläubigkeit, in ihren Augen war es ein und dasselbe. Rom war verkommen zur „cloaca maxima“. Und es gab keine Rückkehr zur alten römischen Familienordnung. Es gab nur den großen Sprung nach vorn. Ins Christentum. In die Keuschheit.
Simone de Beauvoir hat einmal gesagt, für die moderne Frauenbewegung gebe es in der Vergangenheit kein anderes Vorbild als die reichen Frauen. Nur reiche Frauen nämlich konnten sich, früher schon, die Selbstbestimmung leisten. Im Palast der heiligen Marcella auf dem Aventin, im römischen Stadt-Salon der heiligen Paula beginnt die Emanzipationsbewegung des 4. Jahrhunderts, die Frauenbewegung für Keuschheit und Zölibat.
Was die reichen Witwen vormachten, das machten bald die reichen Töchter nach. Bei den Christen waren sie, wenn sie das Gelübde der Jungfräulichkeit ablegten, hochgeachtet. Gleichzeitig behielten sie, weil keinem Manne untertan, die Verfügung über ihr Geld.
Die kleine Schar der Männer, die mit diesen Frauen gemeinsame Sache machten, war von anderem Schlag. In heutige Begriffe übertragen war der heilige Hieronymus der führende Kopf unter den römischen Linksintellektuellen.
Was ist ein Linksintellektueller? Das ist ein Mann, der mit allen andern Streit hat, weil er gegen das Böse kämpft, an dem die andern schuld sind. Bös ist zum Beispiel die Umweltverschmutzung. Im 4. Jahrhundert gab es leider noch keine Umweltverschmutzung. Was ein rechter Linksintellektueller war, der kämpfte, ersatzweise, gegen die moralische Umweltverschmutzung und machte, wie der heilige Hieronymus, als Keuschheitsapostel intellektuelle Karriere.
Es war ein kleiner Unterschied zwischen der heiligen Paula und dem heiligen Hieronymus, wenn sie ihn in ihrem eleganten römischen Salon empfing: Sie, die hochgebildete, reiche Erbin Scipios, er, der intellektuelle Emporkömmling aus der dalmatinischen Provinz, von so obskurer Herkunft, dass die Angaben über seine Geburt um fünfzehn Jahre auseinanderklaffen. Sie war die römische domina, die hohe Lady, die ihm ihr Ohr gnädig neigte, die ihn förderte, ihn zum großen Keuschheitsapostel aufbaute. Und der es doch im Jahr 385 nicht gelang, ihn vor den empörten Machos zu schützen und seine Abschiebung aus Rom zu verhindern.
Was jetzt beginnt, ist eines der klassischen Motive der abendländischen Malerei: Hieronymus ganz allein im Exil zu Bethlehem. Hieronymus der Einsiedler, versunken ins Studium und ins Gebet. „Hieronymus im Gehäuse“, so haben sich das die Maler später vorgestellt. So hatte sich das wohl auch der heilige Hieronymus selber vorgestellt, als er aus Rom nach Bethlehem floh. Doch er hatte, nicht ganz zufällig, seine zölibatäre Rechnung ohne die Frauen gemacht.
Während sich nämlich der heilige Hieronymus in seinem Gehäuse in Bethlehem gemütlich einrichtete, froh, den ganzen Tag Zeit und Ruhe zu haben fürs Schreiben, herrschte daheim in Rom, im Salon der heiligen Paula, die größte Unruhe: War es nicht verantwortungslos gewesen, den heiligen Hieronymus allein abreisen zu lassen? Würde er zurechtkommen, ein hilfloser Intellektueller wie er, einsam im Exil?
Alsbald stach ein Schiff in See. An Bord Hunderte von Jungfrauen und Witwen aus den vornehmsten Kreisen. Die gesamte römische Frauenbewegung war aufgebrochen. Auf der Kommandobrücke, samt ihren Töchtern Eustochia und Blaesilla, die heilige Paula. Auf zum heiligen Hieronymus!
Hieronymus hatte sich in Bethlehem niedergelassen, um die gesamte Heilige Schrift aus dem Hebräischen und dem Griechischen ins Latein zu übersetzen. Diese Übersetzung, die „Vulgata“, hat er auch vollendet. Moderne Exegeten freilich lassen an der Bibel des heiligen Hieronymus kein gutes Haar. Die Übersetzung sei voll von Schludrigkeiten, von Auslassungen, von krassen Fehlern.
Wen wundert das? Während Hieronymus die Bibel übersetzte, herrschte, rings um sein Gehäuse, nicht himmlische Ruhe, sondern höllischer Baulärm. Nach kurzem Augenschein in Bethlehem war die heilige Paula nämlich zu dem Schluss gekommen, dass der große Zölibatsapostel zu unselbständig sei, um allein im Exil zu leben. Dass er der Betreuung bedurfte. Und sie begann zu bauen.
Nach ihrem Prinzip „Geld spielt keine Rolle“ stampfte die heilige Paula drei große Frauenklöster aus dem Sand, die das winzige Gehäuse des heiligen Hieronymus von allen Seiten machtvoll umwallten. Sogar so etwas wie ein antikes Telefon, oder besser: eine antike Faxverbindung, installierte die heilige Paula, nämlich einen stündlichen Kurierdienst zwischen ihrer eigenen Zelle und dem Gehäuse des heiligen Hieronymus. Stündlich von der heiligen Paula inspiriert, stündlich von ihr gemanagt, schrieb der heilige Hieronymus fortan einen Traktat „De Virginitate“ („Über die Keuschheit“) nach dem andern. Finanziert von der heiligen Paula überfluteten seine Streitschriften für den Zölibat aus Bethlehem das Römische Reich.
Es ist jetzt wichtig zu wissen, dass es im Altertum einen blühenden Bildungstourismus gab. Zur Bildung eines jungen Römers gehörte eine Reise nach Ägypten. Vor allem für höhere Töchter aus gutem Hause war Ägypten ein kulturelles Muss.
Plötzlich war eine Bildungsreise nach Ägypten nicht mehr denkbar ohne einen frommen Abstecher nach Bethlehem. Hieronymus selber beschreibt das ungeheure Gewimmel suchender junger Menschen, die bald danach aus dem ganzen Imperium in Bethlehem zusammenströmten. Als wäre es das Taizé der Antike.
Genau wie heute in Taizé um Frère Alois, genauso andächtig saßen die jungen Christinnen und Christen in Bethlehem dem heiligen Hieronymus zu Füßen. Und wenn abends die Lagerfeuer aufloderten, stiegen aus unzähligen Kehlen die Lieder der neuen Jugendbewegung zum Himmel. Es müssen, nach italienischen Forschungen, mehrere tausend gewesen sein, die wie Schlager ums Mittelmeer gingen, begeistert von Mund zu Mund: Lieder vom Zölibat und von der Jungfräulichkeit – Lieder von Jesus, dem ersten keuschen Mann: „Jesu, corona virginum …“.
Ob solchen Klängen verging den spätantiken Machos, daheim in Rom, Hören und Sehen. Mit ein paar linken Intellektuellen waren sie leicht fertiggeworden, mit einer Frauenbewegung zur Not auch. Mit einer Jugendbewegung aus Bethlehem aber hatte keiner gerechnet. Eine Jugendbewegung für Keuschheit und Zölibat, das war zu viel. Zuerst kippte die öffentliche Meinung in Alexandrien. Dann kippte sie in Rom selbst. Am 30. September 419, als der heilige Hieronymus in seinem Gehäuse zu Bethlehem steinalt starb, hatte die cloaca maxima am Tiber sich geläutert zum Jungbrunnen des Zölibats.
Der Triumph des heiligen Hieronymus, der Triumph der christlichen Keuschheit gilt als eine der erstaunlichsten Umwälzungen der europäischen Kulturgeschichte. Und doch könne man sich in diesem Falle alle komplizierten Erklärungen sparen, meint Havelock Ellis, der große englische Sexualforscher.
Der heilige Hieronymus hat gesiegt, weil er die stärkere Sache vertrat. So geistlos, meint Ellis, sei die Sexgläubigkeit der späten Antike gewesen, so abgestanden der ordinäre Konformismus der Schamlosigkeit, dass das Keuschheits-Experiment der heiligen Paula und des heiligen Hieronymus die Jugend anziehen musste mit dem unerhörten Reiz des Revolutionären. Nur deshalb, schreibt Ellis wörtlich, hat die Keuschheit aus Bethlehem Europa erobern können, weil ihr der Zauber eines neuen Erlebnisses eignete, einer herrlichen Freiheit und eines ungeahnten Abenteuers:
“If, indeed, it had not possessed the charm of a new sensation, of a delicious freedom, of an unknown adventure, it would never have conquered the European world.”
Die Versuchungen des heiligen Antonius
Worin wir lernen, wovor ein echter Mann die Flucht ergreifen soll.
Warum ist eigentlich der heilige Antonius in die Wüste geflohen? Kaum eine Frage scheint so müßig wie diese. Weiß doch jeder gebildete Christ: Der heilige Antonius ist in die Wüste geflohen, weil er Angst hatte vor den Frauen.
Wer das zu bezweifeln wagt, bekommt prompt den Vorwurf zu hören, er sei wohl noch nie in einem Museum gewesen. Haben doch Hunderte von Malern den heiligen Antonius alle gleich gemalt: wie er als Einsiedler, weit draußen in der Wüste Ägyptens, vergeblich Ruhe vor den Frauen sucht. Gerade dort, wohin kein Weib aus Fleisch und Blut sich je verirren würde, in jener äußersten Einsamkeit, plagen den heiligen Antonius, Tag und Nacht, betörende Trugbilder weiblicher Reize. Ihn plagt die eigene lüsterne Phantasie. O die „Versuchungen des heiligen Antonius”! Von Hieronymus Bosch bis zu Mathias Grünewald, von Salvador Dalí bis zu Max Ernst, sind sie eines der großen, klassischen Themen der europäischen Malerei.
Und doch beschleicht gerade den erfahrenen Freund der Schönen Künste angesichts so vieler so schön gemalter „Versuchungen des heiligen Antonius” ein leiser historischer Zweifel. Schließlich war Antonius der Einsiedler ein Ägypter des 3. Jahrhunderts; die unzähligen Maler, die uns seine erotischen Phantasien vorgemalt haben, sind alle mindestens tausend Jahre später in Europa zur Welt gekommen. Die Gnade der späten Geburt ist aber selten verbunden mit dem Sinn für die historische Wirklichkeit. Überdies leiden Maler vor der Staffelei oft an Langerweile. Dass sie dann selber heimgesucht werden von tausend lüsternen Phantasien, ist nicht weiter schlimm. Dass daraus dann doch schöne Heiligenbilder werden, ist sogar erfreulich. Aber sagt es auch nur irgendetwas aus über die historische Wirklichkeit?
Für das, was wirklich los war in der Einsiedelei des heiligen Antonius, gibt es einen einzigen zuverlässigen Augenzeugen. Das ist Athanasius von Alexandrien. Dieser hochgebildete Kirchenlehrer war mit dem berühmten Einsiedler persönlich befreundet. „Πολλακις”, schreibt er, „oftmals” habe er Antonius in seiner Eremitage zwischen Nil und Rotem Meer besucht. Und jedesmal sei er aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen.
Einen Einsiedler stellt man sich nämlich einsam vor. Der heilige Antonius aber war in seiner Einsiedelei alles andere als einsam. In Höhlen, Felsspalten, Erdlöchern und Hütten hausten, rings um Antonius, mehrere tausend Jünger. Ausdrücklich gebraucht Athanasius von Alexandrien in seiner Ortsbeschreibung das Wort „πολις”: eine regelrechte „Stadt von Jüngern” sei entstanden rund um den heiligen Antonius mitten in der Wüste.
Und dann die zweite Überraschung: Einen Jünger stellt man sich jung vor. Die Jünger des heiligen Antonius aber waren, in der großen Mehrheit, gestandene Männer. Auch bedeutende Männer. Was hatte sie hinausgetrieben in eine Landschaft, die im Alten Ägypten als tödlich galt?
Noch größer war die dritte Überraschung: Diese Männer, die in äußerster Entsagung draußen in der Wüste lebten, hatte sich Athanasius von Alexandrien genau so vorgestellt, wie wir sie uns vorstellen: abgezehrt und tieftraurig. Abgezehrt sahen sie wohl aus, doch zu gleicher Zeit waren sie göttlich guter Laune – „denn”, fährt Athanasius wörtlich fort, „denn da wurde keiner vom Steuereintreiber geplagt”.
„Denn da wurde keiner vom Steuereintreiber geplagt”: Das ist die historische Wirklichkeit. Nicht aus Angst vor Kleopatras ägyptischen Töchtern sind Antonius und seine Jünger in die Wüste geflohen, sondern aus Angst vor der römischen Steuerfahndung.
Im Jahr 284 war in Rom Diokletian Kaiser geworden. Diokletian war nicht nur ein böser Christenverfolger, sondern hatte, schlimmer noch, eine fatale Ähnlichkeit mit einem besonders berühmten deutschen Finanzminister. Das Wichtigste im Staat, dachte sich Diokletian, sei ein korrektes Steuerwesen. Tatsächlich gelang es ihm, den römischen Fiskus so effizient zu reorganisieren, dass von Britannien bis nach Ägypten kein einziges Steuerschlupfloch mehr blieb, keine einzige Steueroase.
Es war die totale Besteuerung und es war der wirtschaftliche Ruin des Römischen Reiches. In Gallien zuerst brach ein blutiger Aufstand verzweifelter Steuerzahler los, der die gesamte Provinz verwüstete. Das war der „Bagaudenkrieg”. Gleich danach griffen in der Provinz Afrika, das heißt im heutigen Algerien und Tunesien, die bankrotten Bürger zu den Waffen. Das war die „Revolte der Circumcellionen”.
Am schlimmsten war es in Ägypten. Dort trieben die römischen Steuerbeamten die Abgaben nicht selber ein, sondern machten in jedem Dorf die drei oder vier reichsten Bürger mit ihrem Privatvermögen haftbar für die gesamte Steuerschuld ihrer Gemeinde. Nicht etwa die armen Schlucker, vielmehr die reichen Großgrundbesitzer flohen jetzt vor dem drohenden Steuerbankrott zu Tausenden, hinaus in die Wüste. Ein solcher reicher Großbauer, berichtet Athanasius von Alexandrien, sei auch der heilige Antonius gewesen. „Dreihundert Aruren Land, fruchtbar und schön anzusehen”, habe Antonius besessen (umgerechnet etwa 80 Hektar), bevor er dem Fiskus in die Wüste entrann.
Unzählige folgten ihm nach und so gilt der heilige Antonius nicht nur als „Patriarch der Eremiten”, sondern auch, zu Recht, als „Vater des westlichen Mönchtums”. Aus seiner Eremitenstadt in der Wüste Ägyptens ist ja das ganze Klosterwesen der katholischen Kirche hervorgegangen. Und eine Ahnung steigt in uns auf: Ist vielleicht das ganze christliche Mönchtum, ja ist vielleicht, historisch-kritisch betrachtet, der ganze katholische Klerus gar nicht aus Angst vor der Frau entstanden, sondern aus Angst vor dem Finanzamt? Werfen wir, vor jedem überstürzten Urteil, einen klärenden Blick nach Rom.
Während Antonius noch immer in der Wüste saß, hatte Konstantin der Große der Christenverfolgung ein Ende gesetzt. Historisch bedeutsam war dabei gar nicht das so genannte Mailänder Edikt von 313, sondern eine Serie von Folge-Erlassen, in denen Konstantin in wahrhaft majestätischer Großzügigkeit den Priestern der Katholischen Kirche etwas gewährte, wovon alle Bürger Roms genauso träumten wie der Ägypter Antonius: völlige Steuerfreiheit.
Plötzlich herrschten mitten in Rom Zustände wie in der Wüste Ägyptens: Die gesamte christliche Elite, dort die Mönche, hier die Priester, alle waren sie auf wunderbare Weise steuerfrei geworden.
Alsbald begann in Rom ein wahrer Oklahoma-Run reicher Familienväter auf die katholische Priesterweihe. Noch gab es ja keine Zölibatspflicht. Nach jüdischem Vorbild vererbten vielmehr die meisten christlichen Priester ihrem Sohn ihr Amt. Gelang es einer reichen römischen familia, ihren pater familias – auf Deutsch gesagt ihren Papi – zum Priester weihen zu lassen, so war die ganze Familienbande hinfort steuerfrei.