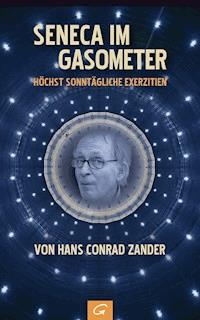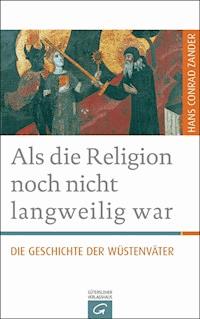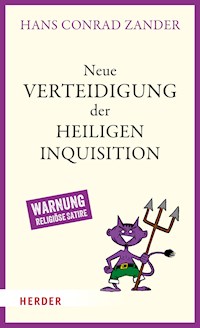Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel - Jesus, der erste Single
Copyright
1. Kapitel
Jesus, der erste Single
Eigentlich, so meinen manche, eigentlich gebe es nichts, was die enthemmte Phantasie der jüngsten Jahrzehnte nicht hineinprojiziert hätte in Jesus Christus.
Kaum hatte er als »Jesus Christ Superstar« am Broadway rauschende Erfolge gefeiert, zog eben dieser Jesus schon als linker Libertador der Dritten Welt schussbereit durch Leonardo Boffs brasilianischen Urwald. Bei Adolf Holl - »Jesus in schlechter Gesellschaft« - trafen ihn die Österreicher als sympathischen Asi-Kumpel in Wiens berühmten Männerheimen. Bald danach begannen aber die Deutschen, von Franz Alt erleuchtet, ihn als »ersten neuen Mann«, ja als »gekreuzigten Frauenfreund« anzubeten. Durch alle Evangelischen Kirchentage nachtwandelte er politisch perfekt korrekt als netter, vorurteilsfreier deutscher Sozialromantiker. Bis wir von Joseph Ratzinger erfuhren, dass er, bei aller ökumenischen Nettigkeit, weiterhin als »Dominus Jesus« zu gelten habe, als göttlicher Stifter des unfehlbaren Papsttums. Im Da-Vinci-Code irrlichterte er als amerikanisches Gralsgespenst im Pariser Louvre herum. Auf den verschlungenen Wegen der evangelischen Theologie trekkt er als »Wanderradikaler«. In Martin Scorceses »Letzte Versuchung Christi« outete er sich, im Dunkel der Kinosäle, als neurotischer Bordellbesucher. Bis erst Mel Gibson ihn mit zwei Stunden Blut, Horror und Gewalt zum erfolgreichsten Kino-Heiland aller Zeiten machte. Und kennt ihr schon den neuesten Jesus? Das ist »Manga the Messiah«. Als strahlender Twen der japanischen Comics führt Jesus eine Schar von kulleräugigen Teenie-Aposteln zum gloriosen österlichen Sieg über die wüsten alten Männer, die ihn ans Kreuz genagelt haben.
Vom brasilianischen Libertador zum japanischen Manga-Komiker - nichts, wirklich gar nichts, meinen manche, hat uns die moderne Hemmungslosigkeit an Jesusbildern erspart.
Das meint auch der katholische Theologe Norbert Scholl und hat dafür eine Erklärung, die auf den ersten Blick einleuchtet: Weil alle Jesus brauchen, braucht jeder sein eigenes Jesusbild.
Irrtum!
Es gibt einen Jesus, den Unzählige dringend bräuchten. Und doch wagt keiner, ihn auszuphantasieren: Jesus als Vorbild und Modell des christlichen Familienvaters. Nicht einmal der Märtyrerin christlicher Familiengläubigkeit, nicht einmal Eva Herman kam es je in den Sinn, Jesus Christus dem fernsehgläubigen Volk als Super Daddy vorzustellen. Ja sogar Kardinal Meisner, der sonst die christliche Familie als das irdische Abbild der himmlischen Dreifaltigkeit anbetet, selbst er, der leidenschaftlich gern in jeden theologischen Fettnapf tritt, hat noch nie im Kölner Dom über Jesus Christus als den idealen Papi gepredigt. Auch seine spirituelle Freundin, Gloria von Thurn und Taxis, sonst so unerschrocken, schreckt bisher noch davor zurück, Jesus Christus als das Urbild des bayerischen Familienvaters anzubeten. Unter Myriaden abenteuerlicher Jesus-Wunschbilder ist dies das einzige, das sich aller, auch der verwegensten Phantasie versagt.
Warum? Sonst geht doch alles. Warum dieses eine nicht?
Weil es das Evangelium nicht zulässt. Das Evangelium Jesu Christi, sonst für fast alles verbiegbar und verdrechselbar, in diesem einen Punkt sperrt es sich absolut. Lukas 14. Kapitel, Vers 26: »Es ging viel Volk mit ihm, und er wandte sich um und sprach: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein.«
»Hassen« ist ein krasses Wort aus dem Munde dessen, der sonst die Sanftmütigen seligpreist. Doch so krass steht es im Evangelium selbst, und zwar ausgerechnet bei Lukas. Bei dem sonst so feinsinnigen, hochgebildeten und netten Frauenversteher Lukas steht diese Aufforderung Jesu zum radikalen Bruch mit der Familie. Am interessantesten ist der Vordersatz: »Es ging viel Volk mit ihm, und er wandte sich um und sprach« (Lukas 14;25). Das heißt: Nicht etwa nur einen kleinen, auserwählt klerikalen Führungskreis hat Jesus aufgerufen zur radikalen Abkehr von jeglichem Familienleben. Nein, die Aufforderung richtet sich an »viel Volk«. Uns alle ruft Jesus auf, mit dem Familienleben zu brechen. Kein Wunder, dass Legionen von familienbeflissenen Theologen angestrengt versucht haben, dieses familienfeindliche Jesuswort familienkonform umzuinterpretieren. Gelungen ist es keinem.
Es geht einfach nicht.
In diesem Punkt ist der evangelische Bericht überwältigend klar: Der Erlöser war kein Papi. Er war das Gegenteil. Jesus von Nazareth war ein Revolutionär.
Er selber sagt es uns. Matthäus, 10. Kapitel, Vers 34: »Wähnt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert.«
Revolution ja. Frage nur: Wogegen?
Darüber herrscht unter christlichen Schriftgelehrten enorme Verwirrung. Unterschwellig geht es nämlich um die Frage, wer schuld sei an der Hinrichtung Jesu. Gern sehen deshalb viele neuerdings in ihm einen nationalistischen Aufrührer gegen die römische Besatzungsmacht. Nicht die Juden, sondern die Römer wären somit die Hauptschuldigen: Sie haben in Jesus einen politischen Revolutionär gekreuzigt. Warum sonst hätte Pilatus gleich in drei Sprachen aufs Kreuz des Aufrührers den Schuldspruch heften lassen: »Jesus von Nazareth, König der Juden« (Johannes 19;19-20)?
Aber hat nicht Procula, die First Lady der Besatzungsmacht, persönlich für Jesus ein gutes Wort eingelegt? »Während er (Pilatus) auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau ausrichten: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute viel gelitten im Traum um seinetwillen« (Matthäus 27;19). Den Träumen seiner römischen Gattin gehorchend, wäscht Pilatus seine römischen Hände in Unschuld: »Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten.«
Wer also, wenn nicht die Römer, könnte schuld sein am Tod Jesu Christi? »Da antwortete das ganze Volk: ›Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!‹« (Matthäus 27;24-25).
Aufrührer gegen den Staat oder gegen den Tempel? Professor Martin Ebner, im Augenblick zuständig für das Jesus-Bild der deutschen Katholiken, deutet mit unendlich viel Fingerspitzengefühl einen katholischen Kompromiss an: »Wir werden nicht daran vorbeikommen, mit einer jüdischen Beteiligung an der Anklage Jesu als Aufrührer gegen die römische Staatsmacht zu rechnen.«
Siehe, ich verkünde euch zwei frohe Botschaften: Nein, wir brauchen die Juden nicht anzuklagen. Nein, wir brauchen auch die Römer nicht anzuklagen. Wir brauchen auch keinen faulen katholischen Kompromiss auszutüfteln. Wohl war Jesus ein Revolutionär. Aber nicht gegen den Staat und nicht gegen den Tempel. Die Revolution, zu der Jesus aufruft, ist von gänzlich anderem Kaliber. Lest nur weiter im Evangelium:
»Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert.« Unmittelbar auf diesen Satz folgt bei Matthäus, aus Jesu eigenem Mund, die unzweideutige Klarstellung, was für eine Revolution er selber, nicht Professor Ebner, meint: »Denn ich bin gekommen, den Menschen zu empören gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein« (Matthäus 10;35-36).
Jesus, der Familienfeind! Kein anderer hat eine derart radikale Revolution gewagt. Lange vor dem römischen Staat mit all seinen Legionen, lange vor dem Tempel in Jerusalem mit all seinen Priestern und Händlern, vor allen andern Institutionen, die die Menschheit bedrücken, war sie: die Familie. Wer gegen die Familie aufsteht, der steht auf gegen die Mutter aller Institutionen.
Gewiss haben wir alle im Kindergarten gelernt, dass die Familie »etwas soziokulturell Bedingtes« sei, von der Großfamilie über die Kleinfamilie bis zur Patchwork-Familie ständigem »soziokulturellem Wandel« unterworfen. Da hatte die Kindergärtnerin natürlich recht. Kindergärtnerinnen haben immer recht. Aber nur teilweise. Nicht ganz.
René König selbst, er, der Stammvater des »soziokulturellen« Diskurses in der deutschen Soziologie, macht bei der Familie eine staunenswerte Einschränkung: In all den »Wirren von Entwicklung und Geschichte« dauere die Familie gerade deshalb so konstant fort, weil sie über das Menschliche zurück ihre »Keimform im Tierreich« habe. Daher die vielen verblüffenden Parallelen zwischen der Tier-Soziologie und der Familien-Soziologie.
In der deutschen Soziologie gilt René König als Gründer der »Kölner Schule«. Wie konnte ausgerechnet ihm dieser lapsus linguae, auf Deutsch gesagt: dieser slip of tongue, von der »Keimzelle im Tierreich« entschlüpfen?
Vielleicht ist Professor König ein paarmal zu viel im Kölner »Grüngürtel« spazieren gegangen. Da konnte der Familiensoziologe etwas erleben: Familie naht von links, Familie naht von rechts, Familie naht von vorn, Familie naht von hinten. Eingeborene Familien. Immigrierte Familien. Christliche Familien. Unchristliche Familien. Familie zu Fuß. Familie als Fahrrad-Geschwader. Und manche Familien liegen schon im Gras. Soziokulturell alles, wie es sich gehört, wunderschön variiert.
Und doch: Von hinten, vorne, links und rechts, im Gras, zu Fuß und auf dem Fahrrad ist eines gleich: das Gezeter. Animalisch kreischen die Kinder, animalisch schreit die Mutter, animalisch brüllt zum Schluss auch noch der Vater mit.
Wer Ohren hat zu hören, der höre hinein in das phonetische Leben der ganz gewöhnlichen Familie. Hörbar animalischer als alles andere, was den Menschen prägt und plagt, ist die Familie. Urkraft des Lebens ist im Familiengeschrei. Warum? Weil sie die Urform der Gesellung ist. Sie ist - »Keimzelle im Tierreich« - die Mutter aller menschlichen Institutionen.
Manche Mediziner vertreten die Meinung, die Religion sei im Kleinhirn angesiedelt, also im älteren, hinteren, kleineren Teil des menschlichen Gehirns. Vielleicht ist das so. Doch so klein das Kleinhirn sein mag, da ist noch Platz für etwas anderes: Ganz hinten, im hintersten Kleinhirn, steckt die Familie. Kein Wunder, dass sie, soweit das Gedächtnis der Menschheit zurückreicht in die Geschichte, zur Zwangsvorstellung der Religion geworden ist. Schon der allerälteste Zarathustra-Kult betrachtet es als fürchterliche Strafe Gottes, ohne Familie leben zu müssen. Ewig wird der Ledige geächtet bleiben. Auf der Brücke Kinwad, die hinüberführt ins Reich der Unsterblichen, weist ein Erzengel den verhinderten Familienvater selbst dann ab, »wenn er im Leben sonst viele Pflichten erfüllt und gute Werke getan hat«:
»Zurück muss der Ledige bleiben, die Seele voll Angst und Not.«
»Seid fruchtbar und mehret euch«, drängt, Zarathustra gleich, auch Moses schon in seinem ersten Buch (1. Mosis 1;22). Der Talmud interpretiert dieses Urgebot unmissverständlich: »Wer kein Eheweib hat, ist ohne Freude, ohne Segen, ohne Glück, ohne Thora, ohne Mauer, ohne Frieden; ein Mann ohne Eheweib ist kein Mensch.« Schlimmer noch: »Ledig bleiben ist so schlimm wie einen Mord begehen.« Selbst der weise Salomon bricht beim Gedanken, ein Mann könnte keine Familie gründen, in den klassischen Ruf des Entsetzens aus: »Wehe dem Alleinstehenden!« (Prediger 4;10).
»Vae soli!«
Wir wissen jetzt Bescheid: Die Familie ist die Mutter aller Institutionen. Was Jesus als Erster gewagt hat, ist die Mutter aller Revolutionen: Religion als familienfreie Zone - in der Gesellschaft und im Gehirn.
Vielleicht hat Professor Ebner doch recht, wenn er den Juden eine klitzekleine Beihilfe zur Hinrichtung Jesu Christi in Rechnung stellt. Zumindest waren es Juden, die ihn als Erste umbringen wollten. Allerdings nicht die Pharisäer in den Synagogen am See Genezareth und nicht die Hohenpriester im Tempel zu Jerusalem, sondern die eigene Familie daheim in Nazareth.
Von ersten Gewalttätigkeiten müssen wir hören, als Jesus eines Tages selber, etwas unvorsichtig, von der Wanderschaft nach Nazareth heimkommt: »Als die Seinen das vernahmen, kamen sie her, um ihn festzuhalten. Denn sie sagten: Er ist irre« (Markus 3;21).
Ein Sohn, der aus der Familie aussteigt, gehört in psychotherapeutische Behandlung. Dabei ging es damals weniger verständnisinnig zu als heute bei Manfred Lütz. Dennoch war diese allererste Behandlung Jesu durch seine Familie vergleichsweise harmlos. Jedenfalls ist Jesus wieder freigekommen. Doch dann steigert sich der Familienkonflikt zum Familienkrimi. Titel: »Brudermord in Nazareth«.
Machen wir es wie Matthäus und Markus und stellen wir die Brüder Jesu mit Namen an den Pranger: »Jakob, Joses, Simon und Judas« (Matthäus 13;55, Markus 6;3). Natürlich ist an dieser Brüderbande »exegetisch« viel herumgedrechselt worden. Nur Vettern seien das gewesen, schallt es - vor lauter Angst um die Exklusivität der Empfängnis Mariä - aus der katholischen Exegese. In manchen Sprachen, so auch im Aramäischen, also in der Muttersprache Jesu, heiße nämlich »Bruder« auch »Vetter«.
Das ist nichts als exegetischer Schwindel. Die Evangelien sind ja nicht auf Aramäisch geschrieben, sondern auf Griechisch. Das griechische Wort αδελϕός, das sie verwenden, ist aber unzweideutig. Es heißt nur Bruder. Vetter nicht. Um Jesus war keine Vetternwirtschaft. Brüder waren um ihn. Brüder so echt wie Bruder Kain. Der sonst so abgehobene Evangelist Johannes schildert den Familienkrimi im 7. Kapitel:
»Danach zog Jesus in Galiläa umher. In Judäa herumziehen wollte er nicht, weil ihm dort die Juden nach dem Leben trachteten. Als nun das jüdische Laubhüttenfest nahte, sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von dannen, zieh nach Judäa, auf dass deine Jünger die Taten sehen, die du vollbringst« (Johannes 7;1-3). Erklärend fügt Johannes hinzu: »Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn« (Johannes 7;5).
Dies ist nichts anderes als ein abgefeimter Mordplan der vier Brüder Jesu. Mit einer heuchlerischen Schmeichelei (»auf dass deine Jünger deine Taten sehen«) wollen seine Brüder, die doch gar nicht an seine Wunder glauben, ihn dahin schicken, wo ihm »die Juden nach dem Leben trachteten«. Heimtückisch in den Tod schicken wollen ihn Jakob, Joses, Simon und Judas. Jesus aber, der tief in die Mördergruben ihrer Bruderherzen sah, meidet die tödliche Falle, die ihm seine Familie stellt, mit einem abgründigen Satz: »Meine Zeit ist noch nicht gekommen« (Johannes 7;5).
Aber war der brüderliche Mordplan wirklich böswillig? Vielleicht fühlte sich die Familie ja im Recht. Im guten, mosaischen Recht: »Wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, der seines Vaters und seiner Mutter Stimme nicht gehorcht, und ihnen auch dann, wenn sie ihn züchtigen, nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter greifen und zu den Ältesten der Stadt führen hinaus ans Tor. Dort sollen sie zu den Ältesten sagen: Dieser unser Sohn ist eigenwillig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Fresser und Säufer« (5. Mosis 21;18-20).
Dass er ein »Fresser und Säufer« sei, ist das nicht der Vorwurf, der nach Jesu eigenem Zeugnis - Matthäus 11;19 - in Nazareth gegen ihn im Umlauf war? Was aber hat nach dem jüdischen Gesetz mit einem solchen eigenwilligen, ungehorsamen, verwahrlosten Sohn draußen am Stadttor zu geschehen?
»So sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt, dass er sterbe« (5. Mosis 21;21).
Von allen Revolutionen ist der Aufstand gegen die Familie die elementarste. Wer diese Revolution wagt, setzt sein Leben aufs Spiel. Warum hat Jesus das getan?
Tödlich ist die Gefahr. Grandios aber ist die revolutionäre Verheißung. Jesus richtet sie an alle, die ihm nachzufolgen wagen: »Wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Ehefrau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der bekommt es hundertfach wieder, und das ewige Leben dazu« (Matthäus 19;29).
»… der bekommt es hundertfach wieder«: Hoffentlich liest Kardinal Meisner nicht allzu viel im Evangelium nach Matthäus. Denn dieser Satz ist ungeheuerlich. Wohl könnten wir uns vorstellen, dass ein engagierter Christ Direktor eines kirchlichen Pflegeheimes wird und somit Vater und Mutter, die er verlassen hat, hundertfach wiederbekommt. Noch besser könnten wir uns vorstellen, dass eine engagierte Christin ihre eigenen Kinder verlässt, danach aber Leiterin der katholischen Krabbelkiste in Köln-Zollstock wird und somit die verlassenen eigenen Kinder hundertfach zurückbekommt. Dass aber einer, wie das Evangelium wörtlich sagt, in der Nachfolge Jesu auch die verlassene »Ehefrau« »hundertfach« wiederbekommt, dies sich vorzustellen hält die fromme Phantasie nicht aus.
Was die fromme Phantasie nicht aushält, genau das bezeugt, ungeniert, das Evangelium nach Lukas: »Und danach wanderte er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, predigte und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes, und die Zwölf waren bei ihm, sowie einige Frauen, die er von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte: Maria, genannt Magdalena, aus der sieben böse Geister ausgefahren waren, Johanna, die Gattin des Chuza, eines Statthalters von Herodes, und Susanna und noch viele andere Frauen, die mit ihrem Vermögen für ihn sorgten« (Lukas 8;3).
Unter all den »vielen anderen Frauen« ist Johanna die spannendste. Aus außerbiblischen Quellen ist nämlich zu erfahren, dass ihr Mann Chuza nichts weniger war als der Finanzminister von Herodes. Auch hat die feministische Forschung inzwischen herausgebracht, dass Johanna, als sie sich der Wandergruppe um Jesus anschloss, ihrem prominenten Gatten bereits davongelaufen war. Offensichtlich hielt Johanna vom Familienleben, auch in Palästinas feinsten Kreisen, nicht mehr als Jesus selbst.
Ganz und gar nicht dem Ideal der christlichen Familienmutter entspricht jene Frau, die Lukas in seiner Aufzählung deshalb als Erste erwähnt, weil sie Jesus am nächsten war: Maria Magdalena. Erst die kranke Phantasie späterer Kirchenväter hat sie mit der »großen Sünderin« verwechselt. Augustinus preist sie noch als »apostola apostolorum« - als ernstzunehmende Chefin der Urkirche. In der »wanderradikalen« Wandergruppe um Jesus war sie offenkundig die radikale Wanderführerin. Stammte sie nicht, wie er, aus Galiläa? Nach den Forschungen der feministischen Theologie muss sie die Witwe eines reichen galiläischen Grundbesitzers gewesen sein. Dass sie selbstständig über ihr Vermögen verfügen und für Jesus sorgen konnte, setzt nämlich, nach jüdischem wie nach römischem Recht, voraus, dass nicht nur die erwähnten »sieben bösen Geister« aus ihr ausgefahren waren, sondern auch ihr Eheherr.
»Und viele andere Frauen«, sagt Lukas ausdrücklich. Ersparen wir uns alle Unterstellungen sexueller Verwahrlosung. Sie stammen aus der Kinophantasie moderner Machos, nicht aus dem antiken Evangelium. Was Lukas so ungeniert über die Finanzen der Wandererinnen bekannt gibt - »die mit ihrem Vermögen für ihn sorgten« -, erinnert vielmehr an einen bürgerlich nüchternen, gerade deshalb aber aufregenden Gedankengang von Simone de Beauvoir in »Das andere Geschlecht«: dass schon in vergangenen Epochen nichts die Emanzipation der Frau so förderte wie die Verfügung über eigenes Geld. Nicht Ausschweifung war es, was die Szene der Jüngerinnen um Jesus prägte, sondern - für die jüdischen Zeitgenossen unfassbar neu und revolutionär - Emanzipation im Sinne Simone de Beauvoirs. Emanzipation im Sinne Jesu. Los von der Familie!
Ein Zweifel regt sich doch. Dass eine größere Gruppe von gebildeten und finanzstarken Frauen Jesus von ferne gesponsert hat, mag ja sein. Aber wirkt die Vorstellung nicht fabulös, dass sich Damen dieser sozialen und kulturellen Klasse vom Sohn eines Zimmermanns aus dem Provinznest Nazareth so angezogen fühlten, dass sie ihm nicht nur ein bisschen etwas zustupften, sondern emanzipationslustig hinter ihm herwanderten, kreuz und quer durchs Heilige Land?
Nein. Grotesk wirkt das nur deshalb, weil wir, was die Herkunft Jesu angeht, den Kopf vollgestopft haben mit verquaster Sozialromantik. Zuerst bekamen wir die Sozialromantik von rechts vorgebetet. Um den Sozialismus liturgisch abzuwehren, weihte Papst Leo XIII den Vater Jesu, den heiligen Josef, zum »Arbeiter« und als solchen zum heiligen Patron eines katholischen Hochfestes der Arbeit am 1. Mai. Nazarenische Malerei verniedlichte dann den Zimmermann auch noch zum Schreiner. Als solcher durfte Josef ein paar Generationen lang in der christlichen Familienstube malerisch hobeln. Als Muster und Modell des gelehrigen, artigen Azubi hobelte Jesus, noch malerischer, mit.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bekam dann allerdings die christliche »Pastoralpädagogik« jenen politisch korrekten Linksdrall, für den Josef nichts anderes mehr sein durfte als ein armer, ausgebeuteter Gelegenheitsarbeiter »auf der Stör«. In neueren Bilderbüchern für den deutschen Religionsunterricht ist sein Sohn Jesus der kruselhaarige Wortführer aller »Armutsflüchtlinge« dieser Welt.
So schlimm war das aber in Wirklichkeit nicht. Gewiss fragen sich die Nachbarn in Nazareth: »Ist dies nicht der Sohn des Zimmermanns?« (Matthäus 13;55). Aber was heißt Zimmermann? »τέκτων« sagt der evangelische Originaltext. Dieses griechische Wort ist nicht zufällig eng verwandt mit unserem Wort »Architekt«. Giovanni Magnani, Historiker an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, bezeichnet Josef als »selbstständigen Bauingenieur«. So etwas wie Bauleiter dürfte Josef mindestens gewesen sein. Jedenfalls waren die Zimmerleute zur Zeit Jesu in Palästina die redegewandten Wortführer unter den Arbeitern, nicht unähnlich den Druckern im deutschen 19. Jahrhundert. Nachdrücklich erwähnt Lukas, dass der junge Jesus in der Synagoge von Nazareth »nach seiner Gewohnheit« (Lukas 4;16-20) aus den Schriftrollen vorlas, unter anderem einen umfangreichen Text aus dem Propheten Isaias. Das Amt des Vorlesers aber war ein Ehrenamt, das man keinem ungebildeten Hilfsarbeitersohn zuwies. Alle vier Evangelien sind voll von Beispielen, wie bibelfest, vor allem wie schlagfertig Jesus war. Typisch Zimmermann eben. Und da er Neues, Spannendes, Aufregendes verkündete, mag der Wanderprediger aus Nazareth für eine gebildete und reiche Frau wie Johanna ein unvergleichlich interessanterer Mann gewesen sein als jener blöde Finanzminister.
Deutlich weniger emanzipiert als die Jüngerinnen wirken leider im Evangelium die Jünger. Na ja, es waren ja auch Männer. Dazu noch, anders als die Jüngerinnen, Männer wirklich aus schlichten Verhältnissen, Fischer und Bauern ohne die höhere Bildung einer Johanna und ohne die wortgewandte Bibelfestigkeit eines Zimmermanns. In der Apostelgeschichte werden sie ausdrücklich als »Männer ohne Bildung und Wissen« bezeichnet (Apostelgeschichte 4;13). Der heilige Hieronymus spitzt das noch ein bisschen zu, indem er es für uns ins Kirchenlateinische übersetzt mit »homines sine litteris et idiotae«.
Anders als bei den Frauen, die sich selber aus ihren Familienbanden zu befreien wussten, musste Jesus bei solchen Männern nachhelfen. Wie energisch er rund um den See Genezareth nachhalf, schildert Markus im 1. Kapitel, Vers 16-18:
»Während er am Meer von Galiläa vorüberging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ein Netz im Meer auswarfen, waren sie doch Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Auf! Mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und augenblicklich ließen sie die Netze liegen und folgten ihm nach.« Ganz offenkundig ohne auch nur der geliebten Ehefrau, den süßen Kindern, dem kranken alten Vater und der teuren Mutter à Dieu zu sagen.
Gleich im folgenden Vers zerrüttet Jesus eine weitere Familie: »Als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot beim Netzeflicken. Und augenblicklich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Knechten, weg gingen sie, hinter ihm her« (Markus 1;19-20).
Am schlimmsten kommt es bei Matthäus: »Ein anderer aber von den Jüngern sagte zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich vorher noch meinen Vater begraben gehe. Jesus aber sprach zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben!« (Matthäus 8;21-22). Für jüdische Begriffe eine fast unvorstellbare Verletzung des strengen mosaischen Kerngebots, Vater und Mutter zu ehren (2. Mosis 20;12).
Ist es da nicht verständlich, dass die Familie in Nazareth es einfach nicht mehr aushielt und sich auf die Socken machte, rund um den See Genezareth, um den aufrührerischen Sohn am Wickel zu packen und zur Rede zu stellen? Wie es zu dem denkwürdigen Zusammenprall zwischen der Familiengruppe um Maria und der Wandergruppe um Jesus kam, schildert Markus im 3. Kapitel:
»Und es kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und schickten zu ihm, um ihn zu rufen. Und das Volk saß um ihn her, als man ihm sagte: Schau, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind da draußen und suchen dich. Da anwortete er ihnen: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die Jünger, die um ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder!« (Markus 3;31-35).
David Flusser, der Begründer der Jesusforschung an der Hebräischen Universität in Jerusalem, hat sich stets dagegen gewehrt, aus den Evangelien so etwas herauszudestillieren wie ein Psychogramm Jesu Christi: »Doch einem psychologischen Faktum im Leben Jesu kann man nicht ausweichen: seiner ablehnenden Haltung gegen die Familie, in die er geboren ward.« Schärfer noch formuliert es ein anderer jüdischer Experte, Schalom Ben-Chorin: »Wenn es einen Zug im Charakter Jesu gibt, der völlig eindeutig hervortritt, dann ist es diese antifamiliäre Haltung, die nur die Wahlverwandtschaft gelten lässt, nicht aber die Sippe.«
Schalom Ben-Chorin war ein jüdischer Religionswissenschaftler, der 1934 aus München nach Palästina fliehen musste. Was heute jeder christliche Student des Neuen Testaments im Proseminar selbstverständlich und bequem lernt, hat er als einer der Ersten, unter schwierigsten Bedingungen, allein und auf eigene Faust in Jerusalem versucht: Jesus nicht aus der christlichen Dogmatik zu verstehen, sondern aus den jüdischen Lebenszusammenhängen seiner Zeit.
Je mehr Schalom Ben-Chorin eben dies versuchte, desto mehr drängte sich ihm der Eindruck auf, dass dem offenen Streit Jesu mit seiner Familie ein noch schwereres Zerwürfnis zugrunde lag: Jesus hatte ein gebrochenes Verhältnis zu seiner Mutter. So wurde der Jesus-Forscher Ben-Chorin zum Begründer einer neuen Wissenschaft. Das ist die empirische MarienForschung.
Johannes im 2. Kapitel, Verse 1-5: »Und am dritten Tag fand eine Hochzeit statt zu Kana in Galiläa. Die Mutter Jesu war auch dort. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Als aber der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.«
Das ist, noch ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums, jene frühe Begebenheit im Leben Jesu, die Ben-Chorin zum Skandalon geworden ist. Er, der doch sonst seinem jüdischen »Bruder Jesus« so herzlich zugetan ist, nennt es »hart«, »schroff«, »schockierend«, ja »lieblos«, dass ein jüdischer Sohn sich untersteht, seine Mutter mit »Frau« anzureden. Wobei übrigens die modernistische Übersetzung mit »Frau« die Szene schönt. Zu Recht gibt Ben-Chorin der lutherdeutschen Übersetzung mit »Weib« den Vorzug. Sie entspricht dem Tonfall, den Jesus sich im Umgang mit der eigenen Mutter anmasst. In den gesamten jüdischen Quellen der Jesus-Zeit hat Ben-Chorin nach einem zweiten Fall gesucht, in dem ein jüdischer Sohn es gewagt hätte, seine Mutter mit »Frau« anzusprechen; er hat keinen finden können. Für das jüdische Empfinden, damals noch mehr als heute, ist dies »eine unerhörte Beleidigung«.
Noch schlimmer der Nachsatz Jesu an seine Mutter: »Was habe ich mit dir zu schaffen?« Im Alten Testament ist das eine Formel, die Kriegserklärungen einleitet.
Dabei hätte Maria die herzliche Unterstützung ihres Sohnes besonders gut brauchen können, kam sie doch, Johannes zufolge, allein zum Fest - ein Indiz übrigens, dass ihr Mann Josef früh gestorben war. Nur als Witwe nämlich konnte Maria allein eingeladen werden. Aber offenbar fand es Jesus nicht einmal nötig, an ihrer Seite auf dem Fest zu erscheinen. Sie kam wohl aus Nazareth, er kam wohl mit seinen Jüngern aus der entgegengesetzten Richtung, aus Kapharnaum. So prallten sie im Festsaal aufeinander.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2010 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
eISBN 978-3-641-05063-4
www.gtvh.de
Leseprobe
www.randomhouse.de