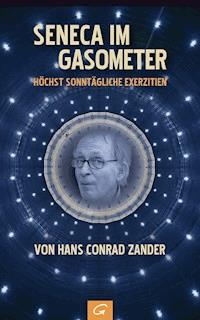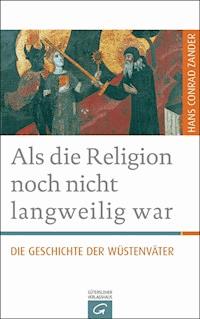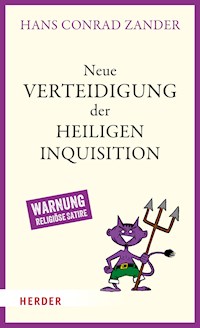15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein kulturgeschichtliches Kaleidoskop des Christentums
Wenn Hans Conrad Zander zur Feder greift, darf man auf Überraschungen gefasst sein: Als theologisch gebildeter Satiriker bietet er Wissenswertes in höchst unterhaltsamer Form. So auch in seinem neuen Buch, das ein einmaliges kulturgeschichtliches Kaleidoskop des Christentums darstellt. In diesen Kabinettstücken stellt er Galileo Galilei als Archetyp des christlichen Märtyrers vor, lässt Charles de Foucauld vom Abenteuer der Religion erzählen, den großen evangelischen Theologen Sören Kierkegaard den Zölibat verteidigen und vieles mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Conrad Zander
ZanderFilets
Eine Kulturgeschichte
des Christentums
in 25 Kabinettstücken
Gütersloher Verlagshaus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk wurde in schweizerischer Rechtschreibung verfasst.
1. Auflage
Copyright © 2015 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Gütersloher Verlagshaus, Verlagsgruppe Random House GmbH, weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © akg-images
ISBN 978-3-641-12939-2
www.gtvh.de
Das war die religiöse Bildung
Eine Einleitung
Viele lieben Papst Franziskus. Zu viele lieben Papst Franziskus. Ich liebe Papst Franziskus nicht. Doch eines nötigt mir Respekt ab: Für moderne katholische Verhältnisse hat der Argentinier ungewöhnlich viel Charakter. Diese combinazione von jesuitischer Schläue mit pinocchiohaftem Komödiantentum macht ihm keiner nach.
Dass alle Medien dieser Welt ihn so sehr lieben, ist allerdings nicht sein eigenes Verdienst. Das liegt am Niedergang der religiösen Bildung. Wo ist dieser Niedergang schlimmer? Bei den Katholiken oder bei den Antiklerikalen? Wohl doch bei den Katholiken. Sie wenigstens müssten doch Pascal gelesen haben. Den grossen Mathematiker und katholischen Satiriker. In seinen »Provinciales« hat er, lange vor unserer Zeit, jene liebevolle, barmherzige Anbiederung an die vielen gegeisselt, mit der die Jesuiten seines Jahrhunderts alle ihre Gegner, die Freigeister ebenso wie die Katholiken, ähnlich übertölpelt haben wie jetzt Papst Franziskus die mit ihm in der Welt umherfliegenden Journalisten.
So hoch hinauf, bis hinauf zu Blaise Pascal, bis nach den klassischen Sternen katholischer Intellektualität, will dieses Buch aber gar nicht greifen. Wir sind ja, nach der jüdischen Einsicht von Karl Kraus, »Insassen einer Zeit, welche die Fähigkeit verloren hat, Nachwelt zu sein« (18. Stück). Diese Fähigkeit, Nachwelt zu sein, heisst auch Bildung.
Religiöse Bildung. Ihren Verlust halte ich für schlimmer als das vielbeklagte Schwinden von Dogma und Moral. Ist doch gute Religion so etwas wie das Gedächtnis der Menschheit. Dieses Gedächtnis nur ein bisschen wiederherzustellen, in kleinen, elementaren, homöopathisch verabreichten, leicht verdaulichen Dosen, hier genannt Stücken, das ist die bescheidene Absicht dieses Buches. Mehr Ehrgeiz wäre im 21. Jahrhundert Vermessenheit.
Aber was rede ich so katholisch daher? Eigentliche Hüterin der religiösen Bildung war, zumindest in Deutschland, die evangelische Geistlichkeit. Was ist davon geblieben?
»Alle Jahre wieder kommt ein Luther-Jahr«. So singen in deutschen Kindergärten gewiss schon die Kleinsten. Jedenfalls stelle ich als Schweizer mir das so vor. Zur Diversifizierung des spätevangelischen Monokults um den Titanen aus Wittenberg liefert dieses Buch, in ökumenischer Geschwisterlichkeit, gleich vier Steilvorlagen.
Allen voran Ulrich Zwingli. Luther hat das Gespräch mit ihm in Marburg abgebrochen mit dem Verdammungswort: »Ihr Schweizer habt einen anderen Geist.« In jener Zeit hiess das: »Euer Geist ist vom Teufel.« Wenn aber Zwinglis Geist vom Teufel war, dann ist der Teufel vielleicht doch die Verkörperung des gesunden religiösen Menschenverstands (5. Stück). Luthers Versuch, das katholische Dogma von der realen Gegenwart Christi im Altarssakrament evangelisch korrekt umzuformatieren, hat Zwingli nichts anderes entgegengesetzt als den einen elementaren, zu Unrecht vergessenen Satz: »Was nicht nach Fleisch schmeckt, ist kein Fleisch.«
Nicht nur der Teufel allein, die ganze Hölle wäre in Marburg losgewesen, wenn Luther es nicht mit dem Zürcher, sondern mit dem Genfer zu tun bekommen hätte. Jean Calvin! Von ihm stammt die Aussage, dass Gott »de façon inexplicable« den einen Menschen Gutes tut, den andern Böses (23. Stück). Das ist kein Satz, mit dem man so weltbeliebt werden kann wie Papst Franziskus mit seiner »misericordia« für alle. Aber es ist ein Satz, der die reale Lebens- und Gotteserfahrung der meisten von uns – Christen und Nichtchristen – in ihrer realen Unerklärbarkeit ehrlich ausspricht.
Jetzt noch, Margot Kässmann zur Auflockerung des Monokults um Luther besonders lebhaft empfohlen, Calvins Freund John Knox, der Reformator Schottlands und Gender-Theologe vor der Zeit. Ein unsympathischer Charakter, gewiss. Aber braucht denn ein Charakter sympathisch zu sein? In seiner schottischen Eigenwilligkeit hatte John Knox Charakter genug, nicht den Streit zu scheuen mit der gefährlichsten Zensurbehörde der Welt: mit dem gesamten weiblichen Geschlecht (20. Stück).
Oder, falls ein Lutheraner besser ins Lutherjahr passt als ein Kalvinist, sei’s der Lutheraner Sören Kierkegaard (3. Stück). Wie ein winziges Torpedo sich in einen gewaltigen Schlachtkreuzer bohrt, so hat dieser dänische Theologe, in seiner evangelischen Charakterstärke, jenes Staatskirchentum angegriffen, das heute noch in unserer Kirchensteuerkirche fortlebt. Von ihm stammt die Definition, Christentum sei das Gegenteil von Spiessertum, Inbegriff des Spiessers aber sei der verheiratete evangelische Pfarrer.
Zwingli, Calvin, John Knox und Sören Kierkegaard: vier evangelische Charaktere, beinahe so archetypisch verschieden wie die vier Evangelisten. Mit ihnen könnte in die seichte Konformität der evangelischen Kirchentage schon fast soviel charakterliche Stärke und Vielfalt einziehen wie in den katholischen Heiligenhimmel.
Das ist es ja, Max Weber zufolge, was Kirche von Sekte unterscheidet. In einer Sekte ziehen nicht nur alle am gleichen Strang, sie sind auch alle gleich. In einer Kirche herrscht – herrschte jedenfalls in klassischen Zeiten – eine Vielfalt widersprüchlicher Charaktere.
Das heisst nicht, dass in einer Kirche der Kampf aller gegen alle losgehen muss wie einst im Grossen Armutsstreit zwischen linken und rechten Franziskanern (22. Stück). Oder dass die Auseinandersetzung zwischen zwei inkongruenten Charakteren der Kirche so zum Verhängnis werden muss wie der Streit zwischen Papst Leo X, einem italienischen Genussmenschen, und Martin Luther, einem deutschen Wahrheitsapostel (5. Stück). Zwei so grundverschiedene Charaktere wie der heilige Thomas Morus und der Spötter Erasmus waren einander in tiefer Freundschaft verbunden (7. Stück). Mit dem »Lob der Torheit« haben sie zusammen ein Werk der christlichen Satire geschaffen, das sogar Pascals »Provinciales« an intellektueller Schärfe übertrifft. Dass gar der heilige Filippo Neri und der heilige Ignatius von Loyola einander gemocht hätten, behaupte ich nicht (25. Stück). Aber dass diese beiden widersprüchlichen religiösen Charaktere, nur ein paar Häuser voneinander entfernt, mitten in Rom und zu Füssen des Heiligen Vaters, nicht übereinander hergefallen sind, sondern einander in christlichem Frieden liessen, ist ein Modell für die Bischofssynoden unserer Zeit.
Simone de Beauvoir hat gesagt, dass es für die Frauen der Moderne in der Vergangenheit als Vorbild nur die reichen Frauen gebe. Sie allein konnten sich die Selbständigkeit leisten. Masslos reich war zweifellos die heilige Paula von Rom (3. Stück). Und sie war die letzte Nachfahrin zweier grosser republikanischer Geschlechter, der Scipionen und der Gracchen. Mit ihrem scipionischen Charakter und mit ihrem Geld hat diese Frau die Arroganz der Machos in der katholischen Kirche besiegt. So hat sie den priesterlichen Zölibat durchgesetzt all jenen katholischen Papis zum Trotz, die, nach jüdischem Vorbild, gern verheiratete Priester geworden wären und das steuerfreie Priestertum im Reich Konstantins auch gleich, nach jüdischer Tradition, an ihre hoffnungsvollen Söhne vererben wollten.
Von ganz anderem Schlag als Paula in Rom war drüben in Konstantinopel Kaiserinmutter Helena (14. Stück). Jacob Burckhardt nennt sie »die verruchte Schankwirtin«. Aber auch verruchte Frauen, gerade sie, haben etwas Anziehendes. Und sie können stark sein. Sehr stark. Das römische Reich unter das Zeichen des Kreuzes zu stellen, diese Idee hat nicht ihr Sohn Konstantin gehabt, sondern sie, seine Mutter. Helena und ihr Reliquienschiff! Wie gern wäre ich mit dieser verruchtesten aller Heiligen von Konstantinopel nach Jerusalem gesegelt.
Aber lieber noch hätte ich die heilige Katharina auf ihrem abenteuerlichen Ritt von Siena nach Avignon begleitet (21. Stück). Anders als die vielgefeierte Theresia von Avila war Katharina keine Simone de Beauvoir vor der Zeit. Nicht lesen und nicht schreiben konnte Katharina, von Selbstverwirklichung der Frau hat sie so wenig etwas gewusst wie von Quotenförderung oder von Gender-Theologie. Dafür hatte dieses italienische Arbeitermädchen Charakter, und zwar einen so starken, dass sie Papst Gregor XI von Avignon nach Rom zurückgeführt hat wie einen Ochsen am Nasenring.
Bei der Gelegenheit gleich noch ein Beitrag zur Gender-Theologie. Dass es so etwas gibt, verwundert nur die religiös Ungebildeten in den theologischen Fakultäten. Sonst wüssten sie, dass der Gender-Wurm seit den allerersten antiken Anfängen, ja seit babylonischen Urzeiten mitten in der christlichen Dogmatik steckt (24. Stück).
Schöne Zeit der religiösen Bildung, kehre wieder! Sie klärt ja nicht nur den Kopf auf, sondern stimmt zugleich das Gemüt gelassen. Nur religiöse Bildung könnte sie kurieren, die grossen Hysterien unserer Zeit. Denkt nur an den »Islamischen Staat«.
»Islam« heisst eigentlich »Frieden«. Das wissen alle. Gross aber ist die Aufregung ob der Frage, wie und warum aus dieser Religion des Friedens eine so blutrünstige Bewegung wie der »Islamische Staat« hervorgehen konnte. Plasberg, Will, Jauch, Beckmann, Maischberger, Illner: Hätte nur einer von ihnen etwas religiöse Bildung, so würde bald allen in Deutschland klar, dass es genau dies schon einmal gegeben hat. Nicht im Islam, sondern bei uns im Christentum. Der blutigste aller Kreuzzüge ist unmittelbar hervorgegangen aus einer Friedensbewegung (19. Stück).
Noch habe ich »Spon« nicht gewürdigt: Dass ausgerechnet junge, fortschrittliche Intellektuelle bei uns zum medialen Klerus einer intoleranten und bornierten political correctness geworden sind, auch dies erstaunt nur, weil die religiöse Bildung verloren gegangen ist. Sonst wüssten wir, dass schon im 13. Jahrhundert die Heilige Inquisition nicht etwa von bösen alten reaktionären Männern gegründet worden ist, sondern von den fortschrittlichsten, liberalsten jungen Intellektuellen jener Zeit (13. Stück).
Und der mediale Hype um Papst Franziskus? Was ist das Erstaunliche daran? Nur eines: Mangels religiöser Bildung scheinen die meisten nicht mehr zu wissen, dass es derartige »kollektive Hysterien« (Sigmund Freud) in der christlichen Geschichte von allem Anfang an gegeben hat. Sie sind auch, beruhigt euch, alle wieder vergangen.
Der syrische Bürgerkrieg war noch nicht ausgebrochen, als ich, auf den Spuren der Wüstenväter, etwas nördlich von Aleppo in eine bizarre Ruinenlandschaft geriet. Weit in der Ebene verstreut, bis fast zum Mittelmeer hin, ragten aus dem Weideland die Trümmer eigenartiger Gebäude: offensichtlich weder Tempel, noch Kirchen, noch Burgen. Was dann? Es waren zerfallene antike Hotels. Alle gebaut während des globalen Hypes um ihn, der mitten drin und über allen, hoch vom Berg Quala’at Samaan herab, auf seiner Säule die Arme segnend ausbreitete: Simeon der Grosse. Der Grösste (10. Stück).
Ein Augenzeuge, der Historiker Theodoret, beschreibt die Szene mitten im 5. Jahrhundert so: »Nicht nur die Syrer drängen sich um Simeon, sondern auch die Araber, die Perser, die von den Persern unterjochten Armenier, die Homeriten und Völkerschaften, die weit im Inneren Asiens wohnen. Es kommen auch viele vom westlichen Rand der Welt: Spanien, Briten und Gallier.« Als wär’s das gesamte world village, so starrten die unabsehbaren Massen in globaler Begeisterung empor zu ihm:
Zu Simeon dem Säulenheiligen damals. Zu Franziskus dem Medienheiligen jetzt.
1. Stück
Als der Borgia trauerte
Worin wir einen ungewöhnlich guten Papst schätzen lernen
Valencia, deine Nächte!
In Valencia hat er seine frühen Jahre verlebt, Rodrigo Borgia, der Spanier, der sich als Papst Alexander VI nennen wird. Aus Valencia nach Rom gebracht hat er seine überbordende Lebenslust und eine fast unerschöpflich gute Laune. Im Jahr 1500 noch schrieb der Gesandte Venedigs aus Rom: »Der Papst ist siebzig Jahre alt und wird jeden Tag jünger. Seine Sorgen überdauern nie eine Nacht. Er will sein Leben geniessen, ist froher Laune und tut nichts, was ihm nicht gut täte.«
Einmal aber haben die Römer den Borgia anders erlebt. Das war im Juni 1497, als die Leiche seines Sohnes Juan mit durchschnittener Kehle aus dem Tiber gezogen wurde. Vor den versammelten Kardinälen brach Rodrigo Borgia zusammen: »Mein Juan! Mein Sohn! Lieber würde ich sieben Papsttümer verlieren als eines meiner Kinder!«
Fünf Jahre zuvor hatte der Jubel in Rom keine Grenzen gekannt, als das Konklavefenster der Sixtinischen Kapelle aufging mit der unerwarteten Botschaft, zum neuen Papst gewählt sei der spanische Kardinal Rodrigo Borgia. Beim Krönungsritt herrschte ein derart begeistertes Gewühl, dass Alexander VI bei der Ankunft im Lateran ohnmächtig erschöpft vom Pferd sank.
Woher die Begeisterung des römischen Volkes, und zwar gerade der kleinen, bescheidenen Leute, für den Spanier? Alle kannten doch die nächtlichen Laster des Borgia. Viele Spässe wurden darüber gemacht. Aber moralische Empörung? »Peccati di carne, peccati di niente«, lautet der alte römische Spruch: »Sünden des Fleisches wiegen nicht schwer.«
Wichtiger als die Laster des Borgia waren dem Volk seine Tugenden. Schon als Kardinal hatte er sich den Ruf erworben, grossmütig zu sein im Umgang mit kleinen Leuten. So verhielt er sich auch als Papst. Mit gnadenloser Härte und Tücke hat Alexander VI die Macht der grossen römischen Geschlechter gebrochen, der Colonna, der Orsini. Aber das römische Volk hasste den Spanier deshalb nicht. Im Gegenteil. Diese feudalen Lokaltyrannen waren es ja, die das Volk aufs Blut ausgesogen hatten. Unter dem Spanier ging es den kleinen Leuten viel besser als zuvor unter den italienischen Päpsten.
Nach dem Abzug des Franzosenkönigs Karls VIII aus Rom lag dem Borgia zum Beispiel viel daran, die Engelsburg stärker zu befestigen. Doch mussten zu diesem Zweck eine Reihe von Häuschen armer Leute abgerissen werden. Die Verhandlungen mit ihnen zogen sich über Jahre hin – geduldig geführt im Auftrag eines Papstes, der sonst keine Minute zögerte, einem widerspenstigen Feudalherrn den Garaus zu machen.
Weniger verzeihlich als die Sünden des Fleisches sind die Sünden des Geldes. Sein ganzes grosses Vermögen hatte der Borgia eingesetzt, um sich, für seine Wahl zum Papst, Stimmen im Konklave zu kaufen. Mit den ärmeren Kardinälen hatte er angefangen. Die verlangten nicht so viel. Dann aber geriet er an die reichen. Die waren so anspruchsvoll, dass Rodrigo Borgia, um Papst zu werden, kurz vor der Wahl noch seinen eigenen Palazzo versetzen musste.
Ämterkauf heisst in der katholischen Kirche Simonie und gilt als Todsünde. Ohne Zweifel haben die Kardinäle mit Rodrigo Borgia einen Todsünder auf den Stuhl Petri erhoben. Doch dieser Todsünder war von allen der tüchtigste.
Der Borgia war ein ungemein fähiger Jurist. Ordnung hat er in die verschlampte römische Bürokratie gebracht. Urkunden, die zu erlangen vorher Jahrzehnte dauerte, unter ihm waren sie in wenigen Wochen da. Und wo immer er seine Nächte verbrachte, des Tags war dieser Papst mit vorbildlichem Pflichtbewusstsein im Amt.
Hocherstaunt aber waren die Römer, als der Spanier ankündigte, er werde jetzt das eigentliche Krebsübel der Kurie, das Nepotentum, radikal abschaffen. War nicht Rodrigo Borgia selber der Nepote, der Papstneffe par excellence?
Nach Rom geholt hatte ihn, als er vierundzwanzig war, sein Onkel, Papst Kalixt III. Dass dieser Spanier sich im Vatikan mit spanischen Neffen umgab, darf als Notwehr durchgehen. Kalixt sah keine andere Möglichkeit, sich als Ausländer in der römischen Schlangengrube zu behaupten. Die Italiener aber waren so verblüfft, dass sie eigens für diese Bande von Spaniern im Vatikan den Begriff nepotismo erfanden. Doch das schlechte Beispiel machte Schule: Die vier folgenden italienischen Päpste setzten die Neffenwirtschaft fort.
In einem gewissen Sinne hat Papst Alexander VI tatsächlich mit dem Nepotismus Schluss gemacht: Statt mit Hilfe seiner Neffen regierte der Borgia mit Hilfe seiner Kinder. Als er im Sommer 1501 Rom verliess, beauftragte er seine Tochter Lucrezia mit der Leitung des Kardinals-Kollegiums. So hat eine blühende junge Frau, kaum zwanzig Jahre alt, drei Monate lang dem Vatikan vorgestanden.
Sie machte ihre Sache gut. Der Borgia hatte ja dafür gesorgt, dass seine Tochter eine ausgezeichnete Bildung bekam. Latein und Griechisch konnte Lukrezia, Französisch, Spanisch und Italienisch. Später, als Herzogin von Ferrara, war sie eine vorbildliche Fürstin und Mäzenin der Künste. Und statt, wie die andern Frauen Roms, ihre Reize nach der neuesten Mode freimütig zu zeigen, zog Lukrezia elegante, aber streng hochgeschlossene – sogenannte gotische – Gewänder vor. So sehr war sie das Lieblingskind des Papstes, dass er für sie, als sie noch jünger war, am Fuss des päpstlichen Thrones ein eigenes Sitzkissen einrichten liess.
Weniger Glück als mit seiner Tochter Lucrezia hatte Alexander VI mit seinem Sohn Cesare. Machiavelli hat ihn gefeiert als einen Mann von »übermenschlichem Mut« und als den »perfekten Fürsten«. Die meisten Römer bewunderten ihn eher als den »perfekten Verbrecher«. Das Bewundernswerte am »criminale perfetto« war nach Ansicht der Renaissance, dass er keine Spuren hinterliess. So gibt es keinerlei Spuren, die beweisen, dass ausgerechnet Cesare seinem unglücklichen Bruder Juan die Kehle durchgeschnitten und seine Leiche in den Tiber geworfen hat. Gerade darin aber sahen viele den Beweis, dass der Täter nur der »perfekte Verbrecher«, also Cesare, sein konnte. Gar nicht perfekt war dagegen sein Mord an Alfonso de Aragón, dem zweiten Mann seiner Schwester Lucrezia. In Wirklichkeit war dieser Sohn des Papstes weder ein »criminale perfetto« noch ein »principe perfetto«, sondern einer von vielen gewissenlosen, brutalen jungen Warlords im Italien der Bürgerkriege.
Lucrezia und Cesare sind zwei Kinder des Papstes, die ihm seine eigentliche Lebensgefährtin, Vannozza de Catta-neis, geboren hat, eine Frau, die in ihrer Intelligenz, Tapferkeit und Diskretion Madame de Maintenon gleicht, der Lebensgefährtin des Sonnenkönigs. Insgesamt hatte Rodrigo Borgia wohl neun Kinder. Gemessen am Zölibatsgesetz der Kirche sind das neun zuviel. Aber der Valencianer nahm, wie so viele Italiener der Renaissance, sittliche Vorschriften einfach nicht ernst. Nicht am Gesetz der Kirche mass sich Rodrigo Borgia, sondern am Verhalten italienischer Fürsten seiner Zeit. So gesehen aber war Papst Alexander, mit seinen neun unehelichen Kindern, ganz banaler, man möchte fast sagen: braver Durchschnitt.
Wie ist es da nur möglich, dass dieser Papst in die Romane, in die Filme, ja noch ins Fernsehen des 21. Jahrhunderts eingehen konnte als grausigster Lustmolch aller Zeiten? Das hat er nicht seinen Lastern zu verdanken, sondern seinen Tugenden.
Entsprechend seinem weltoffenen Charakter war Rodrigo Borgia ein höchst liberaler Papst. Zum Beispiel liess er nicht zu, dass die Inquisition im Kirchenstaat tätig wurde. Ja er verbot im Kirchenstaat jegliche Zensur. Die unverhoffte Folge für jene Zeit so aussergewöhnlicher Liberalität war eine Flut von Schmähschriften gegen seine eigene Person.
Es grämte ihn nicht. So unerschütterlich war die gute Laune dieses Papstes, dass er sogar die schlimmsten Verleumdungen selber gerne las. Mit vergnügtem Kopfschütteln. Zum Beispiel den »Savelli-Brief«. Das ist bis heute der erfolgreichste Pornothriller um Familie Borgia. Nachts um drei habe im Vatikan eine Orgie von satanischer Verworfenheit stattgefunden: Lucrezia mit ihrem Vater und ihrem Bruder im blutschänderischen Bett. Vierzig Huren waren auch dabei. O die Superorgie der drei Borgia mit den vierzig nackten Huren im Vatikan!
Rodrigo Borgia war humanistisch gebildet und merkte deshalb auf der Stelle, dass der anonyme Verleumder diese Orgie aus Homers Ilias abgeschrieben hatte, wo es allerdings statt Huren Schweine sind und statt Lukrezia die Zauberin Circe. Wer im Vatikan war gebildet und zugleich böswillig genug, um den guten alten Homer so obszön zu verfremden? Nur einer kam in Frage: Johannes Burckard, des Papstes Zeremonienmeister. Rodrigo Borgia hat ihm deshalb kein Haar gekrümmt.
Ein Elsässer war Burckhard und somit, jener Zeit entsprechend, ein glühender deutscher Patriot. Nicht über das ausgelassene Privatleben des Papstes war er verbittert, sondern über dessen reichsfeindliche Politik. Mit seiner homerischen Orgien-Phantasie hoffte Burckhard, in Deutschland die nötige Empörung auszulösen, damit der Kaiser ein Konzil einberufe, um den Spanier vom Papstthron zu stürzen.
Das hat er nicht erreicht. Dennoch ist die Orgie aus dem »Savelli-Brief« eingegangen in Europas grosse Legenden. Porno allein langweilt ja schnell. Aber Porno und Papst, diese combinazione fesselt alle.
Und die furchtbaren Giftmorde des Borgia? Als er am 18. August 1503 starb, verbreitete sich das Gerücht, der Teufel habe ihn geholt. Bei einem wüsten Gelage im Vatikan habe Lucifer selber die vergifteten kandierten Früchte, mit denen der Borgia Kardinal Adriano ermorden wollte, heimlich auf des Papstes eigenen Teller geschmuggelt. So habe er sich die Seele, die ihm Rodrigo Borgia einst bei der simonistischen Papstwahl übereignen musste, jäh mitten aus dem Vatikan in die Hölle hinabgeholt.
Dies ist nicht bei Homer abgeschrieben. Vielmehr ist es eine Variante der Faust-Legende, die zuvor schon einem halben Dutzend Päpsten und Gegenpäpsten angehängt worden war. In Wirklichkeit ist Papst Alexander VI an Malaria gestorben.
Wir wollen ihn im Gedächtnis behalten als einen tüchtigen, liberalen und sozialen Papst, als einen guten Vater auch, der seine unehelichen Kinder nicht verleugnet hat, sondern treusorgend zu ihnen gestanden ist.
Und die Orgienlegenden? Auch die wollen wir in Ehren halten. Schliesslich sind sie schon so lange immer weiter ausgesponnen worden, in immer neuen Romanen und Filmen, dass sie jetzt, ähnlich wie das Gilgamesch-Epos oder wie Grimms Märchen, zum Kulturerbe der Menschheit gehören. Jeder von uns sollte sie seinen Kindern und Kindeskindern im trauten Kreis weitererzählen, allerdings nicht bebend vor sittlicher Empörung, sondern mit dem leichten Augenzwinkern italienischer Ironie: »Se non è vero, è ben trovato – Ist’s nicht wahr, so ist’s doch gut erfunden.«
2. Stück
Wie Papst Pius IX in Rom die Strassenbeleuchtung einführte
Worin wir lernen, dass Päpste weder krank noch böse sind
Stell dir, geneigte Leserin, geneigter Leser, stell dir etwas Unerhörtes vor. Stell dir vor, es würde in Rom ein neuer Papst gewählt. Und es fiele die Wahl auf einen Kardinal, der mit seiner ganzen Person den Fortschritt verkörpert. Stell dir das vor. Und jetzt versuche dir vorzustellen, wie es mit diesem Papst weitergehen wird. Es ist vorstellbar, weil es dies, genau dies, einmal schon gegeben hat.
Als Kardinal Sforza 1846 auf den Balkon des päpstlichen Palastes trat mit der uralten Proklamation »Ich verkünde euch eine grosse Freude: Habemus papam«, da war die »grosse Freude« keine rituelle Formel; grenzenlos war der Jubel, der ganz Rom erfasste bei der Nachricht, zum Papst gewählt sei der 54jährige Kardinal Giovanni Maria Graf Mastai-Ferretti.