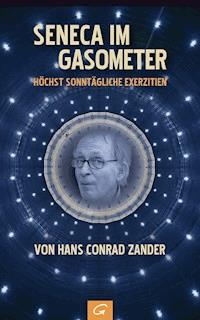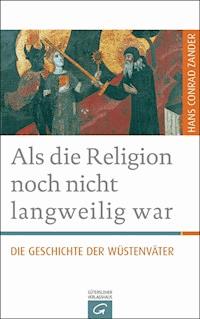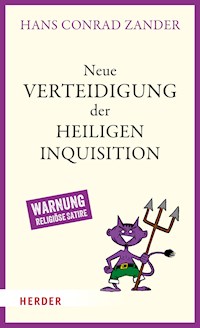3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Es ist aber auch ein Theater!« - eine Divina Commedia der Religion
- 24 pikante Funde aus den Archiven der Kirchengeschichte
- Ein himmlisches Vergnügen vom Großmeister der religiösen Satire!
Etwa zwei Kilogramm Brot pro Tag, zwischen 6 und 30 Eiern, rund drei Liter Wein und zweimal täglich Fleisch - so eine 6882-Kalorien-Diät hat es in sich. »Dicke Männer sind intelligenter als dünne« - diese Feststellung des Aristoteles diente Thomas von Aquin als Antwort auf die beständigen Hänseleien seiner Mitbrüder...
Der Auftakt seines Buches ist gewichtig, doch mit der ihm eigenen Leichtigkeit entfaltet Hans Conrad Zander in seinen Geschichten ein vergnügliches Panorama des kirchlichen Lebens in den vergangenen Jahrhunderten. Lesen Sie, wovor ein Mann die Flucht ergreifen sollte, was Ulrich Zwingli beim Friseur widerfuhr, wie Teresa von Avila es schaffte, ohne Psychotherapie selig zu werden, oder was es mit dem göttlichen Transvestiten auf sich hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anglikanisches Vorspiel: Was ist der Himmel?
In einem kleinen Chalet bei Arosa, ganz aus Lärchenholz, hat meine englische Großmutter ihre späten Jahre verlebt. Das Wichtigste, was sie aus Ashton-under-Line mitgebracht hatte, war die »Encyclopedia of Religion and Ethics«. Wie besessen las sie sich durch die dreizehn dicken Bände dieser einzigartigen Sammlung aller historischen Purzelbäume unserer Religion: »Much better than the Bible!«
Manchmal gönnte sie sich eine religiöse Pause. Dann hieß sie mich auf einem Schemelchen zu ihren Füßen Platz nehmen. Während wir zu zweit einträchtig Mandelschalen knackten, erzählte sie mir Geschichten. Lauter wahre Geschichten. Lauter komische Geschichten. Lauter Komödien aus der Geschichte der Religion.
Eins wunderte mich. Was sie mir erzählte, waren alles katholische Komödien. Dabei war sie doch Anglikanerin. »Großmutter, warum erzählst du mir keine protestantischen Komödien?«
Dass sie der High Church angehörte, also jenem Flügel der Kirche von England, der es eher mit den katholischen Dingen hält als mit den protestantischen, dies zu erklären, war ihr wohl zu heikel. Schweigend sah sie hinaus ins Schneegestöber über Arosa.
»Weißt du, was der Himmel ist?«
Wie sollte ich kleiner katholischer Bub das wissen?
»Der Himmel ist jener unendlich einsame Ort, wo die unendlich einsame protestantische Seele in unendlicher Einsamkeit mit ihrem unendlich einsamen Gotte ringt.« Und sie erzählte mir die Komödie von Robinson Crusoe. Nicht die gefälschte Komödie, die alle kennen, sondern die echte. Die wahre Komödie von Daniel Defoes protestantischer Einsamkeit.
Dann nichts mehr als das Knacken der Mandeln. Und ein leiser anglikanischer Seufzer: »Es gibt sie, die protestantische Komik. Es gibt sie auch. Es gibt sie schon. Man muss nur sehr sehr sorgfältig danach suchen.«
So entstand die Idee zu diesem Buch. Meiner anglikanischen Großmutter zu Ehren habe ich, zwischen Wittenberg und Genf rastlos hin- und herreisend, nach Spurenelementen protestantischer Komik gesucht. Habe, meiner Großmutter nacheifernd, alle 24 Bände der »Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche« durchforscht. Sehr sehr sorgfältig. Habe auch Helmut Thielicke gelesen. Bin sogar zu Peter Berger nach Boston geflogen. Und es wäre falsch zu behaupten, dass ich nicht fündig geworden wäre. In fünf Jahren habe ich immerhin fünfeinhalb protestantische Komödien gefunden.
Ob das reicht?
Im altehrwürdigen Verlagshaus zu Gütersloh, nach bleiernem Schweigen, eine ökumenische Einsicht: »Wir müssen zur katholischen Kirche zurück.«
So ist dieses Buch zustandegekommen. Ein paar evangelische Komödien gewiss, doch ökumenisch angereichert mit vielen katholischen Komödien. Die meisten neu, doch auch einige klassische Komödien, die in katholischen Verlagen vergriffen sind und von vielen vermisst wurden.
Ein ökumenisch korrektes Buch ist es trotzdem nicht geworden. Was meine englische Großmutter bewegt hat, was mich noch heute leidenschaftlich bewegt, ist ein ganz anderes Christentum. Es ist das Christentum von Thomas Morus und Erasmus von Rotterdam.
In einem Garten am Ufer der Themse in Chelsea haben die beiden zusammen gesessen, der englische Heilige und der niederländische Spötter, es war noch vor der Reformation. Einen Sommer lang haben sie zusammen gespottet über die römische Kurie. Über den Aberglauben der Pfaffen. Über die Komik der Heiligen Inquisition.
Wer von den beiden hat besser über die katholische Kirche gespottet? Wohl doch der Heilige. »Es ist«, so beschreibt Erasmus seinen englischen Freund, »als wäre es ihm ständig ums Lachen. Von Jugend auf hatte er solche Lust am Spaßmachen, dass man sagen könnte, er sei dazu geboren.«
Gespottet haben sie und haben geträumt: den everlasting dream von einer selbstironischen, aufgeklärten Katholizität. Es ist auch mein Traum.
Festgehalten hat Erasmus jene sommerlichen Gespräche an der Themse in einem Büchlein, das er, Thomas Morus zu Ehren, »Encomium Moriae« nannte: »Lob der Torheit«. Am besten gefällt mir jene Stelle, wo die Engel, auf den Flühen des Himmels hockend, staunend herabblicken in den Betrieb der Welt: »Es ist aber auch ein Theater!«
Heute wie eh ist es ein Theater mit Stücken, die tragischer sind als Shakespeares Tragödien. Mit Komödien, die so falsch gestimmt sind, dass selbst einem Engel das Lachen vergehen könnte – wäre nicht, unter allen falschen Komödien dieser Welt, doch eine wahre. Das ist, den Engeln zum himmlischen Vergnügen, die Divina Commedia der Religion.
1. Warum waren die Mönche so dick?
Worin wir die 6.882-Kalorien-Diät kennen lernen.
Vom größten Mönch und Gottesgelehrten des Mittelalters, vom heiligen Thomas von Aquin, wird berichtet, dass seine Mitbrüder extra für ihn eine nierenförmige Bucht in den klösterlichen Esstisch gehobelt haben. Damit er überhaupt Platz nehmen konnte. So dick war der heilige Thomas von Aquin.
Er nahm das übrigens mit Humor. Wenn seine Mitbrüder ihn hänselten, pflegte er zu sagen: »Schon bei Aristoteles steht geschrieben: Dicke Männer sind intelligenter als dünne.«
Unter diesem Gesichtspunkt kommt den Forschungen des französischen Historikers Michel Rouche besondere Bedeutung zu. Sie beweisen, dass die meisten Mönche des Mittelalters dem heiligen Thomas von Aquin an Intelligenz und an Humor kaum nachstanden. Rouche hat nämlich mit geradezu mönchischem Fleiß alle verfügbaren Dokumente über die klösterlichen Küchen und Keller jener Zeit ausgewertet. Hier sein statistisch exakter Schluss: In der Abtei Saint-Germain-des-Prés vor den Toren von Paris verzehrte im 10. Jahrhundert ein ganz normaler Mönch an einem ganz normalen Wochentag genau 6.882 Kalorien.
Wir wollen das gar nicht erst in Joule umrechnen, sonst wird es noch mehr. Begnügen wir uns mit dem Hinweis, dass die berühmte Kalorientabelle von Barbara Lüdecke für einen vergleichbaren modernen Beruf, nämlich für Lehrer, weit weniger als die Hälfte gestattet: nicht 6.880, sondern 2.400 Kalorien. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Besonders, wenn man bedenkt, dass die Menschen im Mittelalter wesentlich kleiner gewachsen waren als heute.
Gewiss, anderwärts ging es ein bisschen magerer zu als in Saint-Germain-des-Prés. Aber nur ein bisschen. Nirgendwo in Frankreich sank der normale tägliche Kalorienverbrauch pro Mönch unter 4.700. Und es sei gewarnt vor nationalen Vorurteilen. Zugegeben, französische Mönche aßen besser. Aber alle verfügbaren historischen Quellen deuten darauf hin: Deutsche Mönche – auch englische Mönche übrigens – aßen mehr. Wir werden noch sehen, warum.
Und auch dies sei betont: Michel Rouche ist keineswegs ein übelwollender Antiklerikaler, ein hämischer Linksintellektueller. Wie wohlwollend er im Gegenteil seine Rechnung aufgezogen hat, zeigt der Umstand, dass er nur die Rationen für einen ganz normalen klösterlichen Wochentag berechnet hat. Natürlich gab es auch die Fastenzeit, es gab die mageren Freitage. Vor allen Dingen aber gab es eine Unzahl von Festtagen. Und an Festtagen wurde in den Klöstern noch viel mehr gegessen als an normalen Tagen.
So ist denn das Ergebnis der wissenschaftlichen Diskussion, welche die Forschungen von Michel Rouche in Frankreich ausgelöst haben, zwar bestürzend, aber nicht überraschend. Andere französische Historiker, vor allem aber der belgische Soziologe Léo Moulin, haben inzwischen soviel zusätzliches Quellenmaterial zu Tage gefördert, dass zweifelsfrei feststeht: Michel Rouche hat sich verrechnet. Aber nicht nach oben, sondern nach unten. Die Mönche aßen und tranken in Wirklichkeit noch viel mehr als nur so zwischen 4.700 und 6.900 Kalorien. Waren es 7.000, 8.000, 9.000 oder gar 10.000 Kalorien? Schauen wir uns die klösterliche Speisekarte mit aller gebotenen wissenschaftlichen Nüchternheit im Detail an.
»Panem nostrum quotidianum … Unser tägliches Brot gib uns heute«: Rouche geht davon aus, dass der mittelalterliche Mönch jeden Tag anderthalb bis zwei Kilo Brot aß. Also, nach Barbara Lüdeckes Kalorientabelle, etwa 3.000 Kalorien. Tatsächlich ist erwiesen, dass damals ganz allgemein viel mehr Brot gegessen wurde als heute. Die Kartoffel war ja noch nicht aus Amerika eingeführt. Auch besitzen wir schriftliche Belege dafür, dass zum Beispiel die Abtei Cluny für etwa 300 Mönche täglich 470 Kilo Mehl verbrauchte, was also, auf den ersten Blick, gut anderthalb Kilo Brot pro Mönch ergibt.
Aber halt! Der französische Historiker hat eines übersehen: Aus Mehl kann man nicht nur Brot machen! Die Mönche des Mittelalters waren Meister in der Herstellung von süßem Gebäck: »Frigodolae«, »crispelae«, »refelae«, »cratones«, »fladines«, »bracelli«, »oblatae«, »piperati«, »mellati«, »nebulae« – so hießen die raffinierten Makronen, Krapfen und Waffeln, Honig- und Pfefferkuchen, Und wissen wir auch nicht im einzelnen ganz genau, wie diese Plätzchen geschmeckt haben, so steht doch dies fest: Sie waren alle unbeschreiblich süß und fett. Auf Barbara Lüdeckes Kalorientabelle stünden sie alle viel weiter oben als das schlichte Brot.
Soll ich jetzt noch lange reden von den erlesenen Rezepten für orientalische Süßigkeiten, die die Mönche im Gefolge der Kreuzritter aus Damaskus heimbrachten? Soll ich die kleinen Aniskuchen beschreiben, die Ingwer-Bonbons, die eingelegten Früchte oder gar die Krapfen mit Rosenblättern und Blattgold, die der Ruhm der Karmeliter-Küche waren?
Die größte Weltfremdheit aber hat sich Michel Rouche geleistet, als er nur einen täglichen Verbrauch von 0,6 bis 1,1 Gramm Honig pro Mönch in seine Rechnung aufnahm. Die Klosterbrüder waren ja die großen Bienenzüchter des Mittelalters. Sie brauchten enorme Mengen Wachs für die Altarkerzen, und Wachs ist nur ein Nebenerzeugnis von Honig. Es gab fast nichts, was im Mittelalter nicht mit Honig gesüßt wurde. So wissen wir zum Beispiel vom heiligen Ludwig, dass er während der Fastenzeit zur besonderen Abtötung des Leibes statt Wein Bier trank. Allerdings fügt der Chronist hinzu, dass Sankt Ludwig das Bier der Buße mit Honig süßte.
Die feinsten Schleckereien in den Klöstern waren eine Kombination von Honig und Mandeln. Als Sankt Franziskus im Kloster zu Assisi im Sterben lag, hatte er einen letzten Wunsch. Ihn gelüstete nach dem süßen Mandelgebäck der »tartarae«. Das ist eine Todsünde nach Barbara Lüdeckes Kalorientabelle. Eine Todsünde war es auch nach den Gesetzen der katholischen Kirche, wenn eine Nonne ein Männerkloster betrat. Und doch hat niemand es gewagt, dem heiligen Franz seinen letzten Wunsch abzuschlagen: dass nämlich Schwester Jakobine ihm persönlich eine Schale voll Mandelgebäck ans Sterbebett bringe. Denn das wusste der heilige Franziskus ganz genau: Keine buk die Tartarae so süß wie Schwester Jakobine von Settesoli. Ganz ungeniert berichten die frühen Chronisten des Franziskaner-Ordens von dieser Szene. Und ebenso ungeniert feiern sie ein paar Zeilen später den heiligen Franz als »pauperculum et nudum«, als Musterbeispiel freiwilliger Armut und Kasteiung. Waren sie sich des Widerspruchs nicht bewusst?
Nein, denn dies ist des frommen Rätsels Lösung: Sowenig wie der Hinduismus hat auch das Christentum jemals verbindliche Fastenregeln für Süßigkeiten aufgestellt. Die Askese beider Religionen ist ja stark geprägt von der Angst vor der Sexualität. So haben die Theologen des Mittelalters leidenschaftlich darüber disputiert, ob, nebst Fleisch und Eiern, auch Fisch und Milch samt allen Milchprodukten zum klösterlichen Fastengebot gehörten. Allen diesen Lebensmitteln wurde ja nachgesagt, dass sie das Verlangen des Mannes nach dem Weib stärken. Dass aber Makronenplätzchen und Honigwaffeln zur Sünde des Fleisches verleiten könnten, auf diese Idee kam vernünftigerweise niemand.
Später, als Südamerika entdeckt wurde und die spanischen Nonnen dort, um die verschärften Fastengebote des Konzils von Trient zu umgehen, aus einem ungenießbaren indianischen Getränk unsere heutige Schokolade entwickelten, hat Papst Pius V. sogar ausdrücklich entschieden: Wer Schokolade schleckt, bricht keinerlei Fastengebote (»non frangit ieiunium«).
Wenn aber selbst eine soviel strengere Zeit wie die Gegenreformation nichts gegen Schokolade einzuwenden hatte, wie hätte da das Mittelalter Gewissensbisse empfinden sollen, wenn etwa in manchen Klöstern, gleich am Aschermittwoch, jedem Mönch ein ganzer Sack mit dreißig Pfund Mandeln ausgeteilt wurde, wenn dann, an jedem Tag der Fastenzeit neu, mitten im Refektorium, im klösterlichen Esssaal, ein riesiger Kuchen thronte?
Es ist jetzt leider zu berichten, dass zwar das Fleisch, anders als Gebäck und Süßigkeiten, in den Mönchsregeln des Mittelalters streng verboten war, dass aber selbst diese Vorschrift – die strikteste von allen – fast nirgendwo eingehalten wurde.
Ich wage nicht zu behaupten, dass das an der göttlichen Vorsehung gelegen habe, aber zumindest höhere Gewalt war schon im Spiel. Alle zwei, drei Jahrzehnte brach ja im Mittelalter eine Epidemie aus, und in jeder dieser Epidemien brach regelmäßig die klösterliche Disziplin zusammen. Es dauerte dann, vor allem nach den großen Pestzeiten des späteren Mittelalters, Jahrzehnte, bevor auch nur die elementare Ordnung in den Klöstern wiederhergestellt war.
Das war das eine. Im Vergleich dazu wirkt der zweite Grund lächerlich: Es ist ein winziger Satz in der Regel des heiligen Benedikt. Der große Mönchsvater des Abendlandes hat nämlich, als er seine Regel aufstellte, eine ganz banale Lebenserfahrung außer acht gelassen: Ausnahmen sind aller Laster Anfang.
Gewiss hat der heilige Benedikt in seiner Regel Fleisch streng verboten. Aber er lässt ein fatales Hintertürchen offen: »Für Schwerkranke«, schreibt Benedikt, sei Fleisch erlaubt.
Die Folge war, dass sich in den mittelalterlichen Klöstern niemand so richtig gesund fühlte.
Jeder Mönch wurde ja zwölfmal im Jahr, mancherorts sogar dreißigmal, zur Ader gelassen. Und alle klösterlichen Regelbücher stimmen darin überein:
Wer zur Ader gelassen wurde, hat an den folgenden Tagen als Kranker Anspruch auf Fleisch. Das war die Ausnahme Numero eins.
Ausnahme Numero zwei: Es steht geschrieben im Ersten Buch Moses, dass Gott der Herr das Geflügel nicht am gleichen Tag erschaffen hat wie die Vierbeiner, sondern zusammen mit den Fischen. Enten, Wachteln und Truthähne galten deshalb theologisch als Fisch und fielen überhaupt nicht unter das Fleischverbot des heiligen Benedikt.
Ausnahme Numero drei: An manchen Tagen waren am klösterlichen Tisch Gäste zu bewirten, Männer von Welt, denen man die Entsagungen des heiligen Benedikt nicht zumuten konnte. Daher war es in jenen ritterlichen Zeiten ein selbstverständliches Gebot der Höflichkeit, dass an solchen Tagen die ganze Mönchsgemeinde mit den Gästen zusammen Fleisch aß.
So ging es weiter, aus einer Ausnahme ergab sich auch schon die nächste, bis zum Schluss in der wichtigsten Abtei, in Cluny, der Speisezettel nachweislich so aussah: An allen Tagen, außer mittwochs und freitags, zweimal Fleisch, und zwar mittags meist Rind, abends Schwein. Und als Vorspeise dazu jeweils Geflügel, Pastete oder Pökelfleisch.
Hätte uns so ein mittelalterlicher Klosterbraten geschmeckt? Mit Sicherheit nicht. Das Fleisch war nämlich völlig zerkocht. Schon die jüngeren Mönche hatten ja, wie die meisten Menschen des Mittelalters, keine Zähne mehr. Deshalb wurde auch, noch vor der Hauptspeise, auf jeden Fall ein »pulmentum« serviert, ein dicker Hafer oder Gerstenbrei, den auch der zahnloseste Jüngling problemlos hinunterschlingen konnte.
Viel raffinierter zubereitet als das Fleisch waren die Fischgerichte. Sie waren der eigentliche Ruhm der mittelalterlichen Klosterküche. Ja, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass es den Mönchen durch höchste Verfeinerung der Fischküche gelang, den Sinn dieser Ernährungsregel, nämlich Armut und Verzicht, ins pure Gegenteil zu verkehren. Das zeigt der Vorwurf, den die schöne Heloise ihrem unglücklichen Abälard im Kloster Cluny machte: Er solle doch auf den Luxus des Fisch-Essens verzichten und zur Buße wieder mal mit Fleisch vorlieb nehmen. Als feinster Fisch galt den Mönchen übrigens der Barsch. Flusskrebse dagegen – heute eines der erlesensten und teuersten Gerichte – mochten sie nicht. Kein Wunder: Flusskrebse galten ja noch bis ins 19. Jahrhundert als Arme-Leute-Essen.
Und die Eier? Hier lesen wir von sechs Eiern täglich für den Abt, von zwölf Eiern täglich für die jüngeren Mönche, dort gar von 30 Eiern pro Tag für jeden Mönch. Spiegeleier, Rühreier, weiche Eier, pochierte Eier, Omeletts – eine süddeutsche Chronik berichtet gar von einem Mönch, der am übermäßigen Genuss von Ostereiern gestorben ist.
Was wurde dazu getrunken? Michel Rouche setzt in seine Kalorienrechnung anderthalb Liter Wein ein, pro Tag und pro Mönch. Nur anderthalb Liter? Das wäre gelacht. Inzwischen besitzen wir genauere Zahlen. Im Frankreich des 9. Jahrhunderts waren es nachweislich etwa dreieinhalb Liter pro Tag. Und nach den sehr gewissenhaften Forschungen von Pater Philibert Schmitz trank der normale süddeutsche Mönch im 14. Jahrhundert sogar vier Liter Wein pro Tag. Wie wählerisch die Mönche dabei waren, zeigt eine Bemerkung des heiligen Bernhard von Clairvaux. Er beklagt sich, dass zum Essen drei verschiedene Krüge mit Wein angeboten würden und dass die Mönche solange an den drei Krügen schnupperten, bis sie herausgefunden hätten, welches die bessere Sorte sei.
Der heilige Bernhard von Clairvaux war zweifellos der einzige, der dabei ein schlechtes Gewissen hatte. Anders als heute galt ja der Wein im Mittelalter als Medizin. So gab auch der heilige Thomas von Aquin eher eine medizinische als eine theologische Lehrmeinung wieder, als er im 13. Jahrhundert wörtlich schrieb: »Wenn einer sich so sehr des Weines enthielte, dass er dadurch an seiner Gesundheit Schaden nähme, so wäre er nicht frei von Schuld.« Man beachte den Konjunktiv: »Wenn einer sich so sehr des Weines enthielte …«: Offensichtlich kann sich das der heilige Thomas im Ernst gar nicht vorstellen.
Dabei gab es für den Wein durchaus gewisse Regeln und milde Einschränkungen. Nicht für das Bier. Selbst in den meisten deutschen Klöstern galt Bier als etwas so Gemeines, dass besondere Vorschriften nicht nötig schienen. In der Abtei Trier hieß es zum Beispiel nur, an Fastentagen sei die Mahlzeit statt mit Wein »cum aqua aut cerevisia« zu servieren: »mit Wasser oder Bier«.
Bier oder Wasser – eins wie das andere. Wobei zu beachten ist, dass »aqua« mit »Wasser« gar nicht richtig übersetzt ist. Reines Wasser galt in mittelalterlichen Klöstern als gesundheitsschädlich. Was in den Chroniken als »aqua« bezeichnet wird, war stets verdünnter Fruchtsaft oder Beerensaft.
Wenn es nicht etwas ganz anderes war. Nicht zu Unrecht gilt der Patron Irlands, der heilige Patrick, als Erfinder des Whiskey. Drei von vier großen irischen Whiskey-Destillerien stehen heute genau dort, wo zuvor eine große Abtei stand. Kirschwasser, Mirabellenwasser, Pflümliwasser – fast alle die erlesenen Schnäpse Oberdeutschlands sind klösterlichen Ursprungs. Ein Blick auf Barbara Lüdeckes Kalorientabelle: Auch davon können die Mönche nicht schlank geworden sein.
Ich wollte noch etwas über das Gemüse sagen, über das Grundnahrungsmittel der klösterlichen Küche, nämlich über die dicken Bohnen, und über den Spinat, der erst als Delikatesse galt, wenn er drei Tage auf dem Feuer gestanden hatte. Aber lassen wir das. Es ist Zeit für die Frage aller Fragen: Warum haben diese Männer Gottes, die doch ein so hohes Ideal der Enthaltsamkeit und der Entsagung hatten, warum haben sie – sit venia verbis – so maßlos gefressen und gesoffen?
Zwei Dinge kommen da zusammen. Zwei Dinge, die sich in jeder religiösen Fehlentwicklung wiederfinden: ein Ideal, das nicht zur Wirklichkeit passt, und eine Wirklichkeit, die nicht zum Ideal passt.
Das Ideal bekamen die Mönche jede Nacht um Mitternacht zu hören, wenn in der Matutin, wie heute noch, die Lebensgeschichten der großen Heiligen vorgelesen wurden. Da war die Geschichte vom heiligen Nikolaus von Myra, der schon als Säugling soviel vom Fasten hielt, dass er sich mittwochs und freitags weigerte, die Milch von der Brust der Mutter zu trinken. Da war der heilige Romuald, der täglich nur eine Handvoll Erbsen aß. Da war der heilige Coelestin, für den das Jahr nicht nur eine, sondern sechs Fastenzeiten hatte. Da waren vor allem die großen Wüstenväter, zum Beispiel Antonius der Einsiedler, der niemals vor Sonnenuntergang etwas aß oder trank, und dann auch nur ein paar Kräuter und einen Becher Wasser.
So sah das Ideal aus. Und jetzt die Wirklichkeit: Ob Mönche oder nicht Mönche, die Menschen des Mittelalters lebten alle in panischer Angst vor dem Hungertod. Mochte das Wetter schlecht ausfallen, mochte ein Krieg hereinbrechen, schon waren ganze Länder vom Hunger bedroht. Ähnlich wie heute älteren Menschen die Angst vor dem Krebs, so saß damals jung und alt die Angst vor dem Hunger in den Knochen. Im Grunde war es ein gesunder, ein natürlicher Instinkt der Selbsterhaltung, dass der mittelalterliche Mensch immer dann, wenn etwas da war, soviel hinunterschlang wie nur möglich.
Ein zweites kam hinzu: die Angst vor der Kälte. Bis ins 12. Jahrhundert waren die Klöster, von der Küche einmal abgesehen, überhaupt nicht geheizt. Später hatte ein einziger Raum, das »calefactorium«, ein Kaminfeuer. Es gab im Grunde nur einen wirklichen Schutz gegen Kälte: eine möglichst dicke Schicht Fett.
Das ist auch der Grund, warum die deutsche Klosterküche noch fetter war als die französische, warum die dicken Bohnen und das Fleisch bei uns, entgegen dem ausdrücklichen Verbot des heiligen Benedikt, nur so im Schweineschmalz schwammen. Noch war ja Barbara Lüdecke nicht geboren, noch wusste kein Mensch, was Kalorien sind. Aber was frieren heißt, das wussten die deutschen Mönche des Mittelalters sehr wohl.
Natürlich war der gemeine Mann nicht besser als der Mönch. Auch er war besessen von der Gier, sich den Bauch vollzuschlagen. Aber der gemeine Mann konnte sich das nicht leisten. Leisten konnten es sich nur Adel und Klerus. So fanden auch am Hofe von Burgund maßlose Fressereien statt, bei denen vier Tage und vier Nächte lang ununterbrochen ein Gang nach dem anderen serviert wurde. Man mag dabei an Karl Marx denken oder an Goethe: Adel und Klerus haben ganze Länder aufgefressen und nicht dabei sich übergessen.
Trotzdem war ein Unterschied zwischen Adel und Klerus. So ein dicker Ritter, der fraß einfach fröhlich drauflos. Mit den Mönchen war es ein bisschen anders. Die Geschichte des mittelalterlichen Mönchtums ist durch die Jahrhunderte eine Geschichte des schlechten Gewissens. Sie ist eine Geschichte von oft heroischen Versuchen der Rückkehr zu einem Leben der Selbstbeherrschung und Entsagung. Warum ist soviel guter Wille so oft gescheitert?
Vielleicht ist es wichtig zu wissen, woher das Ideal kam. Es stammte im wesentlichen von den Wüstenvätern, den ersten Einsiedlern und Mönchen im frühchristlichen Ägypten. Anders als heute war Ägypten damals ein reiches Land. Und es hatte ein paradiesisches Klima. Es mochte schon seinen Sinn haben, wenn der heilige Antonius oder der heilige Pachomius Abschied nahmen vom süßen Leben im alten Ägypten, um ein bisschen Buße zu tun und zu fasten. So wie es durchaus menschlich und sinnvoll ist, wenn wir heute ein bisschen fasten.
Im europäischen Mittelalter aber, in einer Zeit der drohenden Hungersnöte und der bitteren Kälte, war dieses Ideal unmenschlich und unchristlich. Schon der heilige Benedikt, ein Italiener der späten Antike, hat vor der Askese als Selbstzweck gewarnt. Hätte Benedikt im Mittelalter nördlich von den Alpen gelebt, er hätte wahrscheinlich seinen Mönchen nicht das Fleischessen, sondern im Gegenteil das Fasten von vornherein verboten und dafür gesorgt, dass sie alle eine zwar bescheidene, aber ausreichende und kräftige Nahrung bekämen.
Aber Benedikt mit seiner christlichen und menschlichen Vernunft war längst tot. Den Ton gab jetzt ein so verstiegener Idealist wie der heilige Bernhard von Clairvaux an, von dem es noch heute im mitternächtlichen Offizium der Mönche heißt: »Quoties sumendus ei cibus erat, toties tormentum se subire putabat – jedesmal, wenn er doch etwas essen musste, war es ihm, als würde er gefoltert.«
So kam es zu dem klassischen psychologischen Teufelskreis aller Suchtkrankheiten. Da knieten die Mönche in der Kirche und sangen voll tiefer, echter Frömmigkeit von Selbstbeherrschung und Entsagung. Ein paar Stunden später aber saßen sie zusammen in der Küche und sangen im besten Küchenlatein: »O beata viscera, nulla sit vobis mora – mögest du niemals darben, seliger Bauch.«
Auf diese Weise hin- und hergerissen zwischen einem unmenschlichen Ideal und einer unmenschlichen Wirklichkeit, wurde die Fresslust der Mönche des Mittelalters zum Gespött für die Welt. Sie wurden zum Exempel für das, was Blaise Pascal gemeint hat mit dem äußerst menschlichen, äußerst christlichen Satz: »Qui veut faire l’ange fait la bête – Wer den Engel spielen will, der sinkt herab zum Tier.«
2. Francis Drake hinter einem Kaktus in Panama.
Worin wir den ökumenischen Dialog eröffnen.
Glühend brennt die Mittagssonne auf die kleine Hafenstadt von Vera Cruz. Wir sind in Mexiko im Jahre 1567.
Selbst drunten, in den sonst so lärmigen Tavernen am Hafen, ist der Friede mittäglicher Erschöpfung eingekehrt. Nur droben, vor dem Palast des spanischen Gouverneurs, blinzelt müde eine Wache. Kinder, Weiber, Hunde – alles schläft. Und in dem weißgetünchten Dominikanerkloster haben sich auch die sonst so wachsamen Väter von der allgegenwärtigen Heiligen Inquisition zurückgezogen zur wohlverdienten Siesta.
Da, mit einemmal, gellt ein Schrei des Entsetzens durch die friedlich verschlafene Stadt: »Los Luteranos! Los Luteranos! « Die Protestanten kommen! Die Protestanten!
Einen Augenblick später wimmelt es in allen Gassen von Vera Cruz von panisch verschreckten Menschen. Weiber, Kinder, Hunde – alles flieht zum Tor hinaus in die Berge. Die Wache rüttelt den spanischen Gouverneur aus dem Bett. Und drüben am Dominikanerkloster schiebt sich aus jeder Schießscharte ein Gewehr der heiligen Inquisition.
Was ist passiert? Draußen vor dem Hafen ist eine kleine Flotte von bewaffneten Handelsschiffen aufgetaucht. Das ist an sich etwas ganz Normales. Nur eines ist nicht normal: Die Schiffe tragen alle auf dem mittleren Segel zwei Buchstaben, die jeder katholischen Seele im 16. Jahrhundert den Schauder über den Rücken jagen: E. R.: – Elisabeth Regina; Elisabeth, Königin von England.
Inzwischen ist der spanische Gouverneur von Vera Cruz aufgewacht und hat die Lage überdacht. Mit seinen paar Kanonen und Soldaten kann er nicht viel ausrichten gegen die Schiffe Ihrer protestantischen Majestät. Infolgedessen entschließt er sich zum ökumenischen Dialog. Und es zeigt sich im Gespräch, dass die Engländer gar nichts Unchristliches wollen. Sie haben nur, gefesselt in den unteren Verschlägen ihrer Schiffe, ein paar hundert Negerheiden, die sie gern als Sklaven an die Katholiken verkaufen möchten. Man feilscht ein bisschen, man einigt sich schließlich auf fünftausend Goldmünzen, und am folgenden Morgen treiben Katholiken und Protestanten die gefesselten Negerheiden gemeinsam auf die nahe gelegenen Plantagen.
Und wieder steht die heiße Mittagssonne Mexikos im Zenit über dem Hafen von Vera Cruz. Die Spanier haben sich zur Siesta zurückgezogen, die Neger malochen in den Plantagen, und die Engländer trinken Tee. Nichts scheint den tropischen Frieden zwischen den Völkern und Konfessionen mehr stören zu können.
Da, mit einemmal gellt ein Schrei des Entsetzens durch den Hafen. Ein Schrei aus dem Mastkorb des britischen Flaggschiffes, das den treu lutheranischen Namen »Jesus of Lubeke« – »Jesus von Lübeck« trägt: »The Popists! The Popists!« Die Papisten kommen! Die Papisten!
Was ist jetzt schon wieder passiert? Vierundzwanzig Stunden nach den Engländern taucht eine zweite Flotte vor dem Hafen von Vera Cruz auf. Eine gewaltige Kriegsflotte ist es diesmal. Es ist die Silberflotte Seiner katholischen Majestät König Philipps II. von Spanien. Sein Name genügt, um jeder protestantischen Seele des 16. Jahrhunderts den Schauder über den Rücken zu jagen.
Und es macht die Silberflotte Philipps II. in der Tat kurzen Prozess mit den paar englischen Schiffen. »Jesus von Lübeck« wird gekapert, ein paar kleinere englische Schiffe gehen unter, die meisten Engländer werden gefangen genommen. Ab geht es mit ihnen ins Dominikanerkloster.
Nun gehört es zu den Gewohnheiten der Heiligen Inquisition, über alles, was sie tut, genau Buchhaltung zu führen. Wir wissen deshalb Bescheid über das Schicksal der englischen Seeleute in Vera Cruz. Unter den Daumenschrauben und Brenneisen der Inquisition äußern fast alle sehr schnell den innigen Wunsch, katholisch zu werden. Sie kommen mit milden Strafen davon: zweihundert Peitschenhiebe, sechs Jahre Galeere und für den Rest des Lebens die Auflage, ein gelbes Büßerhemd zu tragen.
Schwieriger ist der Fall zweier Engländer, die bei allen väterlichen Aufforderungen zur Bekehrung einfach den Kopf schütteln. Da kann das hohe Kirchengericht von Vera Cruz nicht anders, als die beiden zuerst erdrosseln und dann verbrennen.
Bleibt ein letzter Fall. Das ist ein britischer Matrose, der sich den Dominikanern von Vera Cruz nicht bloß schweigend widersetzt, sondern ihnen frech jene unübersetzbare Beschimpfung entgegenschleudert, die heute noch der Schlachtruf militanter britischer Protestanten ist: »Fuck the Pope! Fuck the Pope!«
Das ist eine derart schauderbare Blasphemie, dass sich die Heilige Inquisition von Mexiko wegen besonderer Schwere des Falles für inkompetent erklärt und den protestantischen Frevler per Schiff an die spanische Inquisition überweist. Auf dem Marktplatz von Sevilla wird er unter dem Jubel einer unübersehbaren Menge feierlich bei lebendigem Leibe verbrannt werden.
Es ist jetzt Zeit zu berichten, dass gar nicht alle Engländer in spanische Hände gefallen sind. Ein englisches Schiff, die »Minion«, ist entkommen. Und auf diesem Schiff befindet sich ein junger Seemann, dem die Niederlage von Vera Cruz zum entscheidenden Erlebnis wird. Bei Martin Luther und Johannes Calvin tut er den heiligen Schwur, sein ganzes Leben dem Kampf gegen Spanien, gegen die Katholiken zu weihen. Der junge Mann heißt Francis Drake.
Wie alt Francis Drake zu diesem Zeitpunkt ist, wissen wir nicht. Denn er ist ein Mann von niedriger Herkunft, und das 16. Jahrhundert ist der Ansicht, dass es sich nur bei Adeligen lohne, das genaue Geburtsdatum festzuhalten. Wahrscheinlich ist er Anfang Zwanzig. Und ehrgeizig ist er: Nicht nur in der Frömmigkeit, sondern auch im Leben möchte er es zu etwas bringen. Wie lässt sich beides miteinander verbinden? Ganz einfach: durch die heilige protestantische Seeräuberei.
Man bedenke: Spanien beherrscht die Ozeane, Spanien beherrscht die Neue Welt. Sämtliche katholischen Armeen in Europa werden finanziert durch das Silber und das Gold, das Spaniens Schiffe aus Amerika herübertragen. Am 24. Mai 1572 segelt Francis Drake an der Spitze einer ganzen Seeräuberflotte aus dem Hafen von Plymouth ab: die Seele voll Gier nach Rache am katholischen Antichrist, das Herz voll Gier nach Gold.
Mitternacht, die Geisterstunde. Nombre de Dios, der spanische Silberhafen in Mittelamerika, liegt im Frieden des Herrn. Weiber, Kinder, Katzen, Hunde, selbst die königliche Wache – alles schläft. Nur aus dem Dominikanerkloster dringen Fackelschein und der mitternächtliche Gesang der Väter von der heiligen Inquisition: »Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit – Selig der Mann, der die Gesellschaft der Frevler meidet und auf den Wegen der Sünde nicht wandelt.«
Plötzlich gellt, uns bereits bekannt, ein Schrei des Entsetzens durch den mitternächtlichen Frieden: »Los Luteranos! Los Luteranos!« Die Frevler, die Sünder sind da! In Sekundenschnelle hat der protestantische Seeräuberhaufen die Garde vor dem spanischen Schatzhaus überwältigt. »Schnell eine Fackel!«, schreit Francis Drake. Dann steht er in dem riesigen Gewölbe, geblendet von Silber und Gold. Vor ihm liegen alle Schätze Westindiens. Er braucht nur zuzugreifen und er ist der reichste Mann der Welt. Er braucht das alles nur noch auf seine Schiffe zu verladen, und im Palast zu Madrid, im Vatikan zu Rom wird nichts mehr sein als biblisches Heulen und Zähneklappern.
In diesem Augenblick geschieht etwas ganz Blödes. Es fängt an zu regnen. Und es ist ein tropischer Platzregen, was da zur Mitternacht über Nombre de Dios niedergeht. Im Nu ist das Pulver der Seeräuber vor dem Schatzhaus nass. Sie sind praktisch entwaffnet. Panik ergreift sie. In wildem Durcheinander fliehen sie auf ihre Schiffe zurück. Als letzter klettert, bleich vor Wut, Francis Drake an Bord. Er humpelt. Er hat von hinten einen Schuss ins Bein gekriegt. Und er kann froh sein, dass er im Schutz der Nacht aus dem Hafen entkommt.
Wir dürfen annehmen, dass Francis Drake die folgenden Tage mit drei Dingen verbringt: erstens sein Bein zu verbinden, zweitens sich zu fragen, ob der liebe Gott nicht doch katholisch sei, und drittens einen neuen Plan zu fassen.
Der sieht so aus: Das Gold und Silber im Schatzhaus von Nombre de Dios kommt aus Peru. Mit einer endlosen Maultierkarawane bringt es der Schatzmeister von Lima regelmäßig durchs Gebirge. Es ist ein ganz schmaler Pfad und Hunderte von Meilen lang. Was liegt näher, als sich einfach irgendwo am Rande dieses Pfades hinter einem großen Kaktus niederzulassen und auf die Goldkarawane zu warten?
Der Plan ist kaum gefasst, da taucht ein Kriegsschiff vor der englischen Seeräuberflotte auf. Aber komisch: Es ist kein spanisches, sondern ein französisches Schiff. Aus konfessionellen Gründen will Francis Drake es trotzdem in Grund und Boden schießen, da stellt sich im letzten Augenblick heraus, dass die Franzosen Protestanten sind, Kapitän La Testu ist ihr Chef, ein Hugenotte, der eben mit knapper Not dem Massaker der Bartholomäusnacht entkommen ist. Und auch er hat geschworen, sich für den Rest seines Lebens durch die heilige protestantische Seeräuberei am Katholizismus zu rächen.
Das ist der ideale Geschäftspartner für Francis Drake. Gemeinsam verstecken die beiden ihre Schiffe in einer abgelegenen Bucht an der Küste von Panama. Gemeinsam überhäufen sie den örtlichen Indianerstamm mit Glasperlen und Ohrringen. Und dann geht es, trap-trap-trap, hinter den Rothäuten her hinauf ins Gebirge, zum Maultierpfad von Lima nach Nombre de Dios: »Durch diese hohle Gasse muss er kommen.«
Mitternacht, die Geisterstunde. Unter dem katholischen Sternenhimmel von Panama lauern zwei protestantische Räuberbanden am Wegesrand, zuvorderst Monsieur La Testu und Mister Drake, wohlversteckt, ich sagte es schon, hinter einem großen Kaktus. Dann ein fernes Hufgetrappel. Dann, im sanften Mondenschein, eine unabsehbare Kolonne von Eselsohren. Dann, hinter dem Kaktus hervor, das Blitzen einer Gewehrmündung, und aus Hunderten von spanischen Kehlen der Schrei des Entsetzens: »Los Luteranos!«
Das Gemetzel ist kurz. Den meisten Spaniern, auch dem Schatzmeister, gelingt die Flucht rückwärts Richtung Lima. Zurück bleiben ein paar hundert Maulesel, die verstört durch die Kakteen irren. Und ihre Fracht, fünfzehn Tonnen Gold und Silber, sind in protestantische Hände gefallen.
Der Abtransport dieser Herrlichkeiten hinab zur Küste ist ein bisschen schwierig. So mancher Silbersack, so mancher Goldbarren bleibt in dem Kaktusgestrüpp hängen. Das macht aber nichts. Denn zum Glück ist Monsieur La Testu bei dem nächtlichen Gemetzel umgekommen. Francis Drake braucht also nicht zu teilen. Und mit gewaltigem Tiefgang segelt die englische Räuberflotte aus ihrem Versteck.
Es ist jetzt Zeit heimzukehren. Zwei Drittel der Mannschaft von Francis Drake sind schon an Fieber gestorben, von mexikanischen Messern erdolcht worden oder der Heiligen Inquisition in die Hände gefallen. Am 9. August 1573 segelt Francis Drake in den Hafen von Plymouth ein.
Es ist Sonntagmorgen. Die streng protestantische Stadt scheint menschenleer. Männer, Kinder, Weiber, Hunde – alles ist sittsam bei der Predigt. Da, ein Ruf durch alle Gassen: »Francis Drake ist da! Francis Drake ist zurück!« Und es mögen die Pastoren wettern, wie sie wollen: Im Nu sind alle Kirchen leer. Ganz Plymouth stürzt zum Hafen. Alle wollen ihn sehen: Francis Drake, ihn und seine Schiffe voll Silber und Gold.
Königin Elisabeth wird ihn empfangen. Sir Francis Drake wird er heißen. Als oberster Seeräuber vom Dienste Ihrer graziösen Majestät wird er auf allen katholischen Ozeanen Angst und Schrecken verbreiten. Und wo er landet mit seiner Räuberflotte: an den Küsten Portugals und Galiziens, auf den Karibischen Inseln, in den Häfen Brasiliens und Chiles, ja bis hinauf nach San Francisco, da heißt es jetzt schon nicht mehr: »Los Luteranos!«; da gellt ein ganz neuer spanischer Schreckensruf: »El draque!« – »Der Drachen kommt! Sir Francis Drake!« Und noch Jahrhunderte nach seinem Tod am 28. Januar 1596 werden ihn die Schulbücher, jedenfalls in protestantischen Landen, feiern als den größten Seeräuber aller Zeiten.
Aber lassen wir das. Bleiben wir an diesem Sonntagmorgen im August 1573 im Hafen von Plymouth. Schauen wir zu, wie Francis Drake mit einem lässigen Sprung an Land geht. Wie Tausende ihn begeistert umringen. Wie er lacht, wie er erzählt. Wie ihn die Menge jubelnd auf die Schultern hebt. Und wie er angibt, wie er aufschneidet, dass sich in den Hafenkneipen von Plymouth die Balken biegen.
»Denn Schönres gibt es auf der Erde nicht Als ersten Ruhmes zartes Morgenlicht.«
3. Der heilige Ignatius von Loyola auf dem Örtchen.
Worin wir bis aufs Kleinste dem absoluten Chef gehorchen lernen.
Von neuen Tugenden ist viel die Rede am Unternehmens-Standort Deutschland: von »Flexibilität« und von »Mobilität« der Untergebenen und, für die Vorgesetzten, von »Strategie« und »Vision«. An schönen neuen Wörtern fehlt es uns wahrlich nicht. Wo aber ist ein Mann, der all die neuen Tugenden in Person verkörpert? Hat es ihn je gegeben, diesen Mann?
Ja. Am 22. April 1541 tritt er an die Spitze des ersten modern organisierten Unternehmens der Geschichte. Ignatius von Loyola. Im Alter von 50 Jahren wird der Spanier in Rom erster General der neugegründeten »Gesellschaft Jesu«. Des Jesuitenordens. Der »Compañia de Jesús«.
General, das klingt so militärisch wie die Heldentaten des jungen Ignatius bei der Verteidigung der Festung Pamplona. Und doch ist es kein Zufall, dass Pater Bobadilla, sein Vertrauter seit den Pariser Studienjahren, den Charakter des Ordensgründers mit einem Begriff umschreibt, der eher dem modernen Wirtschaftsleben entnommen scheint. Ignatius von Loyola, sagt Bobadilla, war der »padrone assoluto«, der »absolute Chef«.
»Wenn Hochwürden Ignatius einen Befehl erteilt«, schreibt, wohlgemerkt, Ignatius selbst, »so hat jeder sofort zu folgen, als ob er die Stimme des Herrn vernähme, der im Namen seiner göttlichen Majestät befiehlt. Ein jeder muss in diesem Fall so blind und schnell gehorchen, dass er, falls er am Beten ist, das Gebet sofort abbricht, falls am Schreiben, bei der Stimme des Chefs, das heißt: bei der Stimme Gottes, den angefangenen Buchstaben, zum Beispiel a oder b, unvollendet lässt.«
Mobilität. Alles, was die alten Mönchsorden schwerfällig und unbeweglich machte, schafft der neue Chef des neuen Ordens ab: das feierliche Chorgebet, das Ordenskleid, ja das Kloster überhaupt. Statt der benediktinischen Regel der »stabilitas loci«, des beschaulichen Verweilens am Ort, erfindet er ein ganz neues Gelübde, mit dem sich jeder Jesuit verpflichtet, jederzeit an jedem beliebigen Ort der Erde einsatzbereit dem Papst zur Verfügung zu stehen.
»Mobilität« als Religion. Und »Flexibilität«. In aller Munde ist das Wort. Aber was heißt das eigentlich, »Flexibilität«? Ignatius von Loyola hat es als erster unmissverständlich definiert. »In den Händen meines Chefs«, schreibt der absolute Chef, »soll ich sein wie ein weiches Wachskügelchen in den Fingern dessen, der es formt.«
Für jene, die das Bild nicht schnell genug begreifen, fügt er ein zweites hinzu: In den Händen meines Chefs soll ich sein »wie ein Leichnam, der keinen eigenen Willen hat und kein eigenes Gefühl«.
»Kadavergehorsam«: Der Begriff hat viel Empörung ausgelöst. Zu Unrecht. Keiner hat so gut wie Ignatius gewusst, dass erfolgreiches Management den Mitarbeiter aus dem willenlosen Ausführen von Befehlen stufenweise hinaufführen muss in höhere Formen der Motivation. Zu diesem Zweck hat er die erste völlig moderne Methode des Motivationstrainings entwickelt. Das sind die vierwöchigen »Exerzitien«.
Wie ein Nachwuchs-Manager im Psycho-Seminar lernt der Novize in den ignatianischen »Exerzitien«, seine Motivationsstruktur in unzählige »Punkte« aufzulösen, jeden dieser »Punkte« zu analysieren, zu kontrollieren und neu auszurichten auf jene Vision, die der heilige Ignatius in der Ordenssatzung 104 mal wiederholt: »Omnia ad majorem Dei gloriam – alles zur höheren Ehre Gottes«.
Heute gilt es als selbstverständliche Voraussetzung des unternehmerischen Erfolgs, dass die Mitarbeiter sich in ihrem ganzen Denken mit der Vision ihres Unternehmens identifizieren, dass also ein VW-Mann die Welt mit VW-Augen sieht, ein Opel-Mann die Welt mit Opel-Augen. Genau das hat Ignatius als erster erkannt und praktiziert, wenn er seinen Jesuiten vorschreibt: »Wir müssen so mit der Katholischen Kirche übereinstimmen, dass, wenn sie etwas für schwarz erklärt, was uns dem ersten Anschein nach weiß erscheint, wir dasselbe schwarz nennen müssen. «
»Gehorsam des Denkens«. Nur durch ihn erreichen wir die höchste Stufe der Motivation. Das ist der »vorauseilende Gehorsam«. So sehr habe ich mich identifiziert mit dem Denken, mit dem Willen meines Chefs, dass er mich hinschicken kann, wo er will, hochmotiviert, flexibel und mobil tue ich ganz von alleine genau das, was der Vision meines Chefs entspricht.
Nicht dass der Jesuitengeneral ein Visionär gewesen wäre wie seine Zeitgenossin, die heilige Theresia von Avila. Während sie den Himmel über Spanien voll von Farben und Figuren sah, wirken seine Ekstasen blass und dürftig. Jesus erscheint ihm zum Beispiel als farblos schimmerndes Stabmännchen, die Göttliche Dreifaltigkeit gar als riesiges Klavier mit nur drei Tasten. Vision im klassischen Sinn ist das nicht.
Es ist moderne Vision. Strategische Vision. Nicht auf das schöne Bild der Gottheit kommt es an, sondern auf das, was die göttliche Erscheinung will. »Mein Wille ist es«, sagt Jesus zu Ignatius, »die gesamte Welt und sämtliche Feinde zu unterwerfen.«
Spanische und portugiesische Kapitäne hatten die ganze Welt geöffnet für die neuen europäischen Handels-Gesellschaften. Genauso sollte jetzt die neugegründete »Gesellschaft Jesu« den neuen grenzenlosen Markt der Welt für Christus erobern. Und Ignatius war Stratege genug, um zu erkennen, dass diese Unterwerfung nicht mehr mit den alten militärischen Mitteln der Kreuzritter zu erfolgen hatte, sondern, neu und modern, mit den Mitteln der Kommunikation.
Allein das Verzeichnis der Briefe, die der Jesuitengeneral seinem Sekretär Polanco in neun Jahren diktierte, also nicht die Briefe selbst, sondern nur ihre Auflistung, umfasst 1.597 Seiten. Wie in einem elektronischen Netzwerk der Kommunikation liefen so sämtliche Informationen, Kontrollen und Entscheidungen des neuen Ordens beim absoluten Chef in Rom zusammen. Er sei seine »Hand«, hat Ignatius über seinen Sekretär Polanco gesagt. Ich würde sagen: Pater Polanco war das Handy des heiligen Ignatius.
Strategie fängt damit an, dass der Chef den eigenen Standort fest im Griff hat. Dafür, sagte der heilige Ignatius zu Pater Manare, gebe es ein untrügliches Zeichen: die Sauberkeit am Standort. Präziser gesagt: die Sauberkeit am Standörtchen. Im römischen Professhaus erließ der absolute Chef strenge Instruktionen nicht nur für die tägliche blitzblanke Reinigung des Klos, sondern auch für die tägliche Kontrolle der Reinigung. So oft als möglich sah er selber nach. Und wehe, wenn der heilige Ignatius die Klotüre oder, was ihn besonders ärgerte, den Klodeckel offen fand. Sofort ließ er den Schuldigen ermitteln und vor aller Augen im Speisesaal auspeitschen.
Noch war das Taschentuch nicht erfunden. Dennoch fand es Ignatius unerträglich, wenn seine Mitarbeiter sich, nach Art der Zeit, auf den Boden schneuzten. An allen möglichen Ecken des römischen Professhauses ließ er deshalb geeignete Näpfe aufstellen, in die er sich selber vorbildlich schneuzte.
Unpolierte oder gar unordentlich in den Zimmern herumliegende Schuhe gab’s nicht beim heiligen Ignatius. Als er einmal einen älteren Mitbruder, einen angesehenen Gelehrten, mit aufgelöstem Schuhbändel erwischte, verurteilte er ihn dazu, sein Abendessen vor aller Augen am Katzentischchen kniend einzunehmen.
Besucher aus fernen Ländern pflegten den väterlichen Charme zu rühmen, mit dem der absolute Chef sie in Rom empfing. Seine engsten Mitarbeiter haben von diesem Charme wenig gespürt. In neun Jahren, klagte Polanco, der Sekretär, habe er »kaum jemals ein gutes Wort« gehört. Seinen engsten Vertrauten, Jerónimo Nadal, stauchte er oft so zusammen, dass der Unglückliche sich abends in bittere Tränen auflöste. Nicht besser ging es Pater Laínez, dem späteren zweiten Ordensgeneral. Nach seiner Rückkehr aus Flandern, so schildert es Laínez selbst, sei er vom Chef in Rom immer wieder so hart angefahren worden, dass er schließlich unter schweren Depressionen gelitten und abends oft gebetet habe: »O Gott, was habe ich verbrochen, dass dieser Heilige mich so behandelt?«
Ja, so streng konnte der heilige Ignatius sein. Als er einen jungen, noch studierenden Mitbruder dabei erwischte, wie er einem andern zum Spaß einen Klaps auf den Hintern versetzte und so die »regula tactus« verletzte, das Verbot, sich gegenseitig zu berühren, warf er den Schuldigen fristlos aus der »Gesellschaft Jesu«.
Mit Nörglern und Besserwissern machte der heilige Ignatius besonders kurzen Prozess. So warf er einmal acht junge Ordensbrüder aus dem Römischen Kolleg, ein anderes Mal zehn, zu Pfingsten 1555, als wär’ es die Apostelschar, zwölf auf einen Schlag. So ist es gewiss nicht falsch, den heiligen Ignatius auch als Erfinder der »Personalverschlankung« zu verehren, des »Downsizing«, wie deutsche Unternehmer heute sagen.
Neun Gefährten waren es gewesen, die ihm am 22. April 1541 Gehorsam geschworen hatten. Fünfzehn Jahre danach, bei seinem Tod, waren es kaum mehr als tausend. Zum Vergleich: Der Dominikanerorden, lange Zeit die eigentliche Konkurrenz des Jesuitenordens , zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 30 000 Mönche. Doch was waren die 30 000 faulen Mönche des heiligen Dominikus gegen die 1000 jungen Jesuiten mit ihrer überlegenen Mobilität und Flexibilität, Vision und Strategie? Als »Fürstenbeichtväter«, zuerst in Lissabon, dann in Madrid, in Paris, in Wien schickten sie sich an, subtil und souverän die Herrscher der Welt zu beherrschen. Und all den deutschen Ketzern, die eben noch ihren Hohn so übermütig ausgegossen hatten über die verwahrloste, verkommene Kirche Roms, saß jetzt, tief in den protestantischen Knochen, der »Jesuitenschreck«.
An der römischen Kurie war die Macht der Jesuiten schon zu Lebzeiten des heiligen Ignatius so groß, dass selbst Papst Paul IV., der Caraffa-Papst, der doch den Spanier von ganzem Herzen hasste, es niemals wagte, ihn anders zu empfangen als mit allen Zeichen höchster Ehrerbietung. Nie musste der »absolute Chef«, wie andere Leute, vor dem Papst knien, nie auch nur unbedeckten Hauptes stehen. Erst als der Jesuitengeneral 1556 starb, wagte Gottes Stellvertreter zu sagen, was er dachte: Ignatius von Loyola, so das Urteil Papst Pauls IV., sei ein »Tyrann« gewesen.
Hier irrt der Papst. Ignatius von Loyola war kein später Nachfahre antiker Tyrannen, sondern ein kühner Vorläufer moderner Unternehmensführung. All die neuen Tugenden, von denen heute bei uns eine Legion von Möchtegern-Ignatiussen redet, der spanische Ordensgründer hat sie, im prophetischen Vorgriff auf die Moderne, als erster umgesetzt in die Tat. Er ist der Heilige der »Flexibilität« und »Mobilität«, der »Vision« und »Strategie«. Und noch in seiner Unerträglichkeit ist er der Archetyp des ganz normalen postmodernen Chefs.
4. Bruder Franz und Schwester Armut.
Worin wir lernen, unsere Vorurteile gegen die Heilige Inquisition abzubauen.
Gibt es etwas Traurigeres, meine Schwestern und Brüder, als wenn Christen sich streiten um Hab und Gut? Gibt es etwas Beschämenderes als den Hader in der Gemeinde, wenn einer reicher sein will als der andere?
Ja. Schlimmer noch, viel schlimmer wird der Streit, wenn ein Christ ärmer sein will als der andere. Wenn keiner mehr dem anderen die Armut gönnen mag. Höret die Geschichte vom großen »Armutsstreit«, der ein Jahrhundert lang die Christenheit so erschüttert hat, dass sich zum Schluss die Frömmsten gegenseitig qualvoll ums Leben brachten.
Schuld an allem war der heilige Franziskus. Wohl ist der Poverello hoch zu preisen für seine inbrünstige Liebe zur heiligen »Schwester Armut«. Für etwas anderes aber müssen wir Franziskus tadeln. Als er im Jahre 1209 eine begeisterte Schar gleichgesinnter Brüder um sich sammelte, unterließ er es, in der neuen Gemeinschaft für Ordnung zu sorgen. Statt sich den Kopf zu zerbrechen über so unerquickliche Fragen wie Organisation und Programm, verlor der heilige Franz seine Zeit mit schönen Visionen und Ekstasen.
Wie so ganz anders war da doch der heilige Dominikus. Zu gleicher Zeit wie der heilige Franziskus hat auch er einen Orden gegründet, sogar einen ganz ähnlichen. Doch war der heilige Dominikus klug genug, um zu wissen, dass eine Ordensgründung nur gelingt, wenn der Stifter ganz klar, nüchtern und wirklichkeitsnah zu Werke geht. Zu keiner einzigen Vision hat er sich hinreißen lassen, der heilige Dominikus. Mit christlicher Nüchternheit hat er von morgens bis abends nichts als Arbeit zugewiesen, Ämter verteilt, Regeln aufgestellt. So ausgezeichnet organisiert war der Dominikanerorden beim Tode seines Stifters, dass er, frei von inneren Problemen, alsbald im Dienst der Päpste eine Fülle hoher Ämter übernehmen konnte, ja schließlich sogar das höchste Amt nächst dem Stuhl Petri. Wir nennen es heute die heilige Glaubenskongregation. Damals nannten wir es noch die Heilige Inquisition.
Während so die Söhne des heiligen Dominikus, dank guter Organisation, eine verantwortungsvolle Aufgabe nach der anderen tüchtig übernahmen, boten zu gleicher Zeit die Söhne des heiligen Franz der Welt das beschämende Bild anarchistischer Verwirrung. Das Traurigste an dem Streit in Assisi war, dass er einem Wort Jesu Christi galt. Lukas 9. Kapitel, 3. Vers: »In illo tempore«, sprach Jesus zu seinen Jüngern: »Nichts führet bei euch, weder Stab noch Tasche, weder Brot noch Geld.«
Wie ist das zu verstehen? Als wörtliche Anweisung, wortwörtlich gar? Oder nur symbolisch, im Sinne einer inneren, geistigen Einstellung, so wie der Herr selber es anzudeuten scheint, wenn er nicht »Selig die Armen« sagt, sondern – Matthäus 5. Kapitel, 3. Vers: »Selig die Armen im Geiste«?
Der eigensinnige Bruder Gregor von Neapel, der hitzköpfige Bruder Matthäus von Narni, besonders der vorlaute Bruder Johann von der Kapelle – jeder unter den ersten Brüdern in Assisi wusste es besser als der andere, jeder hielt sich selber für den einzig wahren Armen. Den heiligen Franz selber fragen konnte man nicht, er war abgesegelt nach Ägypten, um dort den Sultan zu bekehren.
Als der Höllenstreit um die Armut in Assisi nicht einmal mehr am Nil zu überhören war, kehrte Franz überstürzt zurück, sah nun wohl ein, dass er etwas falsch gemacht hatte, und versuchte, dem heiligen Dominikus nacheifernd, seine Gemeinschaft endlich ernsthaft zu organisieren. Aber es war zu spät. Der Wurm war drin im Franziskanerorden, die beiden Regeln von 1219 und 1223 stifteten nur neue Verwirrung, und als der heilige Franziskus im Jahr 1226 starb, zerbrach seine Brüderschaft in zwei einander gnadenlos bekämpfende Fraktionen.
Auf der einen Seite die Realos, die nur arm sein wollten im Geiste, nicht in der Materie. Das war die »Fortschrittspartei« um Bruder Elias. Auf der anderen Seite die Fundis um Bruder Cäsarius von Speyer mit der beachtenswerten These, entweder sei ein Mönch arm in der Materie oder er sei reich. Nicht zu vergessen der heilige Antonius von Padua, der zwischen den beiden streitenden Lagern zu vermitteln suchte und deshalb von beiden die schlimmsten Prügel bekam. Die einzigen, die gar nichts taten, sondern einfach kopfschüttelnd zusahen, waren die Dominikaner oder, wie sie nun immer häufiger genannt wurden, die Ehrwürdigen Väter von der Heiligen Inquisition.
Zuerst schienen die Realos um Bruder Elias zu siegen. Kein Wunder, hatten sie doch für sich die fürchtenswerte Macht des Geldes. Aus dem prallen Säckel von Bruder Elias ist zum Beispiel die wunderschöne Basilika von Assisi bezahlt worden. Dann aber, unter Bruder Johann von Parma, triumphierten die Fundis. Kein Wunder, hatten sie doch für sich die einzige Waffe, die noch fürchtenswerter ist als das Geld, nämlich die moralische Empörung. Und je länger der Streit ins Land ging, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, desto mehr vergaßen beide Fraktionen, worum es eigentlich ging.
Ursprünglich hatte man sich noch um relativ sachliche Fragen gestritten, zum Beispiel ob Arbeiten der wahre Ausdruck der Armut sei oder Betteln, ob der Franziskanerorden Weinberge besitzen, ob er Vermächtnisse annehmen dürfe. Als aber das 14. Jahrhundert begann, wandte sich der Streit einem ungleich modischeren Thema zu: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Ärmste im ganzen Land?
Woran kann man sehen, welcher unter den Brüdern der ärmste ist? Der heilige Franz hatte für seinen neuen Orden gar keine Mönchskutte gewollt. Ihm genügte das Alltagskleid der armen Leute in der Toskana, ein brauner Rock. Seinen Jüngern aber gelang es, diese Nicht-Kutte wiederum zur Kutte zu stilisieren, indem sie sie, nach Art der Benediktiner, bis zu den Knöcheln hinab verlängerten und mit einer spitzen, ehrfurchtgebietenden Kapuze versahen.
Jetzt plötzlich stellten die Fundis diese mühselig errungene Kleiderordnung im Franziskanerorden wieder in Frage. Die Armut eines Mönchs, behaupteten sie, sei daran zu erkennen, dass er seinen Rock kürzer trage als andere Mönche.
Midi statt Maxi. Diese neue religiöse Mode war gefährlich. Genügte es nämlich, seine Kutte beliebig zu kürzen, um andere Mönche an Armut zu übertrumpfen, so war nicht einzusehen, warum der Trend an den Waden, ja an den Knien haltmachen sollte. Eine kleine, radikale Minderheit von Franziskanern, Fratizellen genannt, erkühnte sich zum Mini. Auf kirchenlateinisch gesagt: Die Mönchskutte wurde modisch gekürzt »usque ad nates – bis zu den Arschbacken«.
Bisher hatten die Dominikaner nur kopfschüttelnd zugesehen. Jetzt mussten sie, so leid es ihnen tat, eingreifen. Als erste Warnung für alle anderen Wirrköpfe im Orden des heiligen Franz verbrannten die Dominikaner 114 Mini-Franziskanerchen auf den Scheiterhaufen der Heiligen Inquisition.
Laut regt sich jetzt im Franziskanerorden die schweigende Mehrheit. War es nicht eine unerträgliche Schande, dass die Dominikaner bei den Franziskanern Ordnung machen mussten? »Ordnung machen, das können wir selber! « 1316, auf dem Generalkapitel in Neapel, wählte die
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:\\dnb.ddb.de abrufbar.
eISBN 978-3-641-07105-9
© Gütersloher Verlagshaus GmbH, Gütersloh 2005
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe