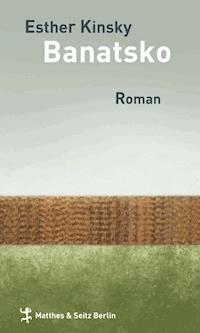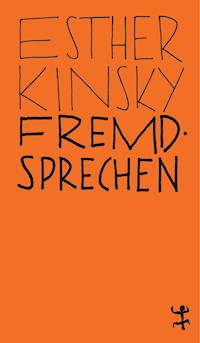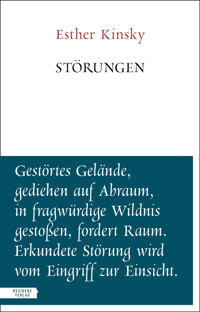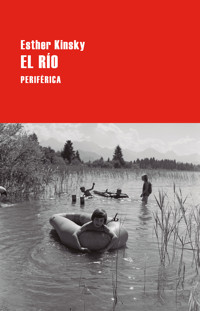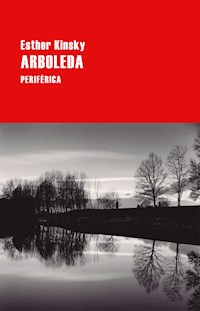19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einer Reise durch den Südosten Ungarns macht die Erzählerin in einem fast ausgestorbenen Ort an der Grenze zu Rumänien Station. Resignation und Vergangenheitsglorifizierung beherrschen die Gespräche der Bewohner. Wie vieles andere ist auch das Kino, ungarisch »Mozi«, längst geschlossen. Einst Mittelpunkt des Ortes, spielt es nur mehr in den Erzählungen und Erinnerungen der Verbliebenen eine wichtige Rolle. Ihre eigene Leidenschaft für das Kino bewegt die Erzählerin dazu, das vor sich hin verfallende »Mozi« wieder zum Leben zu erwecken.
In ihrem neuen Buch erzählt Esther Kinsky von der unwiderstehlichen Magie des Kinos, eines Ortes, »wo Witz, Entsetzen und Erleichterung ihren gemeinschaftlichen Ausdruck fanden, ohne dass die Anonymität im dunklen Raum angegriffen wurde«. Aller glühenden Kinobegeisterung und dem Nachdenken über den »großen Tempel des bewegten Bildes« liegt die Frage zugrunde: Wie ist ein »Weiter Sehen« und eine Verständigung darüber möglich, wenn der Ort einer gemeinsamen Erfahrung zugunsten einer Privatisierung von Leben und Erleben demontiert ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Esther Kinsky
Weiter Sehen
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023.
Erste Auflage 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: nach einem Konzept von Willy Fleckhaus
Umschlagfoto: Esther Kinsky
eISBN 978-3-518-77527-1
www.suhrkamp.de
Motto
There is something important in people, something that's dying – the senses, a universal thing. We can't agree on politics, but maybe we can agree on senses. We are dying of sadness. The whole world is dying of sadness. We are the enemy.
John Cassavetes
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
I. Vorspiel
II
III. Zwischenspiel
IV
V. Nachspiel
Anmerkungen
Informationen zum Buch
I
Vorspiel
I spy, I spy with my little eye
Ich seh etwas, was du nicht siehst
Vor vielen Jahren saß ich auf einer Bank an einem Fjord in Norwegen, hoch im Norden. Die Landschaft war dramatisch: zerklüftete Berge, dunkles Wasser, gelegentlich von einem Windstoß überkräuselt. Ein Frühlingsvorstoß hatte mit blasser Sonne Schnee zum Schmelzen gebracht. Im unverhofften Licht des Sonntagmittags hatten sich etliche Spaziergänger aus der nahegelegenen Universitätsstadt zu einem kleinen Ausflug zu Fuß aufgemacht. Sie zogen auf dem Pfad hinter der Bank vorbei, die Schneereste knirschten unter ihren Sohlen, sie unterhielten sich in ruhigem Tonfall, manche lachten auch gedämpft, etwas Feierliches lag über der Spazierprozession, und kurz stellte ich mir vor, ich säße mit dem Rücken zu einem Film von Carl Theodor Dreyer, ohne mich umzudrehen.
Eine Frau setzte sich zu mir auf die Bank. Sie wirkte ebenso unnorwegisch, wie ich mir selbst vorkam. Sie war klein und rundlich, und in meiner Erinnerung baumelte sie mit den Beinen. Wir blickten eine Zeitlang beide auf den dunklen Fjord, dann fragte sie mich auf Englisch, woher ich kam. Sie selbst war einige Jahre zuvor vor dem Krieg in ihrer jugoslawischen Heimat geflohen und hatte nach langer Suche an der Universität in der nahegelegenen Stadt eine Stelle gefunden. Sie erzählte mir vom Krieg und von der Gegend, aus der sie stammte, einer flachen Landschaft im nördlichen Serbien, einer Stadt nicht weit von der Grenze zu Ungarn. Sie beschrieb den Fluss, die großen Maisfelder und die Beschaffenheit der Städte und Dörfer, die alle wie mit dem Lineal angelegt waren, sämtliche Straßen verliefen schnurgerade von Süd nach Nord oder von Ost nach West, und da es sich um eine sehr flache Gegend handelte, konnte man vielerorts vom einen Ende einer Straße bis zum anderen sehen und sogar noch weiter, bis zum Horizont. Während der kurze norwegische Vorfrühlingstag sich dem Ende zuneigte und sie vor Kälte mit den Zähnen zu klappern begann, führte sie weiter die in der hiesigen Umgebung fast unvorstellbare und geradezu märchenhaft anmutende Flachheit und Weite ihrer südlichen und staubigen Heimatgegend aus und erwähnte schließlich, dass es dort, in der einst zu Ungarn gehörigen und auch seit der Grenzziehung zwischen Ungarn und Jugoslawien in Gedanken immer nach der ungarischen Hauptstadt ausgerichteten Landschaft geheißen habe, man brauche nur auf einen Kürbis zu steigen und könne bis Budapest sehen. Stell dir das mal vor, sagte sie bibbernd, stell dir das mal vor: Man stieg auf einen Kürbis und konnte so weit sehen. Immer weiter sehen.
II
It is seeing which establishes our place in the surrounding world.
John Berger, Ways of Seeing
Wohin mit dem Blick?
Beim Sehen geht es um zweierlei: Was man sieht und Wie man sieht. Bei der Frage nach dem Weiter Sehen soll es nur um das Wie gehen. Beim Wie geht es um den Platz, den man selbst sehend einnimmt. Um den Blickwinkel und um die Distanz zu den Dingen, Bildern, zum Geschehen, zu Nähe und Ferne, zur Weite. Die Weite ist mehr als Ferne, sie ist das, was man an Möglichem zulässt. Das gilt für das Sehen von Landschaft, Gelände, von Menschen, von Kunst. Im vergangenen Jahrhundert ist kein Ort für das Wie des Sehens, für die Besinnung auf den Platz, den man sich sehend zuweist oder nimmt, so bedeutend gewesen wie das Kino als Ort, als Raum. Dieser Raum, der nicht einmal hundert Jahre lang Bedeutung und Gültigkeit hatte, schließt sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter. Der Blick aus dem Dunkel in eine vom Film geschaffene Weite verengt sich mit dem Schwinden dieses Seh-Raums. Die mit dem Raum verbundene kollektive Erfahrung und die mehr oder weniger ausdrückliche Freude am Vorhandensein dieser Erfahrungsmöglichkeiten schwinden, und das ist ein Verlust, der, ob betrauert oder nicht, beschrieben gehört und Gedanken verdient. Das Kino war der Schauplatz eines Jahrhunderts. Heute scheiden sich die Geister am Verhältnis zu diesem Ort. Warum Kino? Filme stehen in anderen Formaten zur Verfügung, die Black Box des Zuschauerraums, die den Rahmen schuf, wird nur noch von wenigen als notwendiger Ort des Sehens empfunden, das Beharren auf dem Filmerleben im Kino gelegentlich sogar als elitär abgetan. Als ginge es doch nur noch um das Was. Und nie mehr ums Wie.
Trotz seiner Verdrängung an den Rand des Geschehens behält das Kino etwas Mythisches als Ort des Sehens. Je weiter sich die Privatisierung aller Erfahrungen ins Leben frisst, desto märchenhafter erscheint ein Ort, an dem die Seherfahrung kollektiv war, wo Witz, Schrecken, Entsetzen und Erleichterung ihren gemeinschaftlichen Ausdruck fanden, ohne dass die Anonymität im dunklen Raum angegriffen wurde. Auch wer nie mehr ins Kino geht, weiß doch etwas von dem Besonderen der Erfahrung, des Ortes, des Eintretens ins Dunkel, aus dem man dann blickte, der unbefohlen befolgten Regel des Sehens: »Alle Blicke in dieselbe Richtung«, in die Richtung, die der dem Publikum unsichtbare Vorführer beherrschte.
Sehen ist eine Fertigkeit, die man erlernt. Eine Fähigkeit, derer man sich langsam bewusst wird. Wenn man will. Am Anfang ist immer der gerahmte Blick. Aus dem Drinnen ins Draußen, aus dem Fenster, dessen Ausschnitt dem Hinausblickenden die Welt bestimmt. Dann die Entdeckung der Differenz zwischen dem Anblick der Dinge aus dem Fenster und dem derselben Dinge im Draußen, umringt von ungerahmter Welt, das Auge selbst ein Teil der Welt. Der Kindheitsblick aus dem Fenster in einen Wintermorgen aus Raureif und Nebel bleibt als Verheißung und Geheimnis der Erinnerung eingeprägt, der Blick auf dasselbe verwilderte bereifte Gelände vom Gartenweg oder Straßenrand aus weckt Verwirrung, prägt sich ein als Erinnerung an die eigene Befindlichkeit im Wintermorgen, an die Befremdlichkeit der Welt, die durchmessen werden musste. Der Wintermorgen als der erste Film: eine Montage verschiedener Blickwinkel und -richtungen. Das Aufsuchen der einzelnen Fenster im Haus auf der Suche nach der Verwandlung des Draußen in Ausschnitte, die sich nur vom betrachtenden Auge lesen und mit Erzählung erfüllen ließen, während sie im Draußen, ihrer Rahmung begeben, zu Orientierungshilfen wurden, an denen das zum Auge gehörige Ich den eigenen Standort in diesem Draußen bestimmte. Dort draußen stand man in der Welt und sah sich um, so weit das haltsuchende Auge reichte, während man drinnen am Fenster stehend auf das eingerahmte Fragment blickte, dem sich eine absolute Bedeutung zuschreiben oder absprechen ließ.
Später: das Fernglas. Ein neuer Rahmengeber, ein neuer Zauber der Metamorphosen durch manipulierte Entfernungen. Die herbeigeholte Ferne, die in diesem Rahmen ein fremdes Land wurde, eine Fiktion, ganz herausgelöst aus dem, was sie umgab: Die andere Seite des Flusses, der man sich im Draußenleben nur über eine weiter flussabwärts gelegene Brücke nähern konnte, wurde durch das Fernglas verfügbar und dem Blick zugänglich, ließ sich mit Vorstellungen füllen, die nichts mit den vagen verschwimmenden Umrissen zu tun hatten, die ohne Fernglas zu erkennen waren und sich in die gewohnte Stufung von Feldern, Straßenbahndamm, Uferbäumen und geahntem Fluss einbetteten. Das Sehen wurde ein Abenteuer, jeder Blick durchs Fernglas eine Entdeckungsreise.
Vom Fernglas zum Sucher der Kamera. Als Kind bekam ich eine kleine, russische Kamera, mit Aufschrift in kyrillischen Buchstaben. Die Kamera war schwarz und silbrig, umgeben von einer braunen Ledertasche mit Druckknopf, deren vorderer Teil mit der großen Auswölbung für das Objektiv sich herunterklappen ließ. Zur Unkenntlichkeit verzerrt spiegelte sich die Welt auf der Oberfläche des Objektivs, und einem rätselhaften technischen Zusammenhang war zu verdanken, dass ich durch den quadratischen Sucher sah, was das Objektiv im Auge hatte. Plötzlich ließ sich die Welt in Stücke einteilen, in Fragmente, die ihrerseits zum Ganzen wurden, wenn man lange genug durch den Sucher schaute, und erst recht, wenn die Fragmente dann als Fotografie auf dem Tisch lagen und alle Erinnerung an das, was sie umgeben hatte, in den Schatten treten ließen. Was ringsum gewesen war, ließ sich in Worten berichten, erzählen, erdichten, es war aus dem Bild ausgeschlossen. Das war eine Entdeckung. Das Sehen, das Wie-Sehen viel mehr als das Was-Sehen, wurde eine Entscheidung.
Eines Frühjahrs wurde das verwilderte Gelände auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf das jeden Morgen mein erster Blick aus dem Fenster fiel, zunichtegemacht. Verwaistes Land, wie es hieß, Erben verschwundener Besitzer hatten sich nicht gemeldet, die Wildnis wurde Bauland, mein Blick fiel morgens auf eine Baustelle, auf Erdhaufen, Lastwagen, dann das Gerippe eines mehrstöckigen Hauses, auf einen Wohnblock. Dem Blick wurde Gewalt angetan, es gab kein Weiter, kein Dahinter mehr, kein Rätsel, keine raureifverwunschenen Formen im Winter. Familien zogen ein, Kinder, die in meine Schule gingen, eines Tages stand ich auf einem der Balkone, auf die ich jetzt aus meinem Fenster blickte, und schaute auf mein Haus, mein Fenster hinunter. Der Punkt, von dem aus ich meine Welt in Augenschein nahm, war von diesem kürzlich entstandenen Balkon aus plötzlich erschütternd fremd und fern, das Fenster so klein, dass sich ihm seine Bedeutung für mein Sehen, für meine Beschäftigung mit dem von ihm bestimmten Ausschnitt der Welt nicht zutrauen ließ. Zum ersten Mal regte sich, noch unartikuliert, in mir die Frage nach dem Verhältnis von Sehen und Gesehenwerden, diesem rätselhaften Zusammenhang von Blick und Widerblick. Doch ich sah auch über mein Haus hinweg, auf die Gegend Richtung Fluss, die ich sonst nur von einem anderen Fenster auf der Rückseite meines Hauses gerahmt und ausschnitthaft kannte. Ich sah die Felderstreifen, den Eisenbahndamm, die Spitzen der Pappelreihen, die den Fluss säumten, die Fabrik hinter den feuchten Auwiesen mit den »Gastarbeiterbaracken«; ich sah weiter, bis zu dem Höhenzug, blaugrün und unscharf, jenseits des Flusses, und bis hin zu der in weißlichem Licht flimmernden Gegend der Flussbiegung, wo sich die flacher werdende Landschaft ins Allmögliche auflöste. Dieses Panorama des Vagen, Weiten, der Denkbarkeiten und der Geschichten, in die sich die Flussbiegung öffnen mochte, blieb mir immer eine Verheißung, die auf eine eigentümliche Weise zum Kino gehörte, als wüchsen dort die Welten, in die ich aus der Dunkelheit des Kinosaals blickte.
* * *
Kino war in meiner Kindheit keine Alltagserfahrung. Ich wuchs in einem Vorort auf, zwar ohne Fernseher, aber auch nicht nah genug an einem Kino für regelmäßige, etwa allwochenendliche Besuche. Von Zeit zu Zeit kam ein Kino auf Rädern, in einer Sporthalle wurde ein Projektor aufgebaut, und es gab Programm. Charlie Chaplin, seltener Buster Keaton mit seiner zum Chaos drängenden Absurdität, Naturfilme, Zeichentrickfilme. Wegen meiner Kurzsichtigkeit musste ich in einer der vorderen Reihen sitzen, und Bambi raubte mir mit den rollenden Augen und verzerrten Proportionen der Tiere wochenlang den Schlaf. Kino war besser mit »richtigen Filmen«, wie etwa Nils Holgersson, auch wenn das Ende immer schwer zu ertragen war. Nicht wegen der Geschichte, sondern einfach weil der Film zu Ende war, weil man nicht mehr weiter sehen konnte, weil sich der Blick schloss aus diesem Leinwandfenster in ein Anderswo. Später nahm mein Vater uns Geschwister manchmal mit in ein Kino nahe am Bahnhof, wo ein Haupt- und ein Vorfilm und die Wochenschau in einer endlosen Schleife liefen. Man konnte jederzeit zu dem schütteren Publikum stoßen, sich im schwachen Licht der Taschenlampe der Platzanweiserin einen Platz suchen und sitzenbleiben. Mit einer Kinokarte konnte man den ganzen Tag dort verbringen, was manche Menschen an kalten oder nassen Tagen auch tun mochten, nach dem zweiten Durchlauf der Schleife waren sie sicher so müde, dass sie sogar schlafen konnten. Viele rauchten Zigaretten, ich erinnere mich an die Schwaden, die vor dem Bild auf der Leinwand aufstiegen und durch die Luft trieben. Die meisten Zuschauer kamen sicher, um sich Wartezeit am Bahnhof zu vertreiben, sie trugen kleine Koffer oder Reisetaschen, einmal vergaß jemand in unserer Reihe seinen Koffer, als er hastig aus dem Kinosaal stürzte, um seinen Zug oder eine Verabredung noch zu erreichen. Ich erinnere mich an den muffigen Geruch des Kinos, an den schweren rauen Filzvorhang, durch den man trat, während die unteren Leder- oder Kunstlederkanten über den Linoleumboden schleiften, an die Platzanweiserin mit ihrer Lockenfrisur und dem müden Gesicht, die immer bemüht war, uns eine Reihe zu finden, in der niemand saß.
Mein Vater war ein schweigsamer Mensch, und die Ausflüge in dieses Kino erfolgten fast immer unangekündigt, später ließ er uns manchmal dort, wenn er Dinge zu erledigen hatte, wir rührten uns nicht vom Fleck. Er äußerte sich nie zu den Filmen, die wir sahen, aber manchmal kam mir der Gedanke, diese Filme könnten Botschaften sein, von der Leinwand an ihn, oder von ihm an uns. In einem Film zum Beispiel sah man einen Zug, der sich über eine riesige Ebene und gegen den fernen, blassen Hintergrund hoher Berge einem Dorf näherte, in dem er – das hatte man vorher erfahren – von mehreren Menschen am Bahnhof schon sehnlichst erwartet wurde. Ich war sicher, dass es sich um denselben Zug und dieselbe Gegend handelte, von dem unser Vater uns ein paar Mal erzählt hatte – eine Kindheitsszene, in der die flache Landschaft der betreffenden Gegend eine große Rolle spielte, denn ein Zug war schon Stunden vor dem Eintreffen am Horizont zu erkennen. Ich erwähnte diesen Zusammenhang nicht, glaubte meinem Vater aber nicht, als er uns später zu erklären versuchte, diese Aufnahme des nahenden Zuges sei mit einer Spielzeugeisenbahn nachgestellt, denn sonst hätte man es nicht filmen können, von hoch oben und mit dem Blick über eine so riesige Landschaft. Höchstens ein Engel, sagte mein Bruder, ein Engel mit Flügeln. Wir anderen lachten ihn aus deshalb. Wegen des Engels mit der Kamera.
Irgendwann hörten die Kinobesuche unter der Obhut meines Vaters auf, und es dauerte einige Jahre, bis das Endlosschleifenkino wieder eine Rolle spielte. Es war die Wiederentdeckung eines heißen Sommers, ich war Jugendliche, kein Kind mehr, und streifte allein an einem Feriennachmittag durch die Straßen und wusste nichts mit mir anzufangen, als ich vor dem Kino stand und mich erinnerte. Das Programm hatte sich geändert. Es gab keine Wochenschauen mehr und auch keine zweit- oder drittrangigen gefälligen Beliebigkeiten, mit denen sich ein müdes Publikum die Zeit vertreiben oder unter deren einschläfernder Vorhersehbarkeit es dösen könnte. Jetzt waren es Filme, deren Titel nach etwas klangen, die einen Ruf hatten, einen Vorklang. Es waren nicht die neuesten Filme, und weiterhin gab es zwischendurch eine Unterbrechung, statt der Wochenschau waren es jetzt Werbungspausen oder ein Kurzfilm, doch der Endlosschleifencharakter hatte sich erhalten. Was ich früher einfach hingenommen hatte – dass man jederzeit eintreten und dann sitzenbleiben konnte, so lange man wollte –, war jetzt ein Zauber, der der Möglichkeit, Glück zu haben, mehr Raum zu lassen schien.
Das Kino hatte sich unter diesem Zauber vom Zufluchtsort obdachloser Vertreter auf unterbrochener Durchreise zum bevorzugten Ort derer gewandelt, die unterschiedliche Rauschzustände absolvierten oder ausklingen ließen, die eine angerauchte Schwerelosigkeit genossen oder sie gelegentlich auch verschliefen. Wahrscheinlich waren auch stille Kinoliebhaber darunter, die einfach auf ihren Plätzen saßen und schauten, so lange sie konnten, vereinzelt gab es auch die Chronisten, die zwischendurch im schwachen Schein der Notbeleuchtung oder am zurückgeschlagenen Vorhang zum Foyer stehend in Notizbücher kritzelten. Insgesamt ging es leiser zu als früher, obwohl es manchmal Zuschauer gab, die vor sich hin lachten, wie in einem lustigen Traum, der mit dem Film nichts zu tun hatte. Ich sah in diesem Kino etliche Filme und weiß von vielen heute noch, an welcher Stelle ich den Saal betrat und das erste Bild auf der Leinwand erblickte. Der letzte Film, den ich dort sah, war Tod in Venedig, kein neuer Film mehr, doch einer, der für mich etwas Besonderes blieb, weil ich einige Jahre zuvor, noch als Kind unter anderen neugierigen Randstehern, von dessen Dreharbeiten im milchigen Licht Norditaliens ein paar Szenen mitbekommen hatte. Diese Inkongruenz zwischen persönlicher Zeugenschaft einer winzigen, zufälligen Phase der Verwandlung von Vorstellung in Film und der sichtbaren Film-Wirklichkeit auf der Leinwand brachte mich immer wieder zum Nachdenken über Kino. Denn wichtig waren nicht nur die Filme, sondern auch der Ort. Das, was sich auf der Projektionsfläche entfaltete, war unweigerlich an diesen Raum gebunden, an das Dunkel mit Ausblick in eine Welt, die, wiewohl kadriert, größer schien als die eigene, von anderen Grenzen bestimmt. Doch war sie in all ihrer Weite an diesen Ort mit seinen Merkmalen gebunden, wobei alles eine Rolle spielte: das Betreten des kleinen Foyers durch die braune Schwingtür, der Tausch von einer Münze gegen eine Eintrittskarte aus rauem Papier, das Eintauchen in den dunklen Raum durch den borstigen Vorhang, der Geruch, die Umrisse der unterschiedlich frisierten und behaarten Schädel Fremder in den mäßig gestuften Sitzreihen – das alles gehörte dazu. Film war nicht nur eine Folge projizierter Bilder, Film war Kino, das sich zwischen Blick und Leinwand ereignete und dem Sehen zwischen anderen Zusehenden widerfuhr. Eine Erfahrung, die sich nicht davon lösen ließ, dass es andere Teilhaber daran gab, die buchstäblich im Dunkeln blieben, doch auch schweigende Mitwisser waren, Seh-Komplizen. Und etwas wirkte dort, in diesem gesonderten, gleichbleibend schlecht belüfteten Ort, etwas, das in eine Richtung wies und Punkte auf der blassen Landkarte meiner kleinen Erfahrungen so verband, dass ein Bild entstand. Ein bewegtes Bild mit verschwommenen Rändern, das ich nie aus dem Blick verlor.
Ein Film auf Zelluloid oder »Zelluloseazetat«, wie es mit der Zeit zur größeren Haltbarkeit entwickelt wurde, ist ein sonderbares Geschöpf. Ein verdichtetes, verletzliches Zeugnis von vereinten Anstrengungen, von Eingriffen und Übergriffen und unzähligen unwägbaren Umständen geschuldeten Umständen, dem Technik und händisches Können dazu verhelfen, immer wieder, mit jeder Vorführung sich zu der Welt zu entfalten, die für die Dauer, die die Zelluloidstreifen brauchen, um vor einer starken Lichtquelle mit festgesetzter Geschwindigkeit und von mehreren Spulen und Spindeln geleitet vorbeizulaufen, den dunklen Zuschauerraum vor der Leinwand so erfüllen kann, dass sie die auf kein erkennbares Geheiß ablaufende Wirklichkeit außerhalb des Kinos in den Hintergrund treten lässt. Ein Film im Kino ist in seiner Dichte und Absolutheit immer ein Eingriff in den Lauf der Welt für die Zuschauenden. Die Erfahrung eines solchen Eingriffs wurde von unzähligen Menschen geteilt, auch ohne dass sie sie jemals bei diesem Namen nannten. Es war eine zur Kultur gehörende Geläufigkeit, die ihre kleinen Rituale, Eingeweihten, Diener, Handwerker und Handlanger hatte und dann unaufhaltsam zu zerbröckeln begann. Für dieses Zerbröckeln wird es viele beim Namen zu nennende Gründe geben, ohne dass diese den Vorgang wirklich verstehen lassen. Natürlich ist das Kino nicht tot, solange es noch Filme gibt, die nur dort so zur Aufführung kommen können, wie sie in der von allen beteiligten Akteuren erarbeiteten Form gemeint sind. Tot ist die verbindliche Gemeinsamkeit der Erfahrung Kino, auf die man sich verständigen konnte, auch wenn sie noch schneewittchenhaft schön und unverwest in manchem Denken und Erinnern aufgehoben ist und einen Traum von der Wiedererweckbarkeit nährt. Ein Traum in einem gläsernen Sarg, der irgendwo in einem Randgelände abgestellt ist. Auch die sieben Zwerge sitzen am heimischen Bildschirm und überlassen das Tragen des Sarges Zufallsträumern, unverdrossenen Freiwilligen, vorübergehend Hoffenden.
Das Kino hatte früher Präsenz, es hatte Gewicht in fast jedem Leben, nicht als Ausnahmeerfahrung, sondern als Normalität in einer weniger privatisierten Welt, in die das Fernsehen nach und nach eindrang und die die permanente Verfügbarkeit von Bildträgern zur Nutzung im privaten Raum zunichtemachte. In den Lehrbüchern, aus denen ich Russisch und Polnisch lernte, spielte das Kino eine noch größere Rolle als Fabrik, Universität und Poliklinik, die auch in vielen Übungen vorkamen. Es gab kaum einen Dialog und keine Lektion, in der nicht Kino unter allen anstehenden grammatischen Vorwänden aufgesucht, verlassen, verpasst oder versprochen wurde. Länder der Verheißung breiteten sich vor meinem inneren Auge aus, in denen das Kino das Leben bestimmte. In meinem Polnischbuch war es vor allem das Kino Wisła, das auf den skizzenhaften Zeichnungen, die die Übungen begleiteten, eine klassizistisch anmutende, fast tempelhafte Fassade zeigte, vor der kleine Figuren in Grüppchen standen, die Frauen in Röcken, die an die Mode der fünfziger Jahre erinnerten, die Männer in Anzügen, und sie alle trugen Aktentaschen, was nahelegte, dass sie alle geradewegs von Universität, Poliklinik oder Fabrik einem Film entgegengeeilt waren – früher nämlich, als das Kino noch zum Leben gehörte, trugen auch Arbeiter, ob in Italien, Frankreich, Polen oder der Bundesrepublik Deutschland, Aktentaschen, in denen sie ihre Jause verstauten. Über oder unter den Zeichnungen standen dann Dialoge wie: Hast du heute Abend schon etwas vor? – Ja, ich gehe mit Antek ins Kino Wisła. – Oh, ich komme mit! Oder: Möchtest du nach der Vorlesung mit uns im Łazienki-Park spazieren gehen? – Nein, ich gehe ins Kino Wisła.
Nach Warschau kam ich zum ersten Mal in einem September, das Licht war mild und graublau, die Luft roch rauchig und kratzte im Hals, ein Geruch, der lange ein Merkmal Osteuropas blieb. Am Morgen trat ich ans Fenster der Wohnung in der Mickiewicza in Żoliborz. Das Zimmer lag auf der rückwärtigen Seite des Wohnblocks, der kleine Balkon stand voll mit Töpfen, in denen sich die herbstlich aufgeschossenen Pelargonien in die dunkle Jahreszeit schickten, und das Erste, was ich hinter den Blumen erblickte, war die Fassade des Kinos Wisła. Die Schrift über dem Eingang sah genauso aus wie auf den Zeichnungen im Lehrbuch, tagsüber spiegelte sie das herbstliche Sonnenlicht, nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Buchstaben vertraut und verhießen die Erfüllung von Erwartungen. Auf die Begegnung mit diesem Kino war ich nicht gefasst, und es blieb wie eine Art Kulisse in diesen Wochen, in denen mir ganz Warschau wie ein Film vorkam. Wenn ich abends an dem Kino vorüberging, sah ich, dass auch Menschen ohne Aktentasche das Kino besuchten, die Männer trugen keine Anzüge und die Frauen keine wadenlangen Röcke. Ich selbst sah keinen Film dort, etwas hielt mich davon ab, vielleicht die Sorge, beim Erklimmen der Stufen könnte sich die Fassade als billige Kulisse erweisen und hinter den Eingangstüren könnte sich eine Kleingartensiedlung auftun, in der schwache Herbstfeuer glommen und die letzten Äpfel noch an den Bäumen hingen, oder ein Trümmerfeld könnte sich ausbreiten, in dem sich zerbrochene Pappmachésäulen auf den ersten Blick nicht von echten, tonnenschweren Trümmerbrocken unterscheiden ließen. Doch auch ohne das Kino aufzusuchen, lernte ich, dass der Łazienki-Park ziemlich weit vom Kino Wisła entfernt ist, er liegt am anderen Ende der Stadt. Wisła ist der polnische Name des Flusses Weichsel, der graublau und sandig trüb durch Warschau fließt und in meiner Erfahrung lange der einzige Fluss blieb, nach dem ein Kino benannt war.
Wohin geht man heute in den Lehrbüchern fremder Sprachen? Gibt es noch Verheißungsorte wie das Kino Wisła, in denen sich das Vertraute – Kino schlechthin – mit dem Fremden, Unbekannten mischt – Poliklinik, Fabrik, ein Fluss mit klingendem Namen – und in eine andere Sprache lockt, die eine andere Welt öffnet?
Auf meinen Reisen in Osteuropa suchte ich an jedem neuen Ort nach dem Kino. Fast jedes Dorf hatte eines oder hatte doch bis in die frühen neunziger Jahre eines gehabt, das Kinosterben lernte man vom Westen, wo Film zur Privatsache wurde, wo Kinos verkümmerten und schließlich eingingen, während die wenigen überlebenden Film als Luxusgut vertrieben. Das Kino als Ort der Klassenlosigkeit verging.
Die Gebäude der einstigen Kinos ließen sich leicht erkennen, ihre prächtelnden Spuren waren noch auszumachen, gelegentlich war ihnen auch noch der Stolz auf diese Errungenschaft anzusehen, auch wenn das Kino schon länger nicht mehr betrieben wurde. Markt, Kino, Friedhof waren die drei Orientierungspunkte der Orte, die ich besuchte: Essen, Sehen, Sterben. Oder: Sehen, Essen, Sterben. Das waren die möglichen Variationen. Immer weniger Kinos waren in Betrieb, aber sie waren noch auszumachen, geschlossen, verbarrikadiert, doch noch nicht umfunktioniert oder abgerissen, manchmal mit Parolen oder den Namen von Fußballmannschaften bemalt, verfallend, verfallen, aber noch vorhanden. Diese dem Verfall anheimgegebenen Tempelchen gab es fast überall, auch in Schottland und Schweden, in Frankreich und Italien. Es gibt Geschichten von Kinos an Bahnhöfen, in denen sich das Pfeifen der Züge in die Filme mischte, neben bimmelnden Friedhofskapellen und Clubs radikaler Organisationen, Kinos, die den Verwirrten und Dementen eines Dorfes oder Stadtteils Halt und Zuhause waren, und Kinos, in denen dunkle Geschäfte getätigt wurden. Das Kino war ein geschichtenstiftender Ort, in dem es im Angesicht der Leinwand die Sprache verschlug, ein Ort, der keinen Ersatz gefunden hat. Die schlummernden Lichtspielschlösschen mit ihren wurmstichigen, rostigen, verrammelten Türen blieben Fragemauern, an denen man nicht anders konnte als zu überlegen, wie es denn weitergehen sollte: mit dem Sehen. Wohin mit dem Blick?
Auf der Suche nach einem Blick übers Tiefland machte ich mich an einem heißen Tag im Mai von Budapest auf den Weg nach Südostungarn. Mich interessierte die Ebene, die ich mir etwa so vorstellte wie die Po-Ebene, flimmernd im Sommer, oft unter einem weißdunstigen Himmel, schattenlos in diesem milchigen Licht. Niemand in Budapest sprach freundlich von diesem flachen Land, dem Alföld, mit einer gewissen Abfälligkeit wies man mich darauf hin, dass es zwischen dem kleinen sanften Abhang im Budapester Stadtpark, der bei Schneefall bereits nach weniger als einer Viertelstunde Schlittenfahrt der Schulkinder blanke dunkle aufgepflügte Erde war, und dem Zusammentreffen der Grenzen von Ungarn, Serbien und Rumänien keine einzige Erhebung gebe, bis auf die von Menschenhand angelegten Flussdeiche, die Überschwemmungen verhindern oder zumindest abschwächen sollten. Ich hatte bei meiner Reise nach Südosten kein Ziel außer diesem flachen Land, einer vagen Vorstellung von Endlosigkeit, gleichförmigem Licht, der Auf