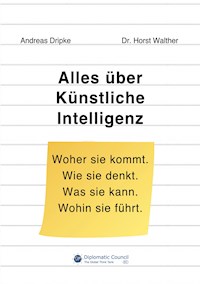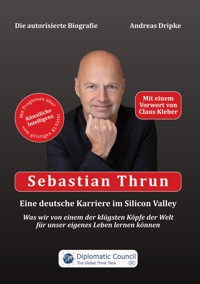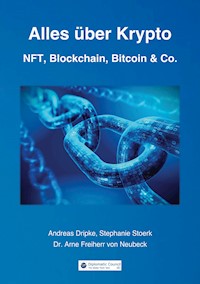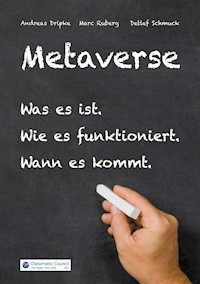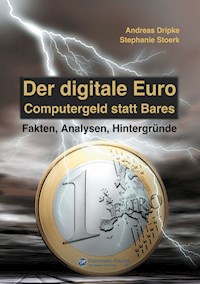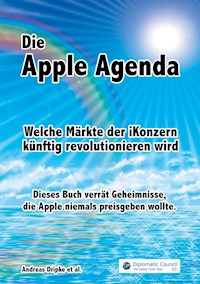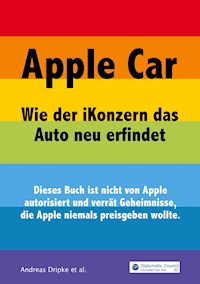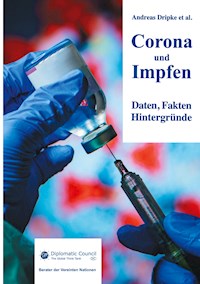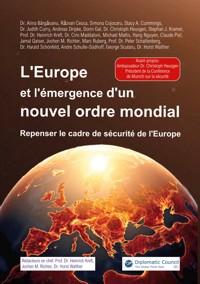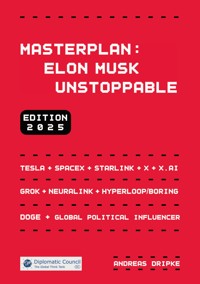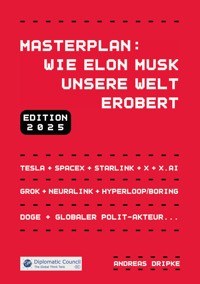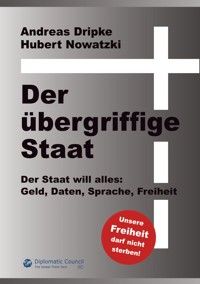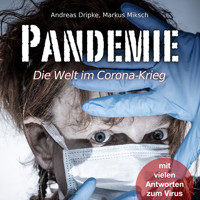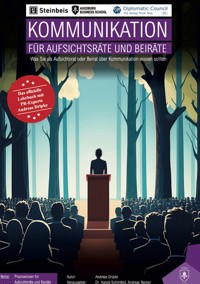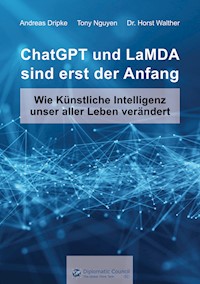Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bitcoins statt Bargeld. Das erscheint vielen Menschen heute noch als eine unvorstellbare Vision. Das kommt auch daher, weil sie gar nicht so genau wissen, was Bitcoins eigentlich sind. Und der Bitcoin ist nur eine, die erste und bekannteste Kryptowährung, von denen mittlerweile zahlreiche im Umlauf sind. Die neue Währungsgeneration kommt mit Macht auf uns zu. Die Vorbereitungen für den D- oder E-Euro sind weitgehend abgeschlossen. Die Umstellung von Bargeld auf Kryptogeld wirft fundamentale Fragen auf. Wie verläuft die Abschaffung des Bargelds? Was steckt hinter Kryptowährungen und wie funktionieren sie? Was bedeutet Blockchain? Wie reagieren die Zentralbanken? Wie sicher ist die Digitaltechnik der Kryptowährungen? Ist während des Übergangs ein Crash oder eine Inflation zu erwarten? Wie wirken sich die Corona-Folgen auf diese Entwicklung aus? Wie kann eine Welt ohne Bargeld überhaupt funktionieren? Die Antworten auf alle diese Fragen finden sich in diesem Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Von Vertrauen und Disruption
Vertrauen ist die Basis für alles
Euro hat ein Viertel an Kaufkraft eingebüßt
Parallelen zwischen Internet und Kryptogeld
Digitalisierung trifft Finanzwesen
Kampf um die digitale Disruption
Wem vertrauen die Menschen?
Vom Mythos zur Realität
Vom Tauschhandel zum Bankgeld
Vom Warengeld zum Fiatgeld
Vertrauen in die Bundesbank und in die EZB
Der große Crash
Der erste Börsencrash der Welt durch Tulipomanie
Aktien und Scheine ohne Gold sind nichts als Papier
Hyperinflation: Das Geld zerrinnt
Black Friday 1929 und Währungsreform 1948
Das Ende der Golddeckung des US-Dollars
Euro-Einführung 2002
Von der Immobilien- zur Hypothekenkrise
Wir sind hochverschuldet
Der Corona-Crash
Bazooka-Hilfe mit Folgen
Coronomics – die Folgepolitik der Pandemie
Ewige Anleihen wie zu Napoleons Zeiten
Experiment der ungebremsten Geldvermehrung
Unser Finanzsystem ist nicht so sicher wie es scheint
Neue Währungswelt
„Riders on the Storm“
Staatliche Kryptowährungen als Dominanzfaktor
Kurzer Ausflug nach China
Nationale Digitalwährung als machtvolles Instrument
Abschreckend in Deutschland, nichts Neues in China
Totale Überwachung des Finanzwesens
Europa wird China folgen
Geostrategischer Wettbewerb
Die Europäische Union gibt sich progressiv
Zentralbank der Zentralbanken
Kampfansage an digitale Zahlungssysteme
Bitcoin in Deutschland
Keiner gibt sein Bargeld freiwillig her
Geburt und Entwicklung des Bitcoin
Das White Paper des Satoshi Nakamoto
Keine Instanz des Vertrauens
2009: das Geburtsjahr des Bitcoin
Altcoins sind nicht alt, sondern alternativ
Schneller und preiswerter Transfer
Offen und doch anonym
Sind Kryptowährungen kriminell?
Wundersame Geldvermehrung
Frau Müller geht in eine Bank
Kryptowährungen und das „Fräulein vom Amt“
Kryptotechnik Blockchain
Vom Kerbstock zur Distributed-Ledger-Technologie
Verteilte Buchhaltung ohne Notar
Von der Geheimhaltung bis zur Honigbiene
Blockchain: unbestreitbar und universell einsetzbar
Urknall einer Kryptowährung
Digitaler Goldrausch
Gefahrenstelle Mining
Difficulty – vorprogrammierte Schwierigkeiten
Alle zehn Minuten entsteht ein neuer Bitcoin-Block
Der letzte Bitcoin entsteht 2140
Tokens sind nicht gleich Coins
Rechenleistung wie der Energiebedarf ganzer Länder
Blockchain ähnlich wie Internet
Weltweite Kryptonervosität
Das künftige Finanzsystem
Quadratur des Kreises
Besitz von Bitcoins könnte illegal werden
Krypto chaotisch wie das Internet
Das Internet wurde 1968 geboren
Den Atomkrieg überleben
Das Internet gehört uns allen
Wer im Internet etwas zu sagen hat
USA: Die Daten im Internet gehören uns
USA räumen sich digitale Weltherrschaft ein
Edward Snowden: Globaler Machtmissbrauch
Viele Parallelen zwischen Internet und Kryptowelt
USA und China im Ring, EU weit abgeschlagen
Welt ohne Bargeld
Bargeld schon lange auf dem Rückzug
Tausche Einkaufsverhalten gegen Bonuspunkte
Von der Kreditkarte zur Online-Zahlung
Digitales Bezahlen und Überwachen
Smartphone für den Ausweis und zum Bezahlen
Ziel ist der gläserne Bürger
Blockchain-Überwachung besser als Bargeld
Hacker bestehlen uns
Chaos, Macht, Terror oder Geld
Kein Hack ohne Nordkorea
WannaCry – größter Krypoangriff aller Zeiten
Am 23. Oktober 2020 wird die EZB lahmgelegt
Bitcoin-Börsen werden geknackt
Ausblick
Über die Autoren
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Bitcoins statt Bargeld. Das erscheint vielen Menschen heute noch als eine unvorstellbare Vision, häufig auch, weil sie gar nicht so genau wissen, was Bitcoins eigentlich sind. Und der Bitcoin ist nur eine, die erste und bekannteste, sogenannte Kryptowährung, von denen mittlerweile zahlreiche im Umlauf sind. Denn die neue Währungsgeneration kommt mit Macht auf uns zu.
Je nach Lebensalter befinden sich unter den Lesern dieses Buches noch Menschen, die ohne das Internet und ohne ein Smartphone aufgewachsen sind, möglicherweise sogar ohne einen Computer. Und dennoch gehören Computer, Smartphones und das Internet heute für die meisten von uns so selbstverständlich zum Alltag wie die Münzen und Scheine zum Bezahlen. Will heißen: Die Entwicklung von „völlig unbekannt“ bis zum „Alltag“ binnen einer Generation ist angesichts des galoppierenden technischen Fortschritts nicht mehr ungewöhnlich.
Daher ist es gut und richtig, sich schon heute mit Bitcoin & Co zu befassen, denn es steht außer Frage, dass Kryptowährungen auf uns zukommen – genauer gesagt: sie sind längst da. Anfang der 2020er Jahre überstieg allein der Wert des weltweiten Bitcoin-Vermögens die Marke von einer Billion US-Dollar, alle anderen Kryptowährungen gar nicht mitgezählt.1
Den neuen Währungen wie Bitcoin & Co kommt im Unterschied zu Computern, Smartphones und dem Internet eine besondere Bedeutung zu, weil sie nicht nur unseren Alltag bestimmen werden, sondern ebenso stark unser Portmonee.
Eine Welt ohne Bargeld ist für viele von uns noch schwer vorstellbar. Jede Veränderung ruft bei den meisten Menschen Ängste hervor – und die Angst vor einem auch nur scheinbar drohenden Verlust des eigenen Vermögens ist besonders ausgeprägt.
Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit der neuen bargeldlosen Gesellschaft zu befassen, um die Risiken zu verstehen, aber auch, um die Chancen zu erfassen und für sich zu nutzen.
Andreas Dripke, Stephanie Stoerk
Von Vertrauen und Disruption
„Nur Bares ist Wahres“ sagt der Volksmund und will damit Bargeld als besonders sicher bezeichnen. Es ist im wortwörtlichen Sinne „handfest“; man kann es in die Hand nehmen gemäß Volkes Ausspruch „was man hat, das hat man“. Man will damit den Unterschied machen zu Geld, das „nur auf der Bank liegt“. Es ist ein anderes Gefühl, ob man das Geld „wirklich hat“ oder sein Vermögen „nur“ auf einem Bildschirm dargestellt bekommt, wie man heute häufig am Smartphone oder PC auf sein Bankkonto zugreift.
Vertrauen ist die Basis für alles
Doch tatsächlich ist der Unterschied gar nicht sehr groß: In beiden Fällen – Bargeld oder Kontogeld – bedarf es Vertrauen. Denn was gerne übersehen wird: Ein Geldschein ist nur solange mehr wert als das bedruckte Papier, wie alle an den höheren Wert glauben. „Währungsstabilität“ heißt das im Fachjargon. Wenn „50 Euro“ aufgedruckt sind, dann glauben wir an diesen Wert und haben auch eine Vorstellung von der damit verbundenen Kaufkraft. Es reicht, um beim Bäcker oder Metzger einkaufen zu können, aber nicht, um sich einen Kleinwagen zuzulegen. Wir vertrauen darauf, dass diese Kaufkraft weitgehend stabil bleibt.
Euro hat ein Viertel an Kaufkraft eingebüßt
Doch das ist ein weiterer Irrtum. So hat die Euro-Währung seit ihrer Einführung im Jahr 2002 bis 2022 – also binnen 20 Jahren – rund ein Viertel ihrer Kaufkraft eingebüßt. Wer also 2002 sagen wir 100.000 Euro in Bargeld zurückgelegt hat, findet sich 20 Jahre später nur noch mit der Kaufkraft von 75.000 Euro wieder. Der Wertverfall erfolgte indes schleichend, so dass er den meisten von uns gar nicht oder bestenfalls am Rande aufgefallen ist. Zum Vergleich: Wer im Jahr 2010 für 40 Euro Bitcoins gekauft hätte (2002 gab es noch keinen Bitcoin), wäre dafür in weniger als 20 Jahren mit einem Vermögen von mehreren Millionen Euro belohnt worden. Anders formuliert: Aus 40 Euro in Bargeld wurden 30 Euro; dieselbe Summe in Bitcoin angelegt hat den Besitzer zum mehrfachen Millionär gemacht. Das Beispiel verdeutlicht, dass es sich im wortwörtlichen Sinne lohnt, sich mit Bitcoin & Co zu beschäftigen. Doch der Umgang mit Neuen wird häufig gehemmt durch Ängstlichkeit und Bequemlichkeit. Nur wenn der Bequemlichkeitsfaktor hoch genug ist, überwinden wir unsere Angst vor dem Neuen.
So zahlen viele Menschen vor allem aus Bequemlichkeit schon lange bargeldlos – sei es per Kreditkarte, EC-Karte, mit dem Smartphone oder gar mit der Smartwatch. Bei geringeren Beträgen haben wir uns längst an das bargeldlose Zahlen gewöhnt – viele haben es sich in den Pandemiejahren 2020/21 zu eigen gemacht, um möglichen Infektionen durch den Austausch von Bargeld vorzubeugen. Indes: Bei dieser Form des digitalen Bezahlens bewegen wir uns stets in der uns vertrauten Währung, typischerweise also im Euro-Raum. Wir übertragen beispielsweise 20 Euro per Plastikkarte oder Smartphone. Weil wir den Schein nicht in die Hand nehmen, konzentrieren wir uns mehr auf den Vorgang – Karte ins Gerät stecken oder Smartphone ans Zahlungsterminal halten – als auf die Währung.
Einen fundamentalen Schritt weiter gehen die sogenannten Kryptowährungen, von denen der Bitcoin die älteste und mit Abstand bekannteste darstellt. Auch hierbei gibt es keinen Schein, kein Bargeld, sondern Aufbewahrung und Übertragung – also Zahlungen – erfolgen rein digital. Genau genommen existiert Kryptogeld überhaupt nur digital. Im Unterschied zu den klassischen staatlichen Währungen, die von einer Zentralbank überwacht werden, insbesondere im Hinblick auf ihre Stabilität, also ihre Kaufkraft, unterliegen die Kryptowährungen keiner derart zentralen Kontrolle. Das hat viele Implikationen und verunsichert teilweise. Der Unterschied zwischen Digitalgeld (Euros in digitaler Form) und Kryptogeld (rein digitale Währungen) verschwimmt teilweise im Bewusstsein der Menschen, doch er ist fundamental wie in diesem Buch dargestellt wird.
Parallelen zwischen Internet und Kryptogeld
Kryptogeld wird häufig verglichen mit dem Internet: Es gehört keiner zentralen Stelle und es wird von keiner zentralen Instanz kontrolliert. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Parallelen, und einige der Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten das Internet determiniert haben, lassen sich als Fingerzeig deuten in Bezug auf künftige Entwicklungen bei Kryptowährungen. Dazu gehört beispielsweise die Frage nach nationaler Dominanz im neuen Medium: Das Internet wird zweifelsohne von den USA dominiert, gefolgt von China, sicherlich nicht von Europa. Im vorliegenden Buch gehen wir unter anderem nicht nur der Frage nach, wie dieses Ungleichgewicht entstanden ist, sondern vor allem auch, welche Gewichtungen sich daraus für die Zukunft im weltweiten Währungswesen ergeben könnten.
Digitalisierung trifft Finanzwesen
Letztlich lässt sich die „Welt ohne Bargeld“ treffender als „Digitalisierung trifft Finanzwesen“ charakterisieren. Daher umfasst das vorliegende Werk neben der Entwicklung des Internet auch eine Geschichte des Geldes. Denn man muss beide Seiten verstehen, um zu begreifen, was passieren wird, wenn sie aufeinanderprallen. In der Fachsprache gibt es den Begriff der „digitalen Disruption“: Das bedeutet, dass das Eindringen der Digitaltechnik in eine Branche diese grundlegend auf den Kopf stellt.
Kryptowährungen haben das Potenzial dafür, das weltweite Finanzsystem fundamental zu verändern, also nicht nur eine bestehende Struktur zu verbessern, sondern eine völlig neue Struktur zu schaffen. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen bargeldlosem Bezahlen sagen wir per Kreditkarte oder Smartphone-Systemen wie Apple Pay einerseits und Bitcoins oder anderen Kryptowährungen andererseits. Im ersten Fall bleibt die Währung erhalten, es wird lediglich eine Euro-Zahlung auf moderne Art und Weise getätigt, während für den zweiten Fall die Euro-Währung überhaupt nicht mehr benötigt wird.
Kampf um die digitale Disruption
Das heutige Finanzsystem wird die digitale Disruption nicht „einfach so“ über sich ergehen lassen, sondern sich wehren. Es wird repräsentiert durch die staatlichen Notenbanken. Sie sind mächtig, sie haben den Gesetzgeber an ihrer Seite und argumentieren mit der Sicherheit und der Stabilität des heutigen Systems. Und sie haben möglicherweise aus der Omnipräsenz des Internet gelernt, dass sie sich zügig und kräftig wehren müssen, um nicht von der neuen Digitaltechnik überrollt zu werden.
Andererseits muss sich das etablierte Finanzsystem eingestehen, dass es keineswegs so stabil ist, wie es sich gerne gibt: Finanzkrisen stellen kein theoretisches Gespinst dar, sondern haben eine eigene Geschichte – und sie haben schon mehrere Generationen mehr oder minder um ihre ganzen Ersparnisse betrogen.
Wem vertrauen die Menschen?
In einer Zeit, in dem sich das Vertrauen in die Politik und in die Institutionen auf dem Rückzug befindet, muss die Frage erlaubt sein: Warum sollten die Bürger eigentlich den staatlichen Notenbanken vertrauen und nicht wenigstens einen Teil ihres Vermögens in Kryptowährungen außerhalb des staatlichen Einflusses anlegen?
Natürlich hat der Staat stets die Möglichkeit, Verbote auszusprechen, also beispielsweise Kryptowährungen zu verbieten. Aber ist es wirklich vorstellbar, dass in irgendeinem zivilisierten Land ein Internet-Verbot erlassen würde? Eher nicht.
Analog stellt sich die Frage, ob die Kryptoentwicklung nicht ebenfalls längst schon einen Punkt erreicht hat, an dem ein staatliches Verbot im Grunde undenkbar ist. Nach Auffassung der Autoren ist dieser Punkt bereits überschritten, aber der Staat kann – wenn schon schwerlich verbieten – so doch reglementieren und vor allem mit einer eigenen staatlichen Kryptowährung versuchen, seine nationale Hoheit über das Finanzsystem zu behalten. Alles läuft auf einen Kampf mit mehreren Fronten hinaus: dem Staatsmonopol gegen ein neues, staatsunabhängigeres Finanzwesen einerseits und dem Wettbewerb um die Dominanz im Kryptosektor der Staaten untereinander andererseits.
Alle diese Entwicklungen werden im vorliegenden Werk umrissen und künftige Szenarien skizziert. Für alle, die in diesen Zeiten des Umbruchs um ihr Geld bangen, behält der Grundsatz von Anlegerlegende André Kostolany seine Gültigkeit: Nicht alles auf eine Karte setzen, sondern breit diversifizieren, um beim Untergang des einen Systems wenigstens noch ein kleines Vermögen im anderen System retten zu können. Um das zu verstehen, ist ein kurzer Blick auf die Geschichte des Geldes von Vorteil.
Vom Mythos zur Realität
Wer Geld besitzt, hat Macht; wer Geld herstellt, ist der Allmächtige. Nach diesem Motto haben sich die Staaten durchweg das Monopol des Gelddruckens gesichert. Betrachten wir kurz die geschichtliche Entwicklung, um zu verstehen, warum dieses Monopol vor dem Kippen stehen könnte und weshalb sich die Staaten dagegen wehren.
Vom Tauschhandel zum Bankgeld
Tauschhandel, Tauschmittel, Muscheln, Münzen, Papiergeld, staatliche Währungen, Plastikgeld, Bankgeld – die Geschichte des Geldes entwickelte sich über Jahrtausende hinweg vom Tauschhandel verschiedener Produkte („tausche Messer gegen Korb“) zu einer Frage des Vertrauens. In der heutigen Zeit ist damit stets das Vertrauen in einen Staat als Hüter einer nationalen Währung verbunden, denn Banknoten sind nichts anderes als Zahlungsversprechen. Auf der britischen 5 Pfund-Note steht neben dem Bild der Queen der schöne Satz: „I Promise to pay the Bearer on Demand the Sum of 5 Pounds.“2 Der Wert des „Fetzen Papier“ ergibt sich einzig und allein daraus, dass alle Marktteilnehmer der britischen Königin vertrauen, dass sie sich an ihr Versprechen hält. Und wer seinen Bankauszug in der Hand hält oder am Computerschirm betrachtet, vertraut ebenfalls darauf, dass die Bank auf Anforderung das ausgewiesene Geld tatsächlich auszahlt.
Mit den sogenannten Kryptowährungen kamen erstmals Währungen in Umlauf, die unabhängig vom Vertrauen in einen Staat oder in eine Bank funktionieren. Was dem einen oder anderen heute noch als „technischer Schnickschnack“ anmutet, könnte sich binnen weniger Jahre oder Jahrzehnte als eine umwälzende Zäsur in der Geschichte des Geldes entpuppen.3
Zunächst einmal einen Blick auf die historische Entwicklung des Geldes: Zwischen 9.000 und 6.000 vor Christus war der Tauschhandel üblich.4 Um den Handel zu erleichtern, kamen gegen Ende dieser Periode leichter transportierbare Tauschmittel wie Getreide oder Gemüse auf. Um 1.200 vor Christus begannen sich Muscheln als erste „Währung“ durchzusetzen, die etwa 500 vor Christus von Münzen aus Gold, Silber und anderen Metallen abgelöst wurden. In China kam schließlich um 800 nach Christus das erste Papiergeld in Umlauf.
Vom Warengeld zum Fiatgeld
Diese Entwicklung markiert den Übergang vom Warengeld zum Fiatgeld. Warengeld besitzt einen Wert an sich, unabhängig davon, ob Vertrauen in eine Währung existiert oder nicht („eine Kuh bleibt eine Kuh“). Fiatgeld (vom lat. „Fiat“, „es werde“) besitzt selbst keinerlei Wert, sondern wird nur durch allgemeine Vereinbarung zum Ersatz für das Warengeld, zum neuen Tauschmittel.5 Ein Staat kann per Gesetz bestimmen, dass jedermann, der am öffentlichen Handel teilnimmt, dieses Tauschmittel akzeptieren muss. Die Regierung verspricht im Gegenzug, den Wert der staatlichen Währung zu sichern.
Das gilt übrigens auch für die neuen Kryptowährungen: Erst durch das Vertrauen der Marktteilnehmer entsteht eine Währungsordnung. Die Frage ist: Wer kann das größere Vertrauen auf sich ziehen: Die Bank, der Staat oder eine neue Generation von Kryptowährungen, die, ähnlich wie das Internet, derart dezentral angelegt sind, dass es keinen „Währungshüter“ im herkömmlichem Sinne gibt, der das in ihn gesetzte Vertrauen missbrauchen könnte.
Im Rahmen der Hyperinflation in Deutschland im Jahre 1923 wurde für jedermann deutlich, was passiert, wenn ein Staat das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht. Damals druckte die Reichsbank zur Finanzierung des Krieges Geldscheine im Überfluss – von 13 Milliarden Reichsmark am Kriegsanfang bis zu 60 Milliarden Reichsmark zum Ende des Krieges – und zerstörte damit das Vertrauen in die Währung. Bald kostete eine Tasse Kaffee 10.000 Reichsmark, später ein Kanten Brot eine Million Reichsmark.6
Vertrauen in die Bundesbank und in die EZB
Heute vertrauen wir hierzulande auf die Bundesbank und auf die Europäische Zentralbank, dass sich eine solche oder ähnliche Entwicklung nicht wiederholt. Gleichzeitig erleben wir in anderen – weniger stabilen – Ländern fortlaufend, wie Währungen schwanken und zerfallen, sobald das Vertrauen schwindet.
Kryptowährungen basieren auf zwei fundamentalen Erkenntnissen, die unmittelbar zusammenhängen: erstens, das Vertrauen in Notenbanken ist nicht grenzenlos und zweitens, die Notenbanken haben das ihnen entgegengebrachte Vertrauen schon des Öfteren missbraucht. Man muss kein „Crash-Prophet“ sein, um zu erkennen, das die Währungs- und Finanzsysteme bereits in der Vergangenheit häufiger einen Crash hingelegt haben, um daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es auch künftig zu einem Crash kommen könnte.
Der große Crash
Wie unstabil die Welt der Wirtschaft und der Währungen ist, hat sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder gezeigt. Die Börsen brachen zusammen, das Geld wurde entwertet, Währungen verschwanden, das Vertrauen von Anlegern erwies sich als flüchtig, die Wirtschaft wurde zu Boden gedrückt, Massenarbeitslosigkeit bereitete den Weg zum Krieg.
Als die wichtigsten Crash-Ereignisse gelten:
Alle diese Krisen im Detail zu beleuchten, würde den Rahmen des vorliegenden Buches sprengen. Aber auf einige ausgewählte Crashsituationen soll eingegangen werden, weil sie beispielhaft verdeutlichen, wie volatil Geld und Geldvermögen sind, welche Rolle das Vertrauen in die Stabilität einer Währung gleich welcher Art spielt und was passiert, wenn dieses Vertrauen verloren geht – und warum Bargeld nur scheinbar sicher ist.