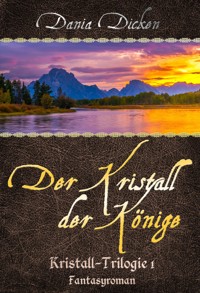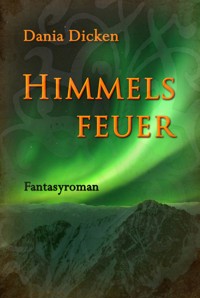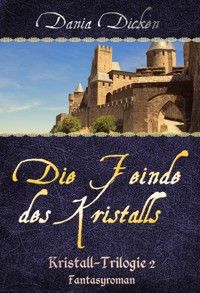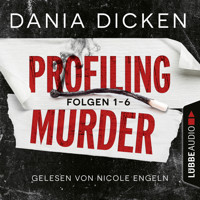4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
FBI-Profilerin Libby Whitman verbringt Thanksgiving zusammen mit ihrem Mann Owen bei ihrer Familie in der kalifornischen Heimat. Der entspannte Urlaub findet jedoch ein jähes Ende, als Libbys zwölfjährige Schwester Hayley nach einer entgleisten Mutprobe beobachtet, wie der siebzehnjährige Harper im Wald einen Jungen erschlägt. Pikant: Harper ist der Sohn des örtlichen Sheriffs und Hayleys Aussage das Einzige, was Harper belastet. Der Sheriff setzt alles daran, um seinen guten Ruf zu schützen und seinen Sohn vor einer Haftstrafe zu bewahren – und kennt dabei keine Skrupel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dania Dicken
Wenn die Wahrheit leise stirbt
Libby Whitman 13
Mut ist die Tugend, die für Gerechtigkeit eintritt.
Cicero
Prolog
Der Ball flog mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit durch die Luft und Logan behielt ihn genau im Auge, während er versuchte, ihn noch irgendwie zu erwischen.
„Homerun!“, brüllte jemand vom Spielfeldrand. Logan tat sein Möglichstes, doch als hinter ihm Jubel laut wurde, begriff er, dass er längst zu spät war. Genervt warf er seinen Handschuh ins Gras, während er in die Richtung joggte, in der Augenblicke zuvor der Baseball zu Boden gegangen war.
„Suchst du den hier?“
Logan fuhr herum. Ein kleines Stück entfernt stand Harper Bowman neben einem Mülleimer und hielt den Baseball in die Höhe.
„Ja“, erwiderte Logan atemlos. Er ging auf Harper zu und wollte ihm den Ball schon abnehmen, doch da drehte Harper sich um und schmetterte ihn im hohen Bogen in den angrenzenden Oakhill Park.
„He!“, rief Dave von hinten und Logan starrte Harper wütend an.
„Was sollte das?“
„Los, Hündchen, hol das Stöckchen“, zog Harper ihn auf.
„Leck mich doch, Harper.“ Logan drehte sich schon um, weil er im Park auf die Suche nach dem Baseball gehen wollte, doch da wurde er von hinten am Kragen und am Hosenbund gepackt. Harper schleuderte ihn so stark herum, dass er das Gleichgewicht verlor und ungebremst zu Boden ging.
„Wie war das?“, schnaubte Harper. Logan wälzte sich herum und wollte schon wieder aufstehen, doch da traf Harpers Schuh ihn mitten im Gesicht und Logan spürte, wie mit einem schmerzhaften Knacken seine Nase brach.
„Harper!“, brüllte Adam. Logan konnte ihn nicht mehr sehen, weil seine Augen tränten, aber er erkannte ihn an der Stimme.
„Hör auf, Mann!“
Doch Harper dachte gar nicht daran. Während Logan sich stöhnend an die Nase fasste, landete ein Tritt in seinem Bauch. Für einen kurzen Moment wurde ihm schwarz vor Augen, bevor er röchelnd nach Luft schnappte und sich schmerzerfüllt am Boden krümmte.
„Harper, lass den Scheiß!“, brüllte Adam. Schützend versuchte Logan, seine Arme vor seinen Kopf zu halten, doch da traf ihn ein weiterer Tritt und ein furchtbarer Schmerz durchzuckte seinen Oberkörper. Es war, als hätte Harper völlig die Besinnung verloren, als er Logan mit harten Tritten zusetzte.
Adam versuchte noch, ihn festzuhalten, doch Harper stieß ihn weg und stürzte sich mit wütendem Gebrüll auf Logan. Der versuchte verzweifelt, sich Harper irgendwie vom Leib zu halten, schrie aber vor Schmerz auf, als er spürte, wie der Knochen in seinem Unterarm brach und ihm das Blut aus der Nase bis ans Kinn herablief. Der nächste Tritt sorgte dafür, dass ihm schwarz vor Augen wurde.
Dienstag, 22. November
„Dieser Fall ist ein Paradebeispiel dafür, was trotz guter und sauberer Profiler-Arbeit alles schieflaufen kann. Bei Widersprüchen im Profil ist es immer wichtig, die Möglichkeit im Hinterkopf zu behalten, dass man es mit mehreren Tätern zu tun hat. Außerdem darf man nicht vergessen, dass selbst in Fällen wie diesem die Kooperation eines Opfers hinsichtlich der Aufklärung nicht unbedingt gegeben sein muss. Man sollte ja meinen, Mary Jane Cox hätte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als für die Verhaftung ihres Peinigers zu sorgen – aber das Gegenteil war der Fall. Sie hat bei der Suche nach Randall Howard nicht kooperiert, um einerseits Vincent Howard Baileys Existenz zu verschweigen und andererseits dafür zu sorgen, dass sie selbst strafrechtlich nicht belangt wird.“
Nick ließ seine Blicke durch den Vortragsraum schweifen, während er eine Pause machte und schließlich an seinem Laptop etwas vorbereitete. Angespannt beobachtete Libby ihn dabei und holte tief Luft. Gleich war es so weit.
Neben ihr in der ersten Reihe saß Julie, was sich fast anfühlte wie früher. Sie hatten oft genug gemeinsam in diesem Raum gesessen und Nicks Vorträgen zum Thema Profiling gelauscht, doch nun war sie hier, um selbst zu den Rekruten zu sprechen.
Das Flüstern, das aufgekommen war, verstummte sofort, als Nick wieder aufblickte. „Ich hoffe, ich darf davon ausgehen, dass Ihre Wochenendlektüre aus dem Essay der Agents Whitman und Thornton bestanden hat, denn wie angekündigt sind die beiden hier und bereit, mit Ihnen zu sprechen und Ihre Fragen zu beantworten. Libby, Julie, ihr könnt nach vorn kommen.“
Die beiden Angesprochenen standen auf und gesellten sich unter den gespannten Blicken der Rekruten nach vorn zu Nick, der nun an seinem Laptop Mitschnitte aus Nachrichtensendungen abspielte. Sie stammten von NBC und der erste zeigte einen jungen Reporter, der vor dem Arlington PD stand und berichtete, dass Vincent Howard Bailey auf drei Polizisten geschossen und eine FBI-Agentin entführt hatte. Libby stand seitlich, so dass sie das Video auf der Leinwand im Augenwinkel sehen konnte. Obwohl sie damit gerechnet hatte, erwischte es sie trotzdem kalt, ein Foto von sich in einem Nachrichtenstudio zu sehen.
Es folgten weitere Mitschnitte, die nachzeichneten, wie intensiv nach ihr und Vincent gefahndet worden war. Ein Bericht befasste sich mit dem Fund des Bunkers, in dem Vincent sich mit ihr versteckt hatte, und der letzte widmete sich ihrer Flucht. Eine Reporterin stand vor der Feuerwache in Karthaus, Pennsylvania und verkündete, dass es Libby gelungen war, aus eigener Kraft vor Vincent zu fliehen. Damit endete das Video.
Nick stellte kurz etwas an seinem Laptop ein und wandte sich dann an Libby. „Du hast das Wort.“
Sie nickte ihm zu und stellte sich hinter das Vortragspult. „Danke, dass ich heute hier sein kann. Ich will ehrlich sein – das fällt mir nicht leicht, aber ich habe damals beschlossen, die Flucht nach vorn anzutreten. Es bleibt einem auch kaum etwas anderes übrig, wenn das eigene Foto eine Woche lang ständig durchs Fernsehen geistert und auf den ersten Blick sichtbar ist, dass ich die Entführung durch einen sadistisch motivierten Serienmörder überlebt habe.“
Nick projizierte ein aktuelleres Foto von ihr im T-Shirt an die Wand, auf dem deutlich ihre Halsnarbe und Schnitte an ihren Armen sichtbar waren, so dass auch die Rekruten weiter hinten es sehen konnten. Es war totenstill im Saal.
„Sie haben sich mit dem Fall Howard und Bailey beschäftigt. Sie wissen, wer Bailey war, was er getan hat und was seine Vorlieben waren. Ich wusste das auch – ziemlich gut sogar. Monatelang haben wir versucht, ihn zu finden und dingfest zu machen, um seine Mordserie zu beenden. Leider war er uns immer einen Schritt voraus. Selbst nach meiner Entführung hat es noch drei Tage gedauert, bis die Suchtrupps den Bunker gefunden haben, in dem er sich mit mir verkrochen hat“, fuhr Libby fort. Während sie sprach, wich ihre Anspannung allmählich. Sie holte tief Luft und sprach weiter.
„Bailey hat etwas für einen Sadisten Erstaunliches getan, indem er mich entführt hat, denn ich hatte ein Gesicht und einen Namen für ihn. Wie Sie wissen, suchen Sadisten sich üblicherweise für Sie anonyme Opfer, weil es ihnen leichter fällt, sie zum Objekt zu degradieren und zu foltern. Mir hingegen hatte er zuvor wochenlang nachgestellt, immer wieder Briefe geschickt und mich angerufen, so dass die Distanz zwischen uns geschrumpft ist. Beeinflusst hat ihn das jedoch nicht. Das erkläre ich mir damit, dass ich ein Feindbild für ihn war, seit ich seinen Cousin erschossen habe – und ich war immer nur Ersatz, so wie seine anderen Opfer auch. Eigentlich wollte er Mary Jane Cox.“
Libby versuchte, unbemerkt ihre schweißnassen Hände an ihrer Hose abzuwischen, und blickte wieder auf.
„Sie alle sind hier, weil Sie in den Dienst dieses Landes treten und für die Wahrung des Rechts eintreten wollen. Das war auch immer meine Motivation. Ich kenne aber auch die andere Seite und kann Ihnen sagen: Was Sie tun, macht einen Unterschied. Es macht vor allem einen Unterschied, wie Sie es tun. Sie werden sicherlich einmal mit Gewaltopfern konfrontiert – mit Entführungsopfern, mit Vergewaltigungsopfern, was auch immer. Dabei haben Sie stets im Blick, den Täter zu fassen und bloß nichts falsch zu machen, was hinterher zu einem Verfahrensfehler führen und den ganzen Fall vor Gericht in sich zusammenfallen lassen könnte. Das ist auch wichtig. Aber was ich sagen will: Bleiben Sie wachsam – und vorsichtig.“
Libby war froh, dass der Raum dunkel genug war, damit sie niemanden im Einzelnen erkennen konnte, als sie fortfuhr.
„Bailey hatte mich fünf Tage lang in seiner Gewalt. Das ist eine Erfahrung, die ich niemals vergessen werde – gefesselt hatte ich ihm nichts entgegenzusetzen und es hing von seinem Wohlwollen ab, ob ich etwas zu essen bekomme oder nicht. Damit hatte er mich im Griff. Er hat mir manchmal dann etwas zu trinken gegeben, wenn er der Meinung war, dass ich meine Sache gut mache, weil ich mich nicht gegen ihn gewehrt habe. Manchmal hat er mich aber auch gequält, einfach weil er es konnte. Sie kennen das Repertoire eines sexuellen Sadisten – ich kannte es auch, aber es hat mir nicht dabei geholfen, dafür zu sorgen, dass er mich verschont. Es hat mir jedoch dabei geholfen, seine schlimmsten Wutausbrüche und Eskalationen abzumildern – und es war auch entscheidend hinsichtlich meiner Flucht.“
Für einen kurzen Moment blickte Libby zu Nick und Julie, weil es sie erdete, und fuhr dann fort.
„Am letzten Tag meiner Gefangenschaft bei Bailey befand ich mich mit ihm in Pine Glen im Haus eines alten Mannes, den er am Vortag kaltblütig erschossen hatte. Die Leiche lag in der Garage des Mannes, wo Bailey auch das Auto versteckt hat, das er Monate zuvor gestohlen hatte. Er hatte vorab die Forderung ans FBI gerichtet, ihm Mary Jane Cox auszuliefern, und behauptet, mich im Gegenzug freizulassen – eine Farce, wie Sie sich denken können. Er ist mit mir in den Wald gefahren, um zu telefonieren und keinerlei Rückschlüsse auf unser Versteck zuzulassen, wenn man ihn ortet. Er hat meinen Mann angerufen, nachdem er mich gezwungen hat, ihm die Handynummer zu verraten. Ganz typisch für einen Sadisten – es hat ihm Vergnügen bereitet, nicht nur mich zu quälen, sondern auch meinem Mann zuzusetzen. Und obwohl mein Mann Detective bei der Metropolitan Police in Washington ist und schon viel gesehen hat, belastet ihn das noch immer.“
Allmählich ging es besser. Libby hatte sich vorgenommen, exemplarisch von einem Tag zu berichten, bevor sie Fragen zuließ.
„Für einen Sadisten war das alles verdammt persönlich. Mein Mann musste ihm natürlich die Nachricht überbringen, dass er Mary Jane nicht bekommt, und daraufhin ist Bailey ziemlich ausgerastet. Er hat mich in das Haus zurückgebracht, mich ans Bett gefesselt ...“ Ihre Stimme begann zu zittern. „Und er hat gedroht, mich mit dem Messer zu verstümmeln, so wie Sie das schon von seinen anderen Opfern kennen. In diesem Moment hat es mich gerettet, dass ich Profilerin bin, denn ich konnte ihn argumentativ davon überzeugen, es zu lassen, um keinen hohen Blutverlust bei mir zu riskieren. Ich wusste ja, dass es ihm noch längst nicht darum ging, mich zu töten. Und tatsächlich hat er es gelassen. Zwar hat er sich an mir abreagiert und mich verletzt ... unter anderem auf diese Art.“ Libby hielt ihre vernarbten Arme hoch. „Aber damit kann ich besser leben als mit dem, was er eigentlich im Sinn hatte.“
Als sie nun zu dem Wasserglas griff, das Nick ihr bereitgestellt hatte, merkte sie erst, wie sehr sie zitterte. Es fiel ihr schwer, das Glas festzuhalten, weshalb Nick ihr leise zuraunte: „Wir können unterbrechen oder aufhören, wenn du willst.“
Doch Libby schüttelte den Kopf. „Will ich nicht. Es geht schon, ich brauche nur einen Moment.“
Sie sagte das deutlich lauter als Nick, weil für sie nichts dabei war, wenn die Rekruten es hörten. Im Raum war es immer noch totenstill.
Schließlich räusperte sie sich und fuhr fort. „Es dauerte bis zum Abend, bis Bailey mich losgebunden und hinunter in die Küche gebracht hat, wo er etwas zu essen zubereitet hatte. Überbackenen Toast, das vergesse ich nie. Ich war mit Handschellen gefesselt, als ich mich an den Küchentisch gesetzt habe, nichts weiter. War nicht nötig, er hat gespürt, wie sehr er mir zugesetzt hatte. In diesem Moment gab er sich großzügig und ließ mich essen, so viel ich wollte. Wie Sie wissen, war er Diabetiker und wollte sich gerade spritzen, um auch etwas essen zu können. Im Wohnzimmer lief der Fernseher und als dort die Rede von uns war, ist er aufgestanden und hat das Insulin einfach liegen gelassen – die Spritze in der Ampulle, alles ganz kompliziert, weil er es sich auf der Straße besorgt hat. Das war meine Rettung. Als er nicht hingesehen hat, habe ich ihm mehr Insulin aufgezogen und er hat sich unwissentlich eine Überdosis verpasst. Das hat er zwar gemerkt und weil er wusste, dass er das Bewusstsein verlieren würde, hat er mich mit einer Handschelle an die Heizung gefesselt, bevor es so weit war. Aber das war meine Chance. Weil er keinen Zucker gefunden hat, wurde er ohnmächtig – und als ich eine Büroklammer in die Finger bekommen habe, war das der Schlüssel zur Freiheit. Das kann ich Ihnen nur raten: Wenn Sie Ihre Handschellen noch nicht mit einem Hilfsmittel wie einer Büroklammer öffnen können, üben Sie es. Ich habe das schon mehrfach gebraucht und bin froh, dass mein Vater es mir gezeigt hat. Er war ja auch Polizist und FBI-Agent.“
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, denn sie wusste, alle Augen waren auf sie gerichtet. Aber sie war fest entschlossen, es zu schaffen.
„Bailey kam wieder zu sich, als ich die Handschellen gerade offen hatte. Ich bin einfach geflohen, in den Wald hinein, barfuß und bloß mit einem blutverschmierten Nachthemd bekleidet. Und jetzt kommt das, was ich Ihnen anfangs mit auf den Weg geben wollte.“ Sie holte tief Luft. „Ich habe bei einem alleinstehenden Mann an der Haustür geklopft. Ich habe eine ziemlich präzise Vorstellung davon, wie ich ausgesehen haben muss, mit den vielen Schnitten an Armen, Beinen und den Striemen auf meinem Rücken, die man zum Glück nie sieht. Der Mann hieß Arthur Deakins – und er hat mir, obwohl es ein heißer Augusttag war, eine Decke gebracht, die Tür verriegelt und seine Schrotflinte geholt, um mir zu zeigen, dass ich sicher bin. Er hat den Notruf gewählt und nur wenige Minuten später waren meine FBI-Kollegen vor Ort. Im Schlepptau hatten sie einen Feuerwehrmann mit Sanitätsausbildung, der die Erstversorgung meiner Verletzungen übernommen hat – ganz vorsichtig und nur mit meinem Einverständnis. Das war verdammt wichtig, denn in diesem Moment hat mich jeder mit Respekt behandelt und so eine Retraumatisierung verhindert.“
Für einen kurzen Augenblick schloss Libby die Augen, bevor sie sich an die Rekruten richtete. „Haben Sie Fragen an mich? Sie wissen eine Menge, wenn Sie mein Essay über Bailey gelesen haben. Ich bin bereit, heute Ihre Fragen zu beantworten, und ich bin bemüht, zu allem Auskunft zu geben, was Sie wissen wollen. Bitte sehen Sie es mir nach, falls ich das nicht bei jeder Frage schaffe.“
Nick sorgte dafür, dass das Licht im Saal nun wieder eingeschaltet wurde und Libby war vollkommen erstaunt, als niemand sich rührte – doch dann hob eine junge Frau ihre Hand und innerhalb von Sekunden taten einige andere Rekruten es ihr gleich. Libby blickte zu der Anwärterin, die sich zuerst gemeldet hatte, und nickte ihr zu.
„Wie lang hat es gedauert, bis Sie in den aktiven Dienst zurückgekehrt sind?“, fragte die Frau.
„Etwa einen Monat. Da hatte ich allerdings schon therapeutische Unterstützung – die habe ich heute noch, wenn auch nicht mehr so häufig“, antwortete Libby.
„Und haben Sie gar nicht mit dem Gedanken gespielt, sich beruflich neu zu orientieren? Ist es nicht hart, im Job mit ähnlichen Fällen konfrontiert zu werden?“
„Doch, und wie. Das ist wahnsinnig hart. Trotzdem will ich weitermachen, denn meine Erfahrung ist ja auch etwas, das ich nutzen kann. Es wird wieder einen Täter wie Bailey geben, und wenn das der Fall ist, dann bin ich der Jäger und er der Gejagte. Und deshalb stehe ich auch hier. Deshalb habe ich auch über ihn geschrieben. Es ist nicht immer einfach, aber ich komme damit zurecht.“
Als keine Frage von ihr mehr kam, rief Libby den nächsten Rekruten auf.
„Haben Sie denn vor dieser Situation am letzten Tag mal versucht, zu fliehen?“, fragte er.
Libby nickte. „Ja, am ersten Tag. Bailey wollte mich ans Bett fesseln und zu dem Zweck musste er mir die Handfesseln für einen Moment abnehmen. Ich war noch fit, ich war auch noch nicht so eingeschüchtert – da habe ich ihn plötzlich attackiert und versucht, ihm die Waffe wegzunehmen. Hat leider nicht geklappt. Danach hat er mich ziemlich eingeschüchtert, weshalb ich es so schnell nicht wieder versucht habe.“
Die nächste Frage kam von einer Frau. „Aus Ihrem Essay ging schon deutlich hervor, dass Sie ihn verdammt gut kannten. Sie haben ja vorhin auch beschrieben, dass es eine persönliche Nähe zwischen Ihnen und Bailey gab, die untypisch ist. Trotzdem frage ich mich, und das ging aus Ihrem Essay auch nicht hervor – hat die Täter-Opfer-Beziehung sich im Verlauf Ihrer Gefangenschaft gewandelt?“
„Oh ja“, sagte Libby. „Das war auch ziemlich absurd. Für das, was da passiert ist, kannten wir uns überraschend gut. Ich wusste, wie er heißt, ich wusste so viel über ihn und er umgekehrt über mich. Das macht es auf eine Art schwieriger. Aber er hat natürlich Sorge dafür getragen, mich seinen Vorstellungen entsprechend immer weiter zu demütigen und ... ja, zu unterwerfen. Im Essay hatte ich das ja auch beschrieben – er wollte das Machtgefälle in unserer Beziehung verstärken, indem er mir befohlen hat, ihn als meinen Herrn anzusprechen.“
Nach einem kurzen Moment des Schweigens fragte die Anwärterin: „Ich nehme an, Sie haben es getan?“
Libby nickte. „Ich wollte erst nicht, aber wenn man vor der Wahl steht, entweder das zu tun oder wieder gefoltert zu werden, ist die Entscheidung leicht.“
„Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie das verinnerlicht?“
„Nein“, sagte Libby kopfschüttelnd. „Es war jedes Mal aufs Neue schwierig, das über die Lippen zu bringen. Das ist mir verdammt schwergefallen, weil ich es ja nicht verinnerlichen wollte. Ich habe ihn auch dafür gehasst, dass er mich damit so gedemütigt hat. Seine ganze Handlungsweise folgte einem strikten Ablauf – erst wollte er mich gefügig machen, indem er mir weh tut, mir nichts zu essen gibt, solche Dinge. Dann ist es langsam immer schlimmer geworden. Ich erinnere mich an einen Moment, das war ...“ Libby schluckte. „Das war nach einer Vergewaltigung. Er hat sich etwas zu trinken geholt und mich dazu aufgefordert, ihn ganz unterwürfig darum zu bitten, mir auch etwas zu geben. Ich habe es getan, obwohl es mich eine irrsinnige Überwindung gekostet hat, aber ich wusste ja nicht, wann ich die nächste Chance haben würde, etwas zu trinken zu bekommen.“ Sie atmete tief durch und fügte hinzu: „Das war überhaupt etwas, was mir wahnsinnig schwergefallen ist – diese Momente, in denen er dann plötzlich versöhnlich gestimmt war, weil ich getan habe, was er wollte, und dann war er großzügig und in Plauderlaune. Sie dürfen sich das ja nicht so vorstellen, als wäre das fünf Tage nonstop so gelaufen. Er hat mich am ersten Tag durchaus zu seinem Profil befragt und zwischendurch auch mit mir über meinen Job und meinen Mann gesprochen.“
„Das muss surreal gewesen sein.“
Libby nickte. „Das war es. Sehr sogar. Aber es beweist, was wir alle vielleicht nicht wahrhaben wollen – auch solche Täter sind Menschen. Sie sind nicht immer nur die Bestien, die wir in ihnen sehen wollen.“
Ein junger Mann war der Nächste. „Für mich sind besonders Ihre Hinweise darauf sehr wertvoll, wie ein guter Umgang mit Verbrechensopfern aussehen sollte. Sie sprachen vorhin von der Begegnung mit zwei Männern gleich nach Ihrer Flucht. Als Mann hätte ich durchaus Berührungsängste, wenn ich mich plötzlich mit einem Vergewaltigungsopfer konfrontiert sähe. Trotzdem will ich das Feld nicht kampflos den Kolleginnen überlassen, sondern da auch mein Bestes geben. Was würden Sie mir raten?“
Libby lächelte scheu. „Nett, dass Sie das fragen. Es ist ja der Königsweg bei den Behörden, in solchen Fällen zunächst die weiblichen Kollegen zu Rate zu ziehen – aber ich bin der Meinung, dass der gute Umgang mit Vergewaltigungsopfern keine Frage des Geschlechts ist. Ich gehe auch zu einem männlichen Therapeuten, da gab es für mich gar keinen Zweifel. Was ich im Umgang mit Männern festgestellt habe, ist eher zu viel Vorsicht als zu wenig. Seien Sie einfach respektvoll und aufmerksam, aber zurückhaltend bei körperlicher Nähe. In dieser Hinsicht sollten Sie nichts unternehmen, ohne sich das Einverständnis geholt zu haben. Ansonsten reicht es vermutlich, wenn Sie sich als Vertrauensperson anbieten und dem Opfer signalisieren, dass Sie auf den ersten Schritt warten.“
Libby war erstaunt über die Fragen, die die Rekruten ihr stellten. Sie waren durchdacht und kein bisschen sensationsgierig, was bei ihr das gute Gefühl weckte, mit ihrem Essay tatsächlich das Bewusstsein geschaffen zu haben, das sie sich wünschte. Schließlich klinkten sich auch Nick und Julie bei der Beantwortung der Fragen ein und als die Sitzung vorüber war, versammelten sich noch zahlreiche Anwärter vorn bei ihnen, um weitere Fragen loszuwerden. Manche kamen einfach nur, um Libby ihre Anerkennung auszusprechen und ihr alles Gute zu wünschen. Als die Reihen sich lichteten, stand schließlich bloß noch eine Anwärterin bei ihnen, die geduldig hinter allen anderen gewartet hatte und nun zögerlich vortrat.
„Vielen Dank für Ihren Bericht, Agent Whitman“, begann sie. „Das war wirklich eindrucksvoll und sehr nützlich für unsere Ausbildung. Mein Name ist Anna Deaver, ich komme aus West Virginia und war in Charleston bei der Polizei. In den letzten beiden Jahren war ich bei der Sitte und deshalb kenne ich eine Organisation, die erst vor fünf Jahren gegründet wurde und als Ansprechpartner für Opfer sexueller Übergriffe dient. West Virginia ist ja ein sehr ländlicher Bundesstaat und in manchen Gebieten geprägt von Armut und Arbeitslosigkeit. Manchmal scheitern Vergewaltigungsopfer und Opfer häuslicher Gewalt schon an der fehlenden Infrastruktur, um zur Polizei zu kommen und Anzeige zu erstatten oder sich ärztliche Hilfe zu suchen. Da setzt die Organisation an – sie nennt sich West Virginia Sexual Assault Crisis Center und sie begleiten Gewaltopfer zur Polizei, zu medizinischen Untersuchungen oder vor Gericht. Eine großartige Sache, aber noch nicht bekannt genug. Und jetzt, da ich Ihnen zugehört habe ...“ Für einen Moment verließ Anna der Mut. „Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen können, der Organisation Ihr Gesicht zu leihen, für Flyer oder Anzeigen. Ich weiß, das ist keine Kleinigkeit, aber Sie haben eine solche Power ... Mit Ihrer Geschichte könnten Sie andere Verbrechensopfer dazu inspirieren, sich zu wehren und für Gerechtigkeit einzustehen.“
Libby schluckte und wusste gar nicht, was sie erwidern sollte. Schließlich sprach sie einfach laut aus, was ihr durch den Kopf ging.
„Das ist eine großartige Sache und ich finde es toll, dass Sie mich fragen, aber ich stehe wahnsinnig ungern im Rampenlicht.“
„Das kann ich verstehen. Das ist jetzt auch bloß so eine Idee, die mir spontan kam, aber die leisten so gute Arbeit und können so viel für Betroffene tun. Die Organisation ist aber noch klein und chronisch unterfinanziert. Vielleicht könnte sich das ändern, wenn jemand wie Sie, mit Ihrer Geschichte, sich dafür stark macht.“
„Puh“, machte Libby und lachte verlegen. „Im Ernst, ich finde das großartig. Darf ich darüber nachdenken? Ich finde das total wichtig, aber ich weiß noch nicht, ob ich den Mut dazu habe.“
„Klar. Ich schreibe Ihnen einfach meine Kontaktdaten auf.“ Anna zerrte einen Block aus ihrem Rucksack und schrieb Libby ihre Handynummer und Mailadresse auf ein Stück Papier, das sie abriss und Libby in die Hand drückte.
„Ich fände es toll. Sie sind wirklich inspirierend. Ich meine, Sie sind immer noch beim FBI und wenn man Sie so sieht ... das lehrt jeden Täter das Fürchten, ganz ehrlich“, sagte Anna.
Libby lachte. „Im Ernst?“
„Ja, absolut. Was Sie da vorhin erzählt haben ...“ Anna schüttelte den Kopf. „Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen.“
„Ich wollte bloß überleben, nichts weiter.“
„Ja, aber als Sie beschrieben haben, wie Sie Bailey entkommen sind ... wow. Darauf können Sie stolz sein.“ Anna lächelte und fügte hinzu: „Ich würde mich freuen, wenn Sie sich melden.“
„Das tue ich“, versprach Libby und blickte Anna hinterher, als sie zur Tür ging.
„Ich kann verstehen, warum sie dich gefragt hat“, sagte Nick. „Du warst wirklich großartig vorhin. Überraschend offen, aber auch sehr menschlich und nahbar. Ich glaube, die Rekruten können viel daraus mitnehmen.“
Libby ließ ihre Gabel sinken. Sie saßen in der Kantine beim Mittagessen und besprachen ihre Eindrücke.
„Ich verstehe sie, ich bin auch total dafür. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich will“, erwiderte Libby.
„Kann ich verstehen“, sagte Julie. „Andererseits hast du jetzt mit unserem Essay auch die Öffentlichkeit gesucht.“
„Eine andere Öffentlichkeit, meinst du nicht? Fachpublikum. Das hat ja nichts damit zu tun, dass mein Gesicht auf einem Flyer auftaucht.“
„Solche Organisationen arbeiten häufig mit Testimonials. Das finde ich auch gut. Ich verstehe wirklich, dass sie dich gefragt hat, aber ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Ich fände es gut, aber ich verstehe, dass du da unsicher bist“, sagte Nick.
„Ich bespreche das heute Abend mal mit Owen, glaube ich“, sagte Libby. „Was ich aber toll fand, war der Rekrut, der von mir wissen wollte, wie er als Mann Vergewaltigungsopfern begegnen soll. Das zeigt schon, dass er das richtige Bewusstsein mitbringt. Wenn ich mal daran zurückdenke, wie ich Hawkins damals angezeigt habe – da habe ich ganz selbstverständlich bei einer Polizistin ausgesagt. Damals war ich froh darüber, aber heute weiß ich zu schätzen, dass mein Therapeut ein Mann ist. Ich fände es schön, wenn die Geschlechterfrage egal ist, weil männliche Befrager genauso gut darin geschult sind.“
„Sind sie häufig, aber viele Opfer fühlen sich bei Frauen einfach wohler“, gab Nick zu bedenken.
Libby zuckte arglos mit den Schultern. „Ich hatte keine Wahl, als ich Bailey entkommen bin. Im Krankenhaus hatte ich mit einer Ärztin zu tun, aber was sie gemacht hat, war trotzdem höllisch. Das hätte nicht schlimmer sein können, wenn ein Mann das übernommen hätte.“
„Glaube ich dir“, sagte Julie. „Ich finde es auch gut, dass der Rekrut sich dafür interessiert hat. Das ist wichtig.“
„Der richtige Umgang mit Vergewaltigungsopfern ist oftmals entscheidend dafür, ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen kennt, aber hierzulande wird angenommen, dass ganze fünfzehn Prozent der Vergewaltigungsopfer glauben, die Polizei könnte oder würde nicht richtig helfen – und deshalb kommt es oft gar nicht erst zu einer Anzeige“, sagte Nick.
Libby nickte ernst. „Ich habe damals auch gezögert. Nicht bloß, weil ich die notwendige Untersuchung gescheut habe, sondern auch, weil ich nicht sicher war, ob das zu irgendwas führt. Hätte es vermutlich auch nicht, wenn Sadie mir nicht die entscheidenden Hinweise gegeben und ich nicht darauf geachtet hätte, keine Beweise zu zerstören. Aber auch ich musste eine Nacht darüber schlafen, bis ich den Mut hatte, Ron anzuzeigen.“
„Verständlich“, sagte Julie. „Deine Ausgangslage war aber auch gut, weil er dich einerseits unzweifelhaft schlimm verletzt hat, und andererseits hattest du einen Zeugen.“
„Ich weiß“, sagte Libby und nickte. „Und trotzdem haben sie vor Gesicht versucht, mich auseinanderzunehmen und zu diskreditieren. Das war fies.“
„Ja, das ist leider ein Fehler im System“, sagte Nick. „Deshalb ist es wichtig, dass solche Organisationen Unterstützung stellen und Opfer auch vor Gericht begleiten. Das ist gut.“
Libby erwiderte seinen Blick und seufzte, woraufhin er schnell nachschob: „Ich will dich damit nicht beeinflussen, das war ganz allgemein gesprochen.“
„Ich weiß, aber ... es stimmt ja. Solche Organisationen brauchen Gesichter wie meins.“
Dormer nickte langsam. „Absolut. Du solltest wirklich darüber nachdenken.“
Libby seufzte unglücklich. Sie war hin- und hergerissen und hatte keine Ahnung, wie sie sich da entscheiden sollte. Als sie nach der Pause ins Büro zurückkehrten und sie sich mit ihren Bericht und der liegengebliebenen Mailkorrespondenz beschäftigen konnte, war sie froh darüber. Sie war Julie auch dankbar, dass sie das Thema nicht weiter vertiefte, und als sie schließlich auf dem Heimweg war, spürte sie erst, welche Anspannung von ihr abfiel.
Das war hart gewesen und sie hatte schon seit einer Woche kaum ein Auge zugemacht, weil sie es gefürchtet hatte, vor den Rekruten zu sprechen. Gleichzeitig wusste sie, dass das wichtig war – die Fragen, die man ihr gestellt hatte, hatten es bewiesen. Sadie hatte das seinerzeit auch getan, sie hatte schon oft in der Academy über ihren Vater gesprochen. Michael hatte sie auch darin bestärkt, es zu tun, und sie war noch immer erstaunt über ihre Offenheit, aber es war ein Kraftakt gewesen. Entsprechend erschöpft war sie, als sie zu Hause ankam und die Haustür hinter ihr ins Schloss fiel. Oreo kam durch die Katzenklappe und begrüßte Libby erfreut, die gleich ihren Napf füllte und sich danach erst einmal umzog. Raus aus der Bluse und der schicken, aber etwas zu engen Stoffhose und rein in einen Hoodie und eine viel bequemere Hose. Anschließend setzte sie sich im Arbeitszimmer an den Laptop und suchte im Internet nach der Organisation, von der Anna erzählt hatte.
In Kalifornien gab es ähnliche Organisationen auch an Universitäten, die sich an Vergewaltigungsopfer richteten, denen am Campus Gewalt widerfahren war. Libby wusste das, hatte es aber nie in Anspruch genommen, weil Sadie sie durch alles hindurchbegleitet hatte. Wenn sie sich aber vorstellte, sie hätte Sadie nicht gehabt ...
Die Organisation machte einen engagierten Eindruck, aber tatsächlich fehlte ihr ein Gesicht, es fehlten auch gezielte Handlungsaufforderungen, die ein Opfer wirklich dazu motivierten, Kontakt aufzunehmen. Aus eigener Erfahrung wusste Libby, dass man Verbrechensopfer erst aus ihrem Schneckenhaus locken musste, und sah an dieser Stelle noch Verbesserungspotenzial.
Die Haustür wurde geöffnet und an der folgenden Geräuschkulisse hörte sie, dass Owen eingetroffen war. Es dauerte nur Augenblicke, bis er sich bemerkbar machte und sie seine Begrüßung erwiderte.
„Wo bist du?“, fragte er.
„Im Arbeitszimmer.“
Augenblicke später erschien Owen in der Tür und lächelte. „Wie war dein Tag?“
„Ich spürte langsam, wie der Stress nachlässt“, sagte Libby ehrlich. „Oder vielmehr die Anspannung.“
„Wie ist es denn gelaufen?“
„Gut eigentlich ... und es ist gut angekommen. Ich habe exemplarisch den letzten Tag grob geschildert und beschrieben, wie ich entkommen bin. Die Anwärter hatten wirklich viele Fragen – gute Fragen. Ich denke da besonders an einen jungen Mann, der von mir wissen wollte, wie er Vergewaltigungsopfern am besten begegnen soll.“
„Da hat sich einer Gedanken gemacht.“
„Ja, ich fand es toll. Und gerade schaue ich mir eine Opferhilfeorganisation aus West Virginia an. Da war heute eine Anwärterin, die mir vorgeschlagen hat, ich könnte doch das Gesicht dieser Organisation werden, um Opfer zu motivieren, sich Hilfe zu holen.“
„Oh. Wow. Was hast du gesagt?“
„Dass ich es mir überlege.“
„Und wie soll das aussehen?“
„Wie man das so kennt – ich könnte dort meine Geschichte erzählen, mein Gesicht könnte auf Flyern erscheinen. Ich muss zugeben, dass das nicht dumm ist. Man kennt mein Gesicht sowieso aus dem Fernsehen.“
„Trotzdem hast du Respekt davor“, stellte Owen richtig fest.
„Ja, sicher. Will ich das? Will ich immer das Opfer von Vincent Howard Bailey sein?“
Owen kam näher und holte tief Luft. „Nichts für ungut, aber ... wenn man dich ansieht, ist der Gedanke da. Mir geht das nicht so, aber ich weiß, dass es anderen so geht. Ich denke, es würde gar nichts daran ändern.“
„Meinst du?“, fragte Libby erstaunt, woraufhin er nickte.
„Ja, ich denke schon. Die Frage ist, ob du den Mut dazu hast. Ich glaube, ändern würde sich dadurch konkret nichts.“
„Fändest du es gut?“
Owen nickte. „Ich weiß aus meiner Arbeit, dass solche Organisationen etwas leisten, was wir bei der Polizei nicht leisten können. Ich hatte auch schon Vergewaltigungsopfer, denen ich helfen wollte. Da ging es mir übrigens wie eurem Rekruten, da hatte ich auch Berührungsängste. Durch dich hat sich das gewandelt, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Ich sehe aber, wie wichtig es ist, dass Betroffene Hilfe bekommen und wenn du dazu beitragen könntest, auch nur eine Frau – oder einen Mann – dazu zu motivieren, wäre das ein Gewinn.“
Überrascht erwiderte Libby seinen Blick. „Hätte nicht gedacht, dass du das sagst.“
„Doch, ich finde das wirklich gut. Du nicht?“
„Doch, absolut. Ich habe vorhin schon gedacht, dass ich das nicht gebraucht habe, weil ich damals Sadie hatte, die mir durch diese Sache mit Ron geholfen hat. Aber hätte ich das nicht gehabt ...“
„Ich meine, überleg mal. Du hast dich heute vor einen vollen Seminarraum gestellt und – ich weiß ja nicht, was du denen erzählt hast. Aber das war ja immer deine Vorgehensweise, du trittst stets die Flucht nach vorn an. Du hast mir schon, als wir Maxwell damals observiert haben, freiwillig von Hawkins erzählt. Das fand ich seinerzeit mutig, aber das gehört eben zu dir. Das ist ja auch richtig so! Ich finde, du würdest mit positivem Beispiel vorangehen, wenn du dich zeigst und sagst: Hier bin ich, es geht mir gut. Es gibt Gerechtigkeit, man kann etwas dafür tun – und niemand wird damit alleingelassen.“
Libby wusste gar nicht, was sie dazu sagen wollte. So sah Owen sie? Aber eigentlich hatte er Recht. Egal, was ihr widerfahren war, sie hatte sich nicht im Schneckenhaus verkrochen. Sie hatte ihren Onkel ins Gefängnis gebracht, Ron ebenfalls – und auch Vincent hatte seine Strafe bekommen. Sie hatte ihm noch einmal gegenübergestanden und ihm in die Augen gesehen.
„Ich schlafe mal eine Nacht drüber“, sagte sie verhalten. „Es wäre eine gute Sache, aber gerade fehlt mir noch der Mut.“
„Du musst es ja nicht überstürzen“, sagte Owen.
„Wie war denn dein Tag?“
„Ziemlich langweilig. Morgen Vormittag steht noch ein Gerichtstermin an und wenn ich da raus bin, komme ich gleich nach Hause, damit wir zum Flughafen fahren können.“
„Klingt gut“, fand Libby. Während Owen in Richtung Schlafzimmer verschwand, schaute sie sich die Homepage der Organisation noch ein wenig genauer an, gesellte sich aber schließlich zu Owen, um für die Reise nach Kalifornien zu packen. Sie hatten schon vor Wochen Flüge für den nächsten Tag gebucht, die Maschine ging am späten Nachmittag und sie würden beide nur bis zur Mittagspause arbeiten, um rechtzeitig zum Flughafen zu kommen. Die Reise nach Kalifornien dauerte zu lange, als dass sie sie erst am Donnerstag hätten antreten wollen.
Libby freute sich schon wahnsinnig auf die Heimat. Sie würden erst mit einem späten Flug am Sonntag nach Hause zurückkehren, so dass sie fast vier volle Tage in Kalifornien haben würden. Sie konnte es kaum erwarten.
Nachdem sie gepackt hatten, machten sie es sich mit einem kleinen Snack vor dem Fernseher gemütlich und schauten sich noch eine Serie an. An diesem Abend war das völlig ausreichend für Libby. Sie freute sich sehr auf das entspannte Wochenende zu Hause – nach dem heutigen Tag brauchte sie das auch.
Als der Abspann lief, rutschte sie etwas näher an Owen heran, der ihr gleich einen schiefen Blick zuwarf und grinste.
„Rieche ich da Hintergedanken?“
Libby überlegte kurz, was sie sagen sollte, aber dann beschloss sie, nicht drumherum zu reden. „Heute und morgen wäre die Chance auf eine Schwangerschaft am größten – und da wir vermutlich morgen nicht dazu kommen ...“
Jetzt lachte Owen. „Wie romantisch!“
„Hey, das war deine Idee.“
„Ich weiß. Ich hatte nur keine Ahnung, dass mir auf einmal der Kalender im Nacken sitzen würde.“
„Das muss alles nicht sein. Ich wollte nur, dass du das weißt.“
Er grinste versöhnlich und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. „Als ob ich je was gegen Sex gehabt hätte.“ Zärtlich strich er mit den Fingerspitzen über ihre Hand.
Libby war froh über seine Reaktion. Sie hätte auch nie für möglich gehalten, dass sie plötzlich so genau ihren Zyklus beobachten würde, aber sie hatte sich schon bei dem Gedanken ertappt, dass es gar nicht so leicht war, schwanger zu werden, wie sie immer geglaubt hatte. Erst versuchte man jahrelang, es mit allen Mitteln zu verhindern, nur um festzustellen, dass erst mal nicht viel passierte, wenn man die Familienplanung dann angehen wollte. Es war nun der fünfte Zyklus, seit sie beschlossen hatten, ein Kind zu bekommen, doch bislang ohne jeden Erfolg. Inzwischen achtete sie gezielt darauf, wann die Chance auf eine Schwangerschaft am höchsten war und beschloss, sie nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Das letzte Mal am Samstag lag aber schon so lang zurück, dass sie sich nicht darauf verlassen wollte, dass das ausreichte.
„Lass uns nach oben gehen“, schlug Owen mit einem vielversprechenden Grinsen vor und Libby war einverstanden. Oreo lag zusammengerollt auf dem Sofa und schien zu schlafen, linste ihnen aber neugierig hinterher, als sie zur Treppe gingen.
Gemeinsam betraten sie das Schlafzimmer und machten es sich im Bett gemütlich. Die eleganteste Anbahnung war das nicht, das sah Libby ein, aber zum Glück hatte Owen Verständnis.
Es gelang ihm jedoch vollkommen mühelos, sich darauf einzulassen und langsam mit den Zärtlichkeiten zu beginnen. Libby schloss die Augen und konzentrierte sich ganz auf seine sanften Berührungen.
Mittwoch, 23. November
Am internationalen Flughafen von Washington hatte Hochbetrieb geherrscht, aber das war zu Thanksgiving nichts Neues. Zu wenigen Gelegenheiten im Jahr reisten mehr Amerikaner durchs Land – aber Libby und Owen waren noch früh dran gewesen.
Libby nutzte den langen Flug, um ein wenig in ihrem Buch zu lesen, während Owen sich einen Film anschaute. Es war längst dunkel, als sie Kalifornien erreichten, doch als sie sich der Metropolregion der Bay Area näherten, bemerkte Libby einen rötlichen Schimmer am Himmel. Sie wusste, das waren keine Wolken – das, was da die Luft trübte, waren Rauchwolken der Waldbrände, die Kalifornien immer noch plagten. Sie erinnerte sich gut an die Waldbrandsaison vor zwei Jahren, als es so intensiv gebrannt hatte, dass es nicht mal zur Mittagszeit wirklich hell geworden war. San Francisco hatte ausgesehen wie eine Kulisse des Films Blade Runner 2049. Diesmal war es nicht ganz so schlimm, aber in der Coastal Range, den Bergen zwischen Pleasanton und San José, brannte es auch Ende November immer noch. Es hatte zuletzt Ende September in der Gegend geregnet, aber das war nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein und hatte auch nicht dazu beigetragen, den jetzigen Brand zu verhindern. Er war Ende Oktober durch unachtsame Camper entstanden und fraß sich wie eine Walze durch die Berge.
Der Pilot drehte eine Schleife über der San Francisco Bay, bevor er schließlich auf der Landebahn aufsetzte. Gespannt blickte Libby nach draußen und betrachtete den rötlichen Schimmer, der alles ziemlich surreal wirken ließ.
Als sie das Terminal erreicht hatten und das Flugzeug verlassen konnten, nahm Libby auch zum ersten Mal einen leichten Brandgeruch in der Luft wahr. Es traf sie jedes Mal, wenn ihre Heimat in Flammen aufging, und inzwischen passierte das immer häufiger, teilweise auch außerhalb der eigentlichen Waldbrandsaison.
Sie folgte Owen hinein in den Flughafen, in dem sie den Geruch schließlich nicht mehr wahrnahm. Da sie nur mit großen Rucksäcken gereist waren, mussten sie keine Koffer abholen und konnten gleich in die Ankunftshalle durchgehen. Libby war nicht überrascht, neben Sadie und Matt auch Hayley zu sehen, die ganz aufgeregt wirkte. Als sie ihre Familie erreicht hatten, begrüßten Owen und Libby die drei nacheinander mit Umarmungen.
„Toll, dass ihr hier seid“, sagte Matt.
„Wir freuen uns auch“, erwiderte Libby.
„Wie war euer Flug?“, fragte Sadie.
„Ach, wie immer. Nichts Besonderes“, sagte Owen. „Seit wann brennt es denn hier so schlimm?“
„So schlimm vielleicht seit einer Woche. Von zu Hause aus kann man die Feuer in den Bergen gut sehen. Die Luftqualität ist erbärmlich schlecht – tut mir leid, dass ihr so begrüßt werdet“, sagte Matt.
„Ist doch nicht eure Schuld.“
„Kommt mit.“ Matt ging voraus zum Auto und sie fuhren los in Richtung Pleasanton, ohne Zeit zu verlieren. Obwohl es inzwischen nach halb neun war, wirkte es noch ziemlich hell aufgrund der vielen Rauchwolken, die den Himmel verhüllten und den roten Schein der vielen Feuer widerspiegelten. Sadie hatte Libby zwar am Telefon gesagt, dass es in der Nähe brannte, aber das volle Ausmaß wurde erst jetzt offenbar.
Obwohl Matt die Lüftung entsprechend umgestellt hatte, roch es im Auto trotzdem nach Rauch. Auf der San Mateo Bridge hatten sie einen guten Ausblick auf die Berge und konnten unter den Rauchschwaden einzelne Brandherde erkennen.
„Das war doch nicht so schlimm, als ich hier noch gewohnt habe“, murmelte Libby.
„Nein, aber in den letzten Jahren wird es immer schlimmer. Kalifornien verbrennt einfach. Was die Sonne im Sommer nicht schafft, besorgen im Herbst die Waldbrände“, sagte Matt.
„Das klingt jetzt aber sehr fatalistisch“, erwiderte Sadie.
„Ist doch so, oder? Ich meine, ich habe kürzlich sogar davon profitiert. Ich habe den Auftrag bekommen, die Waldbrände fotografisch zu dokumentieren – sowohl draußen in den Wäldern als auch in den Siedlungen, die vom Feuer bedroht sind oder bereits zerstört wurden. Ich kann euch die Fotos zeigen, wenn ihr möchtet“, schlug Matt vor.
„Gern“, sagte Libby. „Du weißt, ich liebe deine Fotos.“
Auch von der Rückbank aus sah sie, dass Matt grinste. Hayley neben ihr war völlig in eine Konversation mit einer Freundin an ihrem Handy vertieft.
„Genießt du die Ferien?“, richtete Libby sich an ihre kleine Schwester.
„Na ja“, erwiderte Hayley uneindeutig.
„Na ja? Was ist an Ferien nicht gut zu finden?“
„Wenn man sie nicht nutzen darf.“
„Fängst du schon wieder davon an?“, fragte Matt streng.
„Ich finde es auch immer noch scheiße!“, regte Hayley sich auf.
„Worum geht es?“, fragte Libby irritiert.
„Darum, dass deine Schwester sich am Freitag mit ihren Freunden treffen will, obwohl Sadie mit ihr einkaufen gehen wollte und außerdem du hier bist“, erklärte Matt.
Libby seufzte ergeben. „Dad ... Was habe ich davon, wenn Hayley nur widerwillig dabei ist?“
Matt lachte. „Oh, wenn du mich Dad nennst ...“
„Es ist mein Ernst. Lass Hayley doch was mit ihren Freunden unternehmen. Wir haben uns jetzt und morgen und außerdem sind wir am Freitag auch bei Owens Mum, hast du das vergessen?“
„Es geht unter anderem auch darum, dass sie ständig mit Kids rumhängt, die älter sind als sie. Da sind Fünfzehn- oder Sechzehnjährige bei. Hayley ist zwölf, wie du weißt. Seit drei Monaten.“
„Dad!“, brauste Hayley gereizt auf.
„Entspricht daran irgendetwas nicht der Wahrheit?“, fragte Matt.
„Du tust ja gerade so, als wäre ich noch ein Kind!“
„Mit zwölf ist man meistens noch ein Kind, ja.“
„Ach ja? In meiner Klasse gibt es welche, die schon die Pille nehmen. Könnte ich auch. Ich habe auch schon meine Tage.“
Während Owen überrascht die Brauen hochzog, versuchte Libby, keine Miene zu verziehen und ernst zu bleiben.
„Und deshalb bist du erwachsen?“, fragte sie ihre Schwester.
„Ja, oder nicht? Ich könnte jetzt schwanger werden. Können Kinder das? Nein, können sie nicht.“ Patzig verschränkte sie die Arme vor der Brust und strafte sich selbst Lügen.
„Hayley, Liebes“, versuchte Sadie, zu intervenieren. „Das ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden, das stimmt. Trotzdem hat Dad Recht. In eurer Clique sind Kids, die nicht unbedingt zu alt für dich sind, aber ich mag ihren Einfluss nicht.“
Theatralisch verdrehte Hayley die Augen. „Boah ... als ob du nie Freunde gehabt hättest, die Grandpa doof gefunden hätte.“
Sadie drehte sich zu ihr um. „Da bin ich ein schlechtes Beispiel. Außer Tessa hatte ich fast überhaupt keine Freunde und Tessa mochte er immer.“
„Dann eben Dad! Als ob deine Eltern deine Freunde immer gemocht hätten.“
„Nein, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass sie Recht hatten“, erwiderte Matt, während er von der Brücke fuhr. „Ich hatte auch mit Kids zu tun, die zu früh Alkohol getrunken und gekifft haben und zu früh Sex hatten.“
„Ich will überhaupt keinen Sex“, monierte Hayley. „Die Jungs sind sowieso alle bescheuert und haben Pickel. Mit denen will ich doch keinen Sex.“ Sie schnaubte verächtlich.
Während Owen mühsam versuchte, ein Lachen zu unterdrücken, fiel es Libby leichter, die Fassung zu bewahren.
„Kann ich verstehen, ich hatte darauf mit vierzehn auch noch keine Lust“, sagte sie und blickte forschend zu ihren Eltern. „Ich kenne ihre Freunde nicht, aber ihr müsst Hayley wirklich nicht meinetwegen zu Hause halten. Das will ich nicht. Owen und ich sind am Freitag doch sowieso unterwegs.“
„Seht ihr?“, trumpfte Hayley auf. „Libby versteht mich.“
„Ich war auch mal in deinem Alter“, erwiderte Libby und verkniff sich den Zusatz, dass sie damals in einer polygamen Sekte gelebt und so gut wie gar nichts gedurft hatte.
„Müssen wir das wirklich diskutieren?“, knurrte Matt.
„Boah, Dad! Was soll passieren? Wir sind bei Brittany zu Hause, ihre Eltern sind sogar da.“
„Und was ist mit Scott und Adam? Kommen die auch?“
„Nein“, erwiderte Hayley gedehnt. „Hab ich doch schon gesagt.“
„Nicht so frech, junge Dame.“
„Nenn mich nicht so.“
„Schluss jetzt“, sagte Sadie. „Wir gehen mittags shoppen und danach kannst du zu Brittany, aber um acht ist Schluss.“
„Was? Um acht? Da geht es doch erst richtig los! Komm schon ... bis neun, okay?“
Während Matt schon protestieren wollte, sagte Sadie: „Okay, von mir aus auch das. Aber dann ist wirklich Schluss. Und wenn ich höre, dass da geraucht wird oder irgendwas in der Art, gibt es Ärger.“
„Ich finde Rauchen eklig“, beschied Hayley.
„Es geht hier um deinen Umgang“, präzisierte Matt.
„Ihr seid anstrengend.“ Genervt starrte Hayley aus dem Fenster und wirkte so eingeschnappt, dass Libby sie am liebsten in den Arm genommen hätte. Sie fand es jedoch auch schwierig, sich da einzumischen, denn sie lebte nun schon seit fast drei Jahren in Virginia und hatte keine Ahnung, wie das Leben ihrer kleinen Schwester aussah. Inzwischen ging Hayley auf die Middle School und ihr Freundeskreis schien sich verändert und erweitert zu haben, was offensichtlich vor allem Matt nicht besonders gefiel. Libby konnte sich gar nicht daran erinnern, dass er je bei ihr so angespannt gewesen wäre.
Allerdings musste sie ehrlicherweise auch zugeben, dass sie anders gewesen war als Hayley. Sie war noch mit sechzehn so sehr damit beschäftigt gewesen, sich in der normalen Welt zu orientieren, dass sie mit Sadie und Matt nie in solche Situationen gekommen war. Anscheinend hatten die beiden ihr aber auch mehr vertraut als ihrer eigenen Tochter.
Sie beschloss, Sadie danach zu fragen, aber nicht jetzt. Stattdessen wechselte sie das Thema und erkundigte sich bei Hayley, wie sie es auf der neuen Schule fand. Hayley war jetzt jedoch eingeschnappt und gab sich auf der restlichen Fahrt ziemlich einsilbig. Nach ihrer Ankunft in Pleasanton versteckte sie sich schweigsam hinter ihrem Handy, während sie auf dem Sofa zusammensaßen, und als sie schließlich fragte, ob sie auf ihr Zimmer gehen konnte, erwiderte Matt: „Kannst du. Ist nur schade für deine Schwester.“
„Nein, ist okay, geh schon“, sagte Libby.
Ein Lächeln huschte über Hayleys Lippen, das ihr galt, dann war Hayley auch schon vorbei und verschwand im Flur. Kopfschüttelnd blickte Matt ihr hinterher und seufzte.
„Was das angeht, scheinst du die Pubertät einfach übersprungen zu haben“, sagte er.
„Wie kommst du denn darauf?“, fragte Libby überrascht.
„Du hast nie ... rebelliert. Wir hatten diese Themen mit dir überhaupt nicht.“
„Stimmt.“
„Hast du denn je darüber nachgedacht, woran das liegt?“, fragte Sadie. Überrascht erwiderte Matt ihren Blick.
„Wie meinst du das?“
„Libby war schon auch in der Pubertät, als sie zu uns kam. Wir waren nur nie diejenigen, gegen die sie rebelliert hat. Das hat die FLDS abbekommen. Wir waren die Freiheit, für die sie gekämpft hat.“
„Sie hat aber nie Drogen probiert ... oder?“, fragte Matt mit Blick auf Libby.
Lachend schüttelte sie den Kopf. „Nein, nie. Mit mir hattet ihr es gut – ich war mit den Freiheiten zufrieden, die ich hier hatte, weil das mehr war, als ich mir je zu erträumen gewagt habe. Und Sex ... mit wem hätte ich bitte Sex haben sollen? Wollte ich erst gar nicht und ganz lange war da auch niemand. Bis Kieran kam.“
„Da warst du aber auch alt genug“, sagte Matt.
„Wieso, habt ihr den Eindruck, Hayley ist an Jungs interessiert?“
Sadie schüttelte den Kopf. „Nein, das nicht. Aber seit ihrem Wechsel an die Middle School ist es hier teilweise ... sagen wir, interessant. Dort hat sie jetzt neue Freunde gefunden, die mitunter deutlich ältere Geschwister haben. Sie wird gerade mit ganz anderen Themen konfrontiert als an der Grundschule. Es gibt hier Kids, die rauchen und es gibt tatsächlich Mädchen, die ein oder zwei Jahre älter sind als sie und schon die Pille nehmen. So weit ich weiß, haben die auch schon Sex. Matt ist da etwas besorgt.“
„Etwas? Sie ist noch nicht so weit. Ich habe einfach Angst, dass einer dieser älteren Jungs sie zu etwas drängt, was sie noch nicht will. Am besten ohne Verhütung. Und dann stehen wir hier mit einer Teenie-Schwangerschaft“, sagte Matt.
Skeptisch zog Libby eine Augenbraue hoch. „Dad.“
„Was?“
„Traust du deiner Tochter wirklich so wenig zu?“
„Sie ist nicht wie du, Libby. Wirklich nicht. Sie hat sich vor allem innerhalb des letzten Jahres sehr verändert. Sie ist jetzt in der Pubertät, wie sie sagte, und das merkt man. Der Schulwechsel hat sein Übriges getan. Sie ist launisch und sprunghaft – und sie ist nicht so willensstark wie du. Bei dir hatte ich nie Angst, dass dich jemand bedrängt, egal in welcher Hinsicht.“
„Du vergisst, wie sie am Anfang war. Da war sie auch unsicher“, erinnerte Sadie ihn.
„Ja, aber sie war schon immer zielstrebiger als Hayley. Und sturer. Bei Hayley bin ich mir im Moment nicht sicher ... ich kenne ihre Freunde kaum, ich weiß nur, dass da sechzehnjährige Jungs bei sind und wie die ticken, weiß ich gut genug. Ich war auch mal so einer.“
„Wie aufgeklärt ist sie?“, fragte Libby.
„Ziemlich“, sagte Sadie. „Liegt unter anderem an dir. Was letztes Jahr passiert ist, hat sie ausführlich reflektiert. Anders als Matt glaube ich nicht, dass sie so leicht beeinflussbar ist.“
„Ich bin ein Vater, ich mache mir nur Sorgen“, verteidigte Matt sich.
„Trotzdem habe ich das Gefühl, ihr vertraut ihr nicht so wie mir damals. Ihr verhaltet euch sehr restriktiv.“
„Ja, weil sie in dieser neuen Clique hängt und uns wirklich nicht jeder Umgang gefällt, den sie da hat. Die Kids sind teilweise zu alt für sie und haben Flausen im Kopf. Da sind Jungs bei, die haben schon den Führerschein. Das imponiert ihr, aber sie wäre gern älter, als sie ist. Sie hat schon mehrfach erzählt, dass Gruppendruck bei diesen Kids ein ziemliches Thema ist. An Halloween haben sie zusammen gefeiert und sind um die Häuser gezogen, aber es endete damit, dass es eine Mutprobe auf dem Friedhof gab. Sie haben ausgerechnet von den Jüngeren verlangt, dass sie allein im Dunkeln auf dem Friedhof bleiben“, erzählte Matt.
„Hat sie das gemacht?“, fragte Libby.
„Laut ihrer Aussage ist es dazu nicht gekommen – aber nur, weil eine ihrer Freundinnen zuerst an der Reihe war. Sie hat sich erschrocken und um Hilfe geschrien, so dass eine Polizeistreife vorbeigekommen ist, die zufällig in der Nähe war. Passiert ist letztlich überhaupt nichts, aber ich möchte nicht, dass meine zwölfjährige Tochter mit solchen Kids herumhängt, die es für eine gute Idee halten, die Jüngsten allein auf dem Friedhof stehen zu lassen. Das gefällt mir einfach nicht.“
„Das ist ein schmaler Grat“, sagte Owen, der bislang nur zugehört hatte. „Es zeugt von Verantwortungslosigkeit – aber ist das nicht kennzeichnend für die Pubertät?“
„Ist es, aber indem so viele Ältere in dieser Clique sind, entsteht da ein Gefälle. Die Älteren verlangen zu viel von den Jüngeren, teilweise auch absichtlich. Die Jüngeren wetteifern natürlich immer und versuchen, zu tun, was von ihnen erwartet wird. Ich verstehe auch Matts Sorge, aber ich weiß, dass wir Hayley durch Verbote nicht von diesen Kids fernhalten“, sagte Sadie.
„Am Freitag soll eine Party bei Brittany steigen – oder vielmehr bei ihrer älteren Schwester Ellen“, sagte Matt. „Ellen ist schon fünfzehn und es werden ältere Jungs da sein. Die Eltern sind zwar auch da, aber ich wollte nicht, dass Hayley hingeht, weil mir das einfach nicht gefällt – und weil du da bist. Das war dann mein Gegenargument.“
„Und jetzt habe ich dir alles zerschossen“, murmelte Libby kleinlaut. „Tut mir leid.“
„Muss es nicht – ich bin auch nicht so restriktiv wie Matt, weil ich weiß, dass das nichts bringt. Je mehr wir ihr verbieten, desto mehr begehrt sie dagegen auf. Und wenn mir eins wichtig ist, dann Hayleys Vertrauen. Das will ich nicht verspielen.