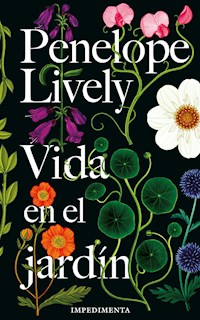13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der neue Roman der Booker-Preisträgerin
Der Lehrerin Charlotte wird auf der Straße die Tasche gestohlen, es ist nichts Wertvolles darin, aber sie stürzt und bricht sich die Hüfte. Dieser Überfall wird Auswirkung haben auf das Leben von sieben ganz unterschiedlichen Menschen. Charlotte muss für ein paar Wochen zu ihrer Tochter ziehen. Die Tochter wird dadurch aus ihrer Routine gerissen. Eine SMS wird eine Affäre verraten und das Ende einer Ehe einleiten, lukrative Ideen werden sich als Luftblase erweisen, ein Einwanderer wird die englische Sprache lieben lernen und vielleicht die Liebe einer Frau erobern. Wenn eins zum andern kommt zeigt, wie eine winzige Veränderung das Leben vieler durcheinanderwirbeln kann. Penelope Lively ist eine Schriftstellerin von seltener Klugheit und großem Einfühlungsvermögen. Dabei lässt die vollendete Geschichtenerzählerin auch in ihrem neuesten Roman feinsten britischen Humor aufblitzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Ähnliche
Penelope Lively
Wenn eins zumanderen kommt
Roman
Aus dem Englischen vonMaria Andreas
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »How It All Began« bei Figtree, einem Imprint von Penguin Books Ltd., London.
1. Auflage 2015Copyright © der Originalausgabe 2011 by Penelope LivelyCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: Buxdesign, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-13785-4www.cbertelsmann.de
Für Rachel und Izzy
Auslöser ist der Schmetterlingseffekt. Schon kleinere Wetterphänomene – und klein nehmen sich, global gesehen, auch schwere Unwetter und Schneestürme aus – können jede Vorhersage rasch in sich zusammenfallen lassen. Irrtümer und Unwägbarkeiten potenzieren sich im Strudel turbulenter Ereignisse: Was als Windhose oder Böe beginnt, kann zu Luftwirbeln von der Größe eines Kontinents anwachsen, die nur durch Satelliten erfassbar sind.
James Gleick, Chaos – die Ordnung des Universums, 1998
1
Der Gehweg klappt hoch und prallt ihr ins Gesicht. Rammt ihr den unteren Brillenrand in die Wange. Sie liegt da, platt auf dem Bauch. Was ist denn das? Über ihr ein Gewirr von Stimmen, die Leute sind besorgt. Natürlich.
Die Tasche.
Sie sagt: »Meine Tasche.«
Ein Gesicht senkt sich neben das ihre. Eine Frau, sehr freundlich. »Der Notarzt ist schon unterwegs. Wird alles wieder! Bleiben Sie einfach liegen, ganz ruhig, bis die da sind.«
Die Tasche.
»Ihre Einkäufe stehen direkt neben Ihnen. Die Sainsbury-Tüte.«
Nein. Die Handtasche.
Die Handtasche ist weg. Irgendwie hatte sie es gewusst. Sofort.
Oben meldet sich eine weitere Stimme. Eine Männerstimme. »Die Frau ist überfallen worden, richtig? Handtaschenraub.«
Ah.
Die Stimmen diskutieren. Sie ist nicht sonderlich interessiert. Da sind sie schon. Tatütata. Klar, wem das gilt, wem hier die Stunde schlägt.
Kundige Hände heben sie hoch, verstauen sie. Im Rettungswagen liegt sie auf der Seite, in einer starren Röhre. Sie hat Schmerzen. Wo? Keine Ahnung. Überall. Am liebsten würde sie eine Weile schlafen.
»Die Augen bitte nicht schließen. Wir sind in ein paar Minuten da.«
Fahrt auf der Krankenliege. Durch endlose Gänge. An Leuten vorbei. Einmal nach rechts, dann Halt. Wieder wird sie hochgehoben, die Röhre wird entfernt. Sie liegt jetzt auf dem Rücken.
Eine Krankenschwester. Sie lächelt, aber geschäftsmäßig. Name? Adresse?
Sie hat alles parat. Kein Problem.
Geburtsdatum?
Auch das kann sie nennen. Kein gutes Geburtsdatum. Liegt schon zu lange zurück.
Nächste Angehörige?
Das wird Rose nicht gefallen. Es ist doch Vormittag, oder? Da ist Rose bei Seiner Lordschaft.
Die nächste Angehörige arbeitet. Sie sollte jetzt lieber nicht behelligt werden. Noch nicht.
Montags traf Rose immer später als üblich bei ihrem Arbeitgeber ein, da sie vorher zur Bank ging, um für ihn Bargeld abzuheben und eventuell Schecks von letzter Woche einzureichen. Henry hatte keine Lust, sich mit Geldautomaten herumzuärgern, und lehnte Geldtransfer via Elektronik grundsätzlich ab. Er bestand darauf, bei kleineren Zahlungen wie Vortrags- oder Rezensentenhonoraren ein handfestes Stück Papier zugesandt zu bekommen. Auch E-Mails fanden vor ihm keine Gnade, mit denen hatte sich Rose zu befassen. Wahrscheinlich konnte Henry den Computer gar nicht anschalten. Obwohl Rose dem alten Filou durchaus zutraute, dass er, sobald sie das Haus verließ, durch den Cyberspace surfte und alte Freunde und Feinde googelte.
»Ich schlage vor, das mit Lord Peters und Mrs Donovan lassen wir mal, Rose. In Ordnung?« Da war sie gerade die zweite Woche bei ihm, und eigentlich fand sie es überhaupt nicht in Ordnung, zumindest anfangs nicht. Monatelang vermied sie es, ihn mit seinem Vornamen anzusprechen. Schließlich gehörte er der Generation ihrer Mutter an, unabhängig davon, was er sonst noch war oder gewesen war. Sie nannte zwar auch manche Freunde ihrer Mutter beim Vornamen, aber die kannte sie schon ihr Leben lang. Die waren auch keine Oxbridge-Professoren, Vorsitzende Königlicher Ausschüsse, Berater von Premierministern und weiß der Kuckuck was. Mit einem Rattenschwanz von Abkürzungen hinter dem Namen. Manchmal warfen ihm Leute verstohlene Blicke zu und grübelten: Woher kenne ich den? Kam ihm aber jemand allzu vertraulich, so konnte er ganz schön bissig werden: »Knapper Bescheid, Rose: Lord Peters macht keine Reklame für die Bücher anderer Leute. Und falls Sie weiteren Mitteilungsdrang verspüren: Nein, Lord Peters erinnert sich an kein Gespräch 1993 mit dem Autor.«
Nun ja, in zehn Jahren neigen Beziehungen dazu, sich zu setzen. Der frisch emeritierte, forsche, selbstherrliche Henry, für den Rose zu arbeiten begonnen hatte, mutierte zu einem streitsüchtigen, indes nicht weniger selbstherrlichen Sechsundsiebzigjährigen von einer gewissen Unberechenbarkeit, mit arthritischem Knie und hohem Bordeaux-Konsum. Da hieß es leisetreten. Manchmal hatte Rose gute Lust, alles hinzuschmeißen. Andererseits kam ihr der Job extrem entgegen, Lord Peters zahlte ein hübsches Sümmchen über das Übliche hinaus – und man wusste nie, ob anderswo Besseres wartete als ein anderer Schreibtisch in einem anderen Büro. Zu Beginn hatte Rose geglaubt, alle ihre Gebete seien erhört worden: Teilzeit, nur vormittags, sie konnte die Kinder von der Schule abholen und den Rest des Tages für sie da sein.
Jetzt spielte das natürlich keine Rolle mehr, James war in Singapur, Lucy an der Uni.
Rose kam über eine halbe Stunde zu spät an. Sie hatte auf der Bank lange warten müssen, bis sie den Scheck einzahlen konnte. Seine Lordschaft wird gereizt sein. Hat die Post wohl selbst geöffnet, jedes Schriftstück angeknurrt. Vielleicht wird er aber auch säuseln: »Ziemlich netter Brief von Cornell, Rose. Die wollen mir den Ehrendoktor verleihen. Was meinen Sie – fliegen wir rüber und holen ihn ab?«
Er reiste nicht mehr gern allein. Gelegentlich ließ sie sich dazu überreden, ihn zu begleiten. Das hatte Vor- und Nachteile: Einerseits kam sie herum wie sonst nie, andererseits konnte ihr seine Gesellschaft ganz schön auf den Wecker gehen. Rose wurde zu »Mrs. Donovan, meine persönliche Assistentin«, musste viel herumsitzen und mit Fremden Smalltalk machen oder ganz den Mund halten. Die Hotels verwöhnten manchmal mit ein wenig Luxus. Und weil jemand anderer zahlte, flog sie Businessclass oder fuhr mit der Bahn erster Klasse.
Für die letzten paar hundert Meter bog Rose von der lauten Durchgangsstraße ab in die ruhige, grüne Allee mit den eleganten weißen, stuckverzierten Häusern. Teure Häuser. Akademiker zählen sonst nicht so zu den Betuchten, aber Henrys Vater war Industrieller gewesen, und so war auf Henry einiges Geld herabgesickert, daher dieses Haus in einem der nobleren Londoner Viertel. Höchst nobel sogar, fand Rose, die in einer Doppelhaushälfte in Enfield lebte und sehr bescheiden in einem Vorort von Saint Albans aufgewachsen war, als Tochter eines Lehrerehepaars. Bisweilen äußerte sich Henry freundlich herablassend über ihre Herkunft: »Das erklärt Ihre mustergültige Syntax, Rose. Bildung lässt sich eben nicht verleugnen.«
Ihre Mutter nahm Henry gegenüber stets eine etwas spröde Haltung ein. Seine Lordschaft. Muss man eigens erwähnen, dass die beiden sich nie begegnet sind? Sie amüsierte sich, wenn Rose von seinem Lebensstil und seinen zuweilen recht hämischen Bemerkungen erzählte. Aber Rose wusste genau, dass ihre Mutter den Job bei Henry läppisch fand. Rose hätte Karriere machen können. Das Thema wurde nie angeschnitten, Kommentar und Gegenkommentar blieben unausgesprochen: »Du kannst lesen, schreiben, rechnen und bist auch sonst nicht auf den Kopf gefallen – da hätte dir vieles offengestanden.« »Aber ich wollte nie Karriere machen. Ich habe mich bewusst für diese Stelle entschieden.«
Und damit, recht blauäugig, auch für Henry, damals noch eine ihr unbekannte Größe. Beim Vorstellungsgespräch hatte sie ihm gegenübergesessen, vor dem großen, inzwischen so vertrauten Schreibtisch mit dem punzierten Leder auf der Schreibfläche. Henry kam ihr ganz nett vor, das Haus imposant und schön; sie hatte noch nie so viele Bücher gesehen (ich dachte immer, wir hätten viele). Und das Gehalt war ziemlich üppig.
»Nehmen Sie doch Platz, Mrs Donovan. Ich skizziere Ihnen am besten vorab die Aufgaben.«
Korrespondenz … Terminkalender … Reisen organisieren … mir das Telefon vom Hals halten … meine Memoiren.
Meine Memoiren. Die waren damals noch Zukunftsmusik und sollten es noch etliche Jahre bleiben. Erst vor relativ Kurzem – »Meine Verpflichtungen rauben mir, dem Himmel sei Dank, nicht mehr ganz so viel Zeit« – kam das Geschwafel in Gang, und nun warteten täglich handbeschriebene Blätter darauf, abgetippt zu werden. »Voilà, Rose, die heutige Morgengabe. Es wird Sie vielleicht erheitern, was ich über Harold Wilson zu sagen habe.« Ein paar glucksende Lacher. Wenn das Geschwafel einmal als Buch erscheint, werden sich nicht wenige Leute auf den Schlips getreten fühlen; gut, dass Harold Wilson schon das Zeitliche gesegnet hat.
»Jetzt erzählen Sie mir doch ein bisschen über sich, Mrs Donovan.«
Was hatte sie erzählt? Sekretariatserfahrung, Assistentin bei einem Unternehmensvorstand (der mir unter den Rock greifen wollte, der Grund, warum ich gegangen bin, aber das brauche ich niemandem auf die Nase zu binden), fünf Jahre Kinderpause.
Henry hat keine Kinder. Um Himmels willen. Er ist definitiv keine Vaterfigur. War auch nie verheiratet. Aber schwul ist er wohl auch nicht. Es hat durchaus nicht an Weiblichkeit gefehlt, die gelegentlich in feine Restaurants oder ins Theater ausgeführt wurde, aber keine der Damen ist geblieben. So ist Henry zum Hagestolz geworden. Er hatte eine Schwester, die vor einigen Jahren gestorben ist; ihrer Tochter Marion, einer Geschäftsfrau, die ihn ab und zu besucht, scheint er recht zugeneigt.
Etwa einmal im Jahr kommt es Henry in den Sinn, sich nach James und Lucy zu erkundigen. An Gerry zeigt er kein Interesse und täuscht auch keines vor; in Henrys Vorstellungswelt existiert Gerry einfach nicht. »Ach so, Ihr Mann …«, hatte er etwas verwirrt gesagt, als Rose ihn einmal erwähnte (weil er Lungenentzündung hatte und ungewöhnlich viel von ihrer Aufmerksamkeit beanspruchte).
Gerry interessiert sich für Henry genauso wenig. Er interessiert sich für Kommunalpolitik, fürs Schreinern, für Sakralmusik und ein bisschen für Sportfischerei. Gerry ist in Ordnung. Wer will schon einen anstrengenden Mann, der einen verschleißt?
Rose stieg die Stufen zu der stattlichen schwarzen Tür unter dem Säulenportikus hinauf, schloss auf und trat ein. Sie ging zu ihrem Büro im hinteren Bereich des Hauses, hängte ihren Mantel auf, nahm das Bargeld aus der Handtasche und klopfte an die Tür zum Arbeitszimmer.
»Herein, herein.« Entschieden gereizt. »Ach, da sind Sie ja. Da ist ein ganzer Packen von der Versicherung gekommen, ich verstehe das Zeug nicht und will es auch nicht verstehen. Sie kümmern sich darum, ja? Ein paar andere Sachen können wir gemeinsam durchgehen – da will jemand, den ich kaum kenne, ein Empfehlungsschreiben von mir. Eine Stirn hat der. Die Bahntickets für Manchester sind gekommen. Warum fahren wir so früh? Neun Uhr dreißig ab Euston – Herr im Himmel!«
»Vor Ihrem Vortrag findet ein Mittagessen statt. Man hätte gern, dass Sie um halb eins dort sind.«
»Wie rücksichtslos. Ach, da kam übrigens ein Anruf für Sie. Von einer Klinik. Hier ist die Nummer, Sie sollen bitte zurückrufen. Anscheinend wegen Ihrer Mutter. Geht es ihr nicht gut? Und ich hätte wahnsinnig gern einen Kaffee, Rose.«
Sie dachte an den Taschendieb. Ihren Taschendieb. An diesen gesichtslosen Menschen, mit dem sie eine flüchtige, dennoch hautnahe Beziehung verband. Dachte an ihn, der genauso gut eine Sie sein könnte. Es gibt jetzt zweifellos auch Taschendiebinnen, wir leben ja im Zeitalter der Chancengleichheit. Diese Person, die einen Moment lang da war und im nächsten Moment verschwunden. Mit meiner Handtasche. Und meinen Tempos, meinen Magentabletten, meinem Kamm, meiner Monatskarte, meiner Bahncard und drei Zwanzigern, glaube ich, ein bisschen Kleingeld und der Barclay-Card. Und mit meinen Schlüsseln.
Die Schlüssel.
Ach ja, um die hat Rose sich schon gekümmert. Hat sie gesagt. Sie hat die Schlösser ausgetauscht. Und die Karte sperren lassen. Die drei Zwanziger und das Kleingeld, die sind eben futsch.
Was wird er/sie mit den sechzig Pfund und ein paar Zerquetschten, die ich ihm/ihr so freundlich überlassen habe, wohl kaufen?
Einen Stapel Bücher bei Waterstones? Eine Opernkarte für Covent Garden? Reicht wohl leider nur für den zweiten Rang. Eine Mitgliedschaft bei den Freunden der Royal Academy?
Drogen, heißt es. Einen Tagesvorrat des persönlichen Suchtmittels.
Nein. Ich stelle mir meinen Taschendieb lieber als Feingeist vor. Nur eben einen ziemlich bedürftigen Feingeist. Das macht mir unsere kurze Beziehung erträglicher. Vielleicht steht ein Figaro auf dem Programm – der würde ihn aufmuntern. Ihn oder sie. In der Academy sind wohl gerade die deutschen Expressionisten zu sehen. Hm. Der neue Philip Roth ist gut. Und dann dieses Buch über Shakespeare.
Die Hüfte. Die schmerzt gewaltig. Trotz der Schmerzmittel. Die beseitigen den Schmerz gar nicht, sondern machen einen nur rammdösig. Man halluziniert. Nein – du kannst mich mal, du Taschendieb. Warum hast du nicht einfach höflich gefragt? Mistkerl. Dann zieh dir eben dein Heroin oder sonst was rein. Kein Figaro für dich.
Rose hatte Henry von der Klinik aus anrufen und ihm für den Rest des Tages absagen müssen. Als sie am nächsten Morgen wieder bei ihm antrat, dachte er tatsächlich daran, sich nach ihrer Mutter zu erkundigen.
»Sie ist doch hoffentlich gut versorgt? Ein Knochenbruch in unserem Alter ist kein Klacks. Also … wir gehen hier unter in Papier, Rose. Unerledigte Post von zwei Tagen.«
Sie erklärte ihm, dass sie ihn möglicherweise nicht nach Manchester begleiten könne. Das hänge vom Entlassungstermin ihrer Mutter ab, über den die Klinik noch nicht entschieden habe. »Ich muss sie zu uns nach Hause holen und mich um sie kümmern. Sie wird eine Weile bei uns wohnen.«
Bestürzung. »Du liebe Zeit. Nun ja, das lassen wir auf uns zukommen. Notfalls kann wohl auch Marion …«
Roses Gästezimmer.
»Ein, zwei Monate, Mum. Wenigstens so lange, bis du keine Krücken mehr brauchst.«
»Ich würde schon zurechtkommen …«
»Nein. Und auch in der Klinik sind alle absolut dagegen. Also.«
Also. Genau, was man nie wollte. Zur Last fallen und so. Was man immer vermeiden wollte. Der GAU. Vielen Dank auch, Taschendieb.
Tut mir leid, Rose. Und Gerry. Danke euch beiden. Hoffen wir, dass eure gute Beziehung keinen Knacks bekommt. Das ist doch der Klassiker: Lästige alte Mutter zieht ein.
Alt werden ist nichts für Feiglinge. Eine gebrochene Hüfte ist ganz bestimmt nichts für Feiglinge. Wir sind jetzt krückenmobil. Die Station auf und ab. Aua. Krankengymnastik bei dem Prachtkerl von Physiotherapeuten aus Neuseeland, eins achtzig. Schmerz lass nach.
Sicher, vor der Hüfte hatte das Knie rumort, der Rücken auch, aber das war bloß Abnutzung, keine bösartige Attacke von außen. Das Knie. Der Rücken. Und der graue Star. Das Stechen in der linken Schulter, die Krampfadern und die Venenentzündung, und nachts mindestens einmal aufstehen und pinkeln, und der Zorn auf alle, die auf dem Anrufbeantworter unverständliches Genuschel hinterlassen. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, lang ist’s her, als der Schmerz nur gelegentlich zuschlug – Zahnschmerzen, Mittelohrentzündung, steifer Hals – und man ein großes, beleidigtes Tamtam um ihn machte. Seit Jahren ist der Schmerz ein ständiger Begleiter, liegt morgens gemütlich mit einem im Bett, hält den ganzen Tag Schritt mit einem, zieht sich vielleicht eine Weile kokett zurück, nur um dann wieder loszutoben: Hier bin ich, erinnerst du dich? Ach, das Alter. Zartfühlend ausgedrückt, der beschauliche Lebensabend. Ha, von wegen beschauliche Abendstimmung! Das ist eher die stürmische Morgendämmerung eines neuen Lebens, von dem man nichts ahnte. Wir sehen alle weg, bis wir – wumm! – selber dran sind und uns fragen, wie wir in diese Hölle hineingestolpert sind, die vielleicht auch erst die Vorhölle ist, wo die schadenfrohen Teufel anrücken und mit ihren Mistgabeln auf uns einstochern.
Aber parallel dazu geht das Leben weiter, das echte, gute Leben mit all seiner Freude und Fülle. Die Blüte meiner Wahnsinnstulpen, die Meisen am Futterhäuschen und ein neues Buch, auf das ich mich für den Abend freuen kann, ein Anruf von Rose und eine Naturdoku im Fernsehen. Und Jennifer nebenan mit ihrem neugeborenen Baby. Ein Baby macht immer fröhlich. So war es jedenfalls damals bei Rose. Schade, dass keine weiteren kamen, trotz aller Versuche. Aber später dann die Enkel, zum großen Glück.
Charlotte betrachtet die jüngeren Ausgaben ihrer selbst mit einer gewissen Distanz. Auch sie sind Charlotte, aber in anderen Inkarnationen, Ahnungslose, die halb vergessenen Dingen nachgehen. Die heutige Charlotte sehnt sich nicht wehmütig zurück, du liebe Zeit, nein. Doch gelegentlich beneidet sie die körperlich agile, geistig hellwache Lehrerin ein wenig (auch wenn das nach Eigenlob klingt; alle meine Schüler haben mit Bestnoten abgeschlossen, keine Frage).
Und dann, in noch weiterer Ferne, die junge Charlotte. Du liebe Güte, schau sie an, wie sie mit Männern ausgeht, heiratet, einen Kinderwagen vor sich herschiebt.
Alle diese Wesen zusammen ergeben, was wir heute haben: die auf Station C gestrandete Charlotte, die mühsam wieder gehen lernt. Station C ist voller Knochenbrüche – Beine, Knöchel, Arme. Die Älteren fallen von Trittleitern, stolpern über Bordsteine; die Jungen stürzen vom Fahrrad, übertreiben beim Sport. Ein Haufen Havarierter ist das hier, ein willkürliches Sammelsurium von Unglücksfällen: Maureen, eine Frau mittleren Alters, hat sich von einer Nachbarin eine Leiter ausgeliehen, um ihre neuen Vorhänge aufzuhängen – mit verheerenden Folgen; die junge Karen wollte mit ihrem Mofa einen Gelenkbus überholen; der alte Pat hat sich unklugerweise auf den eisigen Gehweg hinausgewagt. Station C ist laut, unruhig, strapaziös; man kommt kaum zum Schlafen, andererseits wird viel heilsame Ablenkung geboten. Umgeben vom Unglück anderer, grämt man sich weniger über das eigene. Man leidet, beobachtet aber auch, hat die anderen im Blick und weiß das Spektakel zu würdigen.
»Das ist ja wie Emergency Room gucken«, sagt Rose. »Nur, dass du selber mitspielst.«
Sie sitzen im Aufenthaltsraum, in den die Krückenmobilen geschlurft kommen, um ihre Gäste zu empfangen. Sie haben die Gästezimmerdiskussion hinter sich, die Sache ist entschieden, Rose bleibt fest, Charlotte fügt sich. Nächste Woche wird Charlotte entlassen; Rose wird sie abholen und im Gästezimmer unterbringen, das sie gerade herrichtet – Charlottes Kleider und andere benötigte Gegenstände sind schon herbeigeschafft.
»An dem Tag hätte ich Henry nach Manchester begleiten sollen«, sagt Rose. »Ich habe ihm schon gesagt, dass ich nicht mitkommen kann.«
»Seine Lordschaft war sicher verstimmt.«
»War er auch.« Rose lässt das kalt. »Ist aber kein Problem – er hat seine Nichte Marion eingespannt, die Innenarchitektin. Jetzt ist sie mal dran.«
»Erbt sie?«, will Charlotte wissen. Sie hat sich noch nie ein Blatt vor den Mund genommen.
Rose zuckt mit den Achseln. »Keine Ahnung. Na, irgendwer muss wohl erben.«
»Nettes Mädchen?«
»Kein Mädchen, Mum. Sie ist in meinem Alter.«
Charlotte seufzt. »Natürlich. Wo wir gerade vom Erben reden, wenn ich mal den Löffel abgebe, möchte ich, dass du Jennifer von nebenan ein bisschen für ihr Baby gibst – ein paar Hunderter fürs Sparschwein.«
»Mum …«
»Nicht viel …«
»Red kein solches Zeug! Du gibst den Löffel nicht …«
»Heute Nachmittag noch nicht, und morgen wahrscheinlich auch nicht. Aber du solltest dich an den Gedanken gewöhnen. Ist sie kompetent, diese Marion? Wird sie ihn heil hinschaffen und wieder zurück?«
»Sie ist Geschäftsfrau. Plant alles perfekt durch. Richtet reichen Leuten ihre Häuser ein. Sie hat bei sich zu Hause einen Showroom, da verschlägt’s dir die Sprache, so elegant ist alles. Man sieht richtig, wie es sie schüttelt, wenn sie Lansdale Gardens betritt.« Rose grinst.
Charlotte hat Lansdale Gardens noch nie betreten. »Ich dachte, das ist ein hochherrschaftliches Haus.«
»Schon. Und es gibt ein paar schöne Stücke dort. Aber alles ist auch ein bisschen heruntergekommen.«
Charlotte rutscht auf ihrem Stuhl herum, verzieht das Gesicht. Die Hüfte tobt. Da ist Marion Dingsbums eine gute Ablenkung. »Die Leute zahlen dafür, dass sie gesagt bekommen, welche Farbe ihre Vorhänge haben sollen? Da halte ich es mit Seiner Lordschaft. Fertigvorhänge vom Versandhandel haben mir immer völlig genügt. Ist sie reich?«
»Sehr gut gekleidet«, sagt Rose. »Aber im Grunde weiß ich nichts von ihr.«
Marion sitzt in ihrem Büro neben dem Showroom und macht ihre Buchhaltung; außerdem wartet sie auf einen Anruf von ihrem Lover und denkt an den Kunden, der in einer halben Stunde einen Termin bei ihr hat. Marion führt ihre Bücher gut, gewissenhaft und gründlich; sie versteht sich aufs Rechnen, aber reich ist sie nicht. Sicher lebt sie sorgenfrei, hat ein hinlängliches Auskommen, muss die Zahlen aber immer genau im Auge behalten, dieses ärgerliche, wenn auch beherrschbare Minus auf der Bank. Sie prüft gerade die Rechnungen der Lieferanten, geht die Kontoauszüge des letzten Monats durch und hofft, dass Jeremy sich meldet, bevor sie wegen des Kunden den Anrufbeantworter einschalten muss. Ihre Gedanken schweifen auch kurz zu Henry ab, zu dieser blöden Fahrt nach Manchester nächste Woche, was ihr zeitlich überhaupt nicht passt.
Mit Finanzen beschäftigt, denkt sie auch kurz an Henrys Vermögenslage. Er ist natürlich gut situiert. Dieses Haus. Sein Lebensstil – sein Club, die teuren Restaurants, die er gelegentlich aufsucht. Die Lakaien – Rose, dann Corrie, die putzt, einkauft und oft kocht. Henry … kommt in die Jahre. Und hat keine Angehörigen außer Marion. Irgendwann muss ja jemand erben, es sei denn, alles soll an Oxfam gehen oder an ein Katzenheim.
Nicht, dass Marion mit dem Erbe rechnet. Natürlich nicht. Sie hat den alten Knaben ins Herz geschlossen, schließlich ist er ihr Onkel, ihr einziger noch dazu. Außerdem hat sie Respekt vor ihm. Der alte Herr ist fraglos eine Geistesgröße, und sie ist schon mehrmals der Versuchung erlegen, im Gespräch seinen Namen zu erwähnen. Wenn er sie nur an Lansdale Gardens heranlassen würde! Jedes Mal, wenn sie hinkommt, läuft ihr beim Anblick des fürchterlichen alten Chintzsofas, der Ledersessel und der schlammbraunen Samtvorhänge ein Schauder über den Rücken. Und die Küche erst … Aber Henry lehnt jeden Vorschlag einer Veränderung ab; Marion konnte bisher nicht einmal ein Kissen einschmuggeln.
»Ich lebe außerhalb der Reichweite guten Geschmacks, meine Liebe.« Glucksendes Lachen; anscheinend stellt er guten Geschmack an sich infrage.
Auch Marion verwahrt sich gegen diesen Begriff, abgedroschen und bedeutungslos, wie er ist. Gelungene Räume sind eine Frage von Überraschungen, Kombinationen, Kontrasten – ein Läufer an unerwarteter Stelle, das Spiel interessanter Farben, ein Spiegel als Blickfang. Aber es hat keinen Sinn, Henry hier etwas zu erklären; für ihn ist ihr Beruf amüsante Kurzweil, mit der sie sich die Zeit vertreibt, ihre Arbeit geht über seinen Horizont. Henry interessiert sich für die Mächtigen der Vergangenheit und Gegenwart, für guten Bordeaux, für akademischen Tratsch, für seine Memoiren und vielleicht am Rande immer noch für die Parteipolitik im achtzehnten Jahrhundert, sein ursprüngliches Spezialgebiet. Das sind in Henrys Augen zentrale und zukunftsweisende Themen, alles andere ist höchstens für müßige, flüchtige Nebenbemerkungen gut. Auf der Suche nach Gesprächsstoff hat Marion manchmal von ihren Kunden geplaudert; sind sie prominent, wird Henry neugierig, auch wenn sie ihre Berühmtheit auf Gebieten erlangt haben, die ihm fremd sind. »Goldman Sachs? Von dem habe ich gehört. Wie viel, sagst du, verdient der Mann? Das ist ja unerhört!« Schauspieler erregen seine Aufmerksamkeit: »Der Name kommt mir bekannt vor, auch wenn ich heute nicht mehr so viel ins Theater gehe. Natürlich habe ich Alastair Sim gekannt – habe ich dir das schon mal erzählt?«
Henry hat viele Leute gekannt und würzt seine Konversation mit zahllosen Namen. Marion kann nur mit einem Bruchteil etwas anfangen, doch gelegentlich taucht eine ihr bekannte Berühmtheit auf. Henry hatte Umgang mit führenden Politikern, mit Literaten und Literatinnen, er hat jeden gekannt, der in der akademischen Welt etwas darstellte.
Macmillan hat ihn ebenso um Rat ersucht wie Harold Wilson; über Stephen Spender kann er etliche Anekdoten erzählen, mit Maurice Bowra war er dick befreundet. Für Memoiren gibt es Stoff genug, auch wenn Marion dabei regelmäßig glasige Augen bekommt, beim Tee oder einem von Corries absolut Furcht einflößenden Mittagessen (Schottische Graupensuppe, Steak-Nierchen-Pastete, Gedämpfter Biskuit mit Melasse – kulinarisch gesehen, ist Henry strikt konservativ; Marion hat sich schon öfter gefragt, wie ihm die teuren Restaurants zusagen, die er aufsucht, aber anscheinend kennt er welche, die den gastronomisch Zurückgebliebenen eine Nische bieten). Die Namen fließen aus seinem Mund und werden verächtlich gemacht oder gerühmt, während Marion ein Sandwich ablehnt oder um eine extrakleine Portion bittet und sich insgeheim wünscht, sie könnte Henry ein neues Tischtuch unterjubeln. Ist Henrys kathartischer Sermon so richtig in Schwung gekommen, richtet sie manchmal sehnsüchtig den ganzen Raum neu ein, überlegt, wo sie geeignete Tapeten und Vorhänge herbekäme, und stellt einen schönen, antiken Tisch aus der Provence auf.
Marion hat natürlich ihren eigenen Stil, ihre Handschrift, stellt sich aber flexibel auf ihre Kunden ein – sie möchte wissen, was ihnen vorschwebt, und lässt dann ihre eigenen Vorschläge und Ideen mit einfließen. Und natürlich kommen die Kunden auf Marion zu, weil sie ihre Handschrift schätzen, diese frische, anziehende Mischung aus der Schlichtheit New Englands – Blautöne, Rauputz, lackierte Holzdielen – und französischem Landhausstil, dazu eine Prise Arts and Crafts: der dekorative Sessel, das raffinierte Arrangement von Muscheln oder Steinen auf einem Fensterbrett, ein Gemälde über dem Kamin, das die Blicke auf sich zieht.
Marions Haus ist die Verkörperung all dessen und gleichzeitig seine Präsentation: Die Kunden kommen her, um sich umzusehen und in dem großen Raum im Erdgeschoss herumzuwandern, wo Stoffe, Tapeten, Wandfarben, von Marion hier und dort aufgespürte Kunstgegenstände und Einzelstücke wie Sessel, Tische und Lampen ausgestellt sind, die sich in den Stil des Hauses einfügen. Henry war hier nur selten zu Gast, und wenn, dann schien er nichts zu bemerken. Er ließ sich in einem der hübschen, mit hellem Leinen bezogenen Sessel im oberen Salon nieder und schwang Reden, als wäre er bei sich zu Hause. Henry nimmt nicht wahr, was ihn nicht betrifft.
Eine ganz auf optische Reize fixierte Frau wie Marion findet das ebenso ärgerlich wie unbegreiflich. Ihre Mutter hatte ihr Interesse an Innenräumen geteilt; ihre Einrichtung war elegant und bewusst komponiert. Wie kann da ihr Bruder so gar keine Antennen dafür haben? Seine Kindheit hatte er in einer äußerst imposanten Umgebung verbracht, in einem Landhaus in Dorset, das überquoll von Antiquitäten, Perserteppichen, Silber und allem Pipapo. Nicht besonders geplant oder komponiert, aber auf seine Weise eindrucksvoll. Einiges davon ist in Lansdale Gardens gelandet, wo es etwas fehl am Platze wirkt: die italienische Vitrine, siebzehntes Jahrhundert, neben den durchgesessenen Lederfauteuils im Wohnzimmer, der Regency-Spiegel an der Flockdruck-Blumentapete in der Eingangshalle. Diese Stücke sind nicht hier, weil Henry sie besonders schätzt, sondern als notwendige Möblierung.
Marions Klientel besteht aus Menschen, die das Einrichten zu ihrem Hobby gemacht haben. Sie sind irgendwie zu Geld gekommen und wollen es auch ausgeben; ihre Umgebung bedeutet ihnen sehr viel. Sie ziehen oft um, und jede neue Behausung muss von Kopf bis Fuß neu eingekleidet werden; selbst wenn sie länger bleiben, wo sie sind, halten sie eine regelmäßige Auffrischung für nötig. Die potentesten Geldausgeber lassen für einen einzigen Raum Tausende springen; sogar Marion ist manchmal von den Summen überrascht, aber natürlich dankbar. Ihr fällt dann die Aufgabe zu, eine ganze Menge Inventar, vor nicht allzu langer Zeit angeschafft, wieder zu entsorgen, weil der Kunde der gerafften Vorhänge und des städtischen Chics überdrüssig geworden ist und Marions ruhige Farbpalette und elegant beiläufige Kompositionen vorzieht. Manchmal können Sofas, Sessel und Behänge wieder an den ursprünglichen, keineswegs überraschten Lieferanten zurückverkauft werden. In Chelsea sind ganze Wagenladungen von Zierrat ständig in Umlauf, von einem herrschaftlichen Stadtquartier oder Altbau-Reihenhausjuwel zum nächsten.
Auf diese Weise hatte Marion die Bekanntschaft von Jeremy Dalton gemacht, allerdings beim Aufstöbern, nicht beim Entsorgen. Sie brauchte das perfekte Kamingitter für einen Kunden und hatte von dem neuen Lager für Altmaterial gehört, das gerade in Südlondon aufgemacht hatte, offenbar eine Fundgrube für schöne Dinge, mit höherem Anspruch als ein reiner Recyclinghof, geführt von einem Mann, der ein Händchen für die Akquise hatte. Also begab Marion sich auf unbekanntes Terrain und fand dieses riesige Warenlager vor, mit einer Wahnsinnsauswahl an Kamingittern, von klassizistisch bis Art déco und darüber hinaus, was immer das Herz begehrte. Außerdem Türeinsätze aus Buntglas, Badewannen mit Löwenpranken, ein paar Stücke aus der Arts-and-Crafts-Ära, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenlief. Und dann war dieser Mann an ihrer Seite, dieser Jeremy – hilfsbereit, charmant, witzig, ganz auf ihrer Wellenlänge. Sie unterhielten sich stundenlang, und als genau das richtige Kamingitter gefunden war, tranken sie Kaffee in seinem Büro. Sie würde wiederkommen, wenn sie sich das mit dem kleinen Rattansofa überlegt hätte … Und so fing alles an, wie es eben so ist.
Das war vor fast einem Jahr gewesen. Jeremys Frau Stella arbeitete nicht in seinem Geschäft mit. Sie wohnte in Oxted, wo er mit einem viel kleineren Laden begonnen und sie eine Stelle als Arzthelferin gefunden hatte. Sie hatten zwei Töchter im Teenageralter. Das erschwerte die Situation. Bei Marion selbst war alles unproblematisch, da sie kinderlos war und seit Jahren komplikationsfrei geschieden.
Die Sache musste geheim gehalten werden, da waren sich beide einig – zumindest für die absehbare Zukunft. Wegen der Töchter und der reizbaren Stella, die schon eine depressive Phase hinter sich hatte. Aber da Jeremy die meiste Zeit in London war und oft in der kleinen Mietwohnung in der Nähe des Warenlagers übernachtete, konnten sie sich ganz problemlos dort treffen. Natürlich war er viel unterwegs, auf Beutezug, aber das hatten sie schon für mehrere glückliche Kurztrips ins tiefste Wales oder Cumbria genutzt, wenn sich Marion ein paar Tage wegstehlen konnte. Es gab Pläne, diesen Sommer in die Provence zu reisen, auf der Suche nach alten Schränken und Bettgestellen.
2
Die Ehe der Daltons ging in die Brüche, weil Charlotte Rainsford von einem Taschendieb überfallen wurde. Die Daltons kannten Charlotte nicht und würden sie auch nie kennenlernen; sie war einfach eine schicksalhafte Präsenz an der Peripherie ihres Lebens.
Ein Handy – Jeremys Handy – wurde zum rauchenden Colt. Als Marion ihre Spur darauf hinterließ, war Jeremy zu Hause in Oxted, was sie nicht wusste; sie wähnte ihn in der Londoner Wohnung und schickte ihm eine SMS. Es traf sich, dass sein Handy in der Tasche seines Mantels steckte, der in der Diele seines Hauses in Oxted hing. Stella hatte Jeremy abends herzitiert, damit er ein verstopftes Abflussrohr reinigte; über solche kleinen häuslichen Pannen konnte sie außer sich geraten.
Jeremy fehlte ein bestimmtes Werkzeug, daher fuhr er zu einem Nachbarn, der ihm aushelfen konnte (die Daltons wohnten an einer abgelegenen Straße). Inzwischen machte sich Stella Sorgen um ihre Töchter, die sich verspäteten, und musste feststellen, dass das Telefon nicht funktionierte. Sie suchte ihr Handy und merkte, dass sie es in der Praxis hatte liegen lassen. Um mit Daisy und Emma zu sprechen, bräuchte sie Jeremys Handy. Sie holte es aus seiner Manteltasche und sah gleich in den Posteingang – gut möglich, dass ihre Töchter Jeremy eine SMS geschickt hatten, nachdem sie Stella weder auf dem Handy noch übers Festnetz erreichen konnten.
So stieß Stella auf Marions Nachricht: »Ich schaff’s nicht am Freitag. Muss Onkel Henry nach Manchester begleiten, seine Sekretärin ist verhindert. Mist! Tut mir wahnsinnig leid. Küsschen.«
Das »Küsschen« ließ natürlich die Bombe platzen. Allein die Nachricht einer Mitarbeiterin hätte Stella vielleicht noch nicht misstrauisch gemacht (obwohl der Ton doch ein bisschen vertraulich war …).
Ach, diese verräterische Technologie! Unter den gegebenen Umständen löschte Jeremy seine SMS stets sofort und gewissenhaft, aber diesmal hatte er noch keine Möglichkeit dazu gehabt, denn die Technologie war ihm einen Schritt voraus (oder funktionierte einfach, wie sie sollte). Als er nach Hause kam, wartete Stella schon an der Tür, und plötzlich war der Teufel los.
Marion holte Henry mit dem Taxi von Lansdale Gardens ab und fuhr mit ihm weiter nach Euston, zum Zug nach Manchester. Sie kam ein wenig spät und war sehr geistesabwesend. Das lange Telefongespräch mit Jeremy letzte Nacht hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht, sie hatte schlecht geschlafen. Anscheinend hatte Stella zunächst versucht, ihn auf der Stelle vor die Tür zu setzen, war die Treppe hochgerannt und hatte seine Kleidung in einen Koffer geworfen. Es war ihm gelungen, sie vorerst ruhigzustellen (die Mädchen würden jeden Moment zurückkommen, es sei nicht fair, sie so zu schockieren; morgen würden sie über alles reden, es wäre dumm, etwas zu überstürzen, sie würden das später bereuen). Aber der Waffenstillstand hielt nicht lange an: Am nächsten Tag tobte Stella wieder los, steigerte sich in Hysterie hinein, rief heulend ihre Schwester an und forderte Jeremy erneut auf, das Haus zu verlassen. Jeremy war jetzt in London, in ständigen Verhandlungen mit Stella, die ihm zunehmend entglitt. Sie schaltete einen Anwalt ein. Stellas Schwester saß Jeremy im Nacken, er sei schuld, wenn Stellas labiles seelisches Gleichgewicht wieder in Gefahr geriete – ob er sich nicht an ihren Nervenzusammenbruch vor vier Jahren erinnere?
Marion hatte versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Wogen zu glätten. Sie selbst empfand die Situation als extrem unangenehm. Niemand möchte eine Ehe zerstören, möchte zur Tatwaffe werden. Sie und Jeremy hatten gedacht, der Status quo ließe sich unbegrenzt fortsetzen, auch hegten beide leise Zweifel, ob diese Beziehung für die Ewigkeit bestimmt war, obwohl das keiner dem anderen gegenüber zugegeben hätte – die Affäre war noch relativ frisch. Das wird sich mit der Zeit schon zeigen, hatten beide insgeheim gedacht, während sie ihre prickelnde Liaison genossen, diesen unerwarteten Kick. Aber jetzt war das Schiff am Kentern.
Also lag Marion wach und fiel erst um fünf Uhr früh in einen unruhigen Schlaf, bis der Wecker klingelte; die Zeit reichte gerade, um hastig zu duschen und zu frühstücken. Mit ihrem Wattekopf empfand Marion Henrys kernige Begrüßung in Lansdale Gardens als Angriff auf ihre Nerven. Dieser Mann war eindeutig bestens ausgeschlafen und freute sich auf den bevorstehenden Tag.
»Hallo, hallo! Das Taxi ist startklar, ja? Fehlen nur noch die Fahrkarten, Rose hat alles griffbereit auf meinen Schreibtisch gelegt. Dann können wir los.« Er verschwand in die Toilette. Marion betrachtete sich gähnend in dem Regency-Spiegel und versuchte, das Schlimmste mit einem schnellen Make-up zu beheben. Henry tauchte wieder auf und wirbelte nervös umher, bis er seine Schlüssel gefunden und den Mantel angezogen hatte. Dann stiegen sie die Treppe zu dem wartenden Taxi hinab.
In Euston studierte Marion die Abfahrtstafel und wandte sich an Henry wegen der Fahrkarten. In diesem Moment erkannten beide gleichzeitig, was passiert war. Jeder hatte angenommen, der andere würde die Fahrkarten von Henrys Schreibtisch an sich nehmen. Zusammen mit dem Brief von der Universität mit der Wegbeschreibung und Henrys Vortragsnotizen.
Ärger und Bestürzung wurden höflich gezügelt, man befand sich schließlich in der Öffentlichkeit. »Ganz meine Schuld.« (Marion verfluchte ihn innerlich.) »Ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt«, sagte Henry (mit dem Gefühl, das habe er doch verdammt noch mal getan – ach, Rose, wo sind Sie?). Marion meisterte rasch die Situation, besorgte Ersatzfahrkarten, versicherte Henry, sie werde sich im Zug per Handy mit Manchester in Verbindung setzen und die nötigen Anweisungen geben lassen. Henry kündigte finster an, er müsse nun die Fahrt damit verbringen, ein paar behelfsmäßige Notizen zusammenzuschreiben; aber schließlich hatte er diesen Vortrag schon weiß Gott wie oft gehalten. »Politik und Persönlichkeiten zu Walpoles Zeiten« sollte ihm flüssig von der Zunge gehen.
Im Zug verfielen beide in Schweigen. Marion hatte in ihrer Handtasche einen Schreibblock gefunden, den Henry benutzen konnte; er zog seinen Füller hervor und starrte stirnrunzelnd auf das Papier. Marion telefonierte so lange herum, bis sie an der Universität Manchester einen hilfreichen Menschen aufgetrieben hatte.
Die Midlands zogen vorbei. Henry machte die eine und andere Notiz. Marion tat, als läse sie Zeitung, war aber viel zu zerstreut, um sich zu konzentrieren. Sie dachte an Jeremys missliche Lage, der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können. Sowohl sie als auch Jeremy hatten genug andere Probleme, von den Belastungen einer heimlichen Affäre einmal abgesehen.
Marion brachen die Kunden dramatisch weg. Henrys Portfolio war bei Weitem nicht mehr so prall gefüllt wie einst, und Jeremy hatte Schwierigkeiten, von der Bank einen Kredit für seine neue geschäftliche Expansion zu erhalten.
Die Wertminderung seines Portfolios bekümmerte Henry nicht weiter; er hatte eine hübsche dynamische Rente und einen dicken Batzen Festgeld. Marion hingegen machte sich ernsthaft Sorgen. Im Moment hatte sie in ihrer Kartei nur zwei richtig reiche Kunden. Das Telefon klingelte nicht mehr so oft; immer weniger Interessenten besuchten ihren Showroom. Es sah aus, als schnallten sogar die Wohlhabenden den Gürtel enger. In der Wirtschaft fielen die Prämien knapper aus, auch andere Branchen bekamen die Rezession empfindlich zu spüren, in diesem Jahr wurde nicht neu eingerichtet, es gab keinen Urlaub auf den Seychellen, auf Bermuda oder in Klosters. Ohne Aufträge in Aussicht würde das Minus auf dem Konto, das bislang gut beherrschbar war, immer weiter anwachsen. Schulden machten Marion Angst; Zahlungsunfähigkeit verstieß einfach gegen den guten Ton.
ENDE DER LESEPROBE