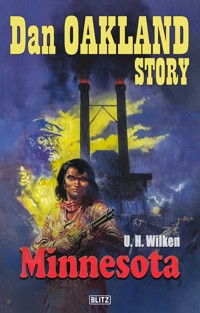Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein Freund wie El GalgoMiguel Monterrey versucht, seine Tante aus der mexikanischen Stadt Chihuahua nach Kalifornien zu bringen, bevor sich der Krieg zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten ausweitet. Auf dem Weg dorthin begegnet er dem Banditen El Galgo und dessen Bande.Bete für deine Seele, Amigo!Amerikanische Soldaten bringen Tod und Gewalt nach Mexiko. Miguel Monterrey muss sich zudem mit Banditen und grausamen Indianern auseinandersetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger
9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!
9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen
9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen
9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon
U. H. Wilken
Bete, Amigo!
ZURDO – Der schwarze GeisterreiterBand 2
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-677-4
Ein Freund wie El Galgo
Lautlos glitt der Tod über die alten brüchigen Mauern. Eine wilde Gestalt rutschte am Strick abwärts, schlich geduckt zum mexikanischen Posten am Tor und stieß erbarmungslos mit dem Messer zu. Mit einem leisen, röchelnden Laut sank der Wachposten zu Boden. Schmutzige Hände krallten sich in die durchschwitzte Kleidung und zogen den Toten hinter buschige Sträucher. Leise knarrend schwangen die Torflügel auf, und schon drangen die mörderischen Bandoleros in die Villa Chihuahua ein.
Der Tod hatte sich den Einlass erzwungen.
Nackte Füße tasteten sich über die schweren Steinplatten des Innenhofes hinweg. An den bloßen Fußgelenken waren riesige Radsporen festgeschnallt. Verdreckte Tücher waren um die Sporen geschlungen worden.
Geladene Waffen schimmerten matt im unruhig flackernden Licht der Fackeln. Stimmengemurmel tönte aus dem Gesindehaus.
Aus dem hochgelegenen, mit schmiedeeisernen Gittern verzierten Fenstern des mächtigen Herrenhauses sickerte gelber, anheimelnd weicher Lichtschein.
Dort im großen Herrenzimmer lachte ein junger Mann auf.
Niemand sah die Bandoleros. Niemand warnte den Besitzer der Villa Chihuahua und dessen Diener und Vaqueros. Kühl strich der Wind von den zerklüfteten Bergen der Sierra Madre herüber.
Der Tod bewegte sich in Gestalt vieler Banditen die Steinstufen zum Herrenhaus empor. Grinsend verharrten die Bandoleros und lauschten den leisen Stimmen.
Oben wurde ein Fenster geöffnet. Die schwarze Silhouette des Hazienderos war zu erkennen. Der reiche Patron entdeckte nicht die mexikanischen Banditen.
Er blickte in das nächtliche Tal hinaus und nach den fernen Hochebenen hinüber. Staub wirbelte über ferne Felsklippen. Im Süden der Sierra Madre begannen die Dschungel mit ihren tausend Schlupfwinkeln, wo sich Rebellen und Bravados verborgen hielten.
Langsam drehte der reiche Mexikaner sich am Fenster um und sah seinen Gast an.
„Wann wollen Sie aufbrechen, Senor Monterrey? Es ist ein weiter Weg bis zur Hauptstadt Chihuahua, und überall in Mexiko lauern die Banditen, Senor! Ich könnte Ihnen ein paar meiner Vaqueros als Schutz mitgeben.“
Der junge Spanier lächelte verwegen. Die weißen Zähne blitzten. Der Bart über dem Mund zog sich in die Breite, und die dunklen Augen funkelten im Lichtschein der Kerzen.
„Gracias, Senor, aber es ist besser, wenn ich allein mit meinem Hombre weiterreite. Zwei Mann fallen kaum auf, nicht wahr?“
Don Eufemio lächelte zurück und zuckte mit den Schultern.
„Sie kommen aus Kalifornien, Senor Monterrey. Hier ist Mexiko. Dieses Land wird von Revolutionen erschüttert. Mexiko wird niemals wieder seinen Frieden bekommen. Warum bleiben Sie nicht hier auf meiner Hazienda? Die Villa Chihuahua gibt Ihnen Schutz. Ich könnte ein paar Männer zu Ihrer Tante Esmeralda nach der Hauptstadt schicken.“
„Ich danke Ihnen, Don Eufemio, aber ich will dieses Land kennenlernen.“
Der junge spanische Kalifornier zog ein Seidentuch hervor und tupfte sich die Stirn ab. Schwarz und bläulich-glänzend fiel das Haar in die Stirn. Das braungebrannte Gesicht weckte Sympathie. Er schritt um den großen Tisch, der wie eine festliche Tafel gedeckt war, und schien in diesem Moment zu träumen.
Don Eufemio läutete, und ein blutjunges Mädchen kam herein und machte einen unterwürfigen Knicks.
„Patron?“, fragte es.
„Bring uns eine Flasche französischen Wein, Guadalupe“, befahl der Haziendero.
„Si, Patron“, sagte das schöne Mädchen und verschwand lautlos.
Der junge Miguel Monterrey atmete tief ein. Ihm war deutlich anzusehen, dass er von der Schönheit dieses Mädchens stark beeindruckt war.
„Ihr Vater ist einer meiner Peones“, erklärte der Mexikaner. „Er bewirtschaftet ein Haus am Rande der Sierra Madre. Dort lasse ich Kampfhähne züchten.“
Miguel stand dicht neben einer hohen Kerze und lauschte. Sein strahlendes Lächeln war erloschen. Er hatte ein dumpfes Geräusch gehört. Irgendwo auf der Hazienda klirrte es metallisch.
„Was ist mit Ihnen, Don Miguel?“
„Ich hörte ein fremdes Geräusch, Senor“, murmelte er und blickte auf die Kerze. Die Flamme flackerte plötzlich im Windzug. Von einer Sekunde zur anderen veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Eben noch war das Gesicht weich gewesen, aber jetzt hatte es sich verhärtet. Mit verengten Augen starrte er zur Tür. Er bewegte sich nicht, stand wie versteinert, und vielleicht rettete ihm die eiserne Beherrschung das Leben.
In der offenen Tür standen schwerbewaffnete Mexikaner! Der Staub der Sierra Madre haftete an der durchschwitzten Kleidung. Breite Waffengurte hingen auf den Schultern und kreuzten sich auf Brust und Rücken. Riesige Sombreros aus Filz und Stroh bedeckten die Köpfe und warfen ihre Schatten auf dunkelhäutige und grinsende Gesichter.
„Santa Virgin!“, stöhnte der Haziendero entsetzt. „Bandoleros!“
Miguel Monterrey zeigte kein Erschrecken, keine Angst; das braungebrannte Gesicht war völlig ausdruckslos. Er verlor nicht die Beherrschung. In den braunen Augen schimmerte es wie fernes kaltes Eis. Niemand hier in Mexiko wusste, dass er in Kalifornien steckbrieflich von den Amerikanern gesucht wurde. Niemand ahnte, dass dieser junge, schlanke und gepflegt aussehende Mann unter einer schwarzen Maske in Kalifornien für die Unterdrückten und Rechtlosen ritt, dass er gar nicht so harmlos war, wie er aussah. Auf seinen Kopf waren mehrere tausend harte amerikanische Dollar ausgesetzt worden. Im alten California wollte man das Leben des schwarzen Maskenreiters auslöschen.
Miguel Monterrey war Zurdo.
Er beobachtete die eindringenden mexikanischen Banditen scheinbar gelassen, doch plötzlich zeigte er Furcht vor ihnen.
Steif wich er zurück.
Feigheit, das war die zweite Maske des Zurdo.
Er sagte kein Wort.
Waffenklirrend polterten die Banditen herein, schnellten durch das Herrenzimmer und packten den Haziendero an den Armen. Brutal traten sie ihm in die Kniekehlen und zwangen ihn zu Boden.
„Knie ’nieder, fettes Cochino!“, fauchte einer der Banditen. „Auf die Knie vor unserem Jefe!“
An diesem späten Abend sah Miguel zum ersten Mal den Anführer dieser Banditen.
Schnaufend und mit breitem Grinsen erschien er in der Tür, und seine Companeros wichen zurück. Er breitete die Arme aus, als wollte er den Haziendero Don Eufemio umarmen.
„Aah, Amigo mio!“, rief er. „Welch eine Freude, dich zu sehen, mein guter alter Freund! Aah, du bist fett geworden, fett wie ein kleines Schweinchen, und ganz rosig im Gesicht. Deine Bäckchen verraten mir, dass du gesund bist, Amigo!“
Der Haziendero stöhnte dumpf auf. Er wurde bleich, und graue Flecken erschienen auf dem Gesicht. Mit geweiteten Augen stierte er dem Bandenführer entgegen.
„El Galgo!“, röchelte er.
Ein scharfes Messer war ihm an die Kehle gesetzt worden. Etwas Blut sickerte aus der Haut und rann über die Klinge.
„Si, Amigo!“, sagte der Bandit und lächelte breit. „Das ist eine große Ehre für dich, Don Eufemio.“
Er erreichte den Haziendero, beugte sich zu ihm hinab und kniff ihm in die Wange, so hart und fest, dass das Blut aus der Wange gepresst wurde.
Draußen auf dem Hof ertönte ein röchelnder Schrei, der sofort erstickte.
El Galgo lauschte und schüttelte wie betrübt den Kopf. Endlich ließ er die Wange des reichen Hazienderos los.
„Der Hombre ist leider tot, mein Freund“, erklärte er. „Meine Compadres haben ihm das Suppenrohr durchgeschnitten, du verstehst? Was soll ich nur mit dir machen, Eufemio? Du bist sehr reich. Wo hast du das Gold?“
„Ich habe kein Gold!“, krächzte der Haziendero. „Ich bin arm wie du, El Galgo!“
„Du lügst, mein kleines Schweinchen“, widersprach der dickleibige Bandit freundlich. „Warum musst du immer lügen? Was soll das? Du kannst El Galgo nicht täuschen. Ich weiß genau, mein Freund, dass du viel Gold hast.“
„Ich schwöre, ich habe kein Gold, El Galgo!“
Der Bandit grinste amüsiert und warf Miguel Monterrey einen schnellen und lauernden Blick zu.
„Was sagst du dazu, Amigo? Soll ich ihm glauben? Weißt du, dass für ihn zweihundert arme Indios verreckt sind? Er hat sie jahrelang in der Sierra Madre nach Gold graben lassen! Sie sind verreckt wie die Fliegen. Jeden Tag zwei, drei Mann! Und sie sind noch nicht einmal richtig begraben worden. Die Geier kamen, die Coyoten und die Wölfe! Die Tierchen waren immer satt, jede Nacht! Und die Aasgeier waren so fett geworden, dass sie nicht einmal wegfliegen konnten. Sie waren so schwer geworden, als hätten sie Blei gefressen, aber sie hatten nur die armen Indios in ihren verdammten Bäuchen! Was sagst du dazu, junger Freund?“
Miguel atmete flach und zuckte die Schultern. Er konnte für Don Eufemio nichts tun. und das, was dieser El Galgo gesagt hatte, schien nicht erlogen zu sein.
„Ich habe kein Gold!“, wimmerte der Haziendero. „Glaub mir das, El Galgo! Ich schwöre es!“
„Du würdest sogar das Leben deiner Mutter verkaufen, Schweinchen“, sagte El Galgo düster. „Du bist ein Höllenhund, Eufemio! Du hast das Gold irgendwo versteckt auf dieser Hazienda. Und du wirst mir die Wahrheit sagen, du elendes Schwein, sonst steche ich dich ab, mein Freund.“ El Galgo richtete sich auf und stieß ein lautes Gelächter aus. Seine Komplizen grinsten unruhig und fiebrig. Er zog die volle Unterlippe in den Mund und stieß den Atem flatternd aus. „Wo liegt es, Eufemio, mein Bruder? Nun sag’s schon! Ich könnte etwas ungeduldig werden!“
Der Haziendero starrte den Mexikaner voller Angst an, doch er verriet nicht das Versteck des Goldes.
Miguel beobachtete die Bandoleros. Dieser El Galgo war ein gefährlicher Mann. Er wirkte verschlagen und heimtückisch. Wahrscheinlich ging er sogar über Leichen. Seine Leute waren Mexikaner und Indios. Sogar Mestizen waren darunter.
El Galgos Worte überraschten Miguel. Sie klangen auf einmal sehr weich, und ein verklärter Ausdruck breitete sich auf dem vollen Gesicht aus.
„Oh, ich hatte einen Traum, Eufemio. Ich sah die guten Indios in der Sierra Madre sterben. Sie beteten zum Himmel und flehten um Gnade. Sie riefen die Heilige Jungfrau an und sangen im Sterben ihre Lieder. Sie gruben mit ihren Händen nach Gold und trugen es zusammen, und du, Eufemio, wolltest immer mehr. Immer flogen die Totenvögel über den Canyon hinweg und warteten auf ihren Fraß. Und die armen Burschen schufteten, bis der Tod sie erlöste. Und du wurdest immer reicher, je mehr Indios starben, Eufemio. Zweihundert Indios, mein Freund.“
„Sie starben an Cholera!“, stöhnte der Haziendero.
„O nein, Eufemio.“ El Galgo schob das Kinn vor und grunzte tief. „Man nennt mich den Windhund. Ich bin schnell und schlau, Amigo. Ich ließ ein paar Indios ausgraben, die verschüttet worden waren. Zwei von ihnen hatten eine Kugel im Kopf. Cholera, wie?“
Drohend stand er dicht vor dem Haziendero. Er schob die Daumen hinter den breiten Waffengurt und wippte auf den Fußspitzen.
Die anderen Banditen standen still und abwartend. Unten auf dem Hof rief jemand. Miguel konnte auf den Hof hinuntersehen. Dort hielten weitere Banditen das Gesinde der Hazienda in Schach. Bis jetzt war kein Schuss gefallen, und die Vaqueros weit draußen bei der Herde ahnten nicht, was auf der Hazienda geschah.
Miguel konnte nichts für den Haziendero tun.
Jäh stieß El Galgo das Knie vor und rammte es in Don Eufemios Gesicht.
„Antworte!“, schrie er voller Wut. „Wo ist das Gold der Indios? Es gehört dir nicht! Willst du, dass die Amerikaner es finden? O nein, mein Freund, es gehört Mexiko, den Indios und mir!“
Halb bewusstlos kniete der Haziendero vor El Galgo. Die Banditen hielten ihn fest.
Mexiko war ein grausames und wildes Land. Amerikanische Truppen waren über den Rio Grande gekommen. Die Amerikaner wollten das von den Spaniern eroberte und von Mexikanern besetzte alte Texas an sich reißen und ganz Mexiko in die Knie zwingen. General Kearny wütete mit seinen Truppen in Kalifornien, und der amerikanische Oberst A. W. Doniphan war von El Paso aus in mexikanisches Gebiet eingedrungen und befand sich jetzt auf dem Vormarsch zur Stadt Chihuahua. Ein gewaltiger Tross bewegte sich durch die nördlichen Wüsten Mexikos und über die Hochebenen.
El Galgo aber wollte das Gold des Hazienderos Don Eufemio erbeuten und damit in der Sierra Madre verschwinden, bevor die Amerikaner kamen.
Wimmernd hing der Haziendero zwischen den Banditen. Sie rissen ihn hoch und stießen ihn zum Tisch hinüber. El Galgo grinste eingefroren und nickte seinen Komplizen zu. Daraufhin stießen sie den Haziendero mit dem Gesicht über eine Kerze.
„Antworte, Eufemio!“, sagte El Galgo kalt. „Wo ist das Gold? Ich frage dich zum letzten Mal, mein Freund. Das Gold liegt hier auf der Hazienda, irgendwo unter den Mauern der Villa Chihuahua! Was willst du noch mehr als dein Leben, Amigo?“
„Gnade!“, stöhnte Don Eufemio. „Gnade!“
„Erst das Gold!“
Miguel Monterrey stand reglos. Kleine Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn. Fieberhaft dachte er nach und suchte nach einer Chance. Zweifellos sagte dieser El Galgo die Wahrheit. Don Eufemios Lächeln hatte Miguel getäuscht. Dieser gastfreundliche Haziendero war ein erbarmungsloser Ausbeuter und Sklaventreiber gewesen. An seinen Händen klebte das Blut von zweihundert armen Indios, die er in seiner unseligen Gier nach dem Gold in den Tod getrieben hatte.
Doch darum konnte Miguel nicht auf El Galgos Seite stehen. Denn El Galgo war ein Bandit, der ebenso grausam handelte.
Fragend starrten die Banditen ihren Jefe an.
„Du willst nichts sagen, Eufemio?“, flüsterte El Galgo und tat erstaunt. „Du willst den Americanos das Gold überlassen, damit sie noch reicher werden und noch mehr Waffen und Munition kaufen können? Oh, mein Freund Eufemio, das ist nicht gut! Amigos, bringt ihn zum Reden!“
Miguel spannte die Muskeln an. Er sah, wie die Banditen den Haziendero nach vorn drückten, wie die Flamme der Kerze das verzerrte graue Gesicht traf, und er hörte Don Eufemios furchtbares Stöhnen.
„Lass es gut sein, El Galgo“, sagte Miguel mit kalt klingender Stimme. „Er wird es dir sagen.“
Steif wandte El Galgo sich dem jungen Spanier zu. Forschend betrachtete er ihn und die einfache, aber teure Kleidung.
„Wer bist du, Amigo?“
„Miguel Monterrey. Ich komme aus Kalifornien und will in die Hauptstadt Chihuahua. Don Eufemio wird mir sein Gold geben, und ich werde es dir geben, El Galgo. Nur so wird Don Eufemio sich seine Ehre bewahren können, und darauf kommt es ihm an.“
„Du bist ein kluger Hombre.“
Die schwarzen Augen des Banditen glitzerten im Kerzenlicht. Das dunkle Haar hing strähnig in die Stirn. Der massige Körper zuckte unter einem verhaltenen und lautlosen Lachen. Jäh kam er mit der Geschmeidigkeit eines Raubtieres heran und musste zu Miguel emporblicken.
„Dann frag Don Eufemio, Amigo. Aber täusche mich nicht! Es macht mir nichts aus, einen Kalifornier zu töten, du verstehst?“
„Ich verstehe.“
Miguel blieb ruhig. Er ging langsam zum Tisch und sah den Haziendero ernst und drängend an.
„Don Eufemio, was nützt Ihnen das ganze Gold, wenn Sie ein toter Mann sind? Das Leben ist kostbarer als alles Gold von Mexiko. Sie haben diese Hazienda und sind immer noch ein reicher Mann, auch ohne Gold. Geben Sie mir das Gold, Senor.“
Der Haziendero stöhnte. Knochige Hände hielten ihn gepackt. Die Flamme war dicht vor seinem Gesicht. Ein Ausdruck des Wahnsinns flackerte in den hervorquellenden Augen.
Angespannt wartete Miguel. Die Antwort würde über das Leben des Hazienderos entscheiden.
Doch Don Eufemio kam nicht mehr dazu, zu antworten. Draußen ertönte ein gellender Warnschrei.
„Americanos!“
Fauchend wirbelte El Galgo herum. Die Banditen ließen den Haziendero los und griffen nach den Schusswaffen. Wieder schrie draußen auf dem Hof ein Bandolero. Vor der Hazienda dröhnten die Hufe vieler Pferde. Banditen jagten mit den Pferden durch das breite Tor.
„Caramba!“, fluchte El Galgo. Mit katzenhaft schnellen Bewegungen hastete er zur Tür. Die Banditen folgten ihm. Sie drängten sich durch die Tür. Noch immer klammerte Don Eufemio sich an der Tischkante fest.
Miguel erkannte die tödliche Gefahr. Er wollte aufschreien, zu Don Eufemio springen und ihn zu Boden reißen, doch es war schon zu spät. Einer der Banditen drehte sich in der Tür herum und stierte bösartig herüber. Die schwere Pistole krachte, und der Schuss riss den Haziendero von den Beinen.
Schon kniete Miguel bei ihm.
Vor dem Herrenhaus schrien die Banditen und wieherten schrill die Pferde. Radsporen rasselten laut. Brüllend warfen die mexikanischen Banditen sich auf die Pferde und rasten über den Hof.
Schüsse peitschten durch das Tal.
Der Haziendero stierte Miguel trübe an.
„Senor“, flüsterte Miguel, „haben Sie wirklich Gold?“
„Ja“, hauchte Don Eufemio, „ja, aber niemand bekommt mein Gold. Es gehört mir.“
Leblos lag er vor Miguel am Boden. Heftig flackerten die Kerzen. Die tödliche Gefahr wuchs von einer Sekunde zur anderen. Miguel sprang auf und schnellte aus dem Herrenzimmer. Voller Kraft lief er durch das große Haus und über den Hof. Im Pferdestall stand ein junger Indio.
„Chato, die Pferde!“, rief Miguel. „Presto!“
Der Indio reagierte sofort, holte die Pferde aus den Boxen und sattelte sie mit blitzschnellen Handgriffen. Schon sprangen sie auf die Pferde. Schreiend lief das Gesinde der Hazienda durcheinander. Staub wallte noch über den Hof, als Miguel und sein stummer Gefährte aus dem Pferdestall gejagt kamen. Im Galopp rasten sie zum Tor hinaus.
Im Tal blitzten Mündungsfeuer grell auf. Amerikanische Soldaten ritten durch das Tal und schwärmten aus.
Miguel saß lässig und sicher auf dem Pferd, als wäre er schon im Sattel geboren worden. Der Indio Chato hing wie eine Katze auf dem Pferd. Im halsbrecherischen Galopp ritten sie davon. Hinter ihnen drangen die Amerikaner in die Hazienda ein. Schüsse peitschten, und Säbel wurden blutig. Gnadenlos wurde das Gesinde niedergemacht.
El Galgo und seine Bandoleros waren nicht mehr zu sehen.
Berittene Amerikaner folgten Miguel und Chato.
Beide mussten fliehen.
Sie ritten eine Zickzackfährte und konnten endlich die Verfolger abschütteln.
Der Morgen graute schon, als sie die keuchenden und schweißnassen Pferde zwischen hohen Felsklippen zügelten.
Miguel rutschte vom Pferd und kletterte sofort auf einen der Felsen. Er streckte sich lang aus und spähte zurück. Im öden Tal ritten die Amerikaner suchend umher. Zweifellos gehörten sie zur Truppe des Oberst Doniphan.
In der Ferne wallte grauer Rauch empor. Dort lag die Villa Chihuahua. Dort wütete das Feuer auf der Hazienda.
Leise seufzte Miguel und flüsterte:
„Arme kleine Guadalupe.“
*
Der heiße Wind trug das dumpfe Dröhnen der Yaquitrommeln herüber. Sehnige Hände schlugen klatschend auf die Trommeln, die mit Menschenhaut bespannt waren.
Horchend saß Miguel im Schatten der Felswand.
Chato saß zusammengesunken abseits. Sein dunkles Gesicht war entspannt. Er hatte die Augen geschlossen und schien zu träumen.
„Woran denkst du, Chato?“, fragte Miguel. „Hast du Sehnsucht nach den Indios? Willst du zu deinem Volk zurück? Niemand wird dich kennen. Aber sie werden dich aufnehmen, denn du gehörst zu ihnen.“
Langsam hob Chato den Kopf und blickte Miguel ernst an. In seinen dunkelbraunen Augen schillerte es. Er konnte Miguel nicht antworten. Schwach schüttelte er den Kopf und wischte über die Augen.
„Bueno“, sagte Miguel leise, „du willst bei mir bleiben, Chato. Das ist gut. Denn ich brauche dich. Du weißt, wer ich bin. Wir beide werden es schon schaffen. Ich muss meine Tante Esmeralda nach Kalifornien bringen, Chato. Hier in Mexiko regiert der Tod. Die Amerikaner sind schon überall.“
Chato sah ihn treu und ergeben an. Er würde für Miguel alles tun. Er würde für ihn sogar in die Hölle reiten.
„Du bist ein guter Freund, Chato“, sprach Miguel weiter. „Wir beide werden ganz bestimmt die Hazienda de los Toros in Kalifornien wiedersehen. Du verstehst nicht, warum hier in Mexiko Krieg ist, nicht wahr? Ich sage es dir, Chato. Der amerikanische Präsident Polk hatte seinen Botschafter nach Mexiko geschickt. Mexiko sollte den Rio Grande als Grenze gegenüber Lone Star Texas anerkennen und unser Kalifornien für fünfundzwanzig Millionen Dollar abtreten, aber es waren schlechte Zeiten zum Verhandeln. Mexiko wurde wieder einmal von Revolutionen heimgesucht, und die Americanos konnten keine feste Regierung finden. Sie holten ihren Botschafter zurück.“
Chato nickte, als hätte er das alles begriffen, doch er hatte nichts verstanden.
„Dann begangen die Mexikaner einen großen Fehler, Chato. Mariano Arista, ein mexikanischer General, ging bei Matamoros über den Rio Grande und trieb amerikanische Soldaten wie ein Rudel Hunde vor sich her. Daraufhin hat der Präsident der Amerikaner die Vergeltung angeordnet, also den Krieg gegen Mexiko, und fünfzigtausend Americanos standen plötzlich unter Waffen. General Kearny zog nach Kalifornien, und Oberst Doniphan marschiert jetzt nach Süden. Er ist ganz in der Nähe von uns. Wir müssen höllisch gut aufpassen, Amigo. Sonst lassen wir unseren Kopf für immer hier zurück.“
Chato stöhnte verhalten und bewegte die Hände.
„Ja, ich verstehe dich, Chato“, flüsterte Miguel. „Wir sollten schnellstens zur Hauptstadt reiten, doch ich denke an das Mädchen Guadalupe. Ich muss wissen, was aus ihr geworden ist. Vielleicht bin ich ein großer Narr, Chato.“
Der Wind war in den Bäumen. Trockenes Gras raschelte zwischen den kahlen Felsen. Weiße Wolken zogen über die Sierra Madre hinweg. Dumpf und unheimlich klangen die Trommeln aus der steinernen Wildnis herüber. Plötzlich klirrten Hufeisen über Felsboden.
Geduckt lief Miguel zwischen die Felsen und entdeckte mehrere amerikanische Soldaten, die sich ihrem Rastplatz näherten. Hart biss er die Zähne zusammen und rannte zurück. Sekunden später saßen sie im Sattel und ritten langsam und vorsichtig nach Westen. Ihre Spur verlor sich auf dem Felsboden der Sierra Madre.
*
Wachsam zogen sie durch die schweigende und zerklüftete Bergwelt. Mächtige Felsen ragten wie die Pfeiler des Himmels empor. Leguane rutschten von heißen Felsen und verschwanden in den dunklen Spalten. Hoch am Himmel kreisten lautlos die Totenvögel auf der ewigen Suche nach Kadavern. Irgendwo in diesem Land marschierten die amerikanischen Kolonnen, und auf knarrenden Wagen lagen die Kanonen, um den Tod in die Herzen der Mexikaner zu jagen.
Auf einmal verhielt Chato und beugte sich horchend vor. Der Wind trug ferne Musik durch die Schluchten.
„Marimbas“, sagte Miguel überrascht. „Wer spielt jetzt noch Gitarre in der Sierra Madre?“
Sie folgten steinigen schmalen Pfaden, vorbei an tiefen und klaffenden dunklen Canyons. Sie erreichten eine Kammhöhe und entdeckten tief unter sich die Adobehäuser einer kleinen Ortschaft. Von dort tönte die Musik herauf.
Es war eine Melodie, die die Mexikaner schon einmal gespielt hatten, damals, als sie den Alamo belagert und die Amerikaner bis auf den letzten Mann niedergemacht hatten. Dieses Lied bedeutete, dass die Mexikaner keine Gnade gegenüber den Amerikanern haben würden.
Eine Todesmelodie.
Schaurig und dennoch voller Sehnsucht klang sie durch die stillen Täler und Schluchten und verlor sich im unwegsamen Land.
Suchend starrte Miguel zurück.
Er hatte zur Villa Chihuahua reiten wollen, doch die Verfolger hatten ihn und Chato in eine andere Richtung gezwungen.
„Adelante!“, sagte er. „Reiten wir hinunter!“
Es war ein langer und beschwerlicher Weg bergab. Im Westen glühte blutrot der Sonnenball hinter den schwarzen Bergen, als sie endlich auf die Straße stießen, die zur Ortschaft führte. Die Todesmelodie war verstummt.
Auch die Yaquitrommeln schwiegen.
Todesstille herrschte.
Steine lösten sich unter den Hufen der Pferde und rollten abwärts. Am Wegrand lag das Wrack eines Maultierkarrens. Vor dem ersten Adobehaus bewegte sich das Windrad eines alten Brunnens träge im Abendwind.
Auf einmal erklangen wieder die Gitarren. Heiß war der Rhythmus. Helles Lachen tönte hinter den Häusern hervor. Mexikaner tanzten vor der großen Cantina und klatschten in die Hände. Niemand hier wusste, wie nahe die Amerikaner schon waren!
Neben einem alten Pferdestall saßen Miguel und Chato ab. Sie zogen die Tiere zum Wassertrog und ließen sie saufen. Miguel tauchte das Gesicht hinein und wusch sich den Staub ab, während Chato wachsam umherspähte und für Miguels Sicherheit sorgte. Mit tropfnassem Gesicht tauchte Miguel auf und nickte Chato zu, und jetzt säuberte auch der treue Indio sein Gesicht.
Sie nahmen die Pferde am Zügel und näherten sich der Rückseite der Cantina. Leise klingelten die Radsporen an Miguels weichen Lederstiefeln. Chato trug Sandalen, und die Sporen waren an den bloßen Fußgelenken festgeschnallt.
Die Musik war voller Lebensfreude.
Chato blieb bei den Pferden zurück. Miguel ging langsam nach vorn und lehnte sich gegen die Hauswand. Er sah dem ausgelassenen Treiben zu und lächelte still vor sich hin. In diesem Land, in dem mehr Blut und Tränen flossen als anderswo, sangen und tanzten die Menschen selbst noch im Angesicht des Todes.
Miguel betrat die Cantina und fragte nach einem Zimmer. Der Mexikaner sah ihn abschätzend an.
„Aus Kalifornien, Senor?“
„Ja, Amigo.“
„Willkommen in unserer Stadt, Senor. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Zimmer. Sie werden zufrieden damit sein.“
Es war ein kleines Zimmer. Das Fenster zeigte zum Hof. Miguel nickte zustimmend und wollte schon zahlen, doch der Mexikaner winkte ab.
„Später, Senor. Ruhen Sie sich gut aus. Morgen reden wir über den Preis. Wollen Sie nicht auch tanzen?“
„Vielleicht, Amigo. Gracias.“
Miguel war allein. Er öffnete das Fenster und stieß einen leisen Pfiff aus. Sofort kam Chato herangelaufen. Wie eine Raubkatze sprang er durch das Fenster.
„Ich werde hier übernachten, Chato. Du bewachst die Pferde. Bring sie in den Stall.“
Chato nickte, schwang sich hinaus und entfernte sich. Müde vom langen Ritt, ließ Miguel sich auf das Schlaflager fallen, behielt die Kleidung an und schloss die Augen. Er lauschte der Musik und dachte an das ferne Tal am Sacramento in Kalifornien. Zum ersten Mal ritt er ohne schwarze Maske. Aber vielleicht würde er auch hier in Mexiko die schwarze Tracht anlegen müssen, um als Zurdo für die unterdrückten Menschen zu reiten und zu kämpfen.
Die Musik ließ ihn schnell einschlafen.
Er konnte sich auf Chato felsenfest verlassen. Der Indio würde selbst im Schlaf noch jedes fremde und verdächtige Geräusch wahrnehmen und ihn sofort warnen.
*
Hoch stand der Mond über dem Tal in der Sierra Madre. Sternenlicht lag bleich und hell auf den flachen Dächern. Lampions leuchteten auf dem Platz vor der Cantina. Junge Menschen tanzten und lachten.
Das Unheil kam näher.
Die Canyons verstärkten die Musik, und der Nachtwind trug sie den Amerikanern entgegen.
Chato ruhte im Pferdestall. Zusammengerollt wie eine Katze lag der junge Indio im Stroh. Die Zügel der Pferde hatte er sich um ein Bein geschlungen.
Irgendwo in diesen Bergen lag El Galgo auf der Lauer.
Lautlos kamen die Amerikaner über den Talrand. Sie gingen in kleinen Gruppen und bewegten sich von einer Deckung zur anderen.
Auf dem Platz in der kleinen Stadt tranken die Menschen ihren Pulque und Mescal. Manche schliefen am Rande des Platzes mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht.
Dumpf schnaubten die Pferde im Stall. Chato erwachte, löste die Zügel vom Bein und richtete sich geschmeidig auf. Geduckt schlich er zum Stalltor und drückte es zu einem Spalt auf.
Seine dunklen Augen weiteten sich.
Er sah Amerikaner!
Ganz deutlich erkannte er die Soldaten in ihren weißen Hosen und mit ihren blauen Jacken. Sie hielten ihre Säbel und ihre Gewehre mit den aufgesteckten Bajonetten bereit. Unter den uniformierten Soldaten befanden sich auch Männer, die wie Trapper aussahen.
Chato konnte nicht schreien! Er war stumm. Und er beobachtete die Soldaten und Trapper mit flackernden Augen.
Sie bewegten sich abseits um die Häuser und Hütten.
Wie ein Schatten glitt er über den Hof. Lautlos erreichte er die Rückseite des Hauses und schnellte durch das Fenster, rüttelte an Miguels Schulter und riss ihn aus dem Schlaf, gestikulierte heftig und machte wilde Zeichen.
Miguel war sofort hellwach, sprang zum Fenster und starrte hinaus. Er konnte gerade noch einen der Amerikaner verschwinden sehen.
In diesen Sekunden bewahrten er kaltes Blut.
Es gab zwei Möglichkeiten. Die eine war, die Mexikaner zu warnen, doch die Warnung käme zu spät. Die andere Möglichkeit war, nichts zu tun, abzuwarten und zu hoffen, dass es nicht zu einem Blutbad kam. Miguel konnte sich nicht vorstellen, dass die Amerikaner auf die angetrunkenen Mexikaner und auf die schlafenden Leute schießen würden.
Er irrte sich.
*
Die Hölle brach los.
Während Miguel noch auf dem Weg in die Cantina war, peitschten die ersten Schüsse auf. Mörderisches Blei heulte über den Platz und bohrte sich mit einem klatschenden Geräusch in die Körper der tanzenden und der schlafenden Mexikaner hinein. Eine laute, herrische und hasserfüllte Stimme tönte durch das Aufbrüllen der Gewehre. Deutlich waren Befehle zu hören.
Er stieß die Tür zum Gastraum auf und sah draußen auf dem Platz die Amerikaner. Orangefarbene Mündungsfeuer flammten auf. In der Cantina sprangen schreiend die Mexikaner hoch. Schüsse zertrümmerten die Fenster, und Kugeln jaulten herein. Schon stürmten Amerikaner durch die Tür und bohrten die Bajonette in die Leiber der völlig überraschten und größtenteils unbewaffneten Mexikaner hinein. Überall spritzte Blut umher. Gewehrkolben zertrümmerten die Köpfe. Säbel enthaupteten die Mexikaner. Frauen und Mädchen wurden hinausgetrieben. Auf dem Platz fielen immer wieder Schüsse, und tot sanken Mexikaner vor ihren Häusern zu Boden. Stiefel zertraten Gitarren. Flüche ertönten. Gellend schrien Frauen in den Hütten. Lodernde Fackeln flogen fauchend auf die Strohdächer, und überall schossen Flammen empor. Mit einem auf seinem Säbel aufgespießten Kopf rannte ein Amerikaner an der Cantina vorbei.
Das Grauen packte Miguel.
Er warf sich zurück und rannte in den Raum. Wie erstarrt stand Chato vor dem Fenster.
„Raus hier!“, schrie Miguel.
Sie sprangen auf den Hof und hetzten zum Stall hinüber, rissen die noch gesattelten Pferde heraus und zerrten sie hinter den Häusern entlang. An einem fast ausgetrockneten Flussbett ragten die Mauern einer Ruine empor. Hier brachten sie die Pferde unter.
Noch immer kamen weitere Amerikaner den Talhang herunter.
Miguel und Chato konnten nicht aus dem Tal kommen. Die Ortschaft war umzingelt. Schüsse krachten, Menschen schrien, Kinder weinten. Und Mexikaner starben einen elenden und wilden Tod auf der Straße. Mit viehischer Gewalt fielen die Amerikaner über die männlichen Bewohner her und töteten sie. In den Hütten stürzten sie sich auf die Mädchen. Überall wütete das Feuer. In der Cantina tranken die Soldaten den Mescal und lachten.
Staub und Pulverrauch wehten über die kleine Stadt. Noch fielen vereinzelt Schüsse, dann war nur noch das Wimmern und Schreien weinender Menschen zu hören.
Trupps von Soldaten durchkämmten die Ortschaft.
Miguel atmete tief und schwer ein.
„Sie dürfen unsere Pferde nicht finden, Chato. Komm!“
Sie verließen die Ruine und hasteten über den sandigen Platz. Urplötzlich standen mehrere Amerikaner vor ihnen. Miguel sah einen jungen Lieutenant, der starr und zynisch lächelte.
„Ein Spanier, wenn ich nicht irre!“
Miguel und Chato blieben wie angewurzelt stehen. Der Lieutenant war Herr über ihr Leben. Seine Laune entschied über ihr Schicksal.
„Nehmt die beiden Hundesöhne fest!“, befahl er. „Sperrt sie ein! Ich überlasse sie dem Captain!“
*
Soldaten packten Miguel und Chato und schlugen und traten sie. Sie trieben sie vor sich und warfen sie in ein altes Haus. Sie stürzten in das Stroh, rollten sich auf die Seite und sahen noch, wie die Amerikaner die Tür zuschlugen.
Plötzlich war Hufschlag zu hören. Es klirrte metallisch, rasselte und klapperte. Beschlagene Hufe knallten über das Pflaster der Straße hinweg.
Geschmeidig sprang Miguel hoch und verharrte neben Chato am Fenster. Ein paar Mexikaner hinter ihnen erhoben sich schwankend und kamen heran. Alle starrten auf die Straße hinaus.
Eine Reiterkolonne kam in die Ortschaft. Es waren Amerikaner, ein kaum disziplinierter Haufen von Soldaten und Zivilisten. Abenteurer, die sich persönlich bereichern wollten. Junge und alte Soldaten, die Oberst Doniphans Kommando unterstanden. Männer, die hungrig waren nach Frauen, Whisky und Essen.
In der Kolonne trotteten Maultiere. Sie trugen schwere Lasten. Jeder der Reiter hatte eine schwere Alston-Reiterpistole und ein Springfield-Gewehr bei sich. Lange Säbel schlugen gegen die Beine der Soldaten.
Nicht ein einziger Einwohner begrüßte die Amerikaner, die sich wieder einmal als Eroberer und Befreier fühlten. Dieses Mexiko aber wollte keine Befreiung durch fremde Nationen. Mexiko war arm, und in jedem Jahr putschte irgendein hoher mexikanischer Offizier, begann eine neue Revolution, ritten andere Aufständische gegen Regierungstruppen, formierten sich die Rebellenheere erneut. Wer immer in Mexiko an die Macht wollte, verschonte nicht das Leben der armen Bevölkerung.
Ein alter Hund lief lahmend neben den Reitern einher und kläffte.
Das war die einzige Begrüßung.
In den Häusern wohnten das Elend und die Furcht.
Niemand kam und begrüßte Captain Macdonald Arlington.
Der aschblonde Captain hob die rechte Hand, und die Doppelreihe der Soldaten verhielt auf der Plaza. Zweifellos gehörte Arlingtons Reiterrudel zur Vorhut der Amerikaner und sollte das Land erkunden und feindliche Stellungen aufklären, denn sonst wären diese Soldaten zu Fuß gekommen.
„Absitzen!“, schrie Arlington.
Langsam ritt er weiter.
Miguel sah das Gesicht des Captains ganz deutlich im Mondlicht, als er vorbeiritt. Er konnte sogar die hellblauen, etwas wässrigen Augen erkennen.
Lieutenant Dencer kam dem Captain entgegen. Sie trafen nahe des Gefängnisses aufeinander, und Miguel hörte jedes Wort, was gesprochen wurde.
„Sir, die Ortschaft ist eingenommen! Jeder Widerstand wurde gebrochen!“, meldete Dencer.