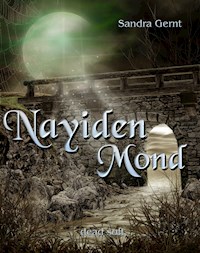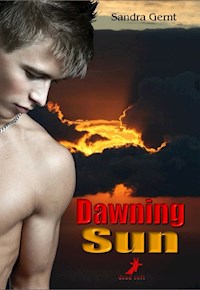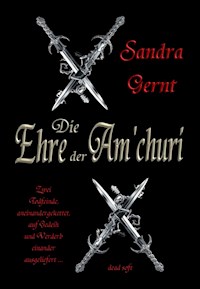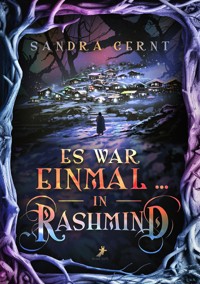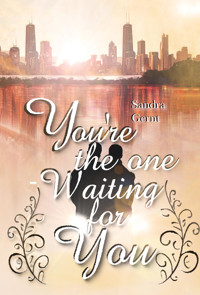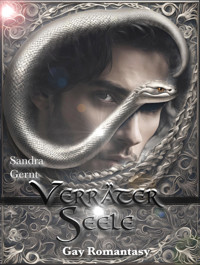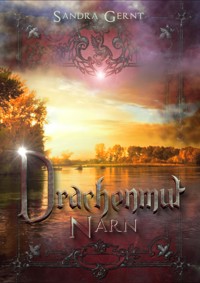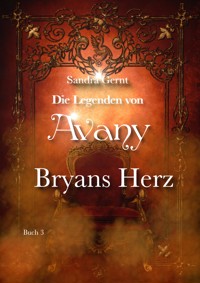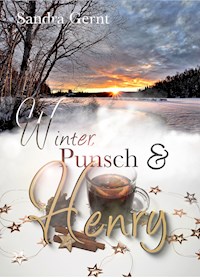
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henry rechnet mit wenig Gutem, als er sich arbeitslos melden muss. Dass sein Sachbearbeiter im Jobcenter allerdings ausgerechnet Malte sein muss, das geht zu weit, oder? Malte ist schließlich sein Nachbar aus glücklichen, fernen Kindertagen. Malte muss nach einem Unglücksfall seit einiger Zeit wieder im Haus seiner Eltern leben. Die Rückkehr zu seiner chaotischen, turbulenten Großfamilie war weder eine leichte noch freiwillige Entscheidung. Da zieht plötzlich Henry ebenfalls zurück zu seiner ebenso großen, ebenso chaotischen Familie. Henry, für den Malte schon immer ein bisschen geschwärmt hat. Leider ist auch er nicht freiwillig heimgekehrt, sondern trägt ein großes Bündel Probleme mit sich herum. Wunden der Vergangenheit müssen heilen, um einen Neuanfang zu ermöglichen – und nur miteinander können sie diesen Weg gehen. Warnung: In dieser Geschichte wird der Suizidversuch einer Nebenfigur thematisiert. Ca. 55.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 270 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Henry rechnet mit wenig Gutem, als er sich arbeitslos melden muss. Dass sein Sachbearbeiter im Jobcenter allerdings ausgerechnet Malte sein muss, das geht zu weit, oder? Malte ist schließlich sein Nachbar aus glücklichen, fernen Kindertagen.
Malte muss nach einem Unglücksfall seit einiger Zeit wieder im Haus seiner Eltern leben. Die Rückkehr zu seiner chaotischen, turbulenten Großfamilie war weder eine leichte noch freiwillige Entscheidung. Da zieht plötzlich Henry ebenfalls zurück zu seiner ebenso großen, ebenso chaotischen Familie. Henry, für den Malte schon immer ein bisschen geschwärmt hat. Leider ist auch er nicht freiwillig heimgekehrt, sondern trägt ein großes Bündel Probleme mit sich herum.
Wunden der Vergangenheit müssen heilen, um einen Neuanfang zu ermöglichen – und nur miteinander können sie diesen Weg gehen.
Warnung: In dieser Geschichte wird der Suizidversuch einer Nebenfigur thematisiert.
Ca. 55.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 270 Seiten.
von
Sandra Gernt
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Epilog
Ein Jahr …
„Ihr seid ein Scheiß-Kackverein! Ich werd‘ euch verklagen! Das könnt ihr nicht mit mir machen!“
Die Dame in Pink stöckelte durch den Raum. Schwarzer Leder-Minirock, dunkelpinkfarbene Daunenjacke, grellpinkfarbene Strumpfhose, barbiepinkfarbene High Heels. Letztere passten farblich am besten zu ihren Fingernägeln, dem Lippenstift, Lidschatten und natürlich den gefärbten Haaren.
„Ey, ich mach euch fertig! Euren Scheiß-Kurs könnt ihr euch sonstwo rein…“
„Frau Müller-Ehrenwart, ich denke, das reicht jetzt“, sagte Malte ruhig, ohne sie anzusehen. „Wenn Sie den Kurs verweigern, muss ich Ihre Bezüge kürzen.“
„Ich bin vierunddreißig, verdammte Kackscheiße! Seit vier Jahren arbeitslos. Ich glaub schon, dass ich weiß, wie man Bewerbungen schreibt! Was soll ich mit einem Bewerbungskurstraining? Hab ich doch schon mal gemacht!“
„Nein, Sie haben den Kurs abgebrochen, und zwar vor dreieinhalb Jahren. Ich habe Anweisungen, Sie zu diesem Kurs zu verpflichten. Das sind gesetzliche Vorgaben, das denke ich mir nicht aus, um Sie zu ärgern.“
„Ihr könnt mich alle mal!“ Mit hochrotem Kopf raffte sie ihre Unterlagen an sich und verließ das Büro.
Malte atmete tief durch. Tag achtzehn im Irrenhaus. So wurde das Jobcenter unter den Kollegen genannt. Normalerweise arbeitete er im Bürgerbüro und sorgte dafür, dass die Leute neue Ausweise und Reisepässe bekamen. Man hatte ihn für einen Monat zwangsabgestellt, nachdem vier Kollegen gleichzeitig im Jobcenter und der Agentur für Arbeit gekündigt hatten und zwei weitere krank ausfielen. Dass es schlimm werden würde, hatte er natürlich gewusst. Vor einem Jahr hatte er dort bereits mehrere Monate gesessen und war gründlich eingearbeitet worden. Da hatte er gedacht, er könnte sich den Wechsel ins andere Amt vorstellen … Bis, ja, bis er auf die Kunden losgelassen worden war. Da war er dann sehr schnell reumütig ins Bürgerbüro zurückgekrochen und hatte geschworen, niemals wieder freiwillig dorthin zu gehen.
Auch an seinem gewohnten Arbeitsplatz kam er mit den merkwürdigsten Menschenwesen in Kontakt. Beschimpft wurde er normalerweise nicht, höchstens ungläubig gefragt, warum es so lange dauern musste, bis der Ausweis zum Abholen fertig war, und ob man das nicht beschleunigen könnte. Hier war es praktisch Normalität. Frustrierte Menschen ohne Lebensperspektive ließen ihre Wut an ihm aus, weil er ein undurchschaubares, ungerechtes System anwenden musste, das er sich nun wirklich nicht selbst ausgedacht hatte. Da er zudem keinen von ihnen kannte, viele Dinge nicht wusste, weil er nach einem Jahr einiges vergessen und sich irgendwie alles schon wieder geändert hatte … Ständig musste er irgendetwas nachschauen und beim Amtsleiter nachfragen, der völlig überlastet und desillusioniert Dienst nach Vorschrift abriss, waren die Kunden zu Recht unzufrieden mit ihm. Er hatte leider wirklich keine Ahnung, und das war nicht seine Schuld.
Vorhin hatte er mit einem fünfzigjährigen Mann, der seit fünfzehn Jahren im System hing, seinen Müsliriegel geteilt und lächelnd festgestellt, dass sie eine Gemeinsamkeit hatten: Sie wollten beide nicht in diesem Büro sein. Er hatte zurückgelächelt. Das war sein bisheriges Tageshighlight.
Noch zwölf Tage, dann durfte er zurück ins Paradies. An seinen normalen Schreibtisch. Dorthin, wo neben Irren, völlig Irren, zerbrochenen Existenzen, schuldlos Gescheiterten und all den anderen Perspektivlosen eben auch normale Menschen vorbeikamen. Menschen, die ihn nicht anbrüllten, anflehten, weinten oder durchdrehten, weil er ihnen die wenigen Bezüge wegnehmen musste. Seine Kollegen im Paradies hatten Wetten laufen, wann er sich krank melden und so dem Zwangsdienst entziehen würde. Eigentlich war das schon fast der einzige Grund, warum er noch immer hier saß.
Das – und die Tatsache, dass die Irren ja auch nichts dafür konnten. Wenn das Jobcenter und die Agentur für Arbeit schließen mussten, weil es nicht einmal mehr das Minimum an Leuten gab, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, würde es den Menschen noch schlechter gehen. Irgendjemand musste diesen Scheißkackjob machen, wie die Dame in Pink es so trefflich ausgedrückt hatte. Und: Er war in diesem Irrenhaus nicht der Arzt, sondern einer der Patienten. Die Ärzte waren die Politiker, und die ließen sich nie blicken. Oder na ja. Vielleicht war er auch ein Pfleger. Jedenfalls hatte er nicht wirklich was zu sagen und war gemeinsam mit den Kunden aufs Abstellgleis gesetzt.
Malte seufzte, schenkte sich die dritte Tasse Nordfriesentee ein und gab das Signal für den nächsten Kunden. Wenn das so weiterging, würde er womöglich noch rückfällig werden und Kaffee trinken. Dabei war er dieser Sucht gerade erst vor einem Jahr entkommen und hatte sich geschworen, nie wieder … Aber nun denn. Verzweifelte Zeiten.
Die Tür ging auf. Er schaute nur kurz hoch. Ein junger Typ, wohl ungefähr sein Alter, also Ende zwanzig. Brünette Wuschellocken, glatt rasiert. Schwarze Jeans, weiße Sneaker. Rote Winterjacke.
„Guten Tag, ich hab einen Termin“, sagte er im forschen Tonfall. Ein Neuling im System? Er hatte etwas Beschwingtes an sich. Wer jahrelang arbeitslos war, bewegte sich anders, sprach auch anders.
Malte begrüßte ihn freundlich und nahm die Unterlagen entgegen, die der Herr ihm reichte. Aha. Tatsächlich niegelnagelfrisch. Damit müsste er eigentlich zum Kollegen, der für ALG I zuständig war, und zwar für die Nachnamen mit den Buchstaben N-R. Für die Frischlinge, die noch Hoffnung hatten. Den gab es nicht mehr und der Stellvertreter war krank, darum musste Malte sich mit um ihn kümmern. Was von der Arbeitslast her schlicht unmöglich war und dennoch wurde es getan.
„Sie haben Ihre Anstellung selbst gekündigt?“, fragte er nach. „Und sind hergezogen aus … Oha, da sind Sie ja durch die halbe Republik gewechselt. Ihnen stehen erst einmal keine Bezüge zu.“ Glaubte er zumindest. Bei begründeten Umzügen konnte das auch schon mal anders aussehen, meinte er sich zu erinnern und zögerte. „Ich muss das beim Amtsleiter …“
„Das weiß ich“, fiel ihm der Mann ungeduldig ins Wort. „Ich werde auch nicht lange genug bleiben, damit mir irgendwas zustehen könnte. Ich will mich nur direkt arbeitssuchend melden.“
„Als Labortechniker hätten Sie jede Menge Chancen, auch kurzfristig unterzukommen. Die werden gesucht“, sagte Malte und begann schon einmal, eine Fallakte anzulegen. Eine Basis schaffen. Details wurden dann später geklärt.
„Ich suche aber nicht, denn ich bleibe höchstens drei, vier Wochen. Vielleicht auch fünf. Je nachdem, wie sich alles entwickelt.“
Neugierig blickte Malte zu ihm hoch. Das klang gestresst und irgendwie seltsam. Sein Kunde starrte zu Boden und wirkte nicht, als wollte er ihm sein Herz ausschütten.
„Ich werde Ihnen per Post Stellen zukommen lassen“, murmelte er und erwartete scharfen Protest. Immerhin hatte der Kunde klargemacht, dass er das weder wollte noch brauchte. Malte war allerdings vom System her dazu verpflichtet. Der Mann war Labortechniker. Labortechniker wurden gesucht. Ende der Diskussion.
Zum Glück schnaufte der Kunde bloß und schwieg ansonsten. Malte tippte fleißig. Vorname: Henry. Familienname: Padeken.
Irgendetwas daran war vertraut, darum stockte er und blickte erneut auf. Auch der Typ war ihm vertraut, stellte er fest und zermarterte sich das Hirn. Hm. Nordfriesentee war nett, schmierte die Windungen allerdings deutlich schlechter als Kaffee. Und nach einem endlosen Vormittag in der Irrenanstalt funktionierte das Denken sowieso nicht mehr.
„Henry Padeken“, murmelte er halblaut und sprach den Vornamen unwillkürlich englisch aus. Sofort klickte es. „O mein Gott – Henry! Henry Padeken! Das glaub ich jetzt nicht!“
Henry fuhr zusammen, als der Typ an seinem Schreibtisch plötzlich laut wurde. Zum ersten Mal sah er ihn an und nahm ihn als Menschen wahr, nicht bloß als anonyme Dienstleistungsmasse. Jung wirkte er. Extrem müde und gestresst. Dunkelblondes Haar stand in sämtliche Richtungen, als hätte er es sich einige Male zu häufig verzweifelt gerauft. Gepflegter kurzer Vollbart. Sehr groß und schlank. Graues Hemd, das ihm viel zu weit war. Irgendwas an ihm war vertraut.
„Henry! Ich bin’s, Malte!“ Der blonde Typ sprang auf. Und plötzlich machte es auch bei ihm „klick“ und es hielt ihn nicht mehr auf seinem Stuhl. Malte! Das konnte jetzt nicht wahr sein, oder? Von allen Menschen auf dieser Welt musste ausgerechnet Malte sein Sachbearbeiter sein? Sein ehemaliger Nachbar, mit dem er von seinem achten Lebensjahr an praktisch wie ein Bruder aufgewachsen war. Zwischen Panik, Fluchtgedanken und Verzweiflung kam in dieser gefühlten Ewigkeit, in der sie eine Schreibtischbreite voneinander getrennt still dastanden und sich lediglich anglotzten, auch so etwas wie Freude hoch.
Gut sah er aus, sein einstiger weltbester Kumpel. Über zehn Jahre war ihr letztes Treffen her. Danach war Henry in den Zug gestiegen, um sein Jurastudium zu beginnen, das er allerdings schneller abgebrochen hatte, als er „Zivilrecht“ hätte buchstabieren können. In diesen zehn Jahren hatte Malte sich von einem mageren, schlaksigen Jungen zu einem äußerst attraktiven Mann gemausert.
Ein Mann, der im Jobcenter arbeitete und definitiv gestresst und überfordert war. Ein zu weites Hemd trug. Und eine Jeans, die ihm zu kurz war. Komische Kombi.
„Was machst du denn hier?“, riefen sie beide gleichzeitig, stutzten und begannen zu lachen. Malte kam um den Schreibtisch herum und umarmte ihn brüderlich, wie er es früher auch schon immer getan hatte.
„Du bist auf Durchreise, Mann, ja?“, fragte er. „Wohnst du bei deinen Eltern?“
„Ich hab leider keine andere Wahl“, entgegnete Henry. Er war noch nicht im Haus gewesen, sondern direkt vom Bahnhof aus zum Amt gefahren, um seinen Termin nicht zu verpassen, den er kurzfristig ergattern konnte. Mit einem kleinen Umweg zum Autoverleih, wo er sich einen Mietwagen besorgt hatte. Darin befand sich noch sein gesamtes Gepäck. Drei Koffer, ein Rucksack, zwei Stoffbeutel. Darin hatte alles Platz, was er besaß, und das war definitiv beunruhigend. Nicht so beunruhigend wie die Tatsache, dass er freiwillig nach Hause zurückkehrte, denn ja, da würde ihn nichts Gutes erwarten.
„Dann werden wir uns in den nächsten Tagen begegnen.“ Malte verzog das Gesicht. „Musste auch wieder heim zu Mama. Längere Geschichte. O Mann! Ich hab mich ewig gefragt, was aus dir geworden ist. Ein Anwalt jedenfalls nicht.“
„Labor war nicht mein erster Wunschtraum. Oder überhaupt einer meiner Träume“, murmelte Henry. „Wie zur Hölle bist du denn jetzt bei der Stadtverwaltung gelandet? Wollte da nicht jemand in die Musikbranche?“
„Leider ist dies die reale Welt, das reale Leben und das Motto lautet nicht Wünsch dir was“, brummte Malte. „Also nein, Musikbranche ist komplett vom Tisch. Hab auch schon seit Jahren keinen DJ mehr gemacht.“
Sie waren gemeinsam in der Tanzschule gewesen. Malte konnte beim Tanzen keinen Takt halten, nicht mal, um sein Leben zu retten. Dafür hatte er die Musikanlage an sich gerissen und sogar bei Wettbewerben aufgelegt, und später auch bei einigen Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstagen.
„Okay, wir müssen uns ranhalten“, murmelte er und kehrte an seinen Platz zurück. „In der Vergangenheit schwelgen können wir dann ein anderes Mal. Wir werden uns zwangsläufig sehen.“ Henry brannte darauf zu erfahren, wieso Malte ebenfalls gegen seinen Willen wieder zurück nach Hause ziehen musste. Es würde ihn von seiner eigenen Misserfolgsgeschichte ablenken, und Ablenkung war definitiv gut. „Schauen wir mal … Hast du schon einen neuen festen Wohnsitz in Aussicht, wenn du sagst, dass du hier bloß ein paar Wochen bleiben willst? Dann könnte ich dir helfen, dort eine Festanstellung zu finden. Macht auch nichts, wenn es ein anderes Bundesland sein sollte.“
Henry sackte ein wenig in dem schwarzen Besucherstuhl zusammen. Der war erstaunlich bequem, sogar gepolstert und mit unempfindlichem Stoff bezogen.
„Ich hab noch keinen Plan“, gestand er niedergedrückt. „Ich bin ziemlich fluchtartig aus Bayern weg, und ich weiß nicht, wohin die Reise als nächstes gehen soll. Hier bleibe ich auf keinen Fall, das ist klar. Sonst weiß ich noch gar nichts.“
„Okay … Pass auf, ich bin zwar nur aushilfsweise auf diesem Posten, aber ich kann dir ein bisschen den Rücken freihalten. Wir hocken uns heute Abend mal zusammen und quatschen, ja? Du hast anscheinend ungutes Zeug erlebt und Stress mit dem Amt würde alles nur noch viel schlimmer machen. Wenn du dein Leben erst einmal komplett neu planen musst … Brauchst du soziale Unterstützung? Vielleicht kann ich bei der Sperre für die Bezüge was erreichen.“
„Nein. Ich hab einiges gespart und du kennst meine Eltern, sie werden mich durchfüttern und hätscheln, bis ich um Gnade flehe. Ich komm klar und ja, wie und wohin es weitergeht, muss ich erst mal schauen.“
„Okay.“ Malte musterte ihn besorgt und begann dann zu tippen. Er stellte Sachfragen bezüglich Ausbildung, Auslandspraktika, alter Arbeitgeber. Einfache Dinge, auf die es einfache Antworten gab. Der große Rest in Henrys Leben war gerade das getreue Gegenteil von einfach. Und auf die meisten Fragen wusste er gar keine Antwort. Da tat es seltsam gut, hier zu sitzen.
Draußen vor der Tür wurde es plötzlich laut. Ein Mann schrie irgendetwas in einer fremden Sprache. Eine Frauenstimme mischte sich ein. Gleich mehrere Kinder heulten. Malte reagierte darauf nicht einmal mit einem Augenbrauenzucken, darum blieb auch Henry entspannt. Nach einigen Minuten kam eine sonore Männerstimme dazu, die erst auf Deutsch, dann auf Englisch zu wissen verlangte, was los war. Der Ordnungsdienst funktionierte jedenfalls, wie es schien.
„Einfach ignorieren“, brummte Malte, druckte einige Dokumente aus und legte Henry etwas vor, was er blind unterzeichnete. Es waren irgendwelche Freigaben für irgendwelche Informationen. Interessierte ihn alles nicht.
Wenige Minuten später stand er wieder im Flur. Grauer Linoleumboden. Abgeschlossene Fenster. Stuhlreihen voller Menschen in Winterkleidung, mit Dokumenten und Ordnern und Mappen in den Händen. Jeder von ihnen hatte diesen vollkommen leeren Gesichtsausdruck, den Leute im Standby-Modus bekamen, wenn man am Bahnhof, beim Arzt oder eben auf dem Amt stundenlang warten musste. Keine Müdigkeit oder Langeweile, sondern schlicht blanke Leere. Mehrere Schwangere waren hier. Frauen und Männer mit kleinen Kindern im Arm, auf dem Schoß, im Kinderwagen. Ein junges Mädchen, das keinesfalls älter als siebzehn sein konnte, schob einem vielleicht zweijährigen Kleinkind Apfelstücke in den Mund. Hoffentlich war das ihr Bruder. Auch ältere Leute saßen herum, starrten ins Nichts oder auf ihre Handys, was in etwa das Gleiche war.
Henry seufzte innerlich. Er war jetzt einer von ihnen. Und er hatte wirklich nicht die geringste Ahnung, wie es für ihn weitergehen sollte. Verdammt! So hatte er sich sein Leben echt nicht vorgestellt.
„Bist du’s, Malte?“
Seine Mama. Natürlich hatte sie gehört, wie er sich ins Haus zu schleichen versuchte. Die Frau hatte auch mit Ende Fünfzig noch Ohren wie ein Luchs. Sie walzte durch die offene Küchentür, jeder Zoll von ihr prächtig. Nur um einen halben Zentimeter hatte sie die vollen zwei Meter verpasst und auch sonst war an ihr nichts zierlich, zart oder püppchenhaft. Sie trug wie meistens eine Jeanslatzhose und Holzfällerhemd – Mode war ihrer Meinung nach für andere, für sie selbst genügte „funktional und wärmend“.
„Na, müde?“, fragte sie lächelnd. „Bist heute früher fertig, ja?“
„Ich hatte heute schon um fünf Uhr angefangen. Sollen wir zwar nicht, aber dann bekomme ich wenigstens Schriftkram geschafft, bevor der Wahnsinn losgeht. Eine richtige Pause hatte ich nicht. Da kann man auch mal um 16.00 Uhr den Stift fallen lassen, finde ich.“ Zumal er gleich eine Verabredung hatte. Um sieben wollte er rübergehen, um Henry zu treffen.
„Du bist bekloppt, Sohn“, stellte Hans fest. Der war nicht sein Erzeuger, sondern der dritte Mann, den seine Mutter geheiratet hatte. Hans nannte ihn trotzdem seinen Sohn, genau wie Philipp und Bianca. Das waren Maltes Halbgeschwister, die von Mann Nummer zwei stammten. Hans war geblieben, hatte Michelle und Lisa aus seiner eigenen gescheiterten Ehe mitgebracht und noch Mia gezeugt. Maltes jüngste Schwester war knapp vierzehn und aktuell altersbedingt out of order. Schwerer Superzickenalarm.
„Danke, Paps“, brummte Malte.
„Gerne doch. Echt, um fünf Uhr im Amt sitzen, das dankt dir kein Mensch. Die Stunden kannst du nicht mal anschreiben lassen, oder?“
„Lass gut sein. Ich will duschen. Und essen. Ich laufe auf einem halben Müsliriegel und sechs Tassen Tee.“
„Duschen kannste vergessen.“ Philipp kam vorbeigehuscht. Sie standen im großen Hausflur, hier kreuzten sich sämtliche Wege des Hauses. Sein jüngerer Bruder studierte Journalismus und wohnte weiterhin daheim, um Geld zu sparen. „Michelle hat das Bad oben besetzt, Mia das untere und selbst das Gästebad nutzt dir nichts, da pudert Lisa ihr Näschen. Die drei wollen gleich ins Kino. Bianca ist bei ihrem Freund.“
Dienstag war der Eintritt ermäßigt, das ergab also Sinn. Wahrscheinlich irgendein Romantikgedöns, das die Mädels gleichermaßen ansprach, trotz der acht Jahre, die zwischen Mia als Jüngste und Michelle als Älteste lagen. Zumindest wenn man Bianca außen vorließ, die drei Jahre jünger als Malte war und eigentlich bei ihrem Freund Karim lebte. Karim war ein Deutsch-Türke mit modern-westlichen Ansichten, der vor Kurzem seinen Job als Fachverkäufer in einem Möbelhaus verloren hatte, das in Konkurs gehen musste. Da Bianca noch in ihrem BWL-Studium steckte, wenn auch auf den Zielgeraden zum Master, konnten die beiden ihre Wohnung nicht halten und mussten beide wieder nach Hause ziehen. Das würde sich hoffentlich bald ändern, Karim gab alles, um anderweitig unterzukommen und Bianca hatte bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche, sobald ihr Studium abgeschlossen war.
Malte seufzte schicksalsmüde. Er wusste nun wieder, warum er niemals mehr zurück zu seinen Eltern ziehen wollte. Hier menschelte es einfach viel zu sehr. Schlecht für die Nerven, wenn man bereits den ganzen Tag auf der Arbeit mit zu vielen anstrengenden Leuten konfrontiert war.
„Essen?“, fragte er ohne viel Hoffnung. Seine Mutter führte ein straffes Regiment, gekocht wurde nur einmal am Tag. Wer zum Mittagessen nicht da war, musste sich abends selbst irgendwie versorgen.
„Die Küche ist frei“, informierte sie ihn erwartungsgemäß.
„Mama! Hier sind keine Handtücher mehr!“, brüllte Mia in diesem Moment durch die Badezimmertür.
„Mama! Ich hab kein warmes Wasser!“, kam es von Lisa.
„Mama! Jemand hat den Fön schon wieder geklaut!“ Klar, wenn die anderen rumnölten, konnte Michelle unmöglich stillbleiben.
„Was hast du?“, fragte Maltes Mutter und schaute Philipp drohend an. Der lächelte, heiter wie immer. Philipp war ihr Sonnenschein, er war von klein an eine Frohnatur gewesen. Warum er sich für einen Beruf entschieden hatte, der wie geschaffen dafür war, jegliche Illusion über das Gute im Menschen zu verlieren, blieb sein Geheimnis.
„Ich hab dir eine Mail geschickt, du musst gleich mal auf meinen Text schauen, ob ich den so einreichen kann.“ Philipp war gelegentlich unsicher, ob er den richtigen Ton für sein Thema traf, und neigte dann dazu, sämtlichen Leuten in seiner Umgebung auf die Nerven zu gehen, damit die „nur mal kurz draufschauen“ sollten.
„MAMA! HANDTUCH!“
„Fein. Text hat Zeit. Malte, geh dir was kochen. Oder bettle deinen Paps an, dass er dir Spiegeleier braten soll. Ich rette erst einmal Mia und dann den Rest der Bande.“ Seine Mutter stampfte in Richtung Waschkeller davon, um Handtücher zu holen. Sie arbeitete vormittags als Erzieherin in einer Einrichtung für behinderte Kinder und organisierte den Rest des Tages dieses Haus. Ihre Schultern waren breit, dementsprechend konnte sie eine Menge Last tragen. Das war sicherlich von Vorteil.
Malte versuchte den Dackelblick, wovon Hans sich tatsächlich erweichen ließ.
„Na komm, Sohn. Schmeiß dich auf die Couch, ich bring dir gleich was Gutes. Wir haben noch einen Rest Reis, den brate ich dir mit Tiefkühlgemüse und zwei Eiern durch, ja? Bisschen Feta und Kirschtomaten dazu?“
„Du bist der Beste.“ Malte klopfte seinem Drittpapa, wie er ihn auch manchmal nannte, dankbar auf die Schulter. Etwas essen, durchschnaufen, ein kurzes Nickerchen, das Geschrei seiner Schwestern ignorieren. Oh, und den Handyalarm einstellen, damit er seine Verabredung nicht verpasste.
„Weiß ich doch. Also dass ich der Beste bin. Wusstest du, dass Henry wieder zu Hause eingezogen ist? Du weißt schon, der von nebenan.“
„Weiß ich“, brummte Malte. „Bin ihm heute begegnet.“
„Auf der Arbeit?“
„Wo sonst? Wenn man heimat- und arbeitslos ist, meldet man sich üblicherweise beim entsprechenden Amt. Ich treffe mich heute Abend mit ihm.“ Malte schlurfte in Richtung Wohnzimmer, ihm wurde Mias Geheule, dass sie jetzt sofort ein Handtuch brauche, allmählich zu laut. Auch Hans verzog sich in Richtung Küche, ohne weitere Fragen zu stellen. Er war eben der Beste. Und zudem der Einzige, der geblieben war. Allein dafür verdiente der Mann einen Orden.
„MAMMAAAAA!“
Er hingegen hatte seine Couch verdient. Zu viele Irre auf dieser Welt. Ihn selbst eingeschlossen. Immerhin wohnte er jetzt freiwillig wieder im Zentrum des Wahnsinns.
Henry schreckte hoch. Er war tatsächlich eingeschlafen! Verdammt, wie spät war es? Und wo war er hier? Er fiel fast aus dem Bett in dem Bemühen, sich zu orientieren und einen Lichtschalter zu finden. Noch bevor er die Nachttischlampe gefunden hatte, kehrten die Erinnerungen zurück.
Er war zu Hause. Im Haus seiner Familie. Nachdem er wochenlang quasi gar nicht geschlafen und eine höllisch anstrengende und unbequeme Zugfahrt sowie den Besuch bei der Arbeitsagentur hinter sich gebracht hatte, war die Begrüßung daheim ziemlich knapp ausgefallen. Ein Blick in sein verquollenes Gesicht, das praktisch nur noch aus Augenringen bestand, und seine Mutter hatte ihn ins Bett gesteckt wie einen kleinen dreijährigen Jungen.
Stockdunkel war es bloß, weil die Jalousien unten waren, wie ihm ein Blick aufs Handy verriet, denn es war erst fünf Uhr nachmittags. Somit hatte er kaum zweieinhalb Stunden geschlafen. Zu wenig, um wirklich ausgeruht zu sein, zu viel für ein Nickerchen, aus dem man erholt aufstand.
Henry streckte sich, rieb sich das schmerzende Gesicht, versuchte vergeblich, das wattige Gefühl aus seinem Kopf zu massieren. Eine Dusche war nötig. Erst mal heiß zum Sauber-, dann kalt zum Wachwerden. Und danach Kaffee. Viel, viel Kaffee. Anschließend was essen. Seine Familie würde mit ihm reden wollen. Daran führte wirklich kein Weg vorbei. Er konnte sie schon hören, und das recht laut. Die Zwillinge brüllten sich auf Französisch an und Aarón hielt auf Spanisch dagegen. Das Baby brüllte aus Sympathie mit. Und zack! Schon fühlte man sich wie damals mit sechzehn, als man vom Auszug und der Flucht in die eigene Wohnung nur selig träumen konnte. Henry quälte sich lächelnd auf die Beine. Home sweet home. Egal wie sehr man es hasste, man musste es einfach lieben.
Jetzt aber erst mal die Dusche. Vorausgesetzt, er fand ein freies Bad.
„Hey, Malte!“ Steffi umarmte ihn wie einen lang verlorenen Sohn. Dabei sahen sie sich durchaus regelmäßig, schließlich wohnte sie direkt neben seinen Eltern. Nun gut, meist blieb es bei einem freundlichen Gruß aus der Ferne. Es war zehn Jahre her, dass er ihr Haus zuletzt betreten hatte.
Verändert hatte sich wenig. Klar, die Tapete war anders, einige Möbel auch. Der riesige Kaktus, der früher immer im Treppenhaus gestanden hatte, war verschwunden und durch eine kleine Zimmerpalme ersetzt worden. Steffi war gealtert, und trotzdem trug sie das Baby des Monats noch genauso fröhlich und liebevoll wie früher.
„Baby des Monats“ war ein etwas bösartiger Running Gag. Steffi und ihr Mann Robert nahmen in unregelmäßigen Abständen Pflegekinder zu sich. Meistens waren es Säuglinge von drogensüchtigen, alkoholkranken oder psychisch labilen Müttern. Diese Kinder blieben meistens nur zwei, drei Wochen, in seltenen Fällen länger als ein paar Monate. In dieser Zeit schrien sie für gewöhnlich bis zu zwanzig Stunden am Tag, weil sie häufig genug unter Entzugserscheinungen von den Substanzen zu leiden hatten, die sie während der Schwangerschaft und manchmal auch noch anschließend mit der Muttermilch aufgenommen hatten. Dazu kam die Trennung von der Mutter, riesige Paletten an gesundheitlichen Störungen, nicht selten Traumata durch Misshandlungen.
Niemand merkte sich die Namen dieser Kleinchen, Steffi und Robert natürlich ausgenommen. Sich emotional an sie zu binden wäre fatal, da sie allesamt binnen kürzester Zeit wieder verschwanden. Für Steffi war es Lebenszweck und Erfüllung. Sie ging vollkommen darin auf, diese Babys zu lieben, zu hätscheln und sich von ihnen anschreien zu lassen. Da sie keine eigenen Kinder bekommen konnte, hatten sie und Robert diejenigen, die eben nicht nach einigen Monaten fortgeholt worden waren, allesamt adoptiert. Henry war einer der Ältesten, er stammte von einer englischen Familie, die nach Deutschland übergesiedelt war, und war als Achtjähriger zu den beiden gekommen. Kein schwer traumatisiertes Drogenkind, sondern eine Vollwaise nach einem Autounfall. Die Zwillinge Jean-Pierre und Amaury waren zwanzig. Vor sechzehn Jahren waren sie bei Nacht und Nebel vom Sozialdienst gebracht worden. Beide litten an einer Erbkrankheit, die zu Knochendeformierungen und Organproblemen führten. Die leiblichen Eltern hatten sich außerstande gesehen, für die Jungen zu sorgen und sie erst einmal in Obhut und schließlich zur Adoption freigegeben. Der Vater hielt noch halbwegs regelmäßig Kontakt, die Mutter war mittlerweile anscheinend selbst verstorben. Aarón war portugiesisch-spanischer Abstammung. Seine Mutter war als Krankenschwester hergekommen, alleinerziehend, ohne familiäre Kontakte. Er war bereits zehn, als sie Selbstmord beging. Das war knapp zwölf Jahre her. Für ihn war es schwer gewesen, sich in die bunte, laute Familie einzufinden und er haderte am meisten von allen. Aktuell hatte er die dritte Ausbildung abgebrochen und weigerte sich, Therapie- oder sonstige Maßnahmen anzunehmen, die ihm angeboten wurden. Bereits ausgezogen war dafür Fabienne, mittlerweile zweiunddreißig, verheiratet, zweifache Mutter; Diley befand sich als Au-Pair in Griechenland und Lukas seit Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung. Liebe allein reichte leider nicht aus, um sie alle retten zu können …
„Hach, so schön, dich mal wieder bei uns zu haben. Komm rein! Henry sitzt in seinem Zimmer. Er hat sich gerade eben mit den Zwillingen gekracht, die seinetwegen aufrücken mussten.“ Klar – Henry war vor Jahren ausgezogen und nun mussten die jüngeren Geschwister den vorhandenen Platz mit ihm teilen. In der Beziehung hatte Malte Glück, für ihn war niemand vertrieben worden und der kleine Raum neben der Waschküche gehörte ganz ihm. Okay, ein Feldbett war nicht der Wunschtraum eines Orthopäden, sein Rücken hasste ihn bereits nach den eineinhalb Wochen, die er auf dem quietschenden Ding zugebracht hatte. Außerdem lief die Waschmaschine gefühlt Tag und Nacht. Mittlerweile hatte er sich an das gleichmäßige Brummen gewöhnt und fand es sogar recht beruhigend. Vielleicht war es trotzdem zu viel, hier von „Glück“ zu reden.
„Aufrücken bedeutet, dass sie das Mädelszimmer übernehmen müssen“, brummte Steffi. „Ja, ich hab einen Arbeitsraum daraus gemacht. Trotzdem stellen die sich echt an!“
Malte klopfte an die Tür. Damals war diese mit Aufklebern übersät gewesen, Sammelsticker verschiedenster Art. Die waren spurlos verschwunden, offenbar hatte Robert die Tür abgeschliffen und neu gestrichen, denn sie präsentierte sich in makellosem Weiß.
„Komm rein!“, erklang die vertraute Stimme von innen. Früher hatte Henry meist auf Englisch geflucht, weil er davon ausgegangen war, dass eines seiner Geschwister anklopfte. Damals hatten sie sich allerdings auch nie mit genauer Uhrzeit verabredet, sondern waren einfach vorbeigekommen, wenn es passte. Seltsam gehemmt öffnete Malte die Tür. So viele Jahre waren vergangen. So vieles hatte sich geändert, so vieles war gleich geblieben. Es überforderte ihn gerade ein bisschen.
„Hi.“ Henry saß auf dem Bett rechts im Raum, der überhaupt kein bisschen mehr wie sein altes Reich eingerichtet war. Die Zwillinge hatten sich hier ausgebreitet und warteten vermutlich sehnsüchtig darauf, dass Henry möglichst schnell wieder abzog.
„Hi.“ Malte setzte sich auf einen der beiden Schreibtischstühle. „Das Ganze ist seltsam, oder?“, platzte er heraus. Henry grinste müde.
„Seltsam ist noch zu wenig gesagt“, brummte er. „Absurd würde es eher treffen. Erst einmal sorry, ich habe mich nie gemeldet. Obwohl ich es versprochen hatte. Das tut mir ehrlich leid.“
„Muss es nicht. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Du warst ausgezogen, um ein völlig neues Leben zu beginnen, und ich war nun einmal Teil des alten Lebens. Ich verstehe das. Außerdem hätte ich ebenfalls versuchen können, Kontakt mit dir aufzunehmen. Das Internet gibt es ja nicht erst seit gestern.“
Er hatte oft an Henry gedacht. Anfangs praktisch täglich, und später immer mal wieder. Wenn er jemandem mit englischem Akzent reden hörte, obwohl er bei Henry kaum wahrnehmbar war. Wenn er einen Mann mit brünetten Wuschellocken sah. Wenn er bestimmte Songs hörte oder in Situationen geriet, die Erinnerungen triggerten. Gefragt hatte er sich häufig, was sein alter Jugendfreund wohl so machte. Da er wusste, es ging ihm gut – seine Mutter hätte es ihm sofort berichtet, wäre es anders – war er nie der Versuchung nachgegangen, ihn in den sozialen Medien zu suchen.
„Hast schon recht. Trotzdem. Wir waren so verdammt gute Freunde damals. Es tut mir wirklich leid. Du hast in meinem Leben gefehlt. Das wird mir gerade erst wieder bewusst.“ Henry lächelte warm, auf diese ehrliche, strahlende Henry-Art – und weckte damit etwas, das Malte tatsächlich verdrängt hatte. Jahrelang hatte er für Henry geschwärmt. Auf unschuldige Weise, als er irgendwann mit zwölf, dreizehn begriff, dass er Mädchen doof fand. Da war nie Hoffnung gewesen, seine Schwärmerei könnte erwidert werden. Es war nie über dieses unschuldige Sehnen hinausgegangen.
„Ich bin ein Stoffeltier. Willst du etwas trinken? Essen? Kann ich dir was anbieten?“, fragte Henry plötzlich steif.
„Alles gut, Mann. Wann bist du so erwachsen geworden?“ Malte versuchte, es locker klingen zu lassen, doch Henrys Gesicht verzog sich und er wirkte deutlich angespannt.
„Ist einiges passiert in den letzten Jahren. Mittlerweile stehe ich ziemlich allein in der Welt, muss ich leider sagen … Außer meiner Familie natürlich. Auf die kann ich mich immer verlassen, was schon gut ist. Auch wenn die Zwillinge mich auf Französisch verfluchen, allein dafür, dass ich mich hier reingequetscht habe. Ich hätte auch das Mädchenzimmer genommen, meine Mom wollte das nicht. Vielleicht aus Angst, dass ich sofort wieder ausziehe und mir ein Hotel nehme. Und jetzt blöken die zwei mich die ganze Zeit französisch an.“
„Das klingt so niedlich.“ Malte unterdrückte ein Glucksen. „Ich kenne keine andere Sprache, wo man die wüstesten Perversitäten rauslassen kann und es trotzdem nach liebevollem Kompliment klingt.“
Es polterte auf der Treppe. Drei Sekunden später rappelte es an der Tür und einer der Zwillinge stürmte hinein, als hätte er den Kommentar zuvor belauscht. Früher konnte Malte sie mühelos unterscheiden, heute schaffte er das nicht mehr – er sah sie zu selten. Sie waren beide ziemlich klein geraten, dunkelhaarig, blass. Zudem bewegten sie sich seltsam, Folge von Knochendeformationen, gutartigen Tumoren in Haut, Muskeln und Bindegewebe, die operativ entfernt werden mussten, was breitflächiges Narbengewebe, Schmerzen und Bewegungsstörungen zur Folge hatte. Sie litten an Herzschwäche, ihre Nieren und Lungen waren von Krankheit und Chemotherapien angegriffen, die Leber ziemlich kaputt. Nicht einmal eine liebende Mutter würde die zwei als hübsch bezeichnen mit ihren entstellten Gesichtern. Das änderte nichts an ihrem Trotz, ihrem Willen, es mit dem Leben aufzunehmen, an ihrer Intelligenz.
„Yo, frérot, quoi de neuf?“, fragte er Malte und nickte ihm freundlich und äußerst friedlich zu, während er seinem Bruder einen raschen, angegifteten Blick schenkte.
„Hey, Bro, alles beim Alten, es gibt nichts Neues“, entgegnete Malte. Sein Französisch war eingerostet, aber dafür reichte es noch. Es war eine Besonderheit in diesem Haus, dass die Geschwister sich untereinander in ihren jeweiligen Muttersprachen unterhielten, gerne wild gemischt mit Deutsch oder anderen Sprachen. Wie es halt gerade kam. Jeder von ihnen beherrschte absolut fließend und akzentfrei Deutsch und sie beschränkten die babylonische Sprachverwirrung auf den Kontakt untereinander. Das allein hatte früher für einige Konflikte gesorgt, weil jeder blind davon ausging, dass es sich um eine fiese Beleidigung handeln musste, wenn er sein Gegenüber nicht verstand.
„Muss nur was holen, bin sofort wieder weg“, brummte der Zwilling.