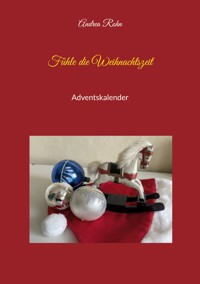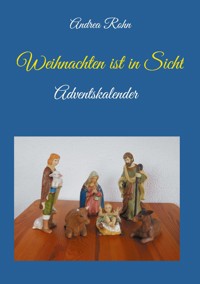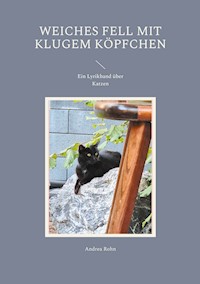Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit Februar erlebt Katharina immer wieder im Traum Szenen aus ihren früheren Leben. Zudem meistert sie bereits seit Jahren ihren Alltag mit einer seltenen chronischen Erkrankung. Doch sie ist dank ihrer Mutter und ihrer Schwester Melissa damit nicht allein. Joachim Degenschwinger findet in seinem Antiquariat zwei Bücher aus dem 16. Jahrhundert, in dem die Autorin, Freifrau Maria Katharina Margaretha von Roden, abgebildet ist. Sie sieht Katharina zum Verwechseln ähnlich. Durch ihre gemeinsame Leidenschaft werden der Antiquar und Katharina Freunde. Seine Verbindungen reichen bis nach Japan, wo weitere Bücher der Freifrau auftauchen. Kann Katharina einen Zusammenhang zwischen ihren früheren Leben und den Schriftwerken der Freifrau von Roden herstellen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte der Verarbeitung vorbehalten, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige heute bekannten und zukünftigen Kommunikationsmittel, fotomechanische und vertonte Wiedergabe, sowie des auszugsweisen Nachdrucks.
Titelfoto: Andrea Rohn Lektorat: Ursula Reppmann-Wörsdörfer
Inhaltsverzeichnis
Personenverzeichnis
Gedicht „Frühere Leben“
01. Kapitel: „1247 – Omnia pro Templi“
02. Kapitel: Das geheime Buch
03. Kapitel: „1436 – Der Geheimbund“
04. Kapitel: „Gerodet ist mein Lebenswald“
05. Kapitel: Wie wir die Rückführungen angingen
06. Kapitel: „1180 – Gleichgeschlechtliche Liebe im Kloster“ und eine nervige Studentin
07. Kapitel: „1098 – Der Heiler“ und einige Überraschungen
08. Kapitel: Ein unerwarteter Fund
09. Kapitel: Der Preis meiner Gesundheit und eine frohe Nachricht
10. Kapitel: Abgrenzung im Gestern und Heute
11. Kapitel: Rekonstruktion der ersten Seiten
12. Kapitel: Geburt der „Lückenfüller
13. Kapitel: Ein anderes Ende
14. Kapitel: Ein professioneller Film und ein Abschied
15. Kapitel: „1717 – Verlorene Liebe“
Dank
Über die Autorin
Bereits erschienen
Vorschau
Für alle, die an sich selbst glauben und für die, welche an sich zweifeln
Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern, dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur.
Jean Paul, dt. Schriftsteller (1763-1825)
Personenverzeichnis
Die Familie
Katharina Wokewem
eine junge, kranke Frau, die ihr Leben meistert und Rückführungen erlebt
Carina Wokewem
Katharinas und Melissas Mutter
Melissa Wokewem
Katharinas Schwester
Maria Katharina Margaretha
Freiherrin von Roden
Autorin, Vorfahrin von Carinas Familie
Die Freunde
Joachim Marius Degenschwinger
Antiquar, Freund der Damen Wokewem und Lebenspartner von Tassilo
Tassilo Degenschwinger
Musikproduzent und Manager, Freund der Damen Wokewem, Lebenspartner von Joachim
Tama Raku
(Juwel der Freude)
Historikerin, Freundin der Familien Degenschwinger und Wokewem und Ehefrau von Sunishi Chosin
Die Geschäftspartner
Sunishi Chosin
(Günstling)
Buchrestaurator, Freund u. Geschäftspartner von Joachim Degenschwinger, Ehemann von Tama Raku
Kiniko Ichigon
(Wort)
Buchhändler, Freund u. Geschäftspartner von Joachim Degenschwinger, Onkel von Tama Raku
Sonstige Personen
Ulrike Weihrich
Studentin, Bekannte von Melissa
Mareike
Mitglied im Mittelalterverein, sehr gute Kamerafrau
Frühere Leben
Bereits vor mehr als tausend Jahren, da lebte meine Seele schon. In vielen Leibern hat erfahren sie eine neue Lektion.
Mal wuchs heran sie als ein Knabe, der nie das Mannesalter sah. Mal nutzte aus sie eine Gabe, die sorgte dann für den Eklat.
Sie wohnte in ‘nem starken Weibe, das sich gerächt für schlimme Schmach. Ihr Quäler selbst erfuhr am Leibe, wie Feuer seinen Willen brach.
Sie hat erlebt von beiden Seiten, wie Eifersucht den Tod gebracht! Sie durfte als ein Ritter reiten, der seinem Orden Schand‘ gemacht.
Sie lernte auch die Liebe kennen, mal zu ‘nem Mann, mal zu ‘ner Frau. Doch immer musste sie sich trennen, weil Glauben sie zwang zu ‘nem „Ciao“.
Sie reiste über Land und Meere, war selbst in Nordamerika. Dort verband sie sich in Ehre mit ‘nem „Native“ aus USA.
Heut‘ lernt Geduld sie aufzubringen, wenn Krankheit ihre Zeit bestimmt. Nur Geist darf tanzen oder springen, weil das auch meine Seele trimmt.
Was alles meine Seel‘ erlebt, das würd‘ zu weit wohl führen. Zu hoffen, dass sie sich einst erhebt, will mich zu Tränen rühren.
1. Kapitel: 1247 – Omnia pro Templi
Rückführung: Mittwoch, 30.04.2008
1247. Als jüngster Sohn eines französischen Landadligen konnte ich nicht damit rechnen, den Besitz zu erben, zumal meine Brüder alle bereits das Mannesalter erreicht hatten.
Ich selbst war nun sechzehn Jahre alt, und mein Vater hatte beschlossen, dass ich mein weiteres Leben in einem Kloster verbringen sollte. Ganz abgeneigt war ich von dieser Vorstellung nicht. Ja, ich hatte mich sogar mit dem Gedanken getragen, freiwillig einer Ordensgemeinschaft beizutreten, da ich von meiner frommen Mutter in ihrem Sinne erzogen worden war. Am Kampf hatte ich, im Gegensatz zu meinen Brüdern, noch nie Gefallen gefunden. So hätte die Entscheidung meines Vaters bei mir im Grunde genommen zu einem Freudenausbruch führen müssen, wenn ... ja, wenn dieser Druck seinerseits nicht gewesen wäre. Hätte er mir den Vorschlag unterbreitet, hätte ich sofort und ohne zu murren zugestimmt. Doch mit Zwang, nein, da regte sich Widerstand in mir.
Dennoch war der Tag gekommen, als ich von einem Klosterbruder abgeholt wurde. Er selbst wartete, sein Maultier am Zügel haltend, etwas abseits von uns im Hof unserer Burg. In Wahrheit war es eine kleine Befestigung, die den hochtrabenden Namen »Burg« nicht im Mindesten verdiente.
Mutter und Vater standen nebeneinander vor mir, um mich zu verabschieden. Während Mama die Tränen über die Wangen liefen, sah mein Vater mich nur streng und missbilligend an. Ich hatte mich partout geweigert, schon jetzt meine Kleidung gegen eine Kutte zu tauschen. Deshalb hatte es eine hitzige Debatte gegeben, die Mama mit ihrer ruhigen Art für mich entschieden hatte.
So stand ich also, den Zügel meines Pferdes in einer Hand, recht verlassen da. Auf meinem Kopf schien ein riesiger Felsbrocken zu liegen, der mir das Gefühl vermittelte, mich immer kleiner werden zu lassen. Mittlerweile hatte ich mich schon in mein Schicksal ergeben, doch der Blick meines Vaters ließ in mir eine kleine Flamme des Widerstandes aufflackern. Ich konnte gar nicht mehr anders, als ihm zum Abschied noch einmal meine Meinung zu sagen.
„Wenn Ihr mir den Vorschlag gemacht hättet, anstatt einfach über mein Leben zu bestimmen, hätte ich mit Freuden zugestimmt. Warum schiebt Ihr mich einfach ab?“, schrie ich ihn an. „Ich will nicht! Nein, ich will nicht!“
Statt einer Antwort erhielt ich einen kräftigen Schlag ins Gesicht, der meine rechte Wange noch lange brennen ließ. Gleichzeitig mit meiner Wut wuchs die Flamme in mir, doch ich wusste auch, dass ich hier nichts sagen oder tun konnte, um die Einstellung meines Vaters zu ändern.
So wandte ich mich meiner über alles geliebten Mutter zu. So bald ich ihr in die Augen sah, war meine Wut wie weggefegt. Mit Tränen in den Augen umarmte ich sie und sagte zu ihr: „Wir werden uns bald wiedersehen, Mama!“ Als ich mich von ihr gelöst hatte, nutzte ich den Augenblick aus, indem mein Vater zu dem Mönch hinüberblickte. Ich blinzelte ihr mit einem Auge verschwörerisch zu und lächelte sie siegessicher an. In mir war nämlich soeben ein Plan gereift, wie ich dem, von meinem Vater vorherbestimmten Leben entkommen konnte und was ich stattdessen mit dieser Freiheit anfangen wollte.
Nachdem der Blick meines Vaters sich wieder auf mich richtete, stieg ich in den Sattel und ritt, meiner Mutter ein letztes Mal zuwinkend, hinter dem Mönch her zum Tor hinaus.
Unterwegs jammerte der Klosterbruder mir vor, dass er nur sehr selten im Sattel sitzen würde und wir infolgedessen nur langsam reiten könnten. Somit würden wir mehrere Stunden unterwegs sein, bis wir unser Ziel, sein Heimatkloster, erreichten.
Mir kam seine Eröffnung ganz recht, denn im Gegensatz zu ihm, war ich ein guter Reiter und diesen Vorteil gedachte ich auch auszunutzen.
Kurz darauf ritten wir, dem Karrenweg folgend, in den Wald hinein. Und hier nutzte ich nicht nur diese Chance, sondern auch meine Ortskenntnis. Bei der ersten Gelegenheit lenkte ich mein Pferd auf einen schmalen Pfad und verschwand, so schnell es der Zustand des Weges erlaubte, im dichten Gehölz. Der Mönch machte gar nicht erst den Versuch, mir zu folgen. Ich war auch ganz froh darum, denn so musste ich mir keine Gedanken um seinen Verbleib machen.
Zunächst hatte ich mir vorgenommen, mich für einige Tage im Wald zu verstecken und dann die nächste Stadt aufzusuchen. Dort würde sich, so dachte ich mir, schon eine Gelegenheit ergeben, mir meinen Unterhalt zu verdienen und mir zu überlegen, was ich mit meinem Leben anfangen könnte. Aber es sollte ganz anders kommen. Die Stadt sollte ich nie erreichen.
Es war bereits dunkel, als mich der Geruch von gebratenem Fleisch anlockte. Mein Magen knurrte bedenklich und erinnerte mich daran, dass ich seit dem Aufbruch am frühen Morgen nichts mehr gegessen hatte.
Naiv, wie ich nun einmal mit meinen sechzehn Jahren noch war, folgte ich, mein Pferd am Zügel führend, dem immer intensiver werdenden Bratengeruch, bis ich durch die Zweige den Schein eines Feuers schimmern sah und Männer sprechen hörte.
Im selben Augenblick wurde ich von einem Mann überrascht, der plötzlich neben mir aus dem dunklen Gebüsch trat. Erschrocken fuhr ich zusammen, was wohl mehr daran lag, dass ich nicht mit einer Wache gerechnet hatte, als an dem auf meine Brust gerichteten Schwert.
Völlig unfähig, etwas zu tun, ließ ich mich von ihm in den Kreis der sich in einer mir unbekannten Sprache unterhaltenden Männern führen. Auf dem kurzen Weg dorthin hatten sich meine Gedanken, was mich erwarten könnte, noch überschlagen. Doch jetzt war ich bei dem Anblick dieser Leute dermaßen positiv überrascht, dass ich einfach stehen blieb und sie anstarrte.
Ich bekam gar nicht mit, dass der Wachposten hinter mir verschwand und ich angesprochen wurde, so erfreut war ich, die Männer zu sehen, die ich schon immer bewundert hatte. Mama hatte mir viel von diesem Waffen tragenden Mönchsorden erzählt. Ihre Informationen stammten hauptsächlich von ihrem Bruder, der auch ein Mitglied dieser Gemeinschaft war. Sie war der festen Überzeugung, dass er sie aufsuchen würde, sollte er sich einmal in der Nähe befinden. Dann könnte ich mich selbst davon überzeugen, was die Zugehörigkeit zu diesem Orden aus einem Mann machte. Insgeheim hofften wir beide, dass er dann einen Weg finden würde, um mich mitzunehmen und in den Orden einzuführen.
Leider hatten wir bisher vergeblich auf dieses Ereignis gewartet. Andererseits hatte ich gerade deshalb so viele Informationen über die Gemeinschaft gesammelt, wie ich nur bekommen konnte. So wusste ich schon beim ersten Blick auf ihre Waffenröcke, mit wem ich es zu tun hatte: Vor mir saßen wahrhaftig Templer!
„Wer bist du? Und was willst du?“, drang eine ungeduldige Stimme zu mir durch. Noch bevor ich überhaupt begriff, dass er mit mir sprach, beantwortete er seine Frage auch schon selbst. „Ich wusste nicht, dass uns schon Bauernburschen bespitzeln.“
„Ich bin kein Bauernbursche!“, stellte ich empört fest, obwohl ich noch immer vom Anblick dieser Männer überwältigt war. „Und ich bin auch kein Spitzel!“
„Wer bist du dann?“, fragte derselbe Ritter belustigt.
Ich ging aber gar nicht auf die Frage ein, sondern rückte sogleich mit meinem Anliegen heraus. „Ich möchte zu Euch gehören!“
Kurz darauf erfolgte allgemeines Gelächter. Die Verspätung kam zustande, weil nicht alle der französischen Sprache mächtig waren. Ein blonder, hochgewachsener Ritter, der mir gegenübersaß, war so freundlich seinen Ordensbrüdern das Gespräch zu übersetzen.
„Da könnte ja jeder dahergelaufene Bauerntölpel kommen“, amüsierte sich mein Gesprächspartner über meinen Wunsch. Sogleich erfolgte wieder Gelächter. In diesem ging dann auch die erneute Frage nach meiner Identität unter.
„Er ist mein Neffe“, entgegnete ausgerechnet der Dolmetscher, als sich die Männer wieder beruhigt hatten.
Ich war nicht weniger verblüfft als seine Brüder, eher wohl noch mehr. Mir fehlte völlig der Zusammenhang. Doch mit seinen nächsten Worten stellte er diesen sofort her.
„Er ist der Sohn meiner Schwester. Er ist ihr genaues Abbild.“ Nach diesen Worten stand er auf, kam auf mich zu und führte mich zu seinem Platz zurück. Ich ließ das alles geschehen, weil ich mich in einem Traum wähnte. Unser Wunsch – der von Mama und mir – begann Wirklichkeit zu werden.
Aufgrund meines Magenknurrens versorgte mein Onkel mich zunächst einmal in dieser Richtung, bevor er seinerseits wissen wollte, wie es meiner Mutter ging, was ich hier suchte und wie ich auf die Idee gekommen war, ein Templer werden zu wollen.
Unser Gespräch verlief ganz ungestört inmitten der vielen Männer, die sich in einer Sprache unterhielten, die ich damals noch nicht verstehen konnte.
Als wir am nächsten Morgen aufbrachen, durfte ich an der Seite meines Onkels, umgeben von der stattlichen Anzahl seiner Ordensbrüder, mit ihnen reiten. Es war ein erhebendes, nicht zu beschreibendes Gefühl. Welcher Jungen in meinem Alter und meiner Stellung hatte schon einmal Templer als Eskorte?
Egal, ob wir durch ein Dorf oder einen Weiler ritten, jedes Mal standen die Bewohner staunend und ehrfürchtig am Straßenrand. Während sich die Frauen meist zurückhielten, zeigten die Kinder auf mich und riefen ihren Eltern in etwa zu: „Sieh mal, der Junge darf mit ihnen reiten!“ Aber hin und wieder hörte ich auch Stimmen, die genau das Gegenteil vermuteten, indem sie glaubten, in mir einen Gefangenen zu sehen.
Mir ging gerade diese letzte Äußerung doch schon recht nahe, zumal ich nicht recht wusste, was mich am Ende unseres Weges erwartete. Mein Onkel hatte sich dazu weder am gestrigen Abend noch am heutigen Tag festlegen wollen. Andererseits genoss ich die Aufmerksamkeit, die unser Trupp erregte, je weiter wir uns von den Besitzungen meines Vaters entfernten.
Es war bereits später Nachmittag, als wir durchs Tor einer Templerburg ritten. Im Innenhof stiegen die Männer von ihren Pferden und führten sie davon. Einzig mein Onkel übergab sein Reittier einem herbeieilenden Stallburschen.
„Warte hier, René! Ich bin gleich wieder bei dir“, meinte er zu mir und verschwand in dem Gebäude vor uns.
Ich war dermaßen fasziniert und überwältigt von der Burg und der Geschäftigkeit, dass mir die Zeit gar nicht lang vorkam, bis er wieder neben meinem Pferd erschien. Meine Hochstimmung hielt auch noch immer an, als er mich absteigen hieß und ins Innere desselben Gebäudes führte, aus dem er soeben gekommen war.
Dort geleitete er mich in einen Raum, in dem sich mehrere Templer unterschiedlichsten Alters aufhielten. Einen dieser Männer stellte er mir als den Komtur, also den Befehlshaber dieser Festung, vor.
„Dein Onkel hat uns dein Anliegen vorgetragen, René“, sprach mich der Komtur direkt an.
Ich war äußerst aufgeregt, strahlte aber von innen heraus. Mir war es nicht möglich, etwas zu erwidern. Aber damit schien er auch gar nicht gerechnet zu haben. Allein meine, von meinem Wunsch überzeugte, Haltung und das Staunen, mit dem ich jedes Detail in diesem Raum in mich aufnahm, schienen ihm zu genügen.
„Du hast in ihm einen starken Fürsprecher. Einen sehr überzeugenden Fürsprecher!“, fuhr er schließlich fort, nachdem er mich kurz gemustert hatte. „Eines jedoch möchte ich von dir noch wissen: Was möchtest du? Was suchst du gerade bei uns?“
Mir kam nicht in den Sinn, dass meine Antwort ausschlaggebend für meine Aufnahme sein konnte, viel weniger fielen mir die erwartungsvollen Blicke aller Anwesenden auf. Einzig mein versetzt hinter mir stehender Onkel schien völlig von mir überzeugt zu sein. Seine Hand, die auf meiner Schulter ruhte, bewegte sich nicht im Mindesten.
„Ich möchte für das Licht kämpfen!“, begann ich nicht sehr laut, aber deutlich, wenn auch mein Blick entrückt auf einen Punkt an der Wand gerichtet war. Dort glaubte ich, genau dieses strahlende, sanfte, heilende Licht zu sehen, welches mich schon mein Leben lang begleitet hatte. „Ich möchte Bücher lesen und schreiben lernen. Ich möchte Wissen erlangen. Ich möchte so vieles lernen.“
Meine Worte schienen die Männer überzeugt zu haben. Trotzdem wandte der Komtur ein: „Es ist noch ein langer Weg, bevor du den Waffenrock tragen darfst.“
Noch immer diesen Lichtpunkt fixierend, nickte ich nur mechanisch.
Damit jedoch war meine Aufnahme beschlossen.
*
In den nächsten Jahren lernte ich all das, worum ich gebeten hatte und noch vieles mehr. Auch die Sprache, in der sich die Templer an jenem Abend unseres ersten Zusammentreffens unterhalten hatten – Latein – gehörte dazu. Hinzu kam alles, was ich für die Verwaltung von Vermögen wissen musste. All dies fiel mir leicht und darin war ich auch ein fleißiger Schüler.
In einem Fach jedoch sollte ich es nie zu etwas bringen: Kampftechnik. Waffen waren nun einmal nichts für mich. Ich konnte noch so viel üben, ich reichte noch nicht einmal an den Durchschnitt heran.
Deshalb war es für mich völlig unverständlich, als ich einige Jahre nach Abschluss meiner Ausbildung den Befehl erhielt, zur Verstärkung der Truppen im Heiligen Land, meinen Onkel zu begleiten.
„Ihr wisst, dass ich ein miserabler Kämpfer bin. Ich bin nicht für das Schwert geboren. Warum kann ich nicht hier in Frankreich bleiben und das tun, was ich kann: die Verwaltung des Vermögens. Ihr wisst, dass ich meine Arbeit immer sorgfältig gemacht habe. Nie habe ich auch nur eine Münze veruntreut. Es gibt genug Brüder, die gute Kämpfer sind. Bitte lasst mich hier bleiben, wo ich nützlich bin. Ich will nicht ins Heilige Land! Ihr schickt mich in den sicheren Tod!“
Mittlerweile war ich längst nicht mehr so naiv wie vor zehn Jahren, als ich durch die Vermittlung meines Onkels Aufnahme in den Orden gefunden hatte. Ich konnte meine Fähigkeiten sehr wohl einschätzen und wusste auch, dass ich im Gefecht eine Gefahr für meine Mitbrüder darstellte. Und genau das wusste auch mein Komtur, zu dem ich diese Worte gesagt hatte.
„René, es ist nicht an mir, darüber zu entscheiden. Ich weiß auch, dass deine Fähigkeiten bei Weitem nicht im Gebrauch der Waffen liegen. Und ich kann nur bestätigen, was du vorgebracht hast. Doch der Befehl, junge, waffenfähige Männer zur Verstärkung ins Heilige Land zu schicken, kommt von ganz oben, vom Großmeister persönlich. Ich darf nur die Männer hier behalten, die nicht mehr für den Kampf taugen. Du weißt so gut wie ich, dass damit zum einen die Alten, zum anderen diejenigen gemeint sind, die aufgrund einer Verletzung keine Waffe mehr führen können.“
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er eigentlich auch noch gerne einen Satz angefügt hätte, der uns beiden streng genommen klar in der Luft hing. >Wenn ich eine Möglichkeit sehen würde, dich hier zu behalten, würde ich es tun.<
Sein wehmütiger Blick, den er mir schenkte, bevor er mich mit einer Handbewegung entließ, sagte mehr, als er je zuzugeben gewagt hätte.
Auch ich hatte ihn gern, wie so viele andere Brüder, die hier zurückbleiben würden. Der Orden war meine Familie. Hier hatte ich all das gefunden, was mir innerhalb meiner leiblichen Verwandtschaft immer gefehlt hatte. Die einzigen Ausnahmen stellten wohl meine mittlerweile verstorbene Mutter und mein Onkel dar. Letzterer würde mich auch auf der langen Reise begleiten, genauso wie mein Freund Pierre.
Wenn ich auch wusste, dass es keinen Sinn hatte, sich gegen den Befehl des Großmeisters aufzulehnen, so machte er mich doch wütend. Ich hatte das Gefühl, mich in der gleichen Situation zu befinden, die ich mit sechzehn Jahren erlebt hatte, als mein Vater mich ins Kloster abschieben wollte. Damals hatte ich es allein geschafft, meinen Lebensweg zu ändern und durch eine gütige Fügung des Schicksals meinen Traum verwirklichen zu können.
Heute jedoch konnte ich selbst nichts ändern. Dafür hatte ich aber in meinem Onkel, der mir mehr väterlicher Freund als Vorgesetzter war und in Pierre Menschen an meiner Seite, denen ich völlig vertrauen konnte.
*
Nach einer langen und ermüdenden Reise erreichten wir endlich unser Ziel: Akkon. Unterwegs hatte mein Onkel mir versprochen, sich dafür einzusetzen, dass ich eine Position in der Verwaltung bekommen würde. Diesmal hatte es wirklich nichts mit Naivität zu tun, daran zu glauben – ja mehr noch – zu wissen, dass er dies auch schaffen würde.
Schon an unserem Ankunftstag in unserer Festung in Akkon suchte er mich mit der Nachricht auf, dass ich schon am nächsten Morgen als Schreiber anfangen könnte.
Nicht nur ich war erleichtert, dass ihm das so schnell gelungen war, auch von ihm selbst und dem zunächst noch skeptischen Pierre sah man die Anspannung abfallen.
Wie schön ist es, wahre Freunde zu haben!!!
*
Einige Monate später trat der Seneschall persönlich an mich heran.
Ein äußerst wichtiges Schreiben müsste zu unserem Großmeister nach Jerusalem gebracht werden. Dafür hätte er mich ausersehen.
Es war eine Ehre, für einen solchen Auftrag ausersehen zu werden, aber mich kränkte dabei doch etwas: Ich hatte das Dokument nicht selbst verfasst. Und das sagte ich dem zweiten Mann im Orden auch ganz offen.
Seine Antwort war präzise und korrekt wie immer, ohne dass er beleidigt ob meines Einwandes war. „Der Inhalt dieses Schreibens ist nur für die obersten Befehlshaber und wichtigsten Männer unseres Ordens bestimmt. Es ist besser, wenn du keine Kenntnis davon hast.“ Mit diesen Worten überreichte er mir eine reich verzierte Metallhülse mit dem Siegel des Großmeisters. Damit war ich auch gleichzeitig entlassen.
Ich dachte noch immer über die Bedeutung seines letzten Satzes nach, als ich kurz darauf im Schutz einiger Brüder aufbrach. Ich war erleichtert, als sich Pierre neben mir einreihte und ich meinen Onkel das Kommando übernehmen sah. Außer ihnen erkannte ich noch einige erprobte Kämpfer, die sich mit den Gegebenheiten und der Route gut auskannten.
Das erste Stück auf dem Weg verlief ereignislos. Erst gegen Mittag holte mich die Realität ein.
Wir ritten in ein Dorf ein, das aus wenigen, am Wegesrand entlang gebauten Hütten bestand. Beim Anblick der auf dem Boden liegenden, blutüberströmten und aus Fenster- oder Türöffnungen herausschauenden Leichen wurde mir schlecht. Aufgrund der frischen Blutlachen konnte das Massaker an sämtlichen erwachsenen Dorfbewohnern noch nicht allzu lange her sein. Hier und da saßen weinende Kinder neben den toten Leibern ihrer Eltern oder liefen verstört herum.
Wäre ich allein gewesen, ich glaube, ich hätte diesen Ort des Schreckens so schnell wie möglich verlassen. Zum Glück waren meine Brüder da ganz anders. Mein Onkel ordnete sofort an, die Hütten nach Überlebenden abzusuchen und die Kinder einzusammeln.
Ich machte mich dann auch sofort zu Fuß auf den Weg. Aus einer Hütte hörte ich ein kleines Kind weinen. Und dieses Geräusch ging mir dermaßen nahe, dass ich alle Befehle vergaß und allein in den dunklen Raum trat. Eigentlich sollten wir immer nur zu zweit vorgehen, aber ich konnte einfach nicht anders.
Zunächst war ich vom grellen Sonnenlicht derart geblendet, dass ich in dem einzigen Raum dieser Behausung nichts erkennen konnte. Doch schnell gewöhnten sich meine Augen an die veränderten Lichtverhältnisse und ich gewahrte in der Raummitte die blutüberströmte Leiche einer jungen Frau. Mir gegenüber stand ein vielleicht zwei- oder dreijähriges halbnacktes Kind, das bei meinem Anblick sofort verstummte und ängstlich vor mir zurückwich.
Da ich keine Erfahrung mit Kindern hatte, machte ich den Fehler, mit ausgebreiteten Armen, aber ohne etwas zu sagen, auf es zu zugehen. Dabei musste ich meine Aufmerksamkeit zwischen ihm und der Leiche auf dem Fußboden teilen.
Das Kleine, ob Junge oder Mädchen konnte ich nicht erkennen, entschlüpfte mir schließlich, als ich die Leiche rechts umrundet hatte, links an dieser vorbei und zur Tür hinaus. Sichtlich erleichtert, diesen Ort verlassen zu können, ohne ein sich windendes, plärrendes Kind in den Armen halten zu müssen, schob ich mich auf demselben Weg an der Toten vorbei wieder in Richtung Tür.
Auf halber Strecke jedoch wurde ich plötzlich von hinten gepackt. Im nächsten Moment spürte ich die Klinge eines Messers oder Dolches an meinem ungeschützten Hals – wieder eine Nachlässigkeit von mir. Ich war wie erstarrt. Was hätte ich auch in dieser Situation tun sollen?
Gleich schneidet er dir die Kehle durch und du bist tot!, war mein einziger Gedanke. Aber das schien gar nicht die Absicht meines Gegners zu sein. Sein Interesse galt nicht mir, sondern dem Dokument, welches ich am Leib trug. Geschickt griff er mit der freien Hand nach der Hülse. Kaum hatte er sie in seinen Besitz gebracht, verschwand die Klinge von meinem Hals. Dafür bekam ich einen dermaßen harten Schlag in den Rücken, dass ich nach vorn flog und in die Blutlache neben der Leiche fiel.
Noch während ich mich angeekelt aufrappelte, verschwand der Dieb wie ein Schatten nach draußen. Als ich wieder auf den Füßen stand, konnte ich noch immer nicht recht begreifen, was gerade geschehen war. Durch die Türöffnung erkannte ich hingegen, dass er schon ein beträchtliches Stück Weg hinter sich gebracht hatte. Er und sein Pferd waren im Hitzeflimmern gerade noch als solche zu erkennen.
Mit einem Lappen versuchte ich notdürftig meinen Waffenrock vom Blut zu reinigen, was natürlich nicht recht gelang. Dann ging ich, mit schweren Schuldgefühlen belastet, zu den wartenden Brüdern zurück. Trotzdem versuchte ich, mir nichts anmerken zu lassen.
Während ich noch darüber grübelte, wann und wie ich es meinem Onkel und den mich begleitenden Brüdern mitteilen sollte, dass das Dokument geraubt worden war, kümmerte mein Onkel sich um das Naheliegendste. Er verteilte die Kinder auf die Ritter, um sie auf diese Weise bis zum nächsten Ort mitzunehmen und dort gut unterzubringen. Ehrlich gesagt war ich froh, dass ich keines der Bälger vor mir aufs Pferd nehmen musste. Außerdem waren meine Brüder durch die Kinder bis zum nächsten bewohnten Dorf so abgelenkt, dass sie nicht weiter auf mich achteten.
Erst, als die Kinder dort gut untergebracht worden waren, verließen wir den Ort und setzten unsere Reise fort. Mir fiel gar nicht auf, dass die Männer weiterhin recht schweigsam waren. Andererseits war mir das ganz recht. Was hätte ich auch sagen sollen? Langsam setzte sich nämlich in meinem Kopf der Gedanke fest, dass sie mich umbringen würden, wenn sie ES erfuhren. Natürlich war mir auch klar, dass ich es recht bald sagen musste, denn je näher wir Jerusalem kamen, desto näher kam auch der Moment, indem die Wahrheit ohnehin ans Licht gekommen wäre.
Am späten Nachmittag überkam mich bei der Ansicht eines Hohlweges, durch den wir reiten mussten, ein ungutes Gefühl und riss mich so aus meinen Gedanken heraus.
„Hier stimmt etwas nicht!“, meinte ich zu Pierre, der mich daraufhin verwirrt ansah. „Wir sollten vorsichtig sein. Ich habe ein seltsames Gefühl.“
„René, mach dir keine Sorgen! Dieses Stück Weg war schon immer sicher“, versuchte er mich mit seiner Überzeugung zu beruhigen.
Doch ich schüttelte den Kopf.
„Glaub mir!“, erwiderte er mit einem abfälligen Lächeln. „Gerade dieses Wegstück nach Jerusalem ist das sicherste der ganzen Strecke. Hier ist noch nie etwas passiert!“
Seine Worte schafften es einfach nicht, diese dunkle Vorahnung zu verscheuchen. Andererseits wäre es ohnehin zu spät gewesen, meinen Onkel davon zu unterrichten, denn er und die ersten Reiter hatten den Einschnitt schon erreicht.
Zunächst schien es auch so, als ob meine Bedenken aus der Luft gegriffen gewesen wären und ich schalt mich schon einen Narren, nachdem auch die letzten Brüder sich im Hohlweg befanden und nichts geschah. Gerade machte ich meine überreizten Nerven dafür verantwortlich, dass ich dort Gefahr verspürte, wo gar keine war, da war sie schon über uns.
Ich sah von rechts einen dunklen Schatten auf mich zufliegen. Noch bevor ich auch nur nach dem Schwert greifen konnte, prallte ein Körper nicht nur gegen mich, sondern riss mich durch seinen Schwung aus dem Sattel. Gemeinsam kamen wir auf dem größtenteils sandigen Boden neben dem Pferd auf.
Während er sich geschickt von mir herunterrollte, war ich sehr hart aufgeschlagen. Wahrscheinlich hatte ich den einzigen, größeren Stein, der dort auf dem Weg lag getroffen. Jedenfalls spürte ich kurz nach dem Aufprall meinen Körper nicht mehr. Den einzigen Körperteil, den ich noch bewegen konnte, war mein Kopf. Alles andere schien nicht mehr zu mir zu gehören. Dass ich gelähmt war, begriff ich aber in diesem Moment noch gar nicht. Ich war nur erstaunt, dass der in einen schwarzen Burnus mit ebensolchem Turban gekleidete Angreifer mich erschrocken ansah.
Im ersten Moment fiel mir der Begriff Beduine ein, doch im gleichen Augenblick wusste ich, dass diese Bezeichnung auf ihn nicht zutraf. Wie ich ihn benennen sollte, kam mir nicht sofort in den Sinn, denn die Situation erforderte meine ganze Aufmerksamkeit.
Der Mann war augenscheinlich sofort wieder auf die Füße gekommen, wobei er gleichzeitig einen Dolch gezogen hatte. Diesen in der Hand stand er für einen endlosen Moment über mich gebeugt.
Er bringt mich um! Jetzt werde ich sterben!, schoss mir durch den Kopf. Seltsamerweise hatten diese Gedanken nichts Beängstigendes an sich, ganz im Gegenteil. Ich empfand es als gerechte Strafe dafür, dass ich das Dokument mir hatte stehlen lassen. Oder besser gesagt, dass ich durch meinen Ungehorsam dem Dieb überhaupt die Möglichkeit dafür gegeben hatte. Vielleicht auch, weil ich ihn nicht sofort verfolgt hatte – was mir dann aber auch als total abwegig erschien. Vielmehr hätte ich meine Brüder sofort von dem Diebstahl in Kenntnis setzen müssen!
Plötzlich jedoch verschwand der Mann aus meinem Blickfeld. Wohin und warum er so schnell von mir abgelassen hatte, konnte ich mir nicht erklären. Ehrlich gesagt war ich gar nicht so erleichtert, wie ich es eigentlich hätte sein sollen. Hätte er mit einem gezielten Stich mein Leben beendet, würde es mir erspart bleiben, den Brüdern meine Schande zu gestehen.
Natürlich hätte ich es mir einfach machen und behaupten können, dass mir das Dokument erst jetzt gestohlen worden war und ich aufgrund meiner körperlichen Situation rein gar nichts daran hatte ändern können, gar nicht zu reden von einer Verfolgung. Aber dieser Gedanke kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Niemals hätte ich bewusst eine Lüge erzählt! Dass ich durch mein bisheriges Schweigen genau das bereits getan hatte, nagte aber doch an mir.
Wie lange ich allein und unbeachtet auf dem Boden gelegen hatte, konnte ich nicht sagen. Allerdings war ich froh, dass ich keinen Helm trug, der mir das Atmen sicherlich erschwert hätte. Doch diese Zeit brauchte ich, um mir klar zu machen, dass ich gelähmt war. Und noch etwas begriff ich: Sobald wie möglich musste ich meine Verfehlung eingestehen!
Während ich so dalag, hatte ich zunächst noch Kampfgeräusche gehört, die mittlerweile aber ganz verstummt waren. Dafür sah ich einen meiner Brüder mit Unterbrechungen in meine Richtung kommen. Hin und wieder bückte er sich oder stieß etwas mit seinem Fuß oder Schwert an. Zunächst war mir noch nicht bewusst, was er da tat, bis mir aufging, dass er überprüfte, ob er wirklich an Leichen vorbei kam oder es noch Verwundete auf seinem Weg zu mir gab. Einen Gegner im Rücken zu haben, dessen vermeintlicher Leichnam sich plötzlich erhob, während er sich über mich beugte, hätte für ihn fatal enden können.
Als er mich fast erreicht hatte, rief ich ihn an. „Ich bin nicht tot!“ Etwas anderes war mir auf die Schnelle nicht eingefallen, zumal ich mich ja nicht einmal durch das einfache Anheben eines Arms bemerkbar machen konnte. Vermutlich lag es aber auch daran, dass ich das Gefühl hatte, nur noch aus einem Kopf zu bestehen.
Trotz aller meiner Bedenken und dem tiefen Schuldgefühl war ich froh, meinen Mitbruder neben mir stehen bleiben zu sehen. Noch trug er seinen Helm, aber trotzdem war ich mir sicher, ihn erkannt zu haben.
Meine Erleichterung verschwand genau wie mein Lächeln im selben Augenblick, als er sein Schwert mit beiden Händen umfasste und es bis in Höhe seines Gesichts anhob, als wolle er es mir mit Kraft in meine Brust stoßen. Entsetzt wurde mir bewusst, dass er mich umbringen wollte. Verwirrt ob seines Tuns sah ich ihn an, unfähig etwas zu sagen.
In der kurzen Zeitspanne, während er die Waffe auf mich niederfahren ließ, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass er schon vom Diebstahl des Dokumentes wusste und mich dafür bestrafen wollte. Besser hier und jetzt, als vor den Großmeister treten zu müssen oder vor meinen Onkel! Seltsamerweise war beides für mich gleich schlimm.
Kurz bevor die Schwertspitze meine Brust berührte, fing mein Bruder den Schwung der Waffe ab, setzte mir die Spitze aber dennoch mit Druck auf, wie ich an der Einkerbung des Waffenrocks erkennen konnte.
„Verräter!“, erklang seine Stimme im selben Moment blechern aus dem Helm heraus.
„Nein, ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Und ich war auch nicht daran beteiligt, dass das Dokument gestohlen wurde!“, verteidigte ich mich sofort.
Überrascht nahm er das Schwert so lange von meiner Brust, bis er sich den Helm vom Kopf gezogen hatte, setzte es dann aber wütend wieder an der gleichen Stelle an.
Mir war sofort klar, dass er mir nicht glaubte. Es machte mich traurig, das gerade bei ihm feststellen zu müssen.
„Habe ich dich jemals belogen, Pierre?“, fragte ich meinen schwarz gelockten Freund, dessen Haare feucht am Kopf klebten. „Ich werde dir alles erzählen, genau so, wie es war.“
Mit diesem Satz begann ich meinen Bericht, während Pierre, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, das Schwert zurück in die Scheide steckte und sich neben mich setzte.
„Bei unserer Freundschaft, bitte glaub mir, dass ich die Wahrheit gesagt habe!“, beendete ich schließlich meinen Bericht und sah ihn schuldbewusst an.
Langsam nickte er vor sich hin. Er schien zu überlegen, was er mit seinem Wissen anfangen sollte. Doch plötzlich schien er zu einem Entschluss gekommen zu sein, denn mit einem Lächeln sprang er auf und winkte zweien unserer Brüder, die sogleich mit einer Trage auf uns zu kamen.
Zunächst wurde ich in ein schnell aufgeschlagenes Zelt gebracht und auf einem provisorischen Lager abgelegt. Scheinbar war ich der Einzige, der mehr als kleinere Schnittverletzungen davongetragen hatte. Jedenfalls kümmerten sich zwei Brüder sofort um mich. Ich sah zwar, wie sie eine Blutung stoppten, fühlte aber noch immer nichts. Schließlich teilte mir Pierre dann mit, dass meine Lähmung nicht zurückgehen würde. Noch während die zwei heilkundigen Brüder mich untersucht hatten, war ich nach wie vor vom Gegenteil überzeugt gewesen.
Ich wusste sofort, was das für mich bedeutete. Entweder wurde ich zu meiner Familie abgeschoben, die mich ganz sicher nicht aufnehmen würde oder ich würde den Rest meines erbärmlichen Lebens in einem Hospital verbringen. Aber auch das wollte ich nicht.
Pierre saß lange an meiner Seite und erörterte mit mir die Möglichkeiten. Obwohl wir beide genau wussten, dass ich es nicht spürte, hielt er meine Hand zwischen seinem Händen. Diese Geste sagte mehr als Worte je ausdrücken konnten.
Nach einiger Zeit jedoch legte er meine Hand auf die Decke, beugte sich zu mir herunter und flüsterte mir ins Ohr: „Ich bringe dich zu einem Ort, an dem du Heilung erfahren wirst.“
Obwohl ich keine Ahnung hatte, welchen Ort er meinte, wusste ich dennoch, dass diese Heilung nicht für den Körper bestimmt war.
Wie ich in den unterirdischen Raum gekommen war, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich auf dem Steinboden eines Gewölbekellers lag. Pierre kniete an meiner Seite und hielt meine Hand zwischen seinen. Ich war ihm unendlich dankbar für das, was er für mich getan hatte, wenn ich auch um die Konsequenzen für ihn fürchtete.
Die Wände waren sämtlich aus Ziegelsteinen gemauert und die Bögen wurden in immer gleichen Abständen von eckigen Säulen aus dem gleichen Material getragen. Ich hatte das Gefühl, dass es noch mehrere solcher Räume geben musste, die durch Gänge in derselben Bauart miteinander verbunden waren. Sehen konnte ich aber davon nichts.
Dafür sah ich aber etwas anderes und das war unbeschreiblich schön. Ein Stück entfernt von meinen Füßen hatte sich auf dem Boden eine riesige Blüte aus weißem, strahlenden Licht gebildet. Die an ihren Rändern hellgelb gefärbten Blütenblätter waren dermaßen ineinander verschachtelt, dass ich gar nicht sagen kann, wie viele es waren. Einerseits schien sich dieses Lichtgebilde zu bewegen, blieb aber andererseits dennoch immer an derselben Stelle.
Gleichzeitig mit dieser unbeschreiblichen Schönheit, nahm mich die Ruhe, die Wärme und die Sanftheit, welche diese Lichtblüte ausstrahlte, dermaßen von sich ein, dass mir nur noch wichtig erschien, sie anzublicken.
Hinter dieser sich bis kurz unter die Decke erstreckenden Erscheinung konnte ich schemenhaft einige, meiner Ansicht nach, kniende Ritter meines Ordens erkennen. Doch ich empfand ihre Anwesenheit nicht als wichtig.
Wie lange ich einfach da gelegen und diese Blüte bewundert hatte, kann ich nicht sagen. Jedenfalls bewegte sie sich plötzlich wie leichter Nebel langsam auf mich zu und schloss mich schließlich ein. Es war ein herrliches Gefühl, wenn auch etwas erdrückend. Gleichzeitig sagte eine Stimme in meinem Kopf: „Es ist alles so geschehen, wie es sollte. Du trägst daran keine Schuld!“
Es tat gut, diese Bestätigung zu hören, zumal ich kurz darauf merkte, wie mir ganz leicht wurde. Ich hatte das Gefühl, zu schweben. Noch einmal nahm ich die Konturen meines Körpers wahr, bevor ich ihn selbst unter mir auf dem Boden des Raums liegen sah. Nur ein dünnes, aus meinem Mund aufsteigendes Rauchseil verband mich noch mit ihm.
Es tat mir nur leid, dass ich meinen neben meinem Körper knienden Freund nicht ein letztes Mal umarmen konnte. Trotzdem drängte es mich, ihm noch einige Worte zu sagen.
„Du warst der beste Freund, den ich mir nur wünschen konnte, Pierre! Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast und die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbringen konnten.“ Ich hätte ihm gerne noch mehr gesagt, aber ich hatte keine Zeit mehr. Tiefe Trauer übermannte mich und entlud sich in einem Tränenfluss.
Nun riss auch der letzte Rauchfaden ab.
Mit den Worten: „Wir müssen uns jetzt trennen. Es war schön, in dir gelebt zu haben“, verabschiedete ich mich von meinem Körper.
Meinem noch lebenden Vater gedachte ich mit zwei Sätzen. „Danke, Vater, für den Druck, den du auf mich ausgeübt hast, ins Kloster zu gehen. Du hast mir unbeabsichtigt den Weg zu meiner wahren Bestimmung gezeigt!“
*
Mittwoch, 30. April 2008. Erschrocken fahre ich aus dem Schlaf auf. Ich atme tief durch, als hätte ich gerade die Wasseroberfläche eines tiefen Sees durchstoßen und würde nach langer Zeit wieder Sauerstoff in meine Lungen füllen.
Gleichzeitig mit diesem Aufatmen setzte ich mich auf. Zunächst begreife ich gar nicht, wo ich mich befinde, denn um mich herrscht tiefste Dunkelheit. Meine Hände tasten wahllos alles ab, was sie erreichen können. Dennoch bin ich unfähig, auch nur einen Gegenstand zuzuordnen, geschweige denn, ihn zu benennen. Nicht einmal, ob etwas sich weich oder hart, warm oder kalt anfühlt, vermag ich mit Bestimmtheit festzustellen.
Selbst mein Körper kommt mir fremd vor. Ich weiß nicht einmal, ob ich ein Mann oder eine Frau, ein Mädchen oder ein Junge bin. Mein Denken steckt in dem gerade Erlebten fest.
Bin ich tot?, frage ich mich in Gedanken. Ich muss es wissen! Wenn ich tot bin, kann ich dann noch sprechen?
Ich gebe mir selbst die Antwort, und zwar laut: „Ein Toter kann nicht reden!“
Mit diesem Satz breche ich den Bann, der sich um mich gelegt hat. Meine Ohren hören deutlich, was meine Lippen geformt und meine Stimmbänder in Töne umgesetzt haben.
Ich weiß plötzlich wieder, wer ich bin und wo ich mich befinde. Dennoch müssen auch meine Augen sich davon überzeugen, was mein Geist langsam begreift. Daher tastet meine Hand nach dem Schalter der Nachttischlampe. Als meine Finger ihn finden, drücke ich auf den Knopf, woraufhin sich eine angenehme Helligkeit in einem kleinen Kreis um die Lichtquelle ausbreitet.
Meine Augen benötigen einige Sekunden, um sich darauf einzustellen, einen Rundumblick durch den Raum zu werfen. Sie stellen fest, was mich mit Gewissheit durchflutet: Ich liege in meinem Bett, denn inzwischen habe ich mich wieder zurück aufs Kopfkissen fallen lassen. Links davon befindet sich das aus Kiefernholz gefertigte und nur mit einem Klarlack überzogene Nachtschränkchen. Darauf steht die kleine, goldfarbene Leuchte mit den beiden gegenüberliegenden Glasscheiben. Auf deren getönten Flächen erkenne ich jeweils einen kahlen Baum.
Unwillkürlich kommt mir der Vergleich mit meinem jetzigen Leben in den Sinn: Seit einiger Zeit ist mein Dasein genauso trostlos wie die blattlosen Holzgewächse, deren Äste sich scheinbar flehend nach oben strecken.
Da ich in diesem Augenblick auf keinen Fall darüber nachdenken möchte, schaue ich nun bewusst an der Lampe vorbei auf das bodentiefe Fenster. Die mit bunten Blumen bedruckten Übergardinen besitze ich nun schon seit über zwanzig Jahren, denke ich. Der Store ist erst halb so alt. Er war ein Frustkauf. Nachdem ich wegen meiner chronischen Erkrankung meine Arbeitsstelle verloren hatte, brauchte ich unbedingt etwas, was mich von der Realität draußen auch optisch trennte. War es ein Fehler gewesen?
Ich verbiete mir, weiter darüber nachzugrübeln und lenke den Blick vom Fenster weg, das durch den lichtdicht geschlossenen Außenrollladen momentan alles und alle aussperrt. Um festzustellen, wie spät es ist, schaue ich auf meinen Wecker, der von dem cremefarbenen Schaffell vor meinem Bett zur Decke starrt. Ich habe ihn dorthin verbannt, weil er so laut tickt, wenn er auf den Nachttisch steht. Dieses Geräusch hasse ich, bin aber zu träge, um mir einen weniger aufdringlichen Zeitmesser zu besorgen.
Es ist halb sieben in der Früh, eigentlich meine normale Aufstehzeit. Doch heute brauche ich noch ein wenig die Geborgenheit meines Bettes.
Als ich mich wieder hinlege, richten sich meine Augen auf den massiven Kleiderschrank. Er ist, wie alle meine Möbel, aus gelacktem Kiefernholz hergestellt. Fünf Türen und ebenso viele Schubladen besitzt er - jeweils zwei mehr, als ich Jahrzehnte hinter mich gebracht habe. Nur noch zwei Jahre, denke ich, dann kommt ein weiteres hinzu.
Schnell reiße ich mich vom Anblick des Möbelstückes und meinen trübsinnigen Betrachtungen los und wende mich der dritten Zimmerwand zu. In deren ersten Drittel befindet sich die weiße Tür, welche in den Flur führt. Sie hebt sich stark von der lachsfarbenen Wand ab, obwohl ich sie nur schemenhaft erkennen kann. Bis dorthin reicht der Lichtschein nicht, dennoch weiß ich genau, wie mein Schlafzimmer aussieht. Ich lebe lange genug hier, um mich selbst im Dunkeln zurechtzufinden.
Eine Tür!, schiebt sich eine Idee in mein Bewusstsein. War dieser Traum ein Hinweis auf einen Eingang? Doch sogleich korrigiere ich mich wieder: Ist es ein Fingerzeig auf einen Ausgang? Was aber soll dieser abenteuerliche, aber so realistische Traum mit meinem jetzigen Leben zu tun haben?
Ich verschiebe das Nachdenken auf die Zeit nach dem Frühstück. Dann werde ich ein paar Bücher über Traumdeutung wälzen, um mich mit den Symbolen auseinanderzusetzen.
Mein Rundblick durchs Schlafzimmer ist fast beendet, als meine Augen einen Gegenstand erfassen, der auf der Kommode liegt, die rechts von der Tür an der Wand steht. Ich muss einige Zeit nachdenken, bis mir einfällt, dass ich dort ein Buch abgelegt habe. Es stammt aus einem Antiquariat, in dem ich am gestrigen Tag gestöbert habe.
*
Dienstag, 29. April 2008. Nach einer Woche, in der es mir sehr schlecht mit den Symptomen meiner systemische Mastozytose ging, erlebte ich den gestrigen als einen guten Tag. Da ich ohnehin einige Dinge einkaufen musste, beschloss ich nach dem Mittagessen und einem anschließenden Verdauungsschläfchen mich bis zum nahegelegenen Supermarkt zu wagen. Weit zu gehen und lange von Zuhause wegzubleiben traute ich mich nicht, denn meine Erkrankung war unberechenbar. Wie schnell konnten sich die lästigen Durchfälle, die Darmkrämpfe oder die Übelkeit erneut einstellen!
Doch gestern Nachmittag schienen alle diese Plagen gemeinsam ausgegangen zu sein, wenngleich sie mir ihre Schwester, die Schwäche, als Aufpasserin zurückgelassen hatten. Sie glaubten wohl, dass ich ansonsten übermütig werden könnte und die Mastozytose – wenn auch nur für kurze Zeit – vergessen würde.
Obwohl ich nur einen Einkaufkorb mit dem Nötigsten gefüllt hatte, musste ich mich auf dem Nachhauseweg gleich zweimal auf jeweils einer der am Weg stehenden Bänke ausruhen. Den Großeinkauf erledigte meine Mutter, die im gleichen Haus wohnt, am Monatsanfang für mich.
Die zweite Bank stand genau gegenüber des Antiquariats, welches ich immer gerne aufsuchte, sobald es meine Gesundheit zuließ. Gestern jedoch war ich zu erschöpft, um den Laden betreten zu können.
Gerade wollte ich mich wieder aufraffen, um meinen Heimweg fortzusetzen, da trat Herr Degenschwinger, der Inhaber des Geschäfts, aus der Tür. Entgegen seines waffenstarrenden und draufgängerischen Namen handelt es sich bei ihm um einen ruhigen Herrn um die Fünfzig.
Mit wenigen, schnellen Schritten kam er auf mich zu, als ich gerade die Bank verlassen wollte. „Frau Wokewem, warten Sie einen Moment!“, rief er dabei, woraufhin ich sitzen blieb und ihm erwartungsvoll entgegensah.
Mir fiel auf, dass er ein schmales Büchlein in einer Hand hielt und es ungewohnt temperamentvoll hin- und herschwenkte. Meine Neugier war geweckt, weshalb ich es kaum erwarten konnte, dass Herr Degenschwinger mich erreichte.
Obwohl an ihm nicht die Spur eines Wohlstandsbauches zu erkennen war, war er dennoch außer Puste. Ich hatte bisher den Eindruck gewonnen, dass der sportlich aussehende, weißhaarige Mann zumindest joggen ging.
Als er sich neben mir auf die Bank fallen ließ, erfuhr ich, dass seine Atemnot nichts mit mangelnder Fitness zu tun hatte.
„Herr Degenschwinger, guten Tag erst einmal“, begrüßte ich ihn und wandte mich ihm zu. „Ich weiß, dass ich mich bereits längere Zeit nicht mehr in ihrer Fundgrube der außergewöhnlichen Schätze sehen gelassen habe. Allerdings sollten Sie wissen, dass ich dafür eine mehr als ausreichende Entschuldigung habe: Ein schwerer Schub hat mich mal wieder niedergerungen. Ich muss wohl auf der Geburtstagsfeier einer Bekannten vor etwas mehr als einer Woche irgendetwas gegessen haben, was sehr viel Histamin enthalten hat. Aber das ist ja nichts Neues für Sie, Herr Degenschwinger. Wir haben uns ja zur Genüge über das Thema unterhalten. Daher bin ich erstaunt, dass Sie mich diesmal so sehr vermisst haben, ...“
„Nein, nein oder doch!“, unterbrach der Buchhändler mich. Sein Atem hatte sich etwas beruhigt, aber seine Aufregung war ihm dennoch anzusehen. „Natürlich habe ich Sie – meine treueste und hochgeschätzte Kundin – vermisst. Allerdings hat nicht die Tatsache, Sie längere Zeit nicht in den Räumen meines Schatzkästchens begrüßen zu können, sondern etwas ganz anderes mich zu Ihnen eilen lassen.“
Ich blickte ihn fragend an, wobei ich überlegte, ob ich ihn bei meinem letzten Besuch in seinem Antiquariat mit der Suche nach einem bestimmten Druckwerk beauftragt hatte. Allerdings konnte ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht hatte ich im Gespräch etwas erwähnt, was ihn auf den Gedanken gebracht hatte, nach einem besonderen Exemplar zu suchen. Innerlich zuckte ich die Schultern.
„Ich habe gestern eine neue Lieferung bekommen“, begann der Mann mit den grauen Augen, die, wie ich fand, genau zu seiner Tätigkeit passten – leicht verstaubt, aber geheimnisvoll und immer wieder überraschend. „Es handelt sich nur um wenige, aber guterhaltene Bücher aus mehreren Jahrhunderten. Was ihnen allerdings allen gemein ist: Sie behandeln das Thema »Frühe Leben«.“
Irritiert blickte ich ihn an. „Habe ich etwa ...“, begann ich meine Gedanken in Worte zu fassen, wurde aber von dem begeisterten Antiquar erneut unterbrochen.
„Nein, Frau Wokewem, Sie haben mir gegenüber nichts davon erwähnt, dass Sie sich für Rückführungen interessieren. Allerdings sprachen Sie vermehrt davon, ein Traumlexikon erwerben zu wollen.“
Ich begriff noch immer nicht, was die Bücher über Reinkarnation mit Träumen zu tun hatten. So schüttelte ich den Kopf. Ich wollte Herrn Degenschwinger bitten, mir auf die Sprünge zu helfen.
„Ja, ich weiß, dass ich Sie jetzt vollständig verwirrt habe“, ließ er mich erst gar nicht zu Wort kommen. „Deshalb erkläre ich Ihnen, was es mit diesem Büchlein auf sich hat.“
Nun erzählte er mir lang und breit, wie er zu den besonderen Exemplaren gekommen war. Da mich das gar nicht interessierte, hörte ich auch nur mit halbem Ohr zu. Erst, als er erwähnte, dass er besagtes Bändchen beinahe samt dem reichlich mitgenommenen Karton, in dem er die Exemplare geliefert bekommen hatte, im Altpapier entsorgt hätte, kehrte meine Aufmerksamkeit zurück.
„... wollte ich die Pappschachtel zerreißen, damit sie in die Papiertonne passte, da fiel mir dieses Buch vor die Füße. Wahrscheinlich hätte ich dem keine besondere Bedeutung beigemessen und es zu den anderen Bänden gestellt, wenn es sich nicht an genau dieser Stelle aufgeklappt hätte.“
Der Antiquar schlug den Buchdeckel behutsam auf und blätterte die ersten beiden Seiten mit seiner behandschuhten linken Hand bedächtig um. Dann hielt er mir das kostbare Buch entgegen, damit ich sehen konnte, was ihn so in Erstaunen versetzt hatte.
Auf dieser Seite befand sich die Zeichnung eines Frauenporträts. Allerdings war es nicht einfach nur irgendein Bild einer unbekannten Schönheit, sondern stellte mich dar.
„Wie ...? Ich verstehe nicht ... Was ...“ Ich war dermaßen verwirrt, dass ich unfähig war, auch nur einen vernünftigen Satz herauszubringen.
„Genauso erging es mir auch gestern, Frau Wokewem“, bestätigte mir Herr Degenschwinger ernst. Dann jedoch stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen, das mir verriet, dass er sich mit seiner Entdeckung nicht zufriedengegeben hatte. „Natürlich habe ich sogleich recherchiert und bin dabei auf einige wenige, aber sehr interessante Einzelheiten gestoßen. Die abgebildete Dame ist eine Freifrau mit dem hübschen Namen Maria Katharina Margaretha von Roden. Sie wurde am 13.07.1513 geboren und verstarb im hohen Alter von genau 90 Jahren am 13.07.1603. Viel mehr habe ich bisher über diese Freifrau noch nicht herausfinden können, obwohl ich fast die ganze Nacht im Internet verbracht habe. – Oder doch: Eine Kleinigkeit gibt es, die in Zusammenhang mit ihr erwähnt wurde: Sie hat sich bereits als junge Frau mit der Wiedergeburt beschäftigt. In diesem Bändchen hat ein unbekannter Autor ihre Rückführungen aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem angeblichen Mann mit Namen Marius Norden um ein Pseudonym der Freifrau Maria Katharina Margaretha von Roden selbst handelt.“
„Sie glauben, dass Marius für Maria steht und Norden, da in diesem Nachnamen die gleichen Buchstaben wie in Roden verwendet wurden, ...“, nahm ich den Gedanken auf.
„Ja, genau deshalb gehe ich davon aus“, bestätigte er meine Mutmaßung. „Außerdem bin ich davon überzeugt, dass sich zur damaligen Zeit wohl kein Mann dafür hergegeben hätte, die für ihn paradoxen Rückführungsgeschichten einer adligen Spinnerin zu Papier zu bringen. – Dabei fällt mir ein: Es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, dass die Freifrau selbst die Autorin ist.“ Herr Degenschwinger blätterte vorsichtig eine Seite weiter. Dort befand sich das Vorwort. „Mir kommt es so vor, als hätte eine Frau diese Worte verfasst. Sicherlich werden Sie mir zustimmen, wenn Sie es erst gelesen haben, Frau Wokewem. Hinzu kommt, dass darin auch erwähnt wird, dass es nur eine geringe Auflage von 25 Exemplaren gibt. Sie seien nur an »gute Freunde sowie an Kenner und Förderer der Studien« weitergegeben worden.“
Obwohl der Antiquar mich mit seiner Neugierde angesteckt hatte, konnte ich mich mit ihm nun nicht länger unterhalten. Ich spürte die