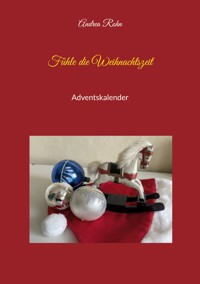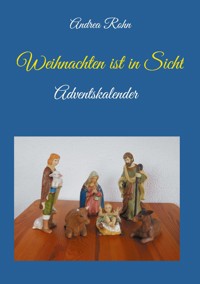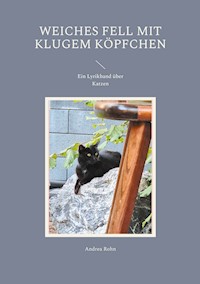Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Götterwanderer
- Sprache: Deutsch
Der 17jährige Bastard Fanai versteht die Welt nicht mehr. Was ist mit seinem Vater, dem Baron Dekert von Karelien, los? Hängt seine Veränderung vom brutalen Schläger zum Familienmenschen und gerechten Herrscher mit seinen zwei neuen Leibwächtern zusammen? Ist einer von beiden ein Magier? Wie kann sich Fanai, der uneheliche Sohn einer Heilerin vor seinen adligen Brüdern Drutmar und Ebermut schützen? Werden sie ihn weiterhin missbrauchen? Oder bahnt sich auch hier eine Wende durch den undurchsichtigen Leibwächter Sir Rabanus an? Gibt es einen Zusammenhang zwischen jenen seltsamen Träumen und der Prophezeiung über die Götter? Ist Fanai etwa selbst der dort verheißene Wanderer?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel: Schon wieder in die Falle getappt
Kapitel: Auf der Burg
Kapitel: Die Ausbildung
Kapitel: Die Träume beginnen
Kapitel: Veränderungen
Kapitel: Die Träume kehren zurück
Kapitel: Dilar und Kastehelmi
Kapitel: Abschied und Heimreise
Kapitel: Meine Liaison mit Sir Rabanus
Kapitel: Verwirrte Gefühle
Kapitel: Ein neuer Traum-Auftrag
Kapitel: Vorbereitungen
Personenverzeichnis
Adalar von Matricaria: Sohn und Erbe des Grafen Irinäus von Matricaria, Bruder von Catandra und Dilar, 15 Sommer alt; Gott des Windes
Alda (Welle): Pony von Fanai
Athanasius von Karelien: Sohn des Barons Dekert und der Baronin Bianca, 2 Sommer alt
Basilius: neuer Wächter auf der Burg
Bianca Isabella Lucia Baronin von Karelien: zweite Gemahlin des Barons Dekert, Mutter von Romuald, Euphemia, Leana, Desiderius, Athanasius und Ermelinde
Bodart: Schmied auf der Burg
Cameron, Sir: Sohn des Magiers Rell-Peras, Bruder von Luciano Da’Simh, Shira Leora und Eivin
Catandra (Vogelgesang) von Matricaria: Tochter des Grafen Irinäus von Matricaria, Schwester von Adalar und Dilar, 12 Sommer alt; Göttin der Erde
Dekert Baron von Karelien: Mann von Baronin Bianca, Vater von Drutmar, Ebermut, Fortan, Romuald, Euphemia, Leana, Desiderius, Athanasius und Ermelinde
Desiderius von Karelien: Sohn des Barons Dekert und der Baronin Bianca, 4 Sommer alt
Dilar von Matricaria: Sohn des Grafen Irinäus von Matricaria, Bruder von Catandra und Adalar, 14 Sommer alt; Gott des Wassers
Drutmar von Karelien: Sohn des Barons Dekert und seiner ersten, verstorbenen Frau, 22 Sommer alt
Ebermut von Karelien: Sohn des Barons Dekert und seiner ersten, verstorbenen Frau, 20 Sommer alt
Eivin: Sohn des Magiers Rell-Peras, Bruder von Cameron, Luciano Da’Simh und Shira Leora; leiblicher Bruder von Baronin Bianca
Ermelinde von Karelien: Tochter des Barons Dekert und der Baronin Bianca, ½ Sommer alt
Euphemia von Karelien: Tochter des Barons Dekert und der Baronin Bianca, 12 Sommer alt
Fanai/Fortan: Sohn des Barons Dekert und der Magd Karelena, 17 Sommer alt
Hilarius: neuer Wächter auf der Burg
Jolar tu-Jas-Joklas: Magier, Heiler, Großkönig von Glendalach
Karelena: Heilerin auf der Burg derer von Karelien, Mutter von Fortan/Fanai
Kallistus: neuer Wächter auf der Burg
Kastehelmi (Tautropfen): Regenbogenschlange / Meerjungfrau, Freundin des Wassergottes
Kirtan (Lied): Einhorn, Freundin und Reittier der Erdgöttin
Leana von Karelien: Tochter des Barons Dekert und der Baronin Bianca, 5 Sommer alt
Lung (Wind): Drache, Freund und Reittier des Windgottes
Marzellus, Sir: Leibwächter des Barons Dekert; Lehrer von Fanai
Master Da’Simh, Luciano: Sohn des Magiers Rell-Peras, Bruder von Cameron, Shira Leora und Eivin
Meinrad: neuer Wächter auf der Burg
Notker: Heiler auf der Burg
Rabanus, Sir: Leibwächter des Barons Dekert; Lehrer von Fanai
Rell-Peras, Sir: Magier, Großmeister des Ordens der Ritter von den Elementen, Vater von Cameron, Shira Leora, Luciano Da’Simh und Eivin
Romuald von Karelien: Sohn des Barons Dekert und der Baronin Bianca, 15 Sommer alt
Shira Leora (Lied des Lichts): Tochter des Magiers Rell-Peras, Schwester von Cameron, Luciano Da’Simh und Eivin
Für meine Schwester Michaela
1. Kapitel: Schon wieder in die Falle getappt
Wir brauchten diese letzte Rast. Eigentlich stimmte das nicht ganz, denn mein Pony und ich hätten die restliche Strecke noch vor Einsetzen der Abenddämmerung zurücklegen können. Aber wären wir allein gewesen, hätte ich nie und nimmer diesen Weg eingeschlagen.
Mein Blick glitt nur kurz über die drei Reittiere und ihre Last auf dem kleinen Plateau vor der Höhle. Nein, weder dem Mädchen noch seinen Brüdern konnte ich heute noch einen Ritt von etwa vier Kerzenstrichen1 zumuten. So lange würde es ungefähr dauern, wenn wir uns in dem Tempo fortbewegten, das ich den beiden Verwundeten zumuten konnte. Die Kleine, ja, die war zäh und würde auch nicht murren, wenn ich ihr versprach, dass sie noch heute Abend und von starken Burgmauer beschützt, in einem weichen Bett liegen könnte. Mit ihr alleine würde der Weg in nur zwei Kerzenstrichen zu bewältigen sein, da wir die Gangart unserer Pferde erhöht hätten.
Bedauernd schüttelte ich den Kopf und stieg aus dem Sattel. Es hatte keinen Zweck, über Dinge nachzudenken, die nicht sein konnten. Ihre Brüder fieberten wieder stark und wären wahrscheinlich schon vor vielen Kerzenstrichen von ihren Pferden gefallen, wenn ich sie nicht auf deren Rücken festgebunden hätte. Für sie war es höchste Zeit, dass wir rasteten und uns um ihre Verletzungen kümmerten. Ich hoffte sie mit den bescheidenen Mitteln, die mir zur Verfügung standen, so weit versorgen zu können, dass sie nicht nur die Nacht überstehen würden.
Zwei Kerzenstriche später lag ich immer noch wach am Lagerfeuer in der Höhle. Ich starrte in die knisternden Flammen, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Auch die bereits vor einem Kerzenstrich in einen erschöpften Schlaf gefallene Catandra sah ich nicht. Sie hatte vorgeschlagen, die Wunden ihrer Brüder frisch zu verbinden und ihnen, sobald ich das Feuer entfacht hätte, einen Tee aus den letzten Resten der getrockneten Pflanzen in meinem Beutel zuzubereiten. Mit Bewunderung hatte ich sie heimlich beobachtet, während ich die zuvor gesammelten Äste aufschichtete und mit dem Flintstein Funken schlug. Die in Wachs getränkte Wolle brannte recht schnell und ich hätte mir fast die Finger verbrannt, hätte sie mich nicht mit diesem betrübten Blick angesehen. Schnell konzentrierte ich mich wieder auf meine Arbeit und entzündete ein anständiges Feuer. Ich überließ es ihr, aus dem Beutel den kleinen Kessel auszupacken und den Rest Wasser aus dem Schlauch hineinzuschütten. Stattdessen kümmerte ich mich um die Pferde.
Später hatten wir beide stumm die kümmerlichen harten Brotkanten geteilt und mit jeweils einem Becher Wein hinuntergespült. Ich hatte mich beeilt, meinen Teil zu verzehren, da ich ihr nicht in die Augen blicken konnte. Wie hätte ich auch den im Feuerschein leuchtenden Sternen in ihrem Gesicht standhalten können? Nein, ich hatte mich ganz gewiss nicht in sie verliebt. Mein schlechtes Gewissen machte mir derart zu schaffen, dass ich einen Grund suchte, ihr aus dem Weg zu gehen. Da kam mir der neben mir liegende leere Wasserschlauch gerade recht. Doch bevor ich danach griff, fiel mir noch etwas ein. Mich dauerte, dass ich ihr nicht genug zu essen bieten konnte. Aus dem Proviantbeutel fischte ich ein kleines Stück Käse heraus. Dieses legte ich auf einen der Steine, die die Feuerstelle auf ihrer Seite umschlossen.
„Ich werde den Schlauch auffüllen, bevor es zu dunkel wird, um den Weg zu erkennen.“ Dann schnappte ich mir den Wasserschlauch und verschwand damit nach draußen. Sollte sie ruhig glauben, dass ich unsicher im Umgang mit Frauen war. Es war besser, als dass sie Verdacht schöpfte und in der Nacht irgendetwas unternahm, damit ich meinen Plan nicht verwirklichen konnte.
Als ich mit prall gefülltem Wasserschlauch und einem Armvoll Ästen zurückkehrte, lag sie, fest in ihre Decke gewickelt, auf dem gleichen Platz jenseits des Feuers, auf dem ich sie sitzend und speisend zurückgelassen hatte. Der geleerte Becher stand neben dem Stein, auf den ich das nun fehlende Käseeckchen gelegt hatte. Ich fasste es als Dankeschön auf.
Nachdem ich mit dem frischen Quellwasser die Wickel gegen das Fieber ihrer Brüder erneuert hatte, legte ich etwas Holz aufs Feuer und machte es mir auf der ihr gegenüberliegenden Seite mit meiner Decke bequem. Diese Nacht musste ich unbedingt schlafen. Was mir morgen bevorstand, würde mich viel Kraft und Mut kosten. Ich musste ausgeruht sein, um das durchzustehen, von dem ich fürchtete, Catandra könnte es mir ansehen. Bei dem Gedanken an das, was ich mir seit Tagen in allen Facetten ausmalte, entfuhr mir ein leiser Seufzer. Ich wünschte, die Lage wäre eine andere. Wären ihre Brüder nicht so schwer verletzt, hätte ich sie auf verborgenen Pfaden zu einer Heilerin geführt, die sie alle drei in ihre Obhut genommen hätte. Sie hätte auch dafür gesorgt, dass sie in Sicherheit gewesen wären und ...
„Aber dem ist nicht so!“, unterbrach ich meine Gedanken. „Fanai“, wie ich mich selbst nannte und was aus dem Tangalanischen übersetzt „der Wanderer“ heißt. „Nimm an, was ist! Du kannst es nicht mehr ändern.“
Trotz dieser Ermahnung kreisten meine Gedanken noch lange um das, was ich morgen zu tun gedachte. Nicht nur Catandra und ihre Brüder Adalar und Dilar würden mich dafür hassen. Ich tat es schon jetzt.
Meine Schätzung vom Vortag, dass wir bis zu unserem Ziel gut vier Kerzenstriche reiten würden, bewahrheitete sich. Trotzdem war es bereits Mittag, als wir ankamen. Wenngleich Catandra und ich kurz nach Sonnenaufgang aufgewacht waren, hatten wir fast einen Kerzenstrich gebraucht, bis wir losreiten konnten. Wie an jedem Morgen hatten wir uns die anfallenden Arbeiten geteilt. Sie kümmerte sich um ihre Brüder, ich um die Pferde. Zuletzt arbeiteten wir Hand in Hand, als es um das Sichern von Adalar und Dilar auf ihren Reittieren ging. Ob ihr Zustand besser oder schlechter als in der Nacht war, als ich das letzte Mal ihre Wickel erneuert hatte, konnte ich nicht sagen. Fest stand, dass wir uns beeilen mussten, wollten wir die Beiden lebend zu ihrem Bestimmungsort bringen. Andererseits konnte ich es nicht riskieren, den kürzesten Weg einzuschlagen, da dieser über die Berge führte und die Pferde meiner drei Begleiter nicht für die steilen Pfade taugten. Mit meinem Pony hätte ich es gewagt. Es war ein sicherer Kletterer, kein langbeiniger und schneller Renner wie die ihren.
Als wir nach dem vielen Kerzenstrichen langen Ritt den kühlen Wald verließen, hielten wir im Schatten der Randbäume an. Zunächst war dieser Stopp dafür gedacht, unsere Augen an das grelle Sonnenlicht zu gewöhnen, das die gesamte grasbewachsene Lichtung vor uns flimmern ließ. Für mich aber war es auch die letzte Möglichkeit, meinen Plan zu ändern. Ritten wir aus dem Schutz der Bäume heraus, würde passieren, was ich mir seit Tagen auszumalen versuchte.
Für Catandra hingegen schien der Anblick einfach nur überwältigend zu sein. Inmitten der von jeglichem Buschwerk befreiten und von dürrem Gras bedeckten Wiese erhob sich eine große Burganlage. Ich bemerkte, wie sie sich im Sattel etwas mehr aufsetzte, als könnte sie es nicht erwarten, dass wir endlich losritten. Für sie verhieß die Burg Schutz, Nahrung und Geborgenheit. Endlich könnte sie wieder in einem weichen Bett, statt auf dem harten Boden schlafen. Sie müsste sich auch nicht die Zähne an harten Brotkanten ausbeißen oder mit einem klumpigen, angebrannten Brei, wie heute Morgen, vorliebnehmen. Auch die Sorgen um ihre Brüder würde sie an einen Heiler abgeben können. Sie würde wieder Kind sein dürfen und sicherlich eine mütterliche Frau vorfinden, die sie in die Arme schloss.
„Ist das unser Ziel?“, fragte sie und wandte mir ihr Gesicht zu.
Erschrocken schlug ich die Augen nieder. Ich hatte Angst, dass sie meine Bedenken darin richtig deuten würde. Dabei hatte ich ihre zierliche Gestalt nur für einen kurzen Augenblick gemustert, um mir darüber klar zu werden, ob ich das Richtige tat. Ihr staubbedeckter Umhang, die darunter hervorlugenden zu weiten Hosen und die für weit größere Füße gemachten Reitstiefel gaben schon ein seltsames Bild ab. Aber das war es nicht, was mich schließlich tief durchatmen ließ. Ein kurzer Blick auf ihr müdes, ausgezehrtes Gesichtchen und auf die beiden zusammengesunkenen Gestalten ihrer Brüder auf den Pferden hinter uns, zeigten mir, was ich zu tun hatte. Mein Entschluss stand fest: Ich würde die drei zur Burg bringen.
„Ja, das ist es“, gab ich mit möglichst fester Stimme zur Antwort und ritt an. Ich nahm mir vor, meinen Blick möglichst geradeaus auf die Burg zu richten, um Catandra nicht ansehen zu müssen. Außerdem bildete ich mir ein, bei ihr den Eindruck erwecken zu müssen, dass auch ich froh war, mich ausruhen zu können. Natürlich wäre ich das auch gewesen, doch für mich stand fest, dass ich dieses Gemäuer nicht betreten würde. Ich würde meine drei Begleiter noch vor den Burgmauern an diejenigen übergeben, die mir sicherlich bald entgegenreiten würden.
Wenn auch die Mittagssonne heiß vom Himmel brannte, so würde die Wache auf den Mauern uns schon in dem Moment gesehen haben, als wir den Schatten des schützenden Blätterdaches verlassen hatten. Die Meldung unseres seltsamen Zuges würde Baron Dekert von Karelien sofort darauf schließen lassen, dass sich ihm äußerst wichtige Gäste näherten. Der Alte würde sich selbst in den Sattel schwingen und uns empfangen.
Ich nahm mir vor, ihm einfach die Zügel der beiden Pferde, die ich führte, in die Hand zu drücken und wortlos davonzugaloppieren. Die Kleine würde zwar etwas verdutzt gucken, aber dadurch wohl nicht bemerken, wem ich sie und ihre Brüder auslieferte.
Wir hatten schon fast die Hälfte des Weges zurückgelegt, als ich sah, dass die Zugbrücke heruntergelassen wurde und das Burgtor sich öffnete.
„Sie haben uns gesehen!“, jubilierte das Kind an meiner Seite.
„Sieht ganz so aus“, murmelte ich vor mich hin, behielt aber das langsame Schritttempo bei. Einerseits wäre ich froh gewesen, wenn ich mein Vorhaben möglichst schnell hätte abschließen können, andererseits fürchtete ich mich davor. Außerdem konnte ich den beiden Verwundeten in ihrem Zustand keine schnellere Gangart zumuten.
Noch bevor die ersten Reiter die Bretter der Zugbrücke verließen, wusste ich, dass uns eine besondere Ehre zuteilwurde. An der Spitze des Empfangskomitees ritt der Baron höchstselbst. Ihm folgten nebeneinander seine beiden Söhne Drutmar und Ebermut. Dahinter schlossen sich zwei Männer an, augenscheinlich die Leibwächter des Barons. Der mittelblonde Ritter wurde mir später als Sir Marzellus und sein schwarzhaariger Begleiter als Sir Rabanus vorgestellt. Den Abschluss bildeten vier Wächter.
Fast hätte ich vor Schreck die Zügel angezogen, denn damit, dass Drutmar und Ebermut den Baron begleiten würden, hatte ich nicht gerechnet.
Das Mädchen musste mein Zögern wohl bemerkt haben. „Stimmt etwas nicht?“
Ich riss mich zusammen und setzte mich demonstrativ im Sattel auf. Nein, ich würde mich von ihnen nicht einschüchtern lassen! Diesmal nicht! War nicht ich derjenige, dem sie ...
„Was ist los, Fanai?“, riss mich Catandra mit besorgter Stimme aus meinen Gedanken.
„Es ist alles in Ordnung, Kleines. Ich habe wohl in den letzten Nächten zu wenig Schlaf gehabt und träume schon im Sattel. Es wird Zeit, dass unser Weg endet“, versuchte ich sie zu beruhigen. Ich hoffte nur, dass meine Stimme fest genug klang, um sie zu überzeugen. Sicherheitshalber warf ich noch einen Blick nach hinten auf ihre schlafenden Brüder. Es fiel mir nicht leicht, die uns entgegenkommenden Reiter aus den Augen zu lassen, aber wenn ich dem Kind durch irgendeine falsche Bewegung Angst einjagte, hätte ich auch nichts gewonnen.
Mittlerweile hatten die Burgbewohner uns schon fast erreicht. Sie parierten ihre Bergponys durch und näherten sich uns nur noch im Schritt. Wenige Pferdelängen später gab der Baron den Wachen ein Zeichen, anzuhalten und dort auf ihn zu warten. Die Männer reagierten sofort, ließen ihre Ponys aber eine breite Front bilden. Ein Wink ihres Herrn genügte, um sie in Bewegung zu setzen. Darüber konnte mich auch ihre zur Schau gestellte lässige Haltung nicht täuschen. Mir war nur zu bekannt, wie reaktionsschnell diese gut ausgebildeten Kämpfer waren. Ihre Aufmerksamkeit würde zwischen der Sicherung der Gegend und dem Geschehen vor ihnen wechseln.
Indem ich ihrem Pferd in die Zügel griff, hatte ich Catandra zu verstehen gegeben, dass wir unsere Reittiere besser verhielten. Sollten die Burgbewohner doch zu uns kommen. Ich wollte zumindest das Gefühl haben, dass ich die Situation beherrschte.
Es war etwas ganz anderes, sich eine Begegnung auszudenken oder sie auch wirklich zu erleben. In meiner Vorstellung hatte ich dem Mädchen ein beruhigendes Lächeln geschenkt und damit ihre Angst hinweggefegt. Außerdem hatte ich mich im Sattel aufgerichtet und die Männer mit einem überheblichen Gesichtsausdruck empfangen. Mein Pony hatte ruhig wie ein Standbild unter mir verharrt.
Die Wirklichkeit sah ganz anders aus: Catandra ins Gesicht zu sehen oder sie gar anzulächeln hatte mein schlechtes Gewissen nicht zugelassen. Infolgedessen saß das Kind nervös auf der Unterlippe kauend und die Zügel zwischen ihren Fingern knetend, auf einem unruhig schnaubenden und mit dem Schweif schlagenden Pferd. Ich hoffte nur, dass sie die Nerven behielt und nicht plötzlich davonpreschte.
Auch meine Anspannung übertrug sich auf mein mit den Hufen stampfendes, mit Kopf und Schweif schlagendes, unruhig schnaubendes Pony. Völlig verkrampft saß ich im Sattel und versuchte, einen Punkt hinter den herannahenden Männern zu fixieren. Fast hätte ich meinem Reittier einfach die Hacken in die Flanken gedrückt, um zurück in den schützenden Wald zu verschwinden. Vieles wäre anders verlaufen, hätte ich diesem Impuls nachgegeben.
Aber schon war die Gelegenheit vorbei und nur eine knappe Pferdelänge von uns entfernt hielt Baron Dekert an. Eine halbe Länge hinter ihm verhielten seine Söhne und knapp dahinter die Leibwächter des Barons ihre Tiere.
Ich versuchte die Stimmung der fünf Männer einzuschätzen, was mir bei Sir Marzellus und Sir Rabanus nicht gelang. Ihre scheinbar gleichgültigen Mienen und die lockere Art, mit der sie im Sattel saßen, gab nichts preis. Anders sah es indessen mit den Söhnen des Barons aus. Während Drutmar mit einem hinterhältigen Grinsen darauf zu lauern schien, was sein Vater sagen und tun würde, strahlte mir aus Ebermuts Gesicht der blanke Hass entgegen.
Mein Mund wurde trocken und meine Hände begannen zu zittern. Schnell wandte ich die Augen ab. Jetzt hing alles von Dekert von Karelien ab. Wenn ich mich auch nicht traute, diesem harten Mann ins Antlitz zu schauen, so konnte ich mir dennoch die steinerne Miene vorstellen, die er meist aufgesetzt hatte. Kalte Schauder überliefen mich. Aber es war zu spät, um einen Rückzieher zu machen. Wenn ich ihm in dieser Situation nicht bewies, dass ich ihm zumindest standhalten würde, verlöre ich meinen letzten Rest an Selbstachtung. Was konnte Catandra und ihren Brüdern schon geschehen, wenn ich sie der Obhut dieses Mannes überließ? Er würde sie als Druckmittel verwenden und – soviel Ehre hatte selbst er im Leib – sobald er hatte, was er wollte, wieder freilassen.
„Fanai“, erklang die gebieterische Stimme meines Gegenübers.
Erschrocken fuhr ich zusammen. Fast hätte mein Pony einen Satz nach vorn gemacht. Doch instinktiv reagierte ich und hielt es mit harter Hand an seinem Platz. Solcherart Behandlung war die kleine Stute mit Namen Alda, was Welle bedeutet, von mir nicht gewohnt. Wahrscheinlich war das der Grund, weshalb sie zitternd stehen blieb.
Ich war mir sicher, dass Dekert von Karelien nichts von dem entgangen war. Ganz bestimmt spielte ein schadenfrohes Lächeln kurz um seine Lippen, bevor seine Züge wieder zu Stein erstarrten. Seine Söhne grinsten mich unverhohlen an, als mein Blick flüchtig in ihre Richtung wanderte. „Drecksäcke“, dachte ich und versuchte meine Angst in Wut umzuwandeln. Aber es blieb nur bei dem Versuch, trieb mich allerdings dazu, die Leibwache des Barons zu mustern. Kurz glaubte ich in deren Gesichtern ein aufmunterndes Lächeln aufblitzen gesehen zu haben, bevor ihre Züge wieder ausdruckslos wurden. Aber ganz egal, ob ich es mir nur eingebildet oder wirklich gesehen hatte, es gab mir die Kraft mein Zittern zu unterdrücken. Soweit, dass ich den Baron angesehen hätte, reichte diese Ermutigung dann aber doch nicht. Stattdessen starrte ich auf den vor der Brust zusammengezogenen Umhang. Es kam mir seltsam vor, warum er ihn so arrangiert hatte, dass man das Wappen auf seinem Rock nicht sehen konnte. Auf dem Umhang fehlte es gänzlich. Bevor ich mich jedoch in Mutmaßungen versteigen konnte, fuhr er zu reden fort: „Fanai, du hast Uns Besuch mitgebracht. Willst du ihn Uns nicht vorstellen? Wo ist deine gute Kinderstube geblieben?“
Erstaunt über die freundlichen Worte, räusperte ich mich. Sie passten so gar nicht zu dem harten Mann, den ich mein Leben lang kannte. Langsam kehrte auch der Speichel in meinen Mund zurück, sodass es mir wieder möglich war, zu sprechen. Gleichzeitig wanderte mein Blick von der Brust des Barons nach oben. Für einen kurzen Moment glaubte ich, ein warmherziges Lächeln im Antlitz Dekerts von Karelien zu erkennen. Was mich aber vollends verblüfte war, dass er mir mit einem Auge zuzublinzeln schien. Da dies unmöglich sein konnte, wandte ich mich Catandra zu.
Mit einer Hand in ihre Richtung deutend, sagte ich: „Darf ich vorstellen: Komtess Catandra von Matricaria.“ Nur kurz streifte mein Blick das nervös dreinblickende Gesichtchen des Mädchens. Dann wandte ich mich im Sattel halb um. „Ihre Brüder, die Grafen Adalar und Dilar.“ Ihr Zustand verschlug mir kurz die Sprache, denn eigentlich hätte ich jetzt den Baron vorstellen müssen. Wären die beiden jungen Männer nicht auf ihren Pferden festgebunden gewesen, hätten sie sicherlich schon längst im verdorrten Sommergras zu deren Hufen gelegen. Sie waren in einem sehr schlechten Zustand. Nur mit Mühe konnte ich erkennen, dass sie noch atmeten.
Genau das war wohl auch der Grund, weshalb der Baron eingriff: „Schluss mit den Förmlichkeiten! Die Jungen benötigen sofort einen Heiler.“ Während seiner letzten Worte winkte er die Wachen herbei. Dann wandte er sich an seine Söhne: „Drutmar, reite zurück zur Burg und sag dem Heiler, dass Wir ihm gleich zwei Verwundete schicken. – Ebermut, du begleitet deinen Bruder und teilst der Baronin mit, dass sie ein Gemach für die Komtess richten soll!“
Die beiden sahen ihren Vater verständnislos an. Mir tat es richtig gut, die überheblichen Bastarde derart sprachlos und verwirrt zu erleben.
„Sofort!“ Der Befehl des Barons knallte wie ein Peitschenhieb auf sie nieder.
Nicht weniger erstaunt als die beiden blickten die Wachen zwischen den Adligen hin und her. Scheinbar war auch ihnen das Verhalten ihres Herrn fremd. Einzig der mittelblonde Sir Marzellus und sein schwarzhaariger Kamerad Sir Rabanus grinsten hämisch.
Kaum hatten Drutmar und Ebermut ihre Pferde gewendet und waren Richtung Burg angaloppiert, wandte Baron Dekert sich den Wachen zu: „Geleitet unsere Gäste mit aller gebotenen Vorsicht zur Burg! Sorgt dafür, dass NIEMAND außer dem Heiler zu den Verwundeten gelangt! Außerdem werden zwei von euch vor dem Gemach der Komtess Posten beziehen! Nur der Baronin und der Baroness ist es gestattet, dort einzutreten. Drutmar und Ebermut erhalten weder Zutritt bei den Grafen noch bei der Komtess! Habt ihr mich verstanden?“
„Zu Befehl, Sir!“, entgegneten die vier Männer etwas verhalten im Chor. Man konnte ihnen ansehen, dass sie erstaunt über diese Anweisungen waren.
Ganz entgegen seiner sonstigen Art, fuhr Dekert von Karelien seine Männer weder an, noch bestand er auf eine laute Wiederholung ihrer Zustimmung. Stattdessen lächelte er Catandra beruhigend zu. Das Kind nickte nur bestätigend.
Inzwischen übergab ich zweien der Wachen jeweils einen der Führstricke der Reitpferde. Sogleich setzten sich die Männer auf ihren Bergponys in Bewegung und führten so die Reittiere der Grafen Adalar und Dilar auf die Burg zu. Die anderen verbeugten sich in Richtung der Komtess und forderten sie mit einer Armbewegung auf, ihren Brüdern zu folgen. Sie selbst hielten sich eine halbe Pferdelänge hinter ihr. Der Trupp wirkte schon seltsam mit den Erwachsenen auf den Bergponys und den Kindern auf den Zeltern, die knapp eine Handlänge höher waren.
Erleichtert, meine große Bürde abgegeben zu haben, seufzte ich laut, während ich den Davonreitenden nachsah. So bemerkte ich zunächst auch nicht, was um mich herum geschah. Sir Rabanus lenkte sein Pony quer hinter das meine, ungeachtet der Tatsache, dass Alda sein Reittier, sollte sie ausschlagen, erheblich verletzen könnte. Erst als Sir Marzellus mir den Blick auf die Davonreitenden verstellte, begriff ich, dass ich meinem Vater schon wieder in die Falle getappt war. Der noch recht junge Leibwächter positionierte sein Reittier zunächst leicht schräg vor Alda, sodass er mir damit den Weg nach vorn abschnitt. Gleichzeitig lenkte der Baron sein Pony auf meines zu.
In mir läuteten sämtliche Alarmglocken. Wenn ich jetzt nicht sofort handeln würde, gäbe es für mich kein Entkommen mehr. Wie hundert Mal geübt, wollte ich Alda das Zeichen sich auf die Hinterbeine zu stellen geben, um uns den Weg nach vorn freizuräumen. Aber ich konnte nicht. Meine geistige Verbindung zu dem Pony schien durch eine Art Nebel gestört zu sein. Gleichzeitig verspürte ich, als ich das Kommando mit den üblichen Zügel- und Fersenbewegungen geben wollte, ein Gefühl, als würde ich mich durch zähen Schlamm bewegen. Hier war eindeutig Magie im Spiel!
Da meinem Vater sämtliche Voraussetzungen für deren Einsatz fehlten, konnte nur einer seiner Leibwächter über diese Gabe verfügen. Meine Gedanken rasten. „Weiss der Baron eigentlich, mit wem er sich da eingelassen hat? Sollte dem nicht so sein, ist es dann nicht meine Pflicht, ihn zu warnen? Andererseits: Hatten mich nicht bereits einige Kleinigkeiten, die ich glaubte mir eingebildet zu haben, stutzig gemacht? So zwiegespalten mein Verhältnis zu meinem Vater auch ist, bisher habe ich ihn noch immer richtig eingeschätzt. Er ist gewiss niemand, der sich einen Magier ins Haus holt, ohne dass es ihm auffällt. Diesen Mann hatte er mit Bedacht ausgewählt! Nur um welchen der beiden handelt es sich? Ist es der mittelblonde Sir Marzellus oder der schwarzhaarige Sir Rabanus? “ Ein Gefühl der Panik erfasste mich. Hektisch sah ich mich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Obwohl mir mein Verstand sagte, dass es keinen Zweck hatte, vor einem Magier zu fliehen – es sei denn man verfügte selbst über die nötigen magischen Kräfte – war ich nahe daran aus dem Sattel zu springen. Meine Fluchtrichtung stand von vornherein fest: Nur der Wald würde mir Schutz gegen Schadenszauber bieten.
Ich war derart in meine Gedanken vertieft, dass ich gar nicht mitbekam, was sich inzwischen um mich herumgetan hatte. Sir Marzellus hatte sein Pony einige Schritte nach vorn treten lassen, damit sein Gebieter an ihm vorbeireiten konnte. Mittlerweile hielt Baron Dekert so dicht neben Alda, dass sich bei einem weiteren Schritt seines Reittieres die Spitzen unserer Stiefel berührt hätten. So nahe waren wir uns lange nicht mehr gekommen.
Mir lief ein Schauer nach dem anderen über den Rücken, gleichzeitig brach mir am ganzen Leib der Schweiß aus. Meine Hände umklammerten die Zügel, bis die Knöchel weiß wurden. Meine Schultern schienen meinen Kopf schützend zwischen sich nehmen zu wollen. Sämtliche Muskeln spannten sich gleichzeitig so fest an, dass es schmerzte. Luft in meine Lungen zu ziehen und sie wieder hinaus zu pressen, war nur in jeweils zwei Phasen möglich. In meiner Brust hämmerte das Herz wie wild. Keine meiner über mehrere Sommer2 mühsam erlernten Techniken, um mich zu beruhigen, wollte mir mehr einfallen. Mein Gehirn war wie leergefegt. Ich schloss die Augen und kniff sie zusammen. Was auch immer er vorhatte; ich wollte es nicht sehen.
Was ich nicht aussperren konnte, war der vertraut starke Geruch nach Hegranerstahl und Waffenöl. Indessen vermisste ich die einzigartigen Körperausdünstungen meines Vaters. So panisch konnte ich gar nicht sein, dass mir diese entgingen. Ein leiser Verdacht keimte weit hinten in meinem Hirn auf, verflüchtigte sich aber so schnell, dass ich ihn nicht zu fassen bekam.
„Fanai“, erklang die gewohnte Stimme dicht an meinem Ohr. Noch etwas, was ich nicht verschließen konnte, um die Situation abzuschwächen.
„Wieso spricht er mich nicht mit meinem Taufnamen Fortan3an, was Glück bedeutet?“ Er war schon immer ein Mann gewesen, der jeden mit seinem Geburtsnamen anredete. Als ich ihm bei unserem letzten Treffen mitgeteilt hatte, dass ich nicht mehr so genannt werden wollte, hatte er meinen Einwurf einfach ignoriert.
„Fanai, du hattest doch nicht vor, Uns schon wieder zu verlassen? Wir sehen dir an, dass du dringend der Speise und einer sicheren Schlafmöglichkeit bedarfst. Beides findest du hinter den Mauern der Burg. Sei Unser Gast!“
Seine ruhig ausgesprochenen Worte überraschten mich so, dass ich die Augen öffnete und ihn ansah. Wenn ich dieses Gesicht nicht seit meiner Geburt gekannt hätte, diese Stimme mir nicht vertraut gewesen wäre, ich hätte schwören können einen anderen Mann als Baron Dekert von Karelien vor mir zu haben. Für einen kurzen Augenblick glaubte ich, ein mir völlig fremdes Gesicht hinter dem seinen durchschimmern zu sehen. Verwirrt schüttelte ich den Kopf. „Das bildest du dir ein, Fanai!“, sagte ich mir. „Es ist eine Falle! Irgendwie hat dieser Magier, den er wer weiß wo, aufgetrieben hat, einen Zauber gewirkt, um mich zu täuschen.“
Mein Gegenüber hatte meine Reaktion wohl als Ablehnung aufgefasst, denn schon änderte er seine Taktik. Ehe ich noch recht begriff, was er tun wollte, beugte er sich zu mir hinüber. Seine kräftigen Hände umfassten meine noch immer um die Zügel verkrampften Fäuste. Allein die Berührung war für mich äußerst unangenehm. Was den körperlichen Schmerz auslöste, war der enorme Druck, den er dabei ausübte. Ich schrie auf. Obwohl ich es mit eigenen Augen sah, konnte ich nicht glauben, dass seine schraubstockartige Umklammerung meine Hände öffnete. Aber erst, als ich merkte, wie mir die Zügel entglitten, wusste ich mit Sicherheit, dass er eine weitere Gemeinheit plante.
Starr vor Schreck und Schmerz musste ich mit ansehen, wie er meine Finger streckte. Fasst in derselben Bewegung presste er meine Handflächen aufeinander. Mit Entsetzen stellte ich fest, dass seine Hände die Meinigen noch immer umschlossen. Er hatte mir die Geste des Treueeids aufgezwungen. So kannte ich meinen Vater!
„Sieh Uns an, Fanai!“, befahl Dekert von Karelien mit einer fremden Stimme.
Wieder streifte ein nicht greifbarer Gedankenfetzen mein Inneres. Der Zwang, ihm Folge zu leisten, war dermaßen übermächtig, dass ich ihm nicht widerstehen konnte. Sich dagegen aufzulehnen schien mir genauso unmöglich, wie ihm meine Hände zu entziehen. Kaum blickte ich ihm ins Gesicht, nahmen mich seine grauen Augen so gefangen, dass ich in ihnen wie in einem tiefen See zu versinken drohte. Im selben Moment fiel meine ganze Anspannung von mir ab. Mein Körper hörte auf zu zittern, Atmung und Herzschlag beruhigten sich und meine Muskeln entspannten sich. Ich tat einen tiefen, befreiten Atemzug und schüttelte damit eine ungeheure Last ab. Für kurze Zeit fühlte ich mich so leicht, wie lange nicht mehr.
„Und nun Fanai, sprichst du Uns nach!“ Die Stimme schien nicht aus dem Mund meines Gegenübers zu kommen, sondern in meinem Kopf zu erklingen.
Ohne auf ein Zeichen meiner Zustimmung zu warten, soufflierte er mir die folgenden Worte: „Ich, Fortan, auch Fanai genannt, unehelich geborener Sohn des Barons Dekert von Karelien und leibliches Kind der Magd Karelena, werde Catandra, Adalar und Dilar von Matricaria ihrer Bestimmung zuführen! Ich werde die besten Voraussetzungen dazu schaffen! Sobald diese Aufgabe erledigt ist, werde ich meine Fähigkeiten in den Dienst des Mannes stellen, dem ich diesen Schwur leiste!“
Kaum hatte ich das letzte Wort ausgesprochen, verstärkte er kurz den Druck seiner Hände. Gleichzeitig sprach er mit einem wissenden Lächeln die Formel, welche auch den Treueeid abschloss, ergänzte ihn allerdings noch.
„Wir nehmen deinen Schwur an. Wir werden alles in Unserer Macht Stehende tun, um dich zu unterstützen und dir Unseren Schutz gewähren, solange du an diesen Schwur gebunden bist.“ Nun schloss er kurz die Augen, womit er die mich lähmende Verbindung unterbrach. Seine Hände öffneten sich so unerwartet, dass ich fast aus dem Sattel gekippt wäre. Mir schwindelte von der schnellen Kappung der gedanklichen Vereinigung. Deshalb war ich froh, dass er meine Schultern umfasste, als gehöre diese Geste mit zu dem Ritual. Ich war ihm nicht nur dankbar, dass er meinen mit Sicherheit schmerzhaften Sturz verhinderte, sondern auch die damit verbundene Erniedrigung. Auch wenn wir allein gewesen wären, hätte mein Selbstwertgefühl einen enormen Knacks bekommen. Noch immer verwirrt, nickte ich ihm zu. Diesmal fiel es mir seltsamerweise nicht schwer, ihm ins Gesicht zu sehen. Auch das Gefühl seiner starken Hände um meine Schultern empfand ich als Hilfestellung und nicht als neuerliche Demütigung. So faste ich das kurze Schließen seiner lächelnden Augen auch als eine stille Übereinkunft zwischen uns auf.
Als er meine Schultern losließ, verspürte ich eine Leere in meinem Herzen. Die Gedanken purzelten nur so in meinem Kopf herum. „Was geht hier nur vor? Wieso zwingt der Baron mir diesen Eid auf? Welche Bestimmung haben die Kinder? Was ist mit Dekert von Karelien geschehen? Wie kann ich Catandra, Adalar und Dilar helfen? Welcher Geist hat vom Baron Besitz ergriffen? Oder unterliege ich einer Täuschung? Das kann ich nicht glauben. Hat der Magier ihn nur zeitweise im Griff? Aber auch das kann ich mir nicht vorstellen. Für eine gespaltene Persönlichkeit, die womöglich zwei Seelen beherbergt, kommt der Baron mir zu klar in seinem Handeln vor. Wer also ist der Mann, der in der Gestalt meines Vaters im Sattel thront, wirklich?“
Ich schrakt zusammen, als Dekert von Karelien – oder wer auch immer er war – in ruhigem Ton anmahnte: „Es wird Zeit in die Burg zurückzukehren. Wer kann schon wissen, was diese Nichtsnutze von Drutmar und Ebermut wieder angerichtet haben?“
Er hatte sein Pony bereits in Richtung Burg gewendet und auch einige Schritte darauf zu schreiten lassen. Sein Blick war geradeaus gerichtet, sodass ich mir nicht sicher war, mit wem er sprach.
Seine Leibwächter hatten sich zu beiden Seiten neben mir postiert und grinsten mich wissend an. Vielleicht machten sie sich auch lustig über meine Verwirrung.
Dekert von Karelien ritt so unvermittelt an, dass selbst die beiden jungen Männer mit den Augen rollten. Natürlich äußerten sie sich nicht dazu, denn das stand ihnen ja nicht zu. Stattdessen setzten auch sie ihre Ponys in Bewegung, was auch Alda als Zeichen des Aufbruchs deutete. Ich wurde hier scheinbar gar nicht mehr gefragt. Selbst mein Reittier entschied, wohin wir uns wandten.
Wäre mein Kopf etwas klarer gewesen, hätte ich diese letzte Gelegenheit ergreifen können, um zu fliehen. Aber in diesem entscheidenden Moment war ich zu überfordert mit dem, was in der letzten Zeit auf mich eingestürmt war. Wahrscheinlich war diese Verwirrung ein zusätzlicher Grund dafür, warum ich die Verbindung zu meinem Pony nicht spüren konnte.
So folgte ich nicht ganz freiwillig, begleitet von meinem Geleitschutz, dem Baron. Dieser war dann auch so rücksichtsvoll, schon nach wenigen Schritten anzuhalten, bis wir etwa eine Ponylänge hinter ihm waren. Dann ritt er in gemäßigtem Schritttempo wieder an.
„Verzeiht Unsere Unhöflichkeit“, begann er ganz unvermittelt wieder zu sprechen, den Blick noch immer starr geradeaus gewandt. „Wir hätten euch schon längst einander vorstellen sollen, denn schließlich werdet ihr in der nächsten Zeit öfter miteinander zu tun haben.“ Er machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr. „Der junge mittelblonde Mann zu deiner Rechten nennt sich Sir Marzellus und behauptet Unser Schreiber und Leibwächter zu sein.“
Der so Vorgestellte rollte mit den Augen, lächelte aber, als ich ihm grüßend zunickte.
„Dein zweiter Begleiter nennt sich Sir Rabanus, gibt sich ebenfalls als Unser Leibwächter aus und beansprucht zusätzlich das Amt des Waffenmeisters. Zu Unserem Leidwesen müssen Wir allerdings zugeben, dass beide ihre Aufgaben sehr gut meistern.“
Auch der dunkelhäutige Sir Rabanus rollte mit den Augen, zuckte mit den Schultern, lächelte dabei aber nachsichtig.
Mir kam der Verdacht, dass die beiden ihren Herrn nicht ganz ernst nahmen. Andererseits schien dieser ein eher freundschaftliches Verhältnis zu seinen Untergebenen zu pflegen. Je mehr ich über die drei erfuhr, desto verwirrter wurde ich. Doch Dekert von Karelien ließ mir keine Zeit nachzudenken.
„Und dieser Nichtsnutz zwischen euch heißt eigentlich Fortan, soll ein Bastardsohn des Besitzers dieser Burg sein und will momentan mit Fanai angesprochen werden.“
Jetzt war es an mir, die Augen zu rollen und den beiden etwas genervt zuzulächeln. Sir Marzellus und Sir Rabanus erwiderten dies ihrerseits mit einem Nicken.
Nach einer kurzen Pause erklärte der Baron: „Wir hoffen, damit der Etikette genüge getan zu haben und wir können unseren Weg etwas schneller fortsetzen. Unser Gast ist hungrig und kann ein bequemes Lager für einen erholsamen Schlaf gut gebrauchen.“
Schon trabte sein Pony an, woraufhin wir gezwungen waren, auch unsere Reittiere in diese schnellere Gangart zu versetzen.
2. Kapitel: Auf der Burg
Welch herrliches Gefühl, einfach an nichts zu denken und über das unendlich scheinende Hochplateau zu galoppieren. Die Augen geschlossen, beide Arme seitwärts ausgestreckt, das Gesicht der Morgensonne zugewandt die Ruhe genießen. Ohne Sattel auf dem blanken Ponyrücken sitzen und die Muskeln unter sich im Gleichklang arbeiten zu spüren: Das ist Freiheit.
Waffenklirren riss mich aus dem Schlaf. Ich sprang sofort auf. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne tasteten sich durch das Fenster im Turmzimmer. Noch halb in den Bildern meines Traumes gefangen, huschte ich auf nackten Füßen zu der kleinen Öffnung in der mannsdicken Mauer. „Verdammt sind die Steine kalt! Ich hätte mir doch besser die abgetragenen Schuhe angezogen, bevor ich so unüberlegt aus dem Bett gesprungen bin. Naja, ist jetzt auch nicht mehr zu ändern!“
Abwechselnd jeweils einen Fuß gegen die Wade drückend, um ihn etwas aufzuwärmen, lehnte ich mich aus dem Fenster. Von hier oben konnte ich weit über die gerodete Fläche bis zum Waldrand blicken. Aber im Dämmerlicht des frühen Sommertages lag die Welt scheinbar noch in tiefem Schlummer, abgesehen von den Geräuschen, die mich geweckt hatten. Um deren Ursache erkennen zu können, musste ich mich allerdings noch etwas weiter hinauslehnen. Ja, ich ging sogar so weit, dass ich mich in die Öffnung setzte und die Beine außen hinunterbaumeln ließ. Was für ein Glück, dass ich keine Angst vor der Höhe hatte. Meine Kletteraktionen im Gebirge hatten sich ausgezahlt.
Nicht weit von den Außenmauern der Burg entfernt lag der Turnierplatz. Von dorther waren die Geräusche erklungen. Ich konnte zunächst nur zwei Schwertkämpfer erkennen, die in einer perfekten Einstudierung eine Kampfsequenz einübten. Nein, Üben konnte man das nicht mehr nennen. Sie schienen sie nicht nur zu beherrschen, sondern feilten an weiteren Möglichkeiten, um sie zu vervollkommnen. Mir sackte die Kinnlade herunter. Schon oft hatte ich dem alten Waffenmeister und meinen Halbbrüdern bei ihren Waffengängen zugesehen, aber eine solche Eleganz und Präzession hatte keiner von ihnen an den Tag gelegt. Dort unten führten zwei Meister ihres Fachs ein erstklassiges Lehrstück auf.
Während ich die ausgefeilte Kunst ihrer Schläge, Paraden und Ausweichmanöver bewunderte, sinnierte ich, wer die beiden Schattengestalten sein könnten. Dass es sich um meine Halbbrüder handelte, hatte ich sogleich ausgeschlossen. Solch eine Perfektion würden sie wohl nie erreichen. Selbst viele Sommer4 langes Üben allein würde sie nie so weit bringen. Weder der raubeinige Ebermut noch der hinterlistige Drutmar konnten die Disziplin aufbringen, die es erforderte, eine derartige Stufe zu erreichen. Oft genug hatte ich ihnen im Verborgenen bei ihren Übungen mit dem Waffenmeister und den Kämpfen gegeneinander zugesehen, um das beurteilen zu können. An die für mich äußerst schmerzhaften Episoden, bei denen ich als ihr Gegner herhalten musste, wollte ich jetzt nicht denken. Außerdem stimmten die Größenverhältnisse der exzellenten Schwertkämpfer nicht mit denen meiner Halbbrüder überein. Die beiden dort unten waren gleich hoch aufgeschossen und sehnig. Drutmar und Ebermut unterschieden sich jedoch ganz entschieden voneinander. Ich verglich Ebermut gerne mit einem Bären. Er hatte sowohl dessen Gestalt als auch dessen Gemüt. Drutmar hingegen war das genaue Gegenteil. Er war schlank und wesentlich kleiner. Er erinnerte mich stets an ein Wiesel, das geschickt seinen Vorteil auszunutzen versteht.
Als die Sonne etwas höher stieg, konnte ich endlich die Gesichter der Kontrahenten erkennen. Verblüfft stellte ich fest, dass es sich um Sir Marzellus und Sir Rabanus, die Leibwächter meines Vaters, handelte. Dass er sich solche meisterlichen Schwertkämpfer leisten konnte, hätte ich nie für möglich gehalten. Allerdings fragte ich mich, warum er es überhaupt für angezeigt hielt. Mit welcher Gefahr rechnete er? Hatte er Bedenken, dass seine Söhne ihn schneller beerben wollten, als er es für angebracht hielt? Wenn dem so wäre, würde zumindest immer einer seiner Leibwächter sich in seiner Nähe aufhalten müssen. Ich glaubte nicht, dass sie es gewagt hätten, ihre Posten zu verlassen. Sicherlich würde dann auch einer Wache vor seiner Kammer halten. Aber ich konnte nicht glauben, dass ein Baron Dekert von Karelien sich vor seinen Söhnen fürchtete. Umgekehrt wurde ein Schuh draus. Das hatte ich ja selbst vor zwei Tagen erlebt, als ich mit den Kindern hier angekommen war.
Oder gab es einen Gegner außerhalb der Burgmauern, den mein Vater fürchten musste? Bevor ich die Burg verlassen hatte, waren mir keinerlei Gerüchte diesbezüglich zu Ohren gekommen – und ich erfuhr mehr, als die meisten Burgbewohner glaubten.
Ich nahm mir vor, genauer nachzuforschen, doch das hatte Zeit. Jetzt genoss ich erst einmal die kostenlose und vor allem für mich ungefährliche Darbietung auf dem Turnierplatz.
So geheimnisvoll mir die beiden Leibwächter auch vorkamen, so sehr bewunderte ich sie. Während ich die Genauigkeit ihrer Angriffe und Verteidigungen genoss, verglich ich sie mit den Menschen, die ich bisher kennengelernt hatte.
Der schwarzhaarige und mit seiner dunkelbraunen Hautfarbe in unserer Region exotisch erscheinende Sir Rabanus war mir ein Rätsel. Einerseits wirkte er, unnahbar und verbreitete eine geheimnisvolle Aura. Andererseits hatte er mir schon bei unserer ersten Begegnung, als ich die Kinder übergeben hatte, zugezwinkert. Sympathisch war er mir auch, weil er seinen Dienstherrn scheinbar nicht so ganz ernst nahm. Was er sich erlaubte, hätte sich niemand hier auf der Burg gewagt. Sah ich vom Gesinde ab, das ohnehin froh war, wenn der Baron es in Ruhe ließ, glaubte ich, dass auch keiner seiner Wachposten oder der frühere Waffenmeister sich soviel herausgenommen hätten. Ebermut und Drutmar, seine legitimen Söhne, waren zwar ungehobelt und – besonders Letzterer – verschlagen, aber sich hinter dem Rücken ihres Vaters über ihn lustig zu machen, hätten selbst sie nicht gewagt.
Während ich ihm zusah, wie meisterhaft er nicht nur sein Schwert führte, sondern auch seinen Körper beherrschte, bewunderte ich ihn. Andererseits machte mir die Leichtigkeit, mit der er diese scharfe Waffe führte und scheinbar keine Bedenken hatte, seinen Partner zu verletzen, auch Angst. Ich musste schlucken, als ich mir vorstellte, ihn zum Gegner zu haben. Abgesehen davon, dass ich nur stümperhaft mit einem hölzernen Übungsschwert umgehen konnte, wäre es ohnehin unmöglich, dass er mich fordern würde. Er war ein Ritter, während ich nur der Sohn einer Magd und der uneheliche Sohn seines Dienstherrn war. Allein der Standesunterschied verhinderte, dass er auch nur auf die Idee kommen würde. Außerdem hätte der Baron uns beide, insbesondere mich, sicherlich empfindlich dafür bestraft, dass ich ein Schwert anrührte. Mir hatten schon die Übungskämpfe, die meine Halbbrüder mir aufdrängten, genug Ärger eingebracht. Sie waren einer der Gründe gewesen, weshalb ich die Burg verlassen hatte.
Sicherlich konnte er mit einem einfachen Stock genauso gut umgehen wie mit dem Schwert. Schade, dass er mir nicht ein paar Kniffe zeigen konnte, mit denen ich mich gegen Drutmar und Ebermut verteidigen könnte. Aber allein, ihn darauf anzusprechen würde schon unangenehme Folgen haben. Was wusste ich von ihm? Würde er mich auslachen, wenn ich ihn mit meinem Anliegen behelligte? Wäre es unter seiner Würde, mich auch nur anzuhören? Was, wenn er meinem Vater davon erzählte? Drohte mir dann eine noch schlimmere Strafe, als das letzte Mal? Eine Woche bei Wasser und Brot im feuchten, kalten Kerker zu verbringen, damit ich lernte, wohin ich gehörte, würde wohl in den Augen meines Vaters diesmal nicht ausreichen. Ganz sicher würde er ein Exempel an mir statuieren, damit ich nie mehr auch nur einen Gedanken daran verschwenden würde. Nein, es wäre wohl besser erst gar nicht weiter darüber nachzudenken!
Sir Marzellus wäre gewiss ein ebenso guter Lehrer für mich gewesen, aber da hatte ich das gleiche Problem wie mit Sir Rabanus. Wenn er mir auch zugänglicher schien, so konnte ich dennoch nicht ausschließen, dass er dieselben Ansichten wie sein Partner haben würde. Der mittelblonde, von der Sonne gebräunte Kämpfer, den der Baron mir auch als seinen Sekretär vorgestellt hatte, schien seinem Dienstherrn genauso wenig Achtung entgegenzubringen wie sein Übungsgegner. Trotzdem glaubte ich, dass er etwas verständnisvoller sein könnte. Vielleicht sollte ich doch …
Hier unterbrach ich meine Gedanken selbst, denn die beiden hatten soeben ihren Kampf beendet. Höflich verbeugten sie sich voreinander, nachdem sie ihre Schwerter wieder in die Scheiden hatten gleiten lassen. Auch diese nebensächliche Tätigkeit sah bei ihnen so aus, als gehöre sie zu einem festgelegten Ritual.
Was mir aber einen regelrechten Stich in die Brust versetzte, war, dass sie sich anlächelten, sich gegenseitig auf die Schultern schlugen und dann herzlich umarmten. Leider verstand ich nicht, was sie sagten. Vielleicht war es so etwas wie: „Danke, dass du bei dem Spaß mitgemacht hast.“
Wenn sie nicht so unterschiedlich gewesen wären, hätte ich in diesem Moment glatt geschworen, dass sie Brüder seien. Auf jeden Fall gingen sie so miteinander um, wie ich es mir mit meinen Brüdern gewünscht hätte. Aber von Ebermut und Drutmar konnte ich diese Herzlichkeit ganz und gar nicht erwarten. Aus der Ehe mit Vaters zweitem Ehegespons Bianca gab es noch drei weitere Brüder, die auch über meinem Stand geboren waren. Die jüngeren waren erst zwei und vier Sommer alt. Einzig Romuald, der mit seinen 15 Sommern etwa meinem Alter entsprach, weilte momentan bei einem befreundeten Adligen. Dort erhielt er eine ritterliche Ausbildung. Doch selbst, wenn er hier auf der Burg leben würde, käme auch er aufgrund seiner legitimen Abstammung nicht infrage. Die anderen acht Kinder meines Vaters – ob ehelich oder von einer Untergebenen geboren – waren alles Mädchen.
Natürlich wäre ich auch mit einer Freundschaft zu einem gleichaltrigen Jungen des Gesindes zufrieden gewesen. Für einige Zeit hatte es auch wirklich eine solche gegeben. Leider hatte Drutmar intrigiert, woraufhin der Junge die Burg verlassen musste und als Stallbursche auf einer mehrere Tagesreisen entfernten Burg untergebracht wurde. Nach diesem Vorfall waren die anderen Knaben nicht mehr an einer irgendwie gearteten Beziehung zu mir interessiert gewesen. Mittlerweile wären sie ohnehin zu alt, sich mit meinen „Kindereien“ abzugeben. Ihr Tagewerk, wenn sie noch auf der Burg weilten, begann bei Sonnenaufgang und endete bei deren Untergang. Warum ich schon immer eine Sonderstellung eingenommen hatte, war mehr dem Einfluss der Ehefrauen meines Vaters geschuldet. Dass sie mir damit eher schadeten als nützten, erkannten sie leider immer zu spät.
Durch meine Grübelei abgelenkt, hatte ich nicht bemerkt, dass die Leibwächter vom Turnierplatz verschwunden waren. Sicherlich würden sie sich gleich im großen Saal zum Frühmahl einfinden. Auch ich war für diese Zeit von meinem Vater dorthin bestellt worden. Was er von mir wollte, wusste ich zwar nicht. Aber mich dort einfinden musste ich, ob ich wollte oder auch nicht. Er war der Herr der Burg. Ihm hatten alle zu gehorchen. Hatte er mir nicht erst vor ein paar Tagen diesen seltsamen Eid aufgezwungen, dessen Ausmaß und Bedeutung ich trotz intensiven Nachdenkens nicht erfassen konnte? Wer wusste schon, welche Gemeinheit er als Nächstes plante?
Sollte ich nicht pünktlich erscheinen, würde ich es garantiert zu spüren bekommen. Baron Dekert von Karelien kannte die verschiedensten „schlagenden“ Argumente. Danach sehnte ich mich ganz uns gar nicht. Also verließ ich meinen Aussichtsplatz, zog mir meine alten, geflickten Schuhe an, kämmte mir mit den Fingern durch meine rote Haarmähne und machte mich auf den Weg nach unten. Ich hoffte nur, dass ich Ebermut und Drutmar nicht begegnete. Allerdings bestand so früh am Morgen wenig Gefahr, da beide eher Spätaufsteher waren. Meist tauchten sie erst gegen Mittag auf. Warum unser Vater ihnen diese Freiheit ließ, konnte ich zwar nicht verstehen, aber es ging mich ja auch nichts an.
Als ich die große Halle betrat, erlebte ich eine Überraschung. Nicht nur der Baron selbst saß an der langen Tafel, sondern auch seine Frau Bianca, nebst deren fünf Kindern. So etwas hatte ich in den ganzen 17 Sommern, die ich auf der Burg geweilt hatte, noch nie erlebt. Nur bei offiziellen Anlässen oder wenn sich Gäste im Haushalt aufhielten, wurde die Baronin von ihrem Gatten am Tisch geduldet. Von den Kindern durfte höchsten einmal ihre zwölfjährige Tochter Euphemia ihr Gesellschaft leisten. Allein die Anwesenheit seiner jüngeren Sprösslinge ließ meinen Vater regelmäßig aus der Haut fahren. Für ihn wurden sie erst beachtenswert, wenn sie anständig mit einer Waffe umgehen konnten oder sich als Braut eigneten. Letzteres war bei seiner ältesten Tochter bald der Fall, weshalb er sie, wenn er es für angebracht hielt, stets an den Tisch beorderte.
Auch Catandra hatte an der Tafel Platz genommen. Sie war in ein Gespräch mit der neben ihr sitzenden Euphemia vertieft. Das Thema ihrer Unterhaltung schien so interessant zu sein, dass sie nichts um sich herum wahrnahmen. Nicht einmal das Lärmen der jüngeren Kinder störte sie.
Des Weiteren verwunderte mich, dass auch seine Leibwächter mit ihm speisten. Sie saßen sich gegenüber, jeweils eines der Kinder neben sich. Zusätzlich hatte auch jeder eines der Kleinen auf dem Schoß und gab ihm zwischendurch von seinem Frühstück ab. Waren das die gleichen Männer, die ich eben noch vom Turmfenster aus beim Waffengang beobachtet hatte? Wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich bezweifeln, dass zwei so ordentlich gekleidete und überhaupt nicht müde aussehende Kämpfer an diesem Familienidyll teilhatten.
„Setz dich neben einen Unserer persönlichen Wächter und bediene dich. Nach dem Mahl haben Wir mit dir und den beiden etwas zu besprechen. Aber erst soll einmal der Leib gestärkt werden“, rief der Baron mir über den Lärm, den die versammelte Gesellschaft veranstaltete, zu. Dann wandte er sich an seine Frau und machte eine Bemerkung, die sie auflachen ließ.
Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Baronin Bianca von Karelien und ihr Mann waren noch nie so herzlich miteinander umgegangen. In seiner Gegenwart hatte ich sie zu keiner Zeit auch nur lächeln sehen. Was ich von meinem Platz im Türrahmen aus beobachtete, konnte es meiner Ansicht nach gar nicht geben.
Da sich in diesem Augenblick mein Magen meldete, nahm ich die Einladung mit der Familie zu speisen, gerne an. Ich setzte mich, wie mein Vater vorgeschlagen – und nicht etwa befohlen – hatte, neben Sir Marzellus auf die Bank. Vor mir auf dem blank polierten Eichentisch stand eine Eschenholzschale. Daneben lag ein aus Lindenholz geschnitzter Löffel.
„Guten Morgen, Fanai“, begrüßte mich der mittelblonde Leibwächter und reichte mir lächelnd den Topf mit dem heißen Dinkelbrei. Meine auf seinem Schoß sitzende Halbschwester angelte nach der Brotschale. Tatsächlich schaffte sie es, mit ihren fünf Sommern bereits, mir zielsicher eine Scheibe der dunklen Köstlichkeit neben meine Schüssel zu legen.
„Guten Morgen, Sir Marzellus, guten Morgen Baroness Leana“, grüßte ich noch immer etwas verblüfft zurück. „Ich hoffe, Ihr habt wohl geruht.“
„Jetzt halte Uns nicht mit diesen Förmlichkeiten auf, sondern nimm Uns den heißen Topf ab, bevor Wir Uns die Finger verbrennen!“, erinnerte mich der neben mir sitzende Mann daran, dass er das Gefäß noch immer in der Hand hielt.
„Entschuldigt!“ Während ich mit dem über die Hand gezogenen Hemdärmel nach dem Metallgefäß griff, duckte ich mich unwillkürlich in Erwartung einer Ohrfeige. Da diese zu meinem Erstaunen ausblieb, nahm ich mir eine Kelle Brei aus dem Topf und stellte ihn wieder zurück an seinen vorherigen Standort. Misstrauisch behielt ich Sir Marzellus im Auge. Der musterte mich dermaßen irritiert, dass die kleine Leana meinte, eine Erklärung abgeben zu müssen.
„Papa haut ihn.“
„Dafür?“ Der gutaussehende Kämpe schüttelte den Kopf und sah hinüber zu Sir Rabanus, der obwohl er den zweitjüngsten Spross der reichen Kinderschar des Barons gerade fütterte, genau mitbekommen zu haben schien, um was es ging. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich in irgendeiner mir nicht geläufigen Form, unterhielten.
Obwohl ich mich ganz meinem Brei zu widmen schien, beobachtete ich die beiden Männer verstohlen. Bisher hatte mich noch niemand dabei erwischt, wenn ich das tat. Vielleicht lag es ja auch daran, dass einem Bastard keine besondere Beachtung geschenkt wurde.
Bei Sir Rabanus und Sir Marzellus war das anders. Ihre Blicke konnte ich körperlich spüren. Daher senkte ich die Augen und gab mich ganz dem Auslöffeln meiner Schale hin. So bekam ich auch nicht mit, dass Sir Rabanus aufstand. Seine kleine Schoßbesetzerin musste er wohl der Baronin übergeben haben, denn kurz darauf verließ sie mit dem quäkenden Mädchen auf dem Arm den Saal. Ihr folgten die restlichen Kinder mitsamt Catandra. Über diesen Aufbruch konnte selbst ich nicht hinweggehen, da er beachtlichen Lärm verursachte. So schaute ich ihnen kauend hinterher. Dabei stellte ich erstaunt fest, dass Sir Rabanus nicht mehr an seinem Platz mir gegenübersaß, sondern die Tür aufhielt und schließlich hinter den zuletzt gehenden zwölf Sommer zählenden Maiden schloss.
So angenehm die plötzliche Stille auch war, so bedrückend wirkte sie auch auf mich. Nun war ich mal wieder mit meinem Vater und seinen Leibwächtern allein.
„Nur nichts anmerken lassen!“, ermahnte ich mich und legte den Löffel in die nun leere Schüssel. Als hätte sich nichts geändert, griff ich nach der Butter, die sich in der Mitte des Tisches in einer kleinen Schale befand. Mit dem Löffelstiel schmierte ich sie mir dick auf meine Brotscheibe und biss herzhaft hinein. Konnte ich wissen, wann ich die nächste Mahlzeit bekommen würde?
„Wir stören dich ja ungern beim Essen, Fanai“, sprach mich der neben mir sitzende Sir Marzellus an und erhob sich, „aber wir haben noch etwas zu besprechen. Falls du IHN nicht verärgern willst, solltest du uns jetzt begleiten.“
Für einen Augenblick war ich unfähig mich zu bewegen und starrte, ohne wirklich etwas wahrzunehmen, auf die Eichenplatte vor mir. Selbst meine Kaubewegung hatte ich eingestellt. Der Speichel hatte sich aus meinem Mund verabschiedet und machte mir ein Herunterschlucken des Bissens unmöglich. Mein Brot hielt ich auf halbem Weg zwischen Tisch und Mund in der Luft. Die andere Hand hatte ich um den Holzbecher mit warmer Ziegenmilch gekrallt. Meine Nackenhaare stellten sich auf und mir lief ein eisiger Schauer über den Rücken.
Nein, es waren nicht seine Worte gewesen, die mich dermaßen lähmten. Es war vielmehr die direkte Nähe beider Leibwächter. Ohne mich umzublicken, wusste ich, dass Sir Rabanus derweil hinter mir stand.
„Deine Scheibe Brot und den Becher mit Milch kannst du mitnehmen“, versuchte Sir Marzellus die Lage etwas zu entspannen. „Sicherlich wird unser Dienstherr nichts dagegen haben, wenn du deine Morgenmahlzeit beendest.“
Mir aber war der Hunger schlagartig vergangen. Ich nahm die Hand vom Becher und ließ das angebissene Dinkelbrot in die Breischüssel fallen. Meine fettigen Finger wischte ich an der ohnehin dreckigen Hose ab. Nun wäre ich bereit zum Aufstehen gewesen, zumal Sir Marzellus bereits über die Bank gestiegen war. Einer deutlicheren Aufforderung hätte es nicht mehr bedurft.
Dass ich nicht dazu kam, mich selbst zu erheben, verdankte ich den zupackenden Händen der beiden Männer. Jeder von ihnen umschloss mit jeweils einer Hand einen meiner Oberarme. Ihre andere Hand legten sie von hinten gegen meine Schulterblätter. Als würde ich nichts wiegen, hoben beziehungsweise zogen sie mich von der Bank. Bei ihren Berührungen überlief mich ein Schauer nach dem anderen. Erst, nachdem meine Füße wieder Boden spürten, merkte ich, dass ich zitterte. Ich weiß nicht, ob es ihrer ursprünglichen Absicht entsprang, dass sie so geschickt die Hände wechselten, um zu verhindern, dass ich mich sogleich auf die Holzdielen gesetzt hätte. Wahrscheinlich ließ ich ihnen auch keine andere Wahl, als mich zwischen sich zur Tür am anderen Ende der großen Halle zu führen. Dass sie zuvor aber noch daran dachten, meine Mahlzeitreste mitzunehmen, bekam ich zunächst gar nicht mit.
Was ich ebenfalls nicht bemerkt hatte, war, dass mein Vater die Halle bereits verlassen hatte. Er erwartete uns in seiner Schreibstube im ersten Obergeschoss des Nordturmes.
Bei unserem Eintreten saß er – der Tür gegenüber – in einem mit Schnitzereien versehenen Eichenstuhl. Vor ihm auf einem kleinen Tisch lagen einige Dokumente, die er mit einer Bewegung zur Seite schob. Mit einem herzhaften Lachen quittierte er, was seine Leibwächter außer mir noch mitgebracht hatten.
„Wie seid ihr denn damit die Treppe hinaufgekommen?“, wollte er prustend wissen.
Mir war nicht ganz klar, ob er mich oder meine Mahlzeitenreste meinte. Entsprechend musste ich ihn wohl auch angesehen haben, denn ein erneuter Lachanfall schüttelte ihn.
„Fanai hat es mit Unserer Hilfe geschafft die Stiege zu bewältigen“, erklärte Sir Rabanus und kicherte vor sich hin.
„Inzwischen haben Wir Uns um sein Essen gekümmert. Speisen zu verschwenden halten Wir für keine gute Idee, zumal wenn man noch nicht satt ist“, fügte Sir Marzellus hinzu, stellte Becher und Schale auf die freigewordene Stelle auf dem Tisch und schloss die Tür. Auch er lachte nun lauthals.
Was daran so lustig war, konnte ich nicht verstehen. Zumindest löste ihre gemeinsame Erheiterung die für mich so angespannte Stimmung. Trotzdem war ich froh, als Sir Rabanus mit der freien Hand einen Lehnstuhl heranzog und ihn hinter mir postierte. Als er mich losließ, plumpste ich regelrecht hinein. Auf dem Weg nach oben hatte ich mich wieder soweit gefangen, dass ich von ihm gestützt, mit zitternden Knien den Aufstieg bewältigt hatte. Endlich wieder zu sitzen, fühlte sich bedeutend besser an.
Ohne einen von ihnen direkt anzusehen, schaute ich mich um, wo die Leibwächter sich postiert hatten. Ich war es gewohnt, mir einen Fluchtweg offen zu halten. Diesmal gab es keinen.
Sir Rabanus lehnte gegen die geschlossene Tür. Sir Marzellus hatte es sich in der Fensternische bequem gemacht. Abgesehen davon, dass auch mein Vater mit einer schnellen Bewegung meine mögliche Flucht hätte vereiteln können, rechnete ich mir nicht die geringste Chance gegen seine Leibwächter aus. Noch am frühen Morgen hatten sie mir mit ihrer Kampfvorführung deutlich bewiesen, wie reaktionsschnell sie waren.
Kurz kam mir der Gedanke, dass der Waffengang mitnichten ihrer körperlichen Ertüchtigung gegolten hatte. Im Nachhinein betrachtet, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie mich keinesfalls bemerkt haben sollten. Solche Meister der Schwertkunst würden selbst im heißesten Wettstreit ihre Umgebung keineswegs aus den Augen verlieren. Mein Blick streifte ihre Gesichter und ich glaubte ein wissendes Lächeln, sowie ein kurzes Nicken dort erkannt zu haben. Konnten sie etwa Gedanken lesen? Oder stand mir meine Frage so deutlich ins Gesicht geschrieben? Mittlerweile hatten sich alle drei wieder von ihren Heiterkeitsausbrüchen erholt. So konnte ich mir fast sicher sein, dass ihre Entgegnung nichts mit ihren Feststellungen zu tun hatte.
„Uns ist zu Ohren gekommen“, brachte mich mein Vater wieder in die Wirklichkeit zurück, „dass es bei deiner ersten Wache vor der Kemenate der Komtess Catandra zu einem Zwischenfall gekommen ist.“
Entgegen der Art, wie er sonst mit mir umging, zeigte er sich neugierig. Dies veranlasste mich, ihn kurz anzusehen, bevor ich mich in den Anblick meines Butterbrotes vertiefte, dass ich allzu gerne noch gegessen hätte.
Ja, ich war aufgeregt. Nach allem, was ich mit meinem Vater und durch ihn erlebt hatte, fühlte ich mich in dessen Nähe nie sicher vor irgendwelchen Repressalien. Hinzu kam auch noch die Anwesenheit der beiden kampferprobten Männer. Trotzdem lockte mich der Rest meiner Frühmahlzeit.
„Nimm einen Schluck Milch!“ Die Aufforderung Sir Marzellus ließ mich aufblicken. Aber nicht ihn, sondern meinen Vater sah ich an. Der nickte nur und wies auf den vor mir stehenden Becher. „Woher wissen sie, dass mein Mund ganz ausgedörrt ist?“
Schnell wandte ich meinen Blick dem Becher und dessen Inhalt zu. In der Annahme, noch weitere Flüssigkeit für meinen trockenen Mund zu benötigen, nahm ich nur zwei große Schlucke. Kaum hatte ich den Becher wieder auf dem Tisch abgesetzt, räusperte der Baron sich vernehmlich. Eine Ermahnung, ihm endlich zu antworten.
Mit noch immer auf das Brot gewandtem Blick spielte ich die Angelegenheit herunter: „Es war nichts. Sir Drutmar hat mich nur etwas necken wollen.“
„Da ist Uns aber etwas ganz Anderes zugetragen worden“, baute mein Vater mir unerwartet erneut eine Brücke. Normalerweise hätte er es damit bewenden lassen und hätte mich hinaus an meine Arbeit geschickt.
„Was ist mit ihm passiert, dass er sich so verändert hat?“, fragte ich mich, entgegnete ihm aber etwas bestimmter: „Da hat man Euch falsch berichtet.“
So gut ich es schaffte meine Aufgeregtheit aus meiner Stimme fernzuhalten, so wenig konnte ich meine ruhelosen Finger unter Kontrolle bringen. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, sie ruhig auf den Oberschenkeln liegen zu lassen. Aber sie führten ein Eigenleben. Abgesehen davon, dass sie ständig feucht waren und danach verlangten an der Hose abgewischt zu werden, ballten sie sich immer wieder zu Fäusten. Kaum, dass ich sie bewusst geöffnet hatte, schlossen sie sich erneut.
„Du stellst Uns also als Lügner hin“, klagte mich Sir Rabanus an. Er hatte seinen Platz an der Tür verlassen und setzte sich, mir zugewandt auf die Armlehne meines Stuhls.
Noch ehe ich richtig begriff, wie er so rasch dorthin gekommen war, umfasste seine bronzefarbene Hand meinen Unterkiefer. Im selben Moment jagte von dort ein Gefühl durch meinen Körper, das mich an Wasser erinnerte. Wie eine Welle über die Haut streicht, wenn man am Ufer eines ruhigen Sees lag, nur eben innerlich, so fühlte es sich an. Es war zwar beängstigend, veranlasste mich aber auch, ihm keinen Widerstand entgegenzusetzen, als er mein Kinn anhob und mein Gesicht in seine Richtung drehte. Für einen kurzen Augenblick war ich gezwungen, ihm in die nachtschwarzen Augen zu sehen. Schnell senkte ich die Lider, denn sein raubtierhafter Blick sagte mir mehr, als ich wissen wollte.
Wieder einmal war mein Mund trocken und ich versuchte verzweifelt zu schlucken. Ich räusperte mich, brachte dann aber doch nur flüsternd heraus: „Das habe ich nicht gesagt.“
„Was hast du dann damit gemeint?“ Seine lauernden Worte machten mir Angst, zumal er den Druck auf meinen Kiefer gleichzeitig verstärkte. „Sieh Uns in die Augen, Fanai!“
Ich versuchte ein paar Mal zu schlucken, bevor ich flüsterte: „Ich … kann … nicht.“ Plötzlich zitterte ich am ganzen Körper. Nicht etwa, dass dieser geheimnisvolle Mann irgendetwas getan hätte, um diese Reaktion bewusst auszulösen. Jedenfalls nichts wie das mit der Welle.
„Sir Rabanus, mäßigt Euch!“, schaltete sich zu meinem Erstaunen sein Dienstherr ein. „Ihr seht doch, wie verängstigt er ist. Bitte geht an Euren Platz zurück und überlasst es kühleren Gemütern, den Jüngling zu befragen!“