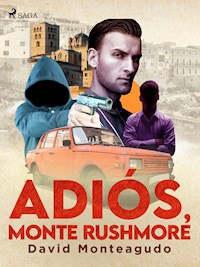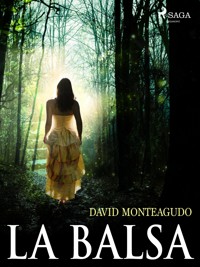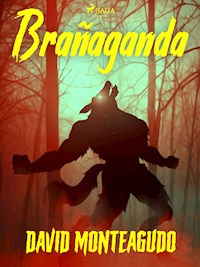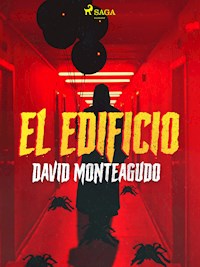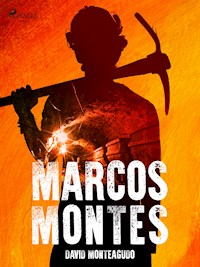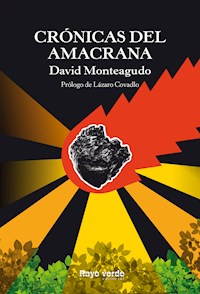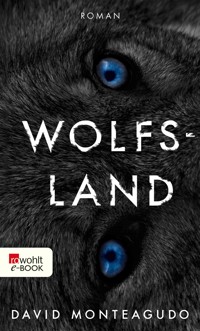
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Vollmond in der archaischen Landschaft der galicischen Berge: Eine Serie von Frauenmorden erschüttert das Dorf Brañaganda. Die Bauern haben dafür nur eine Erklärung – ein Werwolf treibt sein Unwesen. Der Waldhüter Enrique, verheiratet mit der Dorfschullehrerin und verantwortungsbewusster Familienvater, versucht als Einziger, Vernunft in die vom Aberglauben bestimmte Aufklärung der Morde zu bringen. Doch ausgerechnet Enrique muss die Grenzen der Rationalität erfahren. Als er sich in eine junge Frau verliebt, gerät sein Leben außer Kontrolle. Und eines Nachts steht der Werwolf vor ihm und stellt ihn vor eine unmögliche Wahl: «Ich habe Hunger. Du musst dich entscheiden, deine Frau oder deine Geliebte.» Ein fulminanter Roman über den Willen zur Vernunft und die zerstörerische Kraft der Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
David Monteagudo
Wolfsland
Roman
Aus dem Spanischen von Matthias Strobel
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Vollmond in der archaischen Landschaft der galicischen Berge: Eine Serie von Frauenmorden erschüttert das Dorf Brañaganda. Die Bauern haben dafür nur eine Erklärung – ein Werwolf treibt sein Unwesen.
Der Waldhüter Enrique, verheiratet mit der Dorfschullehrerin und verantwortungsbewusster Familienvater, versucht als Einziger, Vernunft in die vom Aberglauben bestimmte Aufklärung der Morde zu bringen. Doch ausgerechnet Enrique muss die Grenzen der Rationalität erfahren. Als er sich in eine junge Frau verliebt, gerät sein Leben außer Kontrolle. Und eines Nachts steht der Werwolf vor ihm und stellt ihn vor eine unmögliche Wahl: «Ich habe Hunger. Du musst dich entscheiden, deine Frau oder deine Geliebte.»
Über David Monteagudo
Inhaltsübersicht
Für Olga
Der Mut und die Waffe nützten nichts,
denn die wilde Bestie
hielt nie inne in ihrem Furor,
als wüteten in ihr
die Feuer Molochs und des Satans.
Rubén Darío, Die Gründe des Wolfs
Erster Teil
Das Haus und die Schule
Annäherung
Wir werden über ein kaltes, schäumendes Meer fliegen. In rasendem Flug; in einer Höhe, von der aus wir sein majestätisches Wogen erkennen können, die wechselnden Töne des aschigen Blaus und die Schaumbüschel, die auf dem klatschenden Kamm der Wellen tänzeln.
Wir werden in Richtung Süden fliegen; und nach mehreren Meilen über der eintönigen Landschaft werden wir an eine gerade, schroff wie eine Mauer aufragende Küste gelangen: an ein Stück Erde, dessen Grün bis an den Rand der Klippen reicht; Klippen, zu deren Füßen sich mit ohrenbetäubendem Gebrüll, vor dem das Land erzittert, die Wellen brechen; Klippen aus grauem Stein. Wie eine Schicht Blätterteig, dessen unterstes Blatt für immer verloren ist, zurückerobert von den feuchten, Wasser schwitzenden Gezeiten, überzogen von einem blassen Aussatz kleiner Muscheln.
Aber die felsige Böschung der Küste hat eine Wunde, und auf die halten wir zu. Es ist die breitgezogene Mündung einer Ria, durch die das Meer ins Land stößt, schwächer wird und dort, wo es sich mit dem Süßwasser des Flusses mischt, zwischen die Berge zwängt.
Aber die Ria ist nicht unser Ziel. Genau in der Mitte fliegen wir über sie hinweg, lassen die bunte Geschäftigkeit an beiden Ufern zurück. Die Dörfer mit ihren Fischerbooten, die sich auf glitzernden Lichttupfern wiegen, dringen immer tiefer ein in den Schoß der Berge, in die Ausläufer eines Massivs, das seine Gipfel reckt, so weit unser Auge reicht.
Wir folgen dem Fluss zu seinen Quellen. Sehen, wie sein Bett ansteigt, sich in das gewaltige Massiv gräbt, immer weiterschlängelt, wie die Vegetation immer dichter und wilder wird und das Grün immer dunkler und karger. Sehen verstreut auf den Hängen liegende Örtchen; die immer wieder hinter Baumwipfeln verschwindende Linie einer schmalen Straße, die hartnäckig dem gewundenen Lauf des Flusses folgt.
Dann verschwinden die Straße und das baumgesäumte Flussbett aus unserem Blickfeld, weil wir nach rechts schwenken und dem Verlauf einer anderen Straße folgen, die noch schmaler ist, eigentlich nur ein Weg, der sich im Zickzack den Berg hinaufwindet, weg vom Tal, hinauf zu einer Hochebene, auf der nichts mehr wächst; und auf der anderen Seite wieder hinunter, hinein in ein weiteres Tal oder vielmehr eine Schlucht, die noch enger ist, noch felsiger.
In diesem Tal treffen hohe Berge aufeinander, Berge mit runden, felsübersäten und dem Wind schutzlos ausgelieferten Gipfeln, auf denen infolge eines Brandes oder habgierigen Abholzens nur noch gräuliches Gestrüpp wächst. Die Berge strahlen Gelassenheit aus, etwas Mütterliches, wie alte, stattliche Matriarchinnen; weiter unten fallen die Hänge steil ab und verleihen dem Tal ein zerklüftetes Profil. Die Hänge wirken wie ausgekleidet mit dichten Laubwäldern, die sich emporwinden; unterbrochen werden sie immer wieder von felsigen Halden oder Viehweiden und Ackerland, die die Vertikale unterteilen. In der Tiefe hüpft nervös ein junger Fluss und beruhigt sich wieder, wo die Vegetation dichter wird; nur versprengte Höfe und ab und zu ein einsames Gebäude zeugen davon, dass hier auch Menschen leben.
Wir werden diesen Ort Brañaganda nennen. Es ist der Schauplatz unserer Geschichte.
Brañaganda ist gar nicht so weit entfernt von dem Meer, über das wir einige Minuten zuvor geflogen sind; wenn wir uns umwenden und zurückblicken, nach Norden hin, können wir es noch als diesigen Streifen erkennen, als ein diffuses Blau, das den Horizont überlagert. Tatsächlich kann man es an wolkenlosen Tagen sehen, vom höchsten Berg aus, dessen Gipfel so rund ist wie die Brust einer Frau.
Aber die meisten Bewohner der Schlucht haben das Meer noch nie gesehen und dürfen auch nicht darauf hoffen, es jemals zu sehen. Sie leben und werkeln in den Tiefen des Tals oder auf den Feldern am Fluss, in ihrer großen Armut einzig und allein darauf bedacht, einen weiteren Tag zu überleben, abgeschnitten vom eigentlich doch so nahen Ozean durch eine Landschaft, die so rau ist wie ihre Rückständigkeit und ihre jahrhundertealte Isolation.
Diese Gegend ist also der Schauplatz unserer Geschichte, und seine Bewohner werden ihre Protagonisten sein. Im Grunde hat diese Geschichte schon begonnen, haben ihre Darsteller ihr Spiel bereits aufgenommen: Auf einer steil in Richtung Fluss abfallenden Wiese erkennen wir zwei Figuren, winzig wie Ameisen, die den grünen Hang erklimmen.
Die steilen Wiesen
Ich werde nie den Tag vergessen, an dem der Werwolf zum ersten Mal zuschlug.
Cándida und ich hatten uns, wie so oft in der halben Stunde Freizeit zwischen Schule und Mittagessen, zur Braña de Boral, einer nahen steilen Wiese, davongestohlen.
Meine Mutter sah noch, wie wir losrannten, und rief uns – im Glauben, dass wir es hören würden – hinterher, wir sollten nicht zu lange bleiben, weil das Essen bald fertig sei. Meine Mutter war die Lehrerin im Dorf, und weil wir gleich neben der Schule wohnten, saßen mittags immer Schüler mit am Tisch, die von abgelegenen Höfen im Tal kamen. Meine Mutter bot ihnen eine warme Mahlzeit an, weil sie von zu Hause meist nur ein Stück trockenes Brot und etwas Speck mitbrachten, mit dem sie dann über den Tag kommen mussten.
Meine Mutter wusste, dass Cándida und ich es uns zur Gewohnheit gemacht hatten, nach der Schule auf der Braña de Boral herumzutollen. Die Braña war eine große Wiese, so quadratisch wie eine Tischdecke, die mitten auf einem abschüssigen Hang lag, was sie für uns natürlich besonders attraktiv machte, zumal sie von der Schule aus, obwohl so nah, nicht zu sehen war. Um zu ihr zu gelangen, musste man nur die Brücke an der Mühle überqueren und dann rechts einige Meter der Corredoira folgen, einem Pfad, der das Flussbett säumte.
Cándida und ich rannten immer bis zum Fuß des Hangs, der wie eine Mauer von Eichen und mannshohen Farnen umgeben war. Dort hielten wir an und sahen nach oben, zur steilen Wiese, einer Wand aus Gras, die fast senkrecht aufragte und deren Ende wir nicht erkennen konnten, weil sie sich oben sanft rundete.
Ohne uns vorher abzustimmen, ja ohne uns auch nur anzusehen, beendeten wir den kurzen Moment des Innehaltens und rannten wieder los oder vielmehr krabbelten auf Händen und Füßen, rutschten immer wieder aus, die frischen Kuhfladen vermeidend.
Cándida war größer und schlanker als ich und – was ich nur ungern zugab – auch stärker. Mit einem gewissen Gefühl von Scham erinnere ich mich daran, wie sie mich einmal unter den Armen packte und ein gutes Stück trug, ohne sich von meinem Strampeln beirren zu lassen. Sie war blond und von blasser Hautfarbe, wirkte eher zart und zerbrechlich; aber sie hatte einen starken Willen, und in ihren dünnen Armen lag eine unvermutete Kraft.
Den Wettlauf den Hang hinauf hatte sie aber noch nie gewonnen. Auch diesmal kam ich einige Sekunden vor ihr oben an und stützte mich trotz des rostigen Stacheldrahts an den alten Holzzaun, der unter meinem Gewicht leicht nachgab, als wäre auch er müde. Kurz darauf traf auch Cándida ein und lehnte sich ebenfalls an den Zaun. Raue, schiefe Grashalme, die davor wuchsen, kitzelten sanft unsere Waden. Wir waren vollkommen erschöpft, unsere Muskeln waren wie betäubt, und aus Mangel an Sauerstoff war uns so schwindlig, dass wir gierig nach Atem rangen. Die kalte Luft brannte uns in den Lungen und auf den Wangen. Vor uns lag die Landschaft in all ihrer Pracht.
Der Winter war fast zu Ende. Die Sonne schien, aber von Westen her wehte stetig ein kalter Wind, der eine Wolkenherde den Himmel entlangtrieb. Schnell und geräuschlos wanderten die Schatten unaufhaltsam den Hang hinunter; überquerten diagonal den gewundenen Lauf des Flusses, zeichneten ihr zärtliches Wogen auf die Berge und verloren sich am Ende des Tals. Wir lehnten eine Weile nebeneinander an dem Zaun, ohne uns anzusehen und ohne zu sprechen, ergriffen von der Majestät der Landschaft; wir hörten, wie der Wind pfiff, wenn er die Berge streifte, das Muhen und Bimmeln in der Stille des ländlichen Mittags.
Der Anblick der gleitenden Schatten hatte etwas Wunderbares, Phantasieanregendes. Nichts in diesem abgelegenen, in der Vergangenheit versunkenen Tal flog so rasch dahin wie jene großen, an den Rändern ausgefransten grauen Flecken: nicht das stotternde Motorrad von Avelino und auch nicht das Pferd, mit dem der Señor de Besteiro über die Brache von Coudelo galoppierte, wenn er gelegentlich auf Besuch in der Schlucht war.
Die Natur schien sich darauf verlegt zu haben, bis in alle Ewigkeit dieses merkwürdige Vorüberziehen flüchtender Wolken hervorzubringen, das in immer regelmäßigerem Takt vonstattenging. Cándida und ich folgten der Bahn der Schatten, die auf den Bergen hinter uns Gestalt annahmen und dann, ganz kurz nur, genau über die Braña hinwegwanderten. Wir hatten uns ein Spiel ausgedacht, bei dem wir erraten mussten, wann der Schatten, wenn er eine nahegelegene Anhöhe bedeckte – und dann schleppend und trügerisch langsam eine unserem Blick verborgene Ebene entlangeilte –, uns erreichen und uns für einen kurzen Moment das Sonnenlicht rauben würde.
Wie gebannt und mit einem Anflug von Furcht auf ihrer leicht gerunzelten Stirn erwartete Cándida den Schattenhieb.
«Mal sehen, ob wir schneller sind als die Wolke!», rief sie mir zu.
«Au ja, sobald der Schatten auf den Hügel dort drüben fällt, rennen wir los!», willigte ich sofort ein.
Kurz darauf tauchte eine geeignete Wolke auf. Der richtige Moment war gekommen. Als der Schatten den Hügel erreichte, rannten wir los, die Wiese hinunter, vor Erregung kreischend. Der Hang war so steil, dass wir mehr sprangen als rannten, in großen, unkontrollierten Schritten, die regelrecht weh taten.
«Sie darf uns nicht einholen!»
Aber die Wolke – oder vielmehr ihr Schatten – fegte auf halber Strecke gnadenlos über uns hinweg. Wir gaben uns geschlagen und stellten jeglichen Versuch, das Gleichgewicht halten zu wollen, ein. Das aufrechte Laufen war in Wahrheit längst ein Fallen, und so ließen wir uns den restlichen Hang einfach hinunterrollen. Das Blau des Himmels und das Grün der Wälder kreisten in schwindelerregender Geschwindigkeit um uns herum, bis eine Stufe im Hang, nur wenige Meter vom unteren Rand entfernt, das rasende Kullern bremste. Als ich mich aufsetzte, schwankte die Wand aus Gras, ja das ganze Tal schien abwärts zu driften. Aber dann ließ das Schwindelgefühl nach, und mir fiel auf, dass ich einen halben Kuhfladen mitgerissen hatte, der nun an einem Faden meines Pullovers hing.
Die Stufe im Hang hatte auch Cándida abgebremst, die merkwürdig verrenkt einige Schritte von mir entfernt lag. Wir sahen uns an. Als wir uns gegenseitig vergewissert hatten, dass wir heil geblieben waren, brachen wir wegen des trockenen Kuhmists an meinem Ärmel in Gelächter aus, berauscht noch vom Hochgefühl unseres rollenden Falls. Da bemerkte ich, dass Cándidas Rock – der graue, formlose Rock eines Landmädchens – sich bis zu ihren Hüften nach oben geschoben hatte.
Sie trug lange, dicke Winterstrümpfe aus grüner Wolle, die schon einige Löcher hatten. Der Anblick dieser zerknitterten, ohne Anmut heruntergerutschten Strümpfe war mir vage unangenehm. Aber das, was von ihren weißen, straffen Schenkeln zu sehen war, schien mir perfekt in seiner Fülle.
Sie bemerkte meinen Blick; und ich bemerkte, dass sie ihn bemerkt hatte. Wir lachten weiter, aber in unser Lachen schlich sich ein schiefer Ton. Cándida streifte ihren Rock nach unten, in aller Ruhe, als weigerte sie sich, dem Vorfall eine besondere Bedeutung zu verleihen. Das Lachen verstummte von selbst.
«Los», rief sie, als hätte sie plötzlich ihre Lebendigkeit wiedergefunden, «lass uns gehen. Ich sterbe vor Hunger.»
Eine unerwartete Begegnung
Schon vom schattigen Pfad aus sah ich in der Kurve an der Mühle Felipe del Couso, den Müller, am Brückengeländer lehnen, wie so oft, wenn Cándida und ich dort vorbeikamen. Es passte mir ganz und gar nicht, dass er dort stand, mit seiner tief in die Stirn gezogenen Baskenmütze, in gewohnt frecher Pose, den Hintern an den Steinen, die bereits dessen Form angenommen zu haben schienen.
Felipe provozierte Cándida immer, wenn wir die Brücke überquerten. Er versuchte, sie mit kindischen Fragen aufs Glatteis zu führen oder alberne Scherze mit ihr zu treiben, auf die sie jedes Mal hereinfiel. Mich ärgerte seine Aufdringlichkeit; auch störte es mich, dass er immer nur mit ihr sprach und mich dabei vollkommen ignorierte. Mir missfiel der boshafte Ton seines Spotts, sein kindisches Getue – gerade er, der Erwachsenen gegenüber eine solche Härte an den Tag legte –, das nur dazu diente, sich an Cándida heranzumachen.
Aber die Brücke war der einzige Weg über den Fluss. Wenn wir zurück zur Schule wollten, blieb uns nichts anderes übrig, als sie zu überqueren.
Cándida brauchte etwas länger, um Felipe del Couso zu bemerken, aber als sie ihn sah, blieb sie instinktiv stehen, nur kurz, um dann die Seite zu wechseln, damit ich zwischen ihr und dem Müller war. Stolz und Verantwortungsgefühl erfüllten mich, die aber in sich zusammenfielen, je mehr wir uns der unseligen Kurve näherten. Ich hielt mich so eng wie möglich am linken Wegrand und versuchte es mit der Vogel-Strauß-Politik: indem ich auf den Boden starrte und unbemerkt zu bleiben hoffte.
Plötzlich ertönte die selbstherrliche, unsympathische und Neugier heuchelnde Stimme Felipe del Cousos.
«Wo willst du hin, Kleine?», fragte er, wobei er die Betonung ganz auf das «hin» legte.
Bitte antworte ihm nicht, dachte ich im Stillen. Aber vielleicht ließ Cándida sich dadurch täuschen, dass Felipe diesmal nicht spöttisch oder schmeichelnd klang, sondern eher wie ein Erwachsener, der mit einem Kind spricht; jedenfalls überhörte Cándida meine stumme Bitte und tat drei schreckliche Dinge. Sie blieb abrupt stehen, drehte sich zu Felipe del Couso um und antwortete:
«Ich werde bei der Lehrerin zu Mittag essen.»
Nur ihre Stimme ließ mich hoffen. Ihre unschuldige, samtige Stimme, die diesmal etwas Herausforderndes hatte, einen Anflug von Autorität und Misstrauen.
«Deshalb also wirst du immer hübscher, weil du dich einladen lässt! Komm mal kurz her, Kleine.»
Er löste sich von der Brüstung, behielt Cándida fest im Auge und ging zwei Schritte auf sie zu. Es wirkte so, als hätte er an ihr etwas entdeckt, was ihm Sorgen bereitete. In diesem Augenblick sah ich den Fleck auf seiner stets von Mehl bestäubten Hose. Auf der Höhe der Tasche war ein roter Fleck; ein dunkelroter Fleck, der sich von innen her auszubreiten schien.
«Geh nicht!», flüsterte ich Cándida zu und hielt sie am Ärmel fest.
Aber sie ging brav auf den Müller zu und hielt seiner möglichen Boshaftigkeit ihre herausfordernde Unschuld entgegen.
Felipe nahm ihren goldgelben Kopf zwischen die Hände und musterte mit dem prüfenden Blick eines Arztes oder Naturforschers ihr blasses Gesicht.
«Mal schauen … Aber … Ah, du Flittchen!», rief er plötzlich. «Hab ich mir’s doch gedacht! Du schminkst dir die Lippen!»
«Tu ich nicht!», protestierte Cándida, empört über diesen ungerechtfertigten Vorwurf. «Meine Lippen sind von Natur aus so!»
«So, so. Ich habe eine unfehlbare Methode, um rauszufinden, ob kleine Mädchen sich die Lippen schminken! Dafür muss ich dich allerdings einem kleinen Test unterziehen.»
«Von mir aus», erwiderte Cándida mit dem herablassenden Hochmut einer Königin. «Du wirst schon sehen, dass nichts dabei rauskommt.»
Vorsicht, Cándida!, dachte ich entsetzt, wagte aber nicht, es laut auszusprechen. Er hat einen Blutfleck auf der Hose!
Der Müller stellte sich hinter sie, legte einen Arm um ihren Bauch und zog sie zu sich heran. Erst in dieser Haltung war zu erkennen, dass Cándida fast so groß war wie er.
«Vorsicht, Cándida!», rief ich, weil ich nicht mehr an mich halten konnte, als Felipe del Couso seine freie Hand in die Hosentasche steckte: in die Hosentasche mit dem Fleck!
Alles ging ganz schnell. Er zog die Hand heraus, lachte dreckig und rieb mit plumper Hastigkeit etwas auf Cándidas Lippen. Was er da auf ihre Lippen rieb, waren wilde Beeren. Schlehen, so rot wie Blut. Als Cándida die klebrige Masse spürte, wurde ihr klar, dass er sich einen Scherz mit ihr erlaubte, und sie versuchte, sich aus seinen Armen zu winden.
«Immer legst du mich rein, du Lügner!», protestierte sie halb verletzt, halb wütend. «Lass mich los!»
Gerissen, wie er war, hielt Felipe del Couso seine Gefangene weiterhin fest und ließ sich nicht davon beirren, dass sie sich mit den Ellenbogen heftig wehrte.
«Siehst du?», sagte er amüsiert und konnte vor Lachen kaum noch an sich halten. «Du schminkst dich eben doch!»
Plötzlich hob Felipe den Blick und sah zu dem Weg hinter mir. Im Bruchteil einer Sekunde veränderte sich seine Miene, und er ließ Cándida los, die mit vor Ekel verzerrtem Gesicht zu mir rannte und sich mit dem Handrücken den Mund abwischte. Ich drehte mich um. Auf dem Weg stand mein Vater. Die Spannung in der Luft war so groß, dass ich mich nicht einmal wunderte, ihn zu sehen, obwohl er mitten in der Woche und um diese Uhrzeit nicht dort hätte sein dürfen.
Felipe del Couso hingegen wirkte nicht sonderlich überrascht. Er lachte so spöttisch wie zuvor, was allerdings im Widerspruch stand zu dem Kräftegleichgewicht, das sich gerade neu gebildet hatte.
«Du kleine Teufelin!», rief er und klopfte sich mit merkwürdiger Schmerzensmiene auf die Arme. «Was hat dieses verflixte Mädchen für eine Kraft! Was machen Sie denn hier, Herr Lehrer?»
«Gibt es in der Mühle nichts zu tun?», fragte mein Vater kurz angebunden.
«Na ja», antwortete Felipe und zog die Vokale in die Länge. «Meine Frau ist ja da.»
«Vielleicht sollten Sie lieber ihr unter die Arme greifen als einem Mädchen, das zufällig des Wegs kommt.»
«Von einem Mädchen kann ja wohl nicht mehr die Rede sein. Gedeiht prächtig, die Kleine!»
Mein Vater ignorierte die Bemerkung, zog ein strahlend weißes Taschentuch aus seiner Jackentasche und ging zu Cándida. Für einen Moment hatte es den Anschein, als wollte er ihr den Mund abwischen, der von der kräftigen Schlehentinte hässlich verschmiert war, aber im letzten Moment drückte er ihr lediglich das Taschentuch schroff in die Hände.
«Los, wisch dir den Mund ab!», befahl er ihr mit plötzlicher Ungeduld. «Dann gehen wir nach Hause.»
«Kann einem schon leidtun, die Kleine, Herr Lehrer! So ganz ohne Vater, der auf sie aufpasst, wo sie sich doch ständig draußen herumtreibt. Irgendwann wird sich ein junger Kerl in einer Scheune an ihr vergreifen, und dann wächst ihr ein Bäuchlein. Diese jungen Dinger lassen sich doch auf den Erstbesten ein, der sie anspricht.»
Mein Vater war schon in Richtung Schule losgegangen, aber als er diese Bemerkung hörte, blieb er stehen, senkte den Kopf und atmete tief aus, als koste es ihn große Anstrengung.
«Gerade weil sie keinen Vater hat», sagte er bedächtig, ohne sich zu dem Müller umzudrehen, «sollten alle im Dorf ein bisschen Verantwortung übernehmen und auf sie aufpassen, damit das nicht passiert, worauf Sie anspielen.»
«Wenn Sie meinen, Herr Lehrer.»
«Und nennen Sie mich nicht Herr Lehrer!», fiel ihm mein Vater ins Wort und drehte sich so heftig um, dass es mir übertrieben vorkam. «Meine Frau ist die Lehrerin; ich hingegen habe mein Lebtag noch nicht unterrichtet.»
«Entschuldigen Sie, Don Enrique. Ich wollte damit nur sagen, dass die Kleine nicht ihr ganzes Leben bei Ihnen zu Hause sein wird, Verzeihung, in der Schule. Oder wollen Sie sie ganz für sich allein?», fügte er in seinem gewohnt witzelnden Tonfall hinzu. «Sie wird von Glück sagen können, wenn sie einen fleißigen Kerl mit einer guten Kuh findet, der sie nicht allzu oft schlägt. Wobei es unserer Mademoiselle nicht an Verehrern mangeln dürfte. Und mit diesem prächtigen Busen wird es auch kein Problem sein, vier oder fünf Bälger großzuziehen.»
«Seien Sie nicht so vulgär!»
In diesem Moment sah ich gerade zum Müller, aber weil der Tonfall meines Vaters mich in Alarmstimmung versetzte, drehte ich mich wieder zu ihm um. Er stand reglos da, war aber sichtlich nervös; in seinen Augen lag ein schrecklicher Ausdruck, und sein Kiefer zitterte merkwürdig, was er offenbar nicht unterdrücken konnte. Ich war verstört, weil mein Vater normalerweise die Gelassenheit und Selbstkontrolle in Person war. So jedenfalls hatte ich ihn noch nie gesehen.
Cándida ihrerseits verschränkte instinktiv die Arme vor der Brust, lief rot an und sah Felipe del Couso gekränkt, aber letztlich ohne Harm an. Er wiederum beachtete sie gar nicht mehr. Stattdessen lehnte er in seiner charakteristisch trägen Haltung an der Brücke und nahm mit spöttischer Selbstzufriedenheit zur Kenntnis, wie heftig mein Vater reagierte.
«Nehmen Sie Rücksicht auf das Mädchen und seien Sie nicht so vulgär.»
Seelenruhig fuhr Felipe del Couso fort, meinen Vater zu provozieren.
«So ist das Leben, Don Enrique. Nächstes Jahr wird dieses Mädchen schon nicht mehr zur Schule gehen; dann muss sie in El Sollado mit anpacken. Soweit ich gehört habe, hat Ihre Frau es nicht geschafft, ihr zu einer höheren Schulbildung zu verhelfen, und das, obwohl sie mit de Besteiro gesprochen hat, als er das letzte Mal hier war. Mumm hat sie, unsere Frau Lehrerin, das muss man ihr lassen! Und dieser de Besteiro, das ist ja vielleicht ein sauberes Bürschchen. Dabei weiß doch jeder, dass er der Vater ist und Möglichkeiten hätte. Und was für welche! Für den wäre es überhaupt kein Problem, ihr eine gute Ausbildung zu finanzieren.»
«Das», unterbrach ihn mein Vater im selben Ton wie eben, als kostete es ihn große Mühe, Ruhe zu bewahren, «ist eine schwere Anschuldigung, die wir besser nicht erheben sollten, ohne Beweise zu haben. Und was das Mädchen angeht: Eine Familie zu gründen und auf dem Feld zu arbeiten ist ein ebenso löbliches und würdiges Unterfangen wie jedes andere. Es sollte nur nicht zu früh geschehen, und genauso wenig wollen wir, dass ihre Unschuld zu früh getrübt wird durch solche unschicklichen und anstößigen Bemerkungen.»
«Sie reden ja wie gedruckt, Herr Lehrer», heuchelte Felipe del Couso Staunen und Bewunderung. «Und natürlich haben Sie vollkommen recht. Aber wer wird denn gleich so ernst sein! Ein kleiner Scherz dann und wann, das muss schon erlaubt sein. Wir hatten doch jede Menge Spaß, Cándida, oder etwa nicht?»
Statt zu antworten, streckte Cándida ihm die Zunge raus und zog eine verächtliche Grimasse. Offenbar fühlte sie sich durch die Distanz, die sie vom Müller trennte, und durch die beiden Beschützer an ihrer Seite sicher. Meinem Vater jedoch missfiel diese Geste.
«Cándida!», rief er verärgert. «Komm jetzt. Wir gehen nach Hause!»
«Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Es war mir ein Vergnügen, Sie haben mich eines Besseren belehrt.»
«Wenn dem wirklich so ist», sagte mein Vater und drehte sich noch einmal zu del Couso um, «dann werden Sie das Kind bestimmt nie wieder belästigen.»
«Nichts für ungut», rief uns der Müller hinterher. Und dann noch ein vergnügtes: «Kleine Teufelin!»
Cándida und ich gingen eine Weile wortlos nebeneinanderher, weil die schlechte Laune meines Vaters auf uns abfärbte.
«Wie kommt’s, dass du hier bist, Vater?», fragte ich schließlich in die Stille hinein. «Wieso bist du nicht in der Mine?»
«Ich arbeite nicht mehr dort», sagte er nur. Und fügte nach einem merkwürdig langen Schweigen hinzu: «Und ihr solltet nicht so auf der Braña herumtollen. Eines Tages passiert noch was!»
Der Weg führte zwischen dichtbelaubten Bäumen hindurch, die an einigen Stellen fast ein Gewölbe bildeten. Das immer wieder von Wolken gedämpfte Sonnenlicht sickerte durch das Laubwerk hindurch, und auf den Blättern zeigten sich zarte frische Grüntöne.
Mein Vater wirkte ernst und nachdenklich, es war nichts mehr aus ihm herauszukriegen. Dabei ließ mir ein Gedanke keine Ruhe: Offenbar hatte er uns auf dem Weg nach El Sollado beim Spielen beobachtet, denn es war die einzige Stelle, von der aus man die Braña de Boral sehen konnte.
Es sollte ein denkwürdiger Tag werden. Mein Vater hatte nach fast zehn Jahren seine Stelle im Büro der Minengesellschaft aufgegeben, weshalb wir ihn nun täglich sehen würden und nicht nur, wie bis dahin, einmal in der Woche.
Und an diesem Tag, sechs oder sieben Stunden nach unserer Begegnung mit dem Müller, tötete, ja verschlang der Werwolf eine junge Frau aus dem Dorf, die nach Einbruch der Nacht auf dem Heimweg gewesen war.
Die Frau hatte in Semellade, dem ersten Ort im Nachbartal, eine kranke Tante besucht. Darüber war es spät geworden, was sie aber nicht davon abgehalten hatte, noch am selben Abend den Heimweg anzutreten. In jener wolkenlosen Nacht schien der Vollmond so hell, dass er alle Sterne überstrahlte. Der Werwolf schlug in der Gándara de Coudelo zu, einem Stück Ödland, das man durchqueren musste, wenn man von Semellade oder einem anderen Dorf nach Brañaganda gelangen wollte.
Dass es der Werwolf gewesen war, wussten wir damals noch nicht. Für die Tat wurden gewöhnliche Wölfe verantwortlich gemacht, obwohl im Tal kaum noch Vertreter dieser Spezies lebten und sich nur mehr die ältesten Dorfbewohner an das letzte Opfer erinnern konnten. Erst als weitere Opfer zu beklagen waren, kam der Verdacht auf, ein Werwolf könnte sein Unwesen treiben.
Der Vorfall erschütterte das Dorf zutiefst. Es war aber nicht diese schreckliche Nachricht – die uns erst am nächsten Tag erreichte – und auch nicht die Kündigung meines Vaters, die mir diesen Tag unauslöschlich ins Gedächtnis brannte. Es waren andere, viel nebensächlichere Dinge: die weiße Haut von Cándidas Schenkeln, der rote Fleck auf der Hose des Müllers, das zitternde Kinn meines Vaters, als er mit Felipe del Couso aneinandergeriet.
Der Werwolf schlug erst ein Jahr später wieder zu. Zu diesem Zeitpunkt ging Cándida schon nicht mehr zur Schule. Sie besuchte uns noch, sooft sie konnte, und blieb manchmal auch zum Essen da, aber es war nicht mehr wie früher. Sie hatte sich verändert, war gewachsen. Und sie wollte nicht mehr mit mir spielen.
Das Haus und die Schule
Schon der erste Tag, an dem der Werwolf zuschlug, hatte sich mir tief eingeprägt, aber die Erinnerung an den Tag, an dem er zum zweiten Mal tötete, ist noch lebendiger. Vielleicht, weil ich schon älter war; vor allem aber, weil ich zusammen mit meiner Mutter und meinem jüngeren Bruder eine wahre Odyssee erlebte; und weil ich den Werwolf mit eigenen Augen sah.
Es geschah am späten Abend, als dieser an Schrecken reiche Tag, der sich bis in den frühen Morgen zog, seinen Höhepunkt erreichte. Bis zum Nachmittag war alles friedlich verlaufen, doch dann wurde es schwierig.
Zuerst erteilte mir Cándida eine Abfuhr.
Ich trieb mich in der Nähe der Schule herum, die in den Sommerferien verlassen und still dalag. Ich langweilte mich und war schlecht gelaunt, weil die wenigen Freunde, dich ich hatte, wie fast alle Dorfbewohner beim Mähen der Wiesen halfen. Es war eine Knochenarbeit, bei der die ganze Familie mit anpacken musste, und es hatte etwas von einem heidnischen Fest. Um mir die Zeit zu vertreiben, schlug ich mit einem langen Eukalyptusstab auf das Gras ein, das am Wegrand wuchs. In diesem Moment erblickte ich Cándida, die aus El Sollado kam. Sie hatte weniger zu tragen als gewöhnlich, was ich in meiner Not als Chance begriff, sie wie früher zum Spielen zu überreden.
Es war ein Akt der Verzweiflung, denn Cándida zeigte sich schon seit einiger Zeit wenig geneigt, mich auf meinen Streifzügen zu begleiten. Und diese Verzweiflung war es auch, die mich verleitete, die Stimme der Vernunft zu überhören.
«Kommst du mit zur Poza?», fragte ich voller Hoffnung. Die Poza, das war eine Stelle am Fluss, in die sich ein schmaler Wasserfall ergoss. «Dort wimmelt es von Forellen!»
«Ach, mein kleiner Orlando, du weißt doch, dass ich nicht kann», antwortete sie, ohne zu zögern, mit diesem zärtlich bedauernden Klang in der Stimme, den das Galicische noch verstärkte. «Aber ich hab dich trotzdem lieb! Wirklich!», fügte sie merkwürdig dramatisch hinzu und drückte mich an ihre Brust.
«Lass den Scheiß!», schimpfte ich und entwand mich ihren Armen.
Es war übertrieben, Cándida einen solchen Ausdruck an den Kopf zu werfen, nur weil sie nicht mit mir spielen wollte. Aber ihre mütterlichen Anwandlungen machten ihre Weigerung nur noch erniedrigender für mich. Auf ihre Zuneigungsbekundungen konnte ich gern verzichten: Schließlich zeigte sie diese auch allen Kälbern und selbst Couceiros Hund gegenüber und überhaupt allem, was lebte. In letzter Zeit führte sie sich außerdem sehr merkwürdig auf. Selbst ein so naiver, unerfahrener Junge wie ich erkannte an ihrem Entzücken und ihrem verträumten Blick, dass ich nicht der eigentliche Adressat für dieses Ungestüm war.
Bestimmt hat sie schon Verehrer, dachte ich verächtlich, während sie ihren Weg fortsetzte.
«Wo gehst du hin? Sag, wo gehst du hin?», rief ich ihr wütend, ja fast aggressiv hinterher.
Aber Cándida drehte sich nicht einmal mehr um.
Die Schule und unser Haus standen dicht beieinander. Es waren alte, baufällige Gebäude, in denen früher Vieh- oder Holzwirtschaft betrieben worden war und die man für ihre neuen Zwecke notdürftig umgebaut hatte. Das Haus war klein, einstöckig und verfügte weder über Strom noch fließendes Wasser; und die Schule konnte trotz der Kreidetafel, der Pulte und der Bilder Francos und der Heiligen Jungfrau ihre ursprüngliche Funktion als Scheune oder Lager nicht verleugnen. Beiden Gebäuden war eigen, dass ein Holzpodium das Gefälle des Geländes ausglich und unter den Füßen einen beunruhigenden Klangraum bildete. Alles wurde von Holzpflöcken unterschiedlicher Größe, die mit Keilen und Klötzen gesichert waren, in der Waagrechten gehalten. Aber das sollte ich erst vierzig Jahre später erfahren, als ich die beiden verfallenen Gebäude wiedersah.
Irgendwann hatte ich es satt, das Gras zu malträtieren, und warf den Stock mit aller Kraft in Richtung Wald – sprich irgendwohin, denn schließlich war ich überall von Bäumen umgeben. Ich wartete gespannt, bis ich hörte, wie er mit einem stumpfen Geräusch auf eine Kiefer prallte.
Nun wusste ich nicht, was ich noch machen sollte, ich wollte mich aber auch nicht bei meiner Mutter ausheulen. Auf mein «Mir ist langweilig» würde sie nur mit dem Vorschlag reagieren, ihr im Haushalt zu helfen oder ein Buch zu lesen.
Also betrat ich die Schule, deren Tür immer offen war. Mein Bruder und ich hatten das zweifelhafte Privileg, dass wir auch außerhalb des Unterrichts in den Schulbänken sitzen oder auf die Tafel malen durften; wir taten es meist aus der Not heraus, weil in der Schule mehr Licht und mehr Platz war als in unserem bescheidenen Zuhause. Tatsächlich saß mein Bruder auch in einer der Schulbänke in der Mitte und zeichnete in aller Ruhe.
Es ärgerte mich, weil ich ihn insgeheim dafür bewunderte, dass er Stunden damit zubringen konnte, tief in sich versunken, ohne irgendetwas anderes zu wollen. Und es machte mich nervös, dass er offensichtlich – was niemandem entging – das künstlerische Talent unseres Vaters geerbt hatte, ganz im Gegensatz zu mir. Mein Bruder war damals acht, ging aber schon seit fünf Jahren mit den anderen Kindern zur Schule, weil meine Mutter ihn dadurch an Werktagen beaufsichtigen konnte. Aufgrund dieses merkwürdigen Status eines eingeschulten Vorschülers genoss er ungerechte Privilegien. «Der soll erst mal abwarten, bis die Doppelbrüche drankommen», sagte ich mir.
Ich schlich um ihn herum, schritt die Schulbänke ab und steckte die Finger in die Löcher für die Tintenfässer, die meine Mutter zu Ferienbeginn immer entfernte. Insgeheim überlegte ich, ob ich ihm vorschlagen sollte, mit mir zu spielen. In meinem Moralverständnis bedeutete dies eine schmachvolle Niederlage, die außerdem ihre Tücken hatte, weil sich die Gleichgültigkeit, die mein Bruder an den Tag legte, wenn er in seiner Welt war – wie jetzt zum Beispiel –, schnell in große Anhänglichkeit verwandeln konnte, wenn ich ihn an meiner Welt teilhaben ließ.
Ich schlich also unschlüssig um ihn herum und kam ihm so immer näher. Er aber schien mich überhaupt nicht zu bemerken, sondern sah nur mit aufmerksamem, gelassenem und klarem Blick auf sein Blatt, ohne auch nur einmal zu blinzeln. Lediglich das Stückchen Zunge, das zwischen seinen Lippen gefangen war, und die verkrampfte Art, mit der er seinen Bleistift hielt, verrieten so etwas wie Anstrengung. Wie anders war meine Art zu zeichnen: Ich gab immer Geräusche von mir, murmelte lautmalerisch vor mich hin, versuchte, meinen Werken mit einer Art Filmmusik eine Ausdrucksstärke zu verleihen, die sie in Wirklichkeit nicht besaßen.
Wieso eigentlich nicht, überlegte ich dann doch, schließlich hat er es schwer genug mit seinem Namen; wie kann man nur Norberto heißen? Nachdem die Zeiten endgültig vorbei waren, in denen ich ihn als Bettnässer, Moppel und Blödmann verspottet hatte – jeweils ein Jahr lang –, befand ich mich nun in der Phase, in der ich mich über seinen Namen lustig machte.
Gerade als ich ihn ansprechen wollte, nahm der Tag seine vertrackte Wendung.
Meine Mutter rief nach mir. Ich hörte, wie sie mich vom Haus aus rief. Einen Moment lang zögerte ich, fürchtete, sie könnte mir eine lästige Aufgabe übertragen.
«Mama ruft nach dir», sagte mein Bruder plötzlich, ohne den Blick vom Papier zu heben.
«Ich weiß, Norrberrto», antwortete ich mit boshafter Betonung. Dann rannte ich los.
An dieser Stelle sei eingefügt, dass meine Mutter damals schwanger war. Bald würden wir ein Brüderchen bekommen; oder was auch immer. Sogar der kleine Norberto war eingeweiht. Meine Eltern hatten es ihm erklären müssen, weil der Arme es mit der Angst zu tun bekommen hatte, als sich der Bauch seiner Mama zu wölben begann und er es für eine Krankheit hielt, die niemand außer ihm bemerkte. Weil meine Eltern keine blumige Erklärung parat hatten, griffen sie auf ein Beispiel aus dem Landleben zurück. «Erinnerst du dich an das Kälbchen, das Marela neulich gekriegt hat?», fragten sie. «Das erst in ihrem Bauch war und dann rauskam und jetzt so niedlich ist? So musst du dir das vorstellen.»
Ich, der ich über mehr Erfahrung verfügte und diese Erklärungen nicht nötig hatte, war sehr überrascht, wie gelassen Norberto auf diesen Vergleich reagierte; mich selbst verstörte er nämlich, weil ich diese Geburt mit eigenen Augen gesehen hatte und sie mir mühsam und blutig erschienen war. Allein schon die durchsichtige Plazenta, die dampfend und runzlig auf dem Boden des Stalls gelegen hatte, hatte etwas äußerst Beunruhigendes gehabt.
Mein Bruder hingegen legte eine größere Neugier an den Tag als ich vor seiner Geburt, weil ihm einige Nebenaspekte nicht einleuchteten. Er fragte zum Beispiel, wie Frauen überhaupt schwanger wurden und ob man verheiratet sein musste, um Kinder haben zu können. Neutral und wissenschaftlich im Ton erklärte ihm mein Vater, dass Kinder kämen, wenn ein Mann und eine Frau sich eng verbunden fühlten, dass es aber nicht unbedingt notwendig sei, dafür vor den Traualtar zu treten.
Ich folgte also dem Ruf meiner Mutter, dachte, sie am Eingang oder am Fenster anzutreffen, aber offenbar war sie drinnen. Ich machte die Tür auf, rannte, immer langsamer werdend, über den Flur und betrat schließlich vorsichtig das Wohnzimmer. Da sah ich sie oder vielmehr ihre Hand, die vom Ohrensessel herabhing, der mit dem Rücken in meiner Richtung stand; und ich begriff, dass etwas nicht stimmte. Meine Mutter setzte sich nie in diesen Sessel, und schon gar nicht um diese Uhrzeit.
«Hol deinen Vater. Schnell!», befahl sie mir, als sie mich bemerkte. «Er ist im Wald der Señora.»
Ihr Ton war streng und bestimmt, hatte aber auch etwas Angestrengtes. Ihr Gesicht war mit Schweißperlen bedeckt und zuckte ab und zu vor Schmerz.
«Was ist mit dir?», fragte ich erschrocken.
«Hol deinen Vater. Geh schon! Wir erklären es dir später.»
Ich stürzte aus dem Haus und rannte auf dem Weg, der zum Fluss hinunterführte, in den Wald hinein.