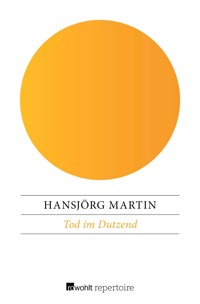4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Am Vormittag kam die Bombendrohung – per Telefon. Am Nachmittag ist ein Sänger niedergeschlagen worden – per Bleirohr. Und am Abend steht ‹Das Rheingold› auf dem Spielplan. Die Kommissare Klipp und Kufuss stellen das Opernhaus auf den Kopf; der eine sucht die Bombe, der andere den unbekannten Täter, der den Mordversuch auf den Bariton Ottokar Kreysch unternommen hat – es ist beim Versuch geblieben, Gott sei Dank; Kreysch liegt mit Platzwunden und einer leichten Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Kufuss und seine Leute finden keine Bombe; es war falscher Alarm – der dritte schon innerhalb der letzten vier Wochen. Die ‹Rheingold›-Aufführung ist nicht gefährdet, wenn es gelingt, Ersatz für Kreysch zu holen ... Es gelingt. Christoffersen, der Chef des künstlerischen Betriebsbüros, hat wieder einmal gezaubert. Der Intendant strahlt. Aber nicht lange. Kommissar Klipp findet nämlich etwas, im Gegensatz zu dem Kollegen Kufuss. Er findet die Tatwaffe, das Bleirohr. Es sind Blutspuren daran (Kreyschs Blut) und Haare (Kreyschs Haare). Und der selbstgefertigte Totschläger ist in der Garderobe von Ockelmann, gleichfalls Bariton, versteckt worden, im Bademantel des Sängers. Ist Ockelmann der Täter? Hier wird es nun ernstlich verwirrend. Denn, einmal ganz abgesehen davon, daß ein Täter normalerweise die Waffe nicht im eigenen Bademantel zu verstecken pflegt – Erik Ockelmann hatte kein Motiv: er hat Kreysch aus der großen Rolle des Wotan in die Nebenrolle des Gottes Donner abgedrängt, und nicht umgekehrt. Eher hätte also Kreysch einen Grund gehabt, Ockelmann niederzuschlagen ... Aber Ockelmann hat andererseits kein Alibi. Gibt es noch etwas, das zwischen den beiden steht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Wotan weint und weiß von nichts
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Am Vormittag kam die Bombendrohung – per Telefon. Am Nachmittag ist ein Sänger niedergeschlagen worden – per Bleirohr. Und am Abend steht ‹Das Rheingold› auf dem Spielplan.
Die Kommissare Klipp und Kufuss stellen das Opernhaus auf den Kopf; der eine sucht die Bombe, der andere den unbekannten Täter, der den Mordversuch auf den Bariton Ottokar Kreysch unternommen hat – es ist beim Versuch geblieben, Gott sei Dank; Kreysch liegt mit Platzwunden und einer leichten Gehirnerschütterung im Krankenhaus.
Kufuss und seine Leute finden keine Bombe; es war falscher Alarm – der dritte schon innerhalb der letzten vier Wochen. Die ‹Rheingold›-Aufführung ist nicht gefährdet, wenn es gelingt, Ersatz für Kreysch zu holen ...
Es gelingt. Christoffersen, der Chef des künstlerischen Betriebsbüros, hat wieder einmal gezaubert. Der Intendant strahlt.
Aber nicht lange.
Kommissar Klipp findet nämlich etwas, im Gegensatz zu dem Kollegen Kufuss. Er findet die Tatwaffe, das Bleirohr. Es sind Blutspuren daran (Kreyschs Blut) und Haare (Kreyschs Haare). Und der selbstgefertigte Totschläger ist in der Garderobe von Ockelmann, gleichfalls Bariton, versteckt worden, im Bademantel des Sängers.
Ist Ockelmann der Täter?
Hier wird es nun ernstlich verwirrend. Denn, einmal ganz abgesehen davon, daß ein Täter normalerweise die Waffe nicht im eigenen Bademantel zu verstecken pflegt – Erik Ockelmann hatte kein Motiv: er hat Kreysch aus der großen Rolle des Wotan in die Nebenrolle des Gottes Donner abgedrängt, und nicht umgekehrt. Eher hätte also Kreysch einen Grund gehabt, Ockelmann niederzuschlagen ...
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Ottokar Kreysch
singt nicht mehr so schön wie früher und kriegt ein Bleirohr über den Schädel.
Erik Ockelmann
hat eine schöne Stimme, ein Verhältnis und einstweilen kein Alibi.
Christoffersen
leitet das künstlerische Betriebsbüro und leidet zeitweilig unter dieser Aufgabe.
Intendant Prof. Knieriehm
leitet – Punkt!
Veronika Kranz
sagt’s schließlich doch.
Kurt Brendel
hat nichts gesagt.
Franz Lohmann
meldet sich krank.
Otto Büddig
vermißt vorübergehend eine Hose.
Dagmar von Raven
läßt nichts anbrennen.
Berthold Kleinwort
hat glücklicherweise Schwierigkeiten mit der Bundeswehr.
Tibor Badorow
hat seine Miete nicht bezahlt.
Kommissar Karli Kufuss
sucht eine Bombe.
Kommissar Leo Klipp
sucht einen Täter, der offenbar kein Motiv hat.
Für Christoph Albrecht HjM
Immer mal wieder verfalle ich in den Fehler, mir die Gabe der Prophetie zu wünschen. Das ist völlig blödsinnig – denn ich hätte ja die Hälfte, ach, mehr als die Hälfte aller meiner Unternehmungen nicht begonnen, wenn mir vorher klargewesen wäre, was auf mich zukommt, auf was ich mich einlasse, in was ich verstrickt werde.
Wie heißt es bei Schiller?
… der Mensch versuche die Götter nicht
und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen …
Da handelt es sich zwar um die tiefe See – aber was ist denn die Zukunft anderes?
Heiliger Strohsack – philosophisch!
Das paßt zu einem Mann wie mir, und erst recht zum Job eines Kriminalbeamten, wie Salami zu Buttercremetorte (wobei zu klären wäre, ob und was der Beruf des Kripokommissars mit Buttercremetorte gemeinsam hat … Das schöne Aussehen gewiß nicht. Die Süße schon gar nicht. Vielleicht die Schwere, die Unbekömmlichkeit? Am ehesten noch das gelegentliche Sodbrennen, das einem etwa beim Lesen der Dienstanweisungen zu- bzw. aufstößt.
Wenn ich – das ist jedenfalls klar – an jenem Spätnachmittag angesichts des alten Germanen, der wie tot zwischen Felsen aus Pappmaché und bemalten Rupfen lag – wenn ich da geahnt hätte, was mir an Verrückten und Verrücktem bevorstand, dann würde ich mich gewiß schleunigst krankgemeldet haben, um den Fall loszuwerden.
Aber ich besitze eben die Gabe der Prophetie nicht – und das ist gut so. Der ohnehin nicht überwältigende Kaffee in der Kantine des Polizeipräsidiums würde mir sonst noch weniger geschmeckt haben.
1
Karli Kufuss kam quer durch die Kantine auf mich zu. Er hob die Linke zu einem wackeligen Gruß, wobei ihm Kaffee aus der Tasse schwappte, die er in der Rechten trug, und machte die beiden Stücke Würfelzucker auf der Untertasse im Handumdrehen naß und braun.
«Als Kellner würdest du kaum Karriere machen», sagte ich, während er balancierend meinen Tisch ansteuerte, sich setzte und anfing, das Kaffeefußbad mit den zerbröckelnden Zuckerstücken in seine Tasse zu praktizieren.
«Das wäre auch nicht mein Traumberuf», erwiderte er, «Plattfüße als Lebenskrönung – nee! Aber die verdienen gut, nicht wahr?»
«Kommt aufs Lokal an. Im Wartesaal 2. Klasse im Bahnhof Pinneberg, wenn’s da so was überhaupt gibt, ist das sicher nicht der Haufen, aber im Grillroom bei Kempinski kommt ein gewiefter Kellner bestimmt gut zurecht. Der hat sicher mehr als ein Kripokommissar, denk ich.»
«Das ist ja auch nicht mein Traumberuf», meinte Karli Kufuss und schlürfte seinen Kaffee.
«Und warum bist du es dann geworden?»
Er schob die Unterlippe vor, hob Augenbrauen und Achseln und schwieg.
Unser oberster Chef ging, nein, er schritt vorbei mit dem weitausgreifenden, wiegenden Gang, der ihm den Spitznamen ‹Dromedar› eingetragen hat. Er grüßte freundlich lächelnd, obschon er sicher keine Ahnung hatte, wen er grüßte, denn sein Personengedächtnis ist miserabel. Wir neigten den Oberkörper um dreieinhalb Zentimeter und lächelten zurück, obschon wir durchaus eine Ahnung hatten, wen wir da anlächelten.
Es ist der dritte Kriminaldirektor, den ich in meiner glorreichen dutzendjährigen Laufbahn erlebe. Er ist eigentlich Forstwirtschafter, soll sich dort, dem Vernehmen nach, Lorbeeren mit der Organisation von Holzfällereinsätzen erworben haben – und das mag ihn dann wohl zum Leiter einer großstädtischen Polizei prädestinieren – wer weiß.
Zu den bemerkenswertesten Impulsen, die von ihm ausgingen, gehört die Dienstanweisung, daß jede Abteilung andersfarbiges Papier zu benutzen habe. Die Sitte zum Beispiel rosa, das Betrugsdezernat grün, die Abteilung Wirtschaftskriminalität gelb (weil gelb als die Farbe der Intellektuellen gilt?), die Mordkommission sinnigerweise rot – und so weiter.
Unter Freunden hatte ich damals viel Beifall geerntet mit dem Vorschlag, die politische Abteilung mit schwarzem Papier auszurüsten. Und Karli Kufuss, der seinerzeit noch bei uns in der Mordkommission saß, hatte Überlegungen angestellt, ob denn bei ‹gemischten› Vergehen oder Verbrechen – also etwa bei Beischlafdiebstahl an einem Aufsichtsratsvorsitzenden (so was kommt ja vor, wenn es auch nicht immer in der Zeitung steht; das richtet sich dann nach den politischen Überzeugungen des Aufsichtsratsvorsitzenden, bzw. des Zeitungsherausgebers …) – ob also in einem solchen Fall gelb-rosa gestreiftes Papier angeschafft und benutzt werden solle.
Wir hatten, wie gesagt, viel gelacht über manche Anordnungen des Dromedars. Aber das war schon vor vier Jahren gewesen. Inzwischen wurden die Meldungen, Aktennotizen und Berichte quer durch Betrug-Diebstahl-Sittlichkeit und Mord alle längst wieder auf weißen Bogen geschrieben. Wie das so geht mit Reformen, die keine sind. Sie scheitern an der Zweckmäßigkeit des Althergebrachten und/oder an ihrer eignen Albernheit.
«Hast du überhaupt einen Traumberuf?» griff ich das Thema wieder auf, das durch des Chefs Vorbeischreiten unterbrochen worden war.
«Ich möchte Pastor sein, irgendwo auf dem Land. Oder Generaldirektor eines solventen Konzerns der Lebensmittelbranche», sagte Karli Kufuss. «Da könnt ich die Verantwortung nach oben oder unten abschieben, hätte wenig zu tun, also viel Zeit für mich selbst und brauchte – außer sonntags, wenn ich Pastor wäre – nicht früh aufzustehen. Ja, und ein gutes Einkommen hätt ich auch. So ’n Landpfarrer in einer frommen Gemeinde, der lebt nicht schlecht, vom Generaldirektor mal ganz zu schweigen. Bei dem braucht die Gemeinde nicht mal fromm zu sein.»
Ich mußte lachen. Karli Kufuss als Landpfarrer im Holsteinischen – ein erbaulicher Gedanke.
Die Kantine war unterdessen leer geworden. Nur neben der Theke saß noch ein einzelner Mann. Er sah müde und mißmutig aus. Ich kannte ihn nicht. Vielleicht war es ein Gerichtsmediziner. Acht Stunden täglich tote Leute aufmachen und in ihren Hirnen und Innereien nach Kugeln, Gift, oder Blutgerinnseln suchen, die auf Gewaltanwendung schließen lassen – das muß auch keine Tätigkeit sein, die überschäumenden Frohsinn erzeugt.
«Wie geht’s deinen Betrügern?» fragte ich Karli Kufuss.
«Haben wir uns so lange nicht gesehen?» fragte er zurück. «Die haben mich doch versetzt. Schon vor drei Wochen. Ich bin jetzt in der neuen Abteilung. Bei den Tuberkulis.»
«Bei wem?» Ich verstand nicht.
«Sonderdezernat ‹Terroristenbekämpfung›», erklärte Karli. «Abgekürzt TB – im Branchenjargon ‹Tuberkulis›. Nie gehört?»
«Nee.» Ich konnte nicht lachen, weil ich die Bezeichnung nicht witzig fand und weil mir Karli Kufuss leid tat.
Das neugeschaffene Sonderdezernat Terroristenbekämpfung war meinem Eindruck nach ein zur Erfolglosigkeit verurteilter Verein, der mehr eine Alibifunktion für ratlos-ohnmächtige Politiker als einen wirklichen Wert hatte. Sie konnten doch immer erst in Aktion treten, wenn eine Bombe hochgegangen war oder wenn sich eine Geisel in den Händen ideologisch unterschiedlich eingefärbter Fanatiker befand. Vorbeugende Maßnahmen gab es so gut wie gar nicht, wenn man nicht Razzien in Ausländerlagern oder Haussuchungen in Kommunen als Vorbeugung betrachten will. Und welcher alte Hase will oder kann das schon? Außerdem war unsere Stadt bisher für die zweifelhaften Helden der Gewaltpolitik offenbar uninteressant. Jedenfalls saßen die zwanzig Männer der Sonderkommission meistens ohne Aufgaben herum und kamen sich vor wie ein Kohlenhändler am Äquator – höchst überflüssig.
Karli Kufuss also tat mir leid, daß er auf diesen Frustrationsposten versetzt worden war. Zugleich wunderte ich mich darüber; ich hatte gehört – und das war ja eigentlich auch klar –, daß zu diesem Dezernat nur ‹politisch zuverlässige› Leute gekommen waren. Und Karli galt im Hause als leicht suspekt, seit er sich 1969 geweigert hatte, auf demonstrierende Studenten einzuknüppeln … Wenn es den Radikalenerlaß, den man nicht Berufsverbot nennen darf, vor fünf Jahren schon gegeben hätte, wäre Karli Kufuss womöglich nicht ins Beamtenverhältnis übernommen worden. Ich allerdings wahrscheinlich auch nicht: mein Onkel, der älteste Bruder meines Vaters, hat von 1908 bis 1911 im gleichen Berliner Haus wie Karl Liebknecht gewohnt und soll, so sagt die Familienlegende, einmal sogar vor Rosa Luxemburg den Hut gezogen haben, als er sie im Treppenhaus traf … Mit einem solchen Onkel biete ich in den Augen der bundesrepublikanischen McCarthyisten vermutlich nicht die gewünschte Gewähr für treue Pflichterfüllung im Dienste der Demokratie.
Ich rief meine Gedanken gerade zur Ordnung, da schob die rosablondmollige Kantinenoberin, die wir Mutter Fourage nennen, das Milchglasschiebefenster beiseite, das Küche und Kantine trennt. Sie sah im Rahmen wie eine weißverhüllte Rubensfigur aus. Ihr beachtlicher Busen füllte das Geviert.
«Ist Kommissar Kufuss hier?» rief sie.
Der mißmutige Mediziner schüttelte den Kopf. Karli erhob sich.
«Was gibt’s?»
«Sie werden am Haustelefon verlangt», sagte Mutter Fourage und hielt ihm durch die Öffnung den Hörer entgegen.
«Ja …» sagte Karli in die Sprechmuschel. «Ja … ja … Ich komme!» und gab ihr den Hörer zurück.
Das Fenster wurde zugeschoben.
«Wir haben Alarm», sagte Karli, wieder am Tisch, zündete sich im Stehen eine Zigarette an und trank den lauwarm gewordenen Kaffeerest aus. «Anonymer Anruf. Der dritte in diesem Monat. Diesmal soll eine Bombe in der Oper ticken. Der Anschlag gilt irgendeinem hohen Besucher, der sich heute abend ‹Rheingold› anhören will. Ich muß los, suchen gehen … Mach’s gut, Leo. Wir sollten bald mal wieder zusammen einen zur Brust nehmen, wie?»
«Finde ich auch, Herr Pastor», sagte ich. «Tritt nicht auf die Bombe!»
«Pastor …» wiederholte er grinsend, schüttelte amüsiert den Kopf und ging davon.
Ich blieb noch eine Weile sitzen, machte mit der Zeigefingerspitze aus dem runden Abdruck meiner Kaffeeuntertasse auf der Plastikplatte des Tisches ein Mondgesicht und hing dem Gedanken nach, was für mich wohl als Traumberuf in Frage käme. Da ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich lieber Schäfer in der Toskana, Bibliothekar in Prag oder Modefotograf in Paris sein möchte, gab ich es auf, kehrte zum Kriminalkommissar-Dasein zurück und begab mich auch gleich an meinen Schreibtisch, wo die vier Jahre alte Akte eines eigenartigen Frauenmordes bereitlag, um mit einem neuen Fall verglichen zu werden, der ganz ähnliche Begleitumstände aufwies.
Es gelang mir jedoch nicht, tiefer in die makabre Materie einzudringen. Ich hatte gerade erst die Fotos der beiden weiblichen Leichen mit den beängstigend ähnlichen Würgemalen grübelnd betrachtet, als mein Chef mich durch seine Vorzimmerstimme zu sich rufen ließ.
«Schön, daß Sie da sind, Herr Klipp», sagte die Stimme mir ins Ohr. «Herr Doktor …»
Ich sagte, ehe sie ihren Auftrag vollenden konnte: «Für Sie bin ich doch immer da, Elviramäuschen!»
Sie brauchte zweieinhalb Sekunden, um das Mäuschen zu schlucken; ich hörte geradezu, wie sie rot wurde.
«Also, Sie sind ein …» Dann überlegte sie es sich anders und sagte kühl: «Herr Doktor Dorau bittet Sie, rüberzukommen.»
«Das ist falsch!» sagte ich.
«Was ist falsch?» fragte sie verwirrt.
«Dodo bittet mich nicht», erklärte ich. «Er läßt mich bitten. Das ist ein wesentlicher Unterschied, Elviramäuschen. Es spricht nicht für Ihr Feingefühl gegenüber der gottgewollten Gesellschaftsordnung, daß Sie so was so nachlässig handhaben. Verstehen Sie mich?»
«Nein!» sagte sie, und diesmal glaubte ich zu hören, wie sie die Stirn runzelte. «Nein, zum Kuckuck! Kommen Sie, und zwar gleich, wenn’s recht ist, Herr Klipp!»
Ich registrierte grienend, wie sie ärgerlich auflegte, zündete mir eine Zigarette an und blieb noch sieben Züge lang sitzen, womit ich mir vormachte, ich sei ein trutziger Geist und frei von jeder Untertanenservilität. Das sind so die kleinen Selbstbetrügereien, die einem das Sklavenleben erträglich machen.
Als ich der Obrigkeit lange genug die Zähne gezeigt hatte, stand ich auf, verließ mein kleines Kommissar-Kämmerlein und machte mich auf den Weg in die Räumlichkeiten des Vorgesetzten. Rangstufe A 15, das heißt Teppich statt blankes Linoleum, Ölbild statt Kunstdruck (aber auch nicht schöner), gepolsterter Schreibtischstuhl mit Armlehnen und nußbaumfurniertem Schreibtisch statt der schlichten Kiefernplatte für Kommissare.
Doktor Doraus – Dodos – kriminalrätliches Antlitz spiegelte sich in der Politur der Schreibtischplatte.
«Tag, Herr Doktor Dorau!» sagte ich.
«Guten Tag, Herr Klipp!» Er legte den silbernen Kugelschreiber im Zweizentimeterabstand parallel neben den DIN-A 5-Notizblock, so daß beide Gegenstände einen genau rechten Winkel zu der schmalen Schale bildeten, in der – von links nach rechts in kleinen Fächern – wohlgeordnet das Rüstzeug vorbildlicher Verwaltung zu besichtigen war: Büroklammern, kleine, Büroklammern, größere, Büroklammern, große; im vierten Fach ein Radiergummi, im fünften Stecknadeln mit bunten Köpfen für die Markierung der Landkarte an der Wand, und im sechsten merkwürdigerweise ein einzelnes Streichholz, über dessen administrative Bedeutung nachzudenken ich jedoch keine Gelegenheit mehr fand, weil Kriminalrat Doktor Dorau mir mit einer eleganten Bewegung seiner gepflegten Hand Platz anbot – oder richtiger, Platz zu nehmen gebot – und die verblüffende Frage stellte:
«Sind Sie ein Musikfreund, Herr Klipp?»
Ich rettete mich in die Gegenfrage: «Welche Art Musik meinen Sie, Herr Doktor?»
«Es handelt sich um Opernmusik», sagte er und redete gleich weiter, ohne meine Stellungnahme abzuwarten, die allerdings auch unbefriedigend ausgefallen wäre. Denn mein Verhältnis zur Oper gleicht dem, das etwa ein Verehrer junger Zigeunerinnen zu nordfriesischen Bäuerinnen Anfang Fünfzig haben mag: Man schläft schlimmstenfalls bei ihnen, aber gewiß nicht mit ihnen. Ich erinnere mich an einen Verdi-Besuch – ich glaube, es war ‹La Traviata› – bei dem mich angewiderte Abonnenten nach dem zweiten Akt vertrieben hatten, weil mein Schnarchen ihren Kunstgenuß bedeutend schmälerte.
Dodo also redete weiter. Schnell, leise und mit seiner präzisen Diktion, von deren druckreifen Sätzen ich mich immer wieder korrumpieren lasse, teilte er mir mit, daß es in der Oper einen Bombenalarm gegeben habe und daß die Kollegen vom Sonderdezernat Terroristenbekämpfung zwar bisher keine Bombe, wohl aber einen Schwerverletzten hinter den Kulissen gefunden hätten – einen Sänger. Einen ziemlich wichtigen Sänger, jawohl … Und ich möge mich doch sofort dorthin begeben, mit den Leuten von der Spurensicherung, denn es sehe nach Mordversuch aus.
«Aber», fuhr er mit Betonung fort, «ich bitte um geschickte und diskrete Arbeit, lieber Herr Klipp! Nach der Meldung vor zehn Minuten – der Arzt ist übrigens schon unterwegs – hat mich gleich Herr Professor Knieriehm angerufen, der Intendant, und um die Entsendung eines Beamten gebeten, der das nötige Fingerspitzengefühl hat. Und das traue ich Ihnen zu, Klipp; machen Sie mir also keine Schande! Die Oper kann derzeit alles andere als irgendwelche Sensationen gebrauchen, die sich negativ auswirken könnten. Und Professor Knieriehm ist ein guter alter Freund von mir – Sie verstehen?»
Ich verstand, unterdrückte fix die Versuchung, mich geschmeichelt zu fühlen, erhob mich, nahm die dargebotene gepflegte Hand und nickte zu der Anweisung, nur ihm als erstem zu berichten und sowieso und grundsätzlich und überhaupt keine Verlautbarungen an die Presse zu geben.
Dann verließ ich Dodos wohlaufgeräumte Wirkungsstätte, nahm Abschied von der ordentlichen Schreibtischplatte, den sauber sortierten Büroklammern und dem einzelnen Streichholz ohne erkennbarer Funktion und setzte mich opernwärts in Bewegung, um dort meines Amtes zu walten.
2
Das Opernhaus, dessen Fassade aus mißverstandener Repräsentationsarchitektur und Marmor besteht und wie eine riesige Musiktruhe aussieht, liegt an einer verkehrsreichen Straße mitten in der Stadt. Busse brummen vorbei, Straßenbahnen rasseln vorüber, der Autostrom bricht während der Geschäftszeit kaum für die dreißig Sekunden ab, die man braucht, um von der gegenüberliegenden Konditorei über den Fahrdamm zu gelangen. Tagsüber kommt man ins Innere des klobigen Gebäudes nur durch den Bühneneingang, der in einer schmalen, dunklen Seitenstraße liegt.
Die Tür ist mächtig. Ein Kind könnte sie nicht öffnen. Dahinter hängt, halbkreisförmig drapiert, ein schwerer schmutzigroter Filzvorhang, um Zugluft abzuhalten. Zugluft ist offenbar Opernfeind Nr. 1. Sie bedroht Sängerkehlen und Tänzermuskeln, Instrumente, Dekorationen, Kostüme und vermutlich das Wohlbefinden des Pförtners. Gegen Zugluft, fand ich später heraus, werden in der Oper fast ebenso viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen wie gegen Feuer, Fortschritt und Abonnentenschwund.
Wer die erste Antizugluftbarrikade, den dicken Filzvorhang überwunden hat, wird – wie ich – vor Verwunderung erst einmal zwinkernd stehenbleiben. Die Welt hinter dieser Tür und diesem Vorhang hat nichts, aber auch gar nichts mit der ratternden Realität draußen auf der Straße zu tun.
Das erste, was mir auffiel, was mir sozusagen in die Nase stach, war der seltsame Geruch. Es riecht nach Staub, frischem Holz, Parfum, Schweiß und Leim – und das alles zusammen so intensiv, daß ich zögerte, tief Luft zu holen.
Während ich also zwinkernd und mit angehaltenem Atem dastand, kamen schweigend vier ungewöhnlich aussehende Wesen die Treppe, die in den Keller führte, herauf. Sie sahen mich nicht und gingen vorbei, die Treppe nach oben weiter. Es waren – den Bewegungen und hochgebundenen Haaren nach zu urteilen – Mädchen. Aber ich hatte noch niemals vorher so häßlich anzuschauende Mädchen gesehen. Da war aber auch nichts, was ein bißchen nett aussah. Sie hatten sich schlottrige Strickjacken um die eckigen Schultern gehängt, dicke graue und braune Wolldinger, verfilzt und wie die Bärte alter Bauern. Die Jacken hingen ihnen bis an die Popos … Doch ja, die Popos in den engen schwarzen Trikots sahen nett aus, und oben aus den Strickjacken wuchsen hübsche Hälse, aber unterhalb der Popos beulten sich abstruse strumpf- oder stiefelähnliche Beinumhüllungen aus schwarzer Wolle, die aus den Mädchenbeinen Bärenstampfer machten und bei zweien der x-beinig Vorübertapsenden noch dazu zerrissen und löcherig waren und mich auf den irrigen Gedanken brachten, das könnten irgendwelche Hexen- oder Trollkostüme sein … Ich erfuhr dann, daß es in Wirklichkeit nur Thermoshüllen für die Tänzerinnen waren, um die kostbaren Gelenke gegen Kälte zu schützen.
Beim Wort ‹Tänzerinnen› hatte ich bisher immer zärtlich-zierlich-erotische Assoziationen gehabt und hatte an Degas’ appetitliche Balletteusen in Weiß und Rosa gedacht. Aber da mußte ich umdenken lernen – wie in manchen anderen Bereichen auch, was sich bald herausstellen sollte.
Am Fuße der breiten Treppe nach oben befand sich ein 2 × 2 m-Glasgehäuse, in dem ein blasser, hagerer Mann unbestimmten Alters vor einer Bild-Zeitung saß und telefonierte. Jetzt legte er den Hörer auf und sah mich aus Augen an, die etwa die Leuchtkraft von schmutzigen 15-Watt-Birnen hatten. Er klappte ein Fensterchen auf und teilte mir mit:
«Sie dürfen hier nicht rein!»
Wie zur Bekräftigung erschien oben auf dem Treppenabsatz ein Polizeibeamter in Uniform.
«Ich denke doch», sagte ich – laut genug, daß es der Kollege auch gleich hören konnte.
«Weshalb?» fragte der Pförtner, nun auch mit erhobener Stimme.
«Deshalb.» Ich zeigte ihm meinen Ausweis.
Er nahm von der drei Zentimeter hohen Schlagzeile, in der vermutlich – meistens ist es so in diesem Blatt – irgend etwas Abscheuerregendes verkündet wurde, seine Brille, setzte sie auf (was seine Augen noch trüber machte) und studierte meine Legitimation.
«Ach so», sagte er. «Ja, dann …» Er schaltete seinen Gesichtsausdruck von Amtswürde auf Unterwürfigkeit um und erklärte mir, daß ich die Tür zur Bühne rechts am oberen Treppenabsatz fände.
Als ich die acht Steinstufen erklomm, kam mir ein vollschlanker Mensch entgegen, dessen rotes Gesicht bis über den Mund von einem weißen Wollschal verdeckt war. Hinter dem Schal machte der Mann «Hamhamham himhimhim homhomhom humhumhuuu!» mit seinen Stimmbändern, und zwar in fallenden Tönen, von Stufe zu Stufe.
«Guten Tag!» sagte ich.
Er streifte mich mit einem abwesend-gleichgültigen Blick, kletterte – «humhumhum homhomhom himhimhim» – seine Tonleiter wieder hinauf und verschwand in einem Seitengang, ein strahlendes «Hamhamham» jauchzend.
«Darf ich auch mal Ihren Ausweis sehen?» sagte der Polizist vor der Tür mit der Aufschrift BÜHNE, ZUTRITT VERBOTEN!
«Sicher, Kollege.» Ich zeigte ihm das Passepartout.
«’tschuldigung, Herr Kommissar», sagte er. «Aber ich habe Befehl, niemand ohne –»
«Klar, geschenkt!» sagte ich. «Wo liegt der Verletzte? Ist er schon im Krankenhaus?»
«Nee, sie haben ihn liegen lassen, bis der Arzt … Aber wo? Keine Ahnung!» Er öffnete die Stahltür und wies ins Halbdunkel. «Ihre – die Herren von der Mordkommission sind mit einem von der Oper hier entlanggegangen.»
«Lassen Sie nur, ich finde das schon», sagte ich und betrat den Bühnenraum.
Flupp, machte die Eisentür hinter mir.
Ich stand in der Dämmerung zwischen Lattengerüsten, riesigen Leinwandrollen und Holzpodesten; ich brauchte eine Weile, um mich an das halbe Licht, das noch intensivere Geruchsgemisch aus Leim, Farbe, Holz, Staub und Schweiß und an die seltsam summende Stille zu gewöhnen.
Mein Blick nach oben verlor sich in endlos scheinende dunkle Höhen. Geheimnisvoll wirkende Gebilde hingen da, bauchig-wulstige, unbewegliche Ungetüme und bizarre Bäume, eine große Glaskugel, die im schwachen Schein der wenigen nackten Birnen glitzerte, ein riesiger vergoldeter Bilderrahmen, etwas, das an morsches Mauerwerk erinnerte, und weinrote geraffte Samtschals daneben.
Während ich noch dastand und meine Sinne der fremden Welt anzupassen suchte, kam ein großer Mann zwischen den Leinwänden auf mich zu. Er war, soviel ich sehen konnte, jung – Anfang Dreißig vielleicht –, trug einen Schnauzbart, eine Brille, halblanges Haar, ein Cordjackett und teure Schuhe mit dicken Kreppsohlen.
«Guten Tag!» sagte er. «Sind Sie der Kommissar?»
«Ja», bestätigte ich und nannte meinen Namen.
«Christoffersen», sagte er. «Wir warten schon auf Sie. Der Intendant ist bereits ziemlich nervös.»
«Dagegen hilft Baldrian», sagte ich. «Auch bei Intendanten.»
Herr Christoffersen, das sah ich ihm an, hätte gern gelacht, aber er wußte offenbar nicht so recht, ob das schicklich sei. Er hatte hübsche, ein bißchen traurige Augen, die zu der Forschheit, mit der er jetzt weiterredete, nicht so recht passen wollten.
«Kommen Sie mit, Kommissar!» schnarrte er.
«Wohin, Christoffersen?» fragte ich, um ihn zu erinnern, daß man auch bei simplen Kriminalbeamten die Anrede ‹Herr› gebrauchen kann.
«Auf – äh – auf die Unterbühne», sagte er, schon weniger forsch, so daß Stimme und Augen wieder zusammen zu gehören begannen. «Wenn ich bitten darf, Herr Kommissar. Ich gehe vor, ja?»
«Liegt der Verletzte noch dort?»
«Ja. Wir wollten warten, was der Arzt sagt. Bei Kopfverletzungen, wissen Sie … Wir wollten nichts falsch machen.»
Ich fand das richtig und sagte es ihm auch. Außerdem war es mir lieber, den Tatort möglichst unverändert zu sehen. Fragen stellte ich keine – das kam später. «Okay, Herr Christoffersen», sagte ich, «gehen Sie voran – ich brech mir sonst noch was.»