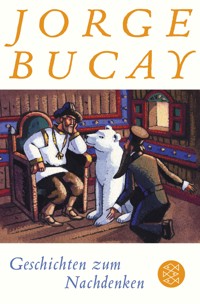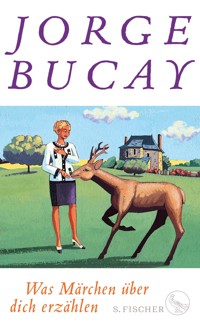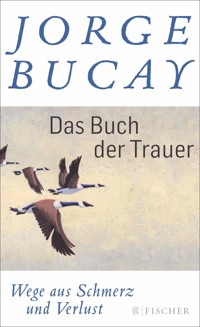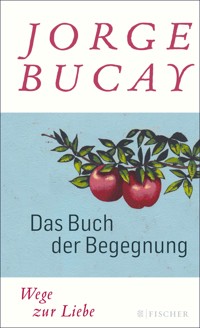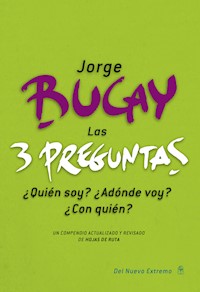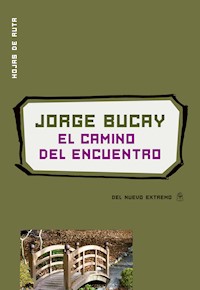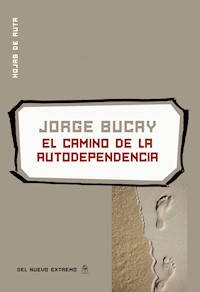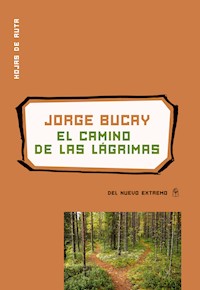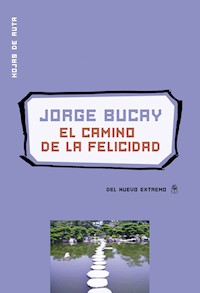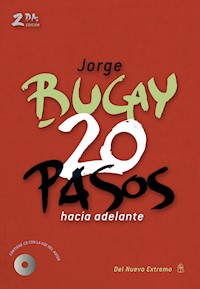9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Fast zwanzig Jahre sind vergangen, seit Demian, der sympathische Protagonist aus ›Komm, ich erzähl dir eine Geschichte‹, das eigene Leben besser verstehen lernte durch Geschichten, die ihm sein Therapeut erzählte. Jetzt steckt er erneut in einer Krise, und in seinem Leben geht es privat wie beruflich drunter und drüber. Was liegt näher, als den Kontakt zum »Dicken« wieder aufzunehmen? Denn der hatte ihm zum Abschied gesagt: »Was auch geschieht: Zähl auf mich!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jorge Bucay
Zähl auf mich
Roman
Aus dem Spanischen von Stephanie von Harrach
Fischer e-books
Für alle Leser von
Komm, ich erzähl dir eine Geschichte,
die dieses Buch – und seinen Autor – erst
möglich gemacht haben.
Einleitung
Du machst wieder alles so kompliziert, Demian. Man muß nicht immer jede Sache, jede Geste, jedes noch so kleine Detail durchanalysieren. Wenn dir was nicht in den Kram paßt, wird das endlos ausdiskutiert. Das nervt, findest du nicht? Entschuldige, wenn ich das sage, aber es ödet mich einfach an, daß du jedes meiner Worte auf die Goldwaage legst und sogar auch noch an dem heruminterpretierst, was ich für mich behalte. Es ist doch alles in Ordnung, oder? Können wir es nicht mal dabei belassen?
Das war mehr oder weniger das, was Ludmila mir sagte.
Ludmila … Eine Schönheit sondergleichen, von ihrem Gang bis hin zu ihrem Parfüm – allem voran ihr Name.
Zart und zerbrechlich hatte sie eines Morgens vor etwa sechs Monaten während der Visite mit hängenden Armen vor mir gestanden, den Mund leicht geöffnet, den Kittel nicht zugeknöpft, das Haar fiel ihr übers Gesicht.
»Ich versteh das nicht«, sagte sie schulterzuckend, vor dem erstaunten Blick des Patienten.
»Was verstehen Sie nicht, Frau Doktor?« versuchte ich ihre Bemerkung der Krankenhaussituation anzupassen und erhob sie mit einem Handstreich von der Studentin zur ausgebildeten Fachärztin.
»Gar nichts«, sagte sie unverfroren. »Eigentlich verstehe ich von dieser ganzen Sache rein gar nichts.«
»Wie heißen Sie?« fragte ich mit gewollt drohendem Unterton.
»Ludmila«, antwortete sie und hielt meinem Blick stand. »Und du?«
Und es geschah, was sich kein Dozent je erlauben dürfte, was aber oft genug passiert: Mit meinen fast vierzig Jahren verliebte ich mich in eine Studentin. Ich verliebte mich in ihre zwanzig Lenze, in ihre Zerbrechlichkeit, in ihren müde abwesenden Blick, ihre widersprüchliche jugendliche Reife, in diese sonderbar faszinierende Mischung aus unerreichbarer Videospielheldin und Milan-Kundera-Figur. Ich verliebte mich in sie und sicherlich auch in ihren Namen: Ludmila.
Vielleicht sollte ich sagen, vor allem in ihren Namen, denn sie selbst war nahezu ungreifbar. Es war mir fast unmöglich, ein paar Stunden bei ihr zu sein, ohne an die abwesende Frau bei Neruda zu denken (»du gefällst mir, wenn du schweigst, als wärst du in der Ferne«); denn wenn es etwas gab, was Ludmila perfekt beherrschte, dann war es das Schweigen. Schweigen und ihren rätselhaften Blick ins Leere schweifen lassen, als wäre sie außerhalb der Welt, weitab des Universums, und überließe mich ganz meiner Passion, hinter das Geheimnis ihrer Gedanken zu kommen.
Wenn ich heute daran zurückdenke, finde ich es fast verzeihlich. Diese junge Frau und ihr Verhalten waren mir völlig neu, und doch erinnerte sie mich, was vielleicht noch entscheidender war, vage an einen früheren, einen beinahe vergessenen Demian.
Außerdem hatte ich sie zu einem Zeitpunkt kennengelernt, als ich gerade den Strapazen von Gabys pausenloser Lamentiererei entkommen war. Seit unserer Heirat hatte meine Exfrau immerzu gefordert, protestiert, gefleht und um etwas gekämpft, was sie ein wenig hochtrabend »ihr Recht« nannte. Sie hatte von mir verlangt, ich solle meine »Verantwortung ernster nehmen«.
Natürlich war Ludmila das genaue Gegenteil. Sie war einfach nur da, als ginge sie alles andere nichts an … Und das war verständlicherweise sehr verlockend.
Trotzdem sage ich mir bisweilen, als Arzt hätte ich ein Stück weit mehr über mein Trotzverhalten und meine kompensatorischen Bedürfnisse hinaussehen müssen. Ich verwechselte ihre jugendliche Gleichmut mit einer »quasi Zen-Haltung«, ihre absolute Gleichgültigkeit mit »frühzeitiger Weisheit« und ihre nervöse Magersucht mit der Schwerelosigkeit des spirituellen Lebens.
Irgendwann fand ich heraus, daß sie ihr frisches und natürliches Aussehen Dutzenden von Cremes und teuerstem Make-up verdankte, erstanden bei ihren unzähligen Gängen durch die Einkaufszentren der Welt. Tuben, Fläschchen und Tiegelchen (bezahlt vom Papa), alle eigens dafür entworfen, unbemerkt zu bleiben.
Und dann kam ich dahinter, daß auch die Kleidung, die gedankenlos ausgewählt und ihr immer gleich vom Leib zu fallen schien, Teil einer ausgeklügelten Verführungsstrategie war.
Beim Nachhausekommen klang mir ihr »Dochallesinordnung …« noch im Ohr.
Im besten Fall hatte dieses dreiste Gör einfach recht, und ich versteifte mich zu sehr darauf, alles zu verkomplizieren, suchte immer nach dem Haar in der Suppe …
Da fiel mir der Dicke ein. An einem Nachmittag vor mehr als fünfzehn Jahren hatte er mir die Geschichte vom »Kreis der neunundneunzig« erzählt …
Vielleicht war es das.
Wieder mal meine Unfähigkeit, das Leben so zu genießen, wie es war?
Warum konnte ich mich verflixt noch mal nicht mit dem zufriedengeben, was ich hatte?
Denn das war ja nicht einmal wenig: Ich arbeitete in einem Beruf, der mir Freude machte, war gesund, hatte Freunde auf der ganzen Welt … Und ein bißchen Kleingeld in der Tasche, um sie überall besuchen zu können.
Worüber zerbrach ich mir eigentlich den Kopf?
Vielleicht, um mir nicht doch am Ende noch eingestehen zu müssen …
Was einzugestehen?
Die Wahrheit natürlich.
Und die Wahrheit war: Das Mädchen, Ludmila, hatte mich verlassen.
Während ich mit dem Finger den Eiswürfel in meinem zweiten Martini rosso herumwirbelte, entdeckte ich, daß diese traurige Tatsache auch einen unverkennbar positiven Beiklang hatte. Es war ein wahrer Leidensgrund. Eine gewisse Zeit lang zumindest konnte ich mir einreden, es sei ihr Verlust, der mich schmerzte, und mich so von diesem schrecklichen Gefühl der Unruhe befreien, das mich seit einiger Zeit umtrieb. Aber sosehr ich es mir auch wünschte, die Selbsttäuschung hielt nicht länger an, als bis der Drink ausgetrunken war. Die narzißtische Kränkung, von Ludmila verlassen worden zu sein, reichte allein nicht aus, um das gewaltige Loch zu erklären, das ich in mir spürte. Eine seltsame innere Leere hatte in den vergangenen Monaten meinen Gemütszustand bestimmt und in vielerlei Hinsicht auch die letzte Phase meiner Ehe.
Mich bedrückte noch etwas anderes, und ich würde mit Sicherheit nicht zur Ruhe kommen, bevor ich herausgefunden hatte, was.
Wieder kam mir Jorge in den Sinn.
Wie war das doch gleich mit dem Schüler und der Teetasse? Fast stürzte ich in meine Bibliothek. Ich öffnete die obere linke Schranktür. Auf der Suche nach den Aufzeichnungen, die ich während meiner Therapie gemacht hatte (ich hatte die Geschichten, die mir der Dicke in den Sitzungen erzählt hatte, meistens gleich aufgeschrieben), durchblätterte ich meine Uninotizen, schob ein paar alte Fotos beiseite und glättete mein verknittertes Doktordiplom. Da waren sie endlich! Ich durchforstete die Papiere, bis ich die Geschichte fand, und war gleich wieder von ihr gebannt.
Ein Mann kam an den Stand des Weisen Badwin und sagte:
»Ich habe viele Bücher gelesen und hatte das Glück, zahlreiche weise, erleuchtete Männer kennenzulernen. Ich habe all das Wissen aufgesogen, dessen ich habhaft werden konnte und das die anderen Meister mir vermittelt haben. Alles übrige, so glaube ich, kannst allein du mich jetzt lehren. Wenn du mich als deinen Schüler annimmst, kann ich mein Wissen mit Sicherheit um all das ergänzen, was mir noch fehlt.«
Meister Badwin sagte:
»Ich bin immer gern bereit, mein Wissen zu teilen. Trinken wir einen Tee, bevor wir mit der ersten Lektion beginnen.«
Der Meister stand auf und brachte zwei hübsche Porzellantassen und eine Kupferkanne herbei, aus der es köstlich nach Tee duftete.
Der Schüler nahm eine der Tassen entgegen, und der Meister neigte die Kanne, um Tee einzuschenken.
Die Flüssigkeit erreichte bald den Tassenrand, doch der Meister schien es nicht wahrzunehmen. Badwin goß auch weiterhin Tee hinein, nachdem der schon längst über den Rand getreten war, den Teller in den Händen des Schülers überschwemmte und den Teppich zu durchnässen begann.
Erst da machte der Schüler den Meister darauf aufmerksam:
»Badwin«, sagte er, »schenk nicht weiter ein, die Tasse ist voll, sie kann keinen Tee mehr fassen …«
»Es freut mich, daß du das bemerkst«, sagte der Meister, »in der Tasse ist kein Platz für mehr Tee. Ist in dir noch Platz für das, was du von mir zu lernen hoffst?« Und er fuhr fort: »Um das Erlernte wirklich in dir verankern zu können, mußt du gelegentlich den Mut haben und deine Tasse leeren, du mußt das aufgeben, was deinen Geist anfüllt, und bereit sein, alles Bekannte zurückzulassen, ohne zu wissen, was an seine Stelle treten könnte.«
»Lernen«, hatte der Dicke gesagt und war zu den Sufis übergegangen, »ist, wie wenn man einen Pfirsich vor sich hat. Am Anfang sieht man nur die faltige rauhe Oberfläche. Die Frucht scheint nicht sehr verlockend, aber nach der ersten Etappe gelangt man ans Fruchtfleisch, und das Lernen wird saftig, süß und nahrhaft. Manche möchten am liebsten gleich dort verweilen, aber der Lernprozeß hört hier noch nicht auf. Ein Stückchen weiter treffen wir auf den harten hölzernen Kern. Das ist der Moment, an dem wir alles Bisherige hinterfragen, der schwierigste Augenblick. Erst wenn wir den Mut fassen, die zähe dünne Haut zu durchstoßen, um zum saftig zarten Inneren zu gelangen, wenn wir es schaffen, das Neue zum Alten zu fügen, um von beidem zu profitieren, dann kommen wir zum eigentlichen Mittelpunkt des Ganzen. Dem Inbegriff aller Möglichkeiten. Dem Samen künftiger Früchte. Hier beginnt ein neuer Ausbildungszyklus, den wir erst antreten können, wenn wir die Leere durchschritten haben, von der aus alles möglich ist.«
Mag sein, daß mir das bisher noch nie passiert war.
Jedenfalls, hier war ich, der Schüler, bereit, meine Tasse noch einmal zu leeren. Aber wo war der Meister?
Ich schaute mich aufmerksam um, doch vom Meister gab es weit und breit keine Spur, nicht einmal ein Foto hatte ich von ihm …
Kapitel 1
Maria Lidia saß schon am Tisch in der Bar. Ich sah auf die Uhr, es war genau vier. Hatte ich mich vertan? Nein, wir waren um vier Uhr verabredet. Dieses eine Mal wäre ich gern derjenige gewesen, der auf sie wartet.
Ich schlich von hinten an sie heran. Es würde sie umhauen, daß ich pünktlich war.
»Hallo, Marily«, sagte ich, während ich sie rücklings umarmte, samt Stuhl und allem an meine Brust drückte und ihr einen dicken Kuß aufs Haar gab.
Maria Lidia war mit Abstand die beste Freundin, die ich je hatte. Wir hatten uns vor fünfzehn Jahren auf einem Gesundheitskongreß in Córdoba kennengelernt, als ich meine letzten Veranstaltungen der Allgemeinmedizin besuchte und sie ihre Diplomarbeit in Psychologie schrieb.
»Na, sieh mal einer an! Wie schön! Offenbar haben wir dich bald wieder.«
Obwohl ich mich zugegebenermaßen vor ihrer Antwort fürchtete, konnte ich es mir nicht verkneifen zu fragen, worauf sie anspielte.
Mit einem Lächeln, das irgendwo zwischen schelmisch und ironisch angesiedelt war, sah sie mir ins Gesicht.
»Ganz einfach, der trendige Slang, das Mädchen, der Fitneßclub und der neue Look … Es hat nur noch gefehlt, daß du dir die Haare färbst, Selbstbräuner benutzt und dich als metrosexuell outest«, konterte Marily, undiplomatisch wie immer.
»Und was soll das jetzt?« beklagte ich mich.
»Na, seit Monaten hast du mich nicht mehr Marily genannt. Seit du deine neue Flamme hast, nennst du mich ›Baby‹ oder ›Herzchen‹. Wenn wir zusammen waren, habe ich meinen Vor- und Nachnamen, ja meine ganze Geschichte verloren. Du scheinst also definitiv auf dem Weg der Besserung zu sein. Offenbar erholst du dich von deinem ›Tattergreis-Syndrom‹. Jetzt mußt du nur noch den ein oder anderen Begriff aus deinem Teenie-Jargon streichen (wieder Bier sagen statt Bierchen, zum Beispiel) und dieses lächerliche Schweißband ablegen, dann bist du wieder unter uns. Wir ›Erwachsenen‹ haben dich schon vermißt. Na, wenn das keine guten Nachrichten sind?«
»Ich weiß nicht, ob es das Tattergreis-Syndrom ist …«, ich suchte nach einer Überleitung, um ihr zu erzählen, was wirklich mit mir los war.
»Natürlich ist es das … Aber wenn es dich stört, kannst du es auch anders nennen. Wir Frauen kennen das zur Genüge. Als meine Freundinnen und ich die Dreißig überschritten haben, lief es für uns unter dem Begriff ›Existenzkrise‹. Mit dem intellektuellen Anstrich sollte die Angst davor etwas im Zaum gehalten werden, aber viel gebracht hat es nicht, es war trotzdem grauenvoll. Diese wahnsinnige innere Rastlosigkeit, die einen von heute auf morgen überfällt, ohne Maß und Ziel – aber dafür nur um so dringlicher.«
»Ja, das kommt mir bekannt vor. Immer unterwegs sein zu wollen, ohne zu wissen wohin noch warum, das ständige Gefühl, zwar hier zu sein, aber sich eigentlich ganz woandershin zu wünschen … Und wenn du dann bei diesem Anderswo bist, spürst du sofort, das ist auch nicht der richtige Ort.«
»Ganz genau«, stimmte Marily zu, »als hätte man eine völlig andere Wahrnehmung von der Vergänglichkeit der Zeit, nicht wahr? Als müßte man jetzt Knall auf Fall einen neuen Sinn des Lebens finden …«
»Genau das, eine Neuorientierung. Innehalten und dir anschauen, was du bislang gemacht hast … Das. Wie soll man das nennen?«
»Na, in drei Worten: Tatter-Greis-Syndrom«, sagte Marily und lachte wieder lauthals los, so daß die übrigen Barbesucher schon zu ihr herübersahen.
Ich versenkte meinen Bart in der Brust und versuchte, unerkannt zu bleiben, aber sie setzte noch einen drauf:
»Ach, Demi, das Problem von euch Männern ist, daß ihr so durchschaubar seid, so vorhersehbar, ihr verhaltet euch alle gleich. Da taucht so ein junges Mädchen auf, dem ihr vor eurer Trennung nicht mal gewagt hättet, in die Augen zu schauen, um nicht als alter Ranschleimer zu wirken, und dann rennt ihr plötzlich zum Frisör, aber nicht zu euerm alten, sondern zum ›Stylisten‹. Ihr kauft euch neue Klamotten in einem Szeneladen, nehmt euch die Zeit fürs Fitneßstudio und belegt einen Tai-Chi-Kurs … Und irgendwann glaubt ihr, daß ihr immer noch in Form seid und mithalten könnt.«
Unaufhaltsam war Marily wieder in ihr feministisches Fahrwasser geraten, das ich so sehr haßte. Und sie tat es nicht, um mich zu ärgern, dazu kannte ich sie zu gut, sie konnte einfach nicht anders. An diesem Nachmittag hatte ich keine Lust, mich in eine dieser Debatten über die Gleichheit der Geschlechter verstricken zu lassen wie schon so viele Male zuvor. Also bedeutete ich ihr, ein bißchen leiser zu sein, und ließ das Thema einfach laufen.
»Es braucht dir nicht peinlich zu sein, dich hat es immerhin noch früh erwischt. Vielleicht, weil du keine Kinder hast. Hättest du welche, wären sie jetzt noch zu klein und du noch damit beschäftigt, sie großzuziehen. Die Mehrzahl deiner Geschlechtsgenossen erwischt es um die Fünfzig, meist nach der ersten Scheidung und gerade dann, wenn sie alles daransetzen, ›ihrer Ex‹ die Schuld für all das in die Schuhe zu schieben, was sie nicht haben machen können.«
Als hätte er nur auf das Ende dieses langen Monologs gewartet, beeilte sich der Ober, uns unsere Biere zu bringen, vielleicht wollte er sichergehen, daß wir schnell austrinken und dann so bald wie möglich verschwinden würden.
Maria Lidia hob ihr Glas und schrie beinahe:
»Auf den verlassenen Pygmalion!«
Ich streckte ihr mein Bier entgegen, und wir stießen herzhaft an. Beim Trinken versuchte ich mich an die Pygmalion-Geschichte zu erinnern. Ich kam auf Bernard Shaws Stück und das Musical »My Fair Lady«, aber den mythologischen Stoff, der ihnen beiden zugrunde lag, bekam ich nicht mehr zusammen.
»Wie war das noch mal?« fragte ich. Und auf den erstaunten Blick meiner Freundin hin fügte ich hinzu: »Na, der Mythos von Pygmalion, worum ging es da gleich?«
Pygmalion war Bildhauer. Vielleicht der beste Steinkünstler im ganzen Land. Eines Nachts träumt er von einer schönen Frau, die anmutig und verführerisch durch sein Zimmer spaziert. Pygmalion glaubt, es sei Aphrodite, die Göttin der Liebe und der sinnlichen Begierde, die ihn auf diesem Weg auffordere, zu ihrer Huldigung eine Skulptur nach ihrem Vorbild in Marmor zu schlagen.
Am nächsten Morgen geht Pygmalion in den Steinbruch und findet einen prächtigen Marmorbrocken, wie geschaffen für das geplante Kunstwerk: groß genug, um die Frau aus seinem Traum nachzubilden, stehend, in Lebensgröße, leicht an eine Wand gelehnt, wie sie stolz auf die Welt der Sterblichen blickt.
Die folgenden Monate widmet der Künstler der Aufgabe, alle überflüssigen Teile aus dem Stein zu hauen, damit die perfekte Schönheit hervortreten kann. Tag für Tag arbeitet er unermüdlich daran, nachts träumt er von diesem Gesicht, diesem Körper, diesen Händen, den Gesten. Die Statue nimmt allmählich Form an, und da Pygmalion in seinem Atelier übernachtet, ist das erste, was ihm jeden Morgen ins Auge fällt, die Frau aus Marmor.
Pygmalion sieht nicht bloß das bereits vollendete Werk vor sich, sondern malt sich auch aus, wie es wäre, wenn diese Frau zu Leben erwachte. Mit jedem Schlag verleiht er dem Form, was er von seiner Vorstellung her bereits kennt: die Züge dieser perfekten Frau. Um sie besser beschreiben zu können, gibt er ihr einen Namen. Er nennt sie Galathea.
Je stärker sich die Feinheiten herausschälen, um so größer wird sein Eifer, das Werk zu vollenden. Es ist gar nicht so sehr der natürliche Wunsch eines Bildhauers, die Arbeit abzuschließen, es ist die Leidenschaft eines Verliebten, sich endlich und für immer seiner Angebeteten gegenüberzusehen.
Schließlich ist der Tag gekommen. Nur noch polieren, und Galathea kann ins Licht der Öffentlichkeit treten.
»Deine Schönheit wird der Welt den Atem verschlagen«, sagt Pygmalion zur Marmorfigur.
In dieser Nacht weckt ihn ein Luftzug, der durchs Fenster dringt. Eine wunderschöne Frau steht vor Galathea. Ein Strahlen geht von ihr aus. Es ist Aphrodite selbst. Sie ist ins Atelier hinabgestiegen, um das Werk zu betrachten, das Pygmalion ihr zu Ehren erschaffen hat.
»Meinen Glückwunsch, Bildhauer, dies ist ein Meisterwerk. Ich bin sehr zufrieden. Was auch immer du dir wünschst, es sei dir gewährt«, spricht die Göttin.
Pygmalion zögert nicht eine Sekunde lang. Er weiß, was er sich wünscht. Schon seit Wochen denkt er an nichts anderes.
»Ich danke dir, Aphrodite. Mein einziger Wunsch ist, daß du meine Statue zum Leben erweckst. Daß sie eine Frau aus Fleisch und Blut werden darf, eine Frau, die lebt, fühlt und denkt, wie ich es mir erträumt habe …«
Die Göttin überlegt und entscheidet, der Wunsch des Bildhauers möge in Erfüllung gehen.
»So sei es«, sagt Aphrodite – und verschwindet aus dem Zimmer.
Erstaunt und voller Freude sieht Pygmalion, wie Galathea ihre riesigen Augen öffnet und sich ihre kalte, weiße Marmorhaut in warme, rosige Menschenhaut verwandelt.
Der Künstler tritt näher und reicht ihr die Hand, um ihr vom Podest zu helfen.
Mit graziler Geste ergreift Galathea sie, steigt herab und schreitet stolzen Schrittes ans Fenster.
»Galathea«, sagt Pygmalion, »du bist mein Werk. Innerlich und äußerlich entsprichst du genau meinen Wünschen und Vorstellungen. Könnte es einen glücklicheren Augenblick im Leben eines Menschen geben, als wenn die Frau seiner Träume in Fleisch und Blut vor ihm steht? Heirate mich, bezaubernde Galathea.«
Die wunderschöne Frau dreht den Kopf und schaut ihn kurz über ihre Schulter an. Dann blickt sie wieder auf die Stadt, und mit der Stimme, die Pygmalion sich für sie ausgedacht hat, sagt sie etwas, was dem Künstler niemals in den Sinn gekommen wäre:
»Du weißt genau, wie ich denke und wie ich bin. Glaubst du wirklich, daß jemand wie ich sich mit jemandem wie dir begnügen könnte?«
»Aber ich hab mir Ludmila doch nicht ausgedacht!« protestierte ich.
»Äußerlich nicht, aber mir scheint, was das Innere angeht, hast du sie dir erschaffen. Ihr seid doch alle gleich. Ihr entwerft einen Prototyp nach dem Negativmodell derjenigen, die gegangen ist, und danach haltet ihr Ausschau. Du sagst doch selbst, das Mädchen sei gar nicht richtig greifbar gewesen.«
»Du verallgemeinerst, und ich muß dir widersprechen. Das ist mein ureigener Fall, ganz intim und persönlich.«
»Na schön, Demi, reg dich nicht auf, ich versuch das Problem nur mit etwas Humor anzugehen. Glaub nicht, ich versteh dich nicht. Aber ich sag’s noch einmal: Mit Vierzig mußt du der Wahrheit ins Gesicht sehen … Ich kann dir nicht mit dem üblichen Männerblödsinn kommen: ›Da kann man nichts machen, Alter‹, ›Sie sind doch alle gleich‹, ›Die weiß ja nicht, was ihr entgeht‹ und so weiter … Eine Frau in meinem Alter hat eben einen anderen Blickwinkel, und aus meinem ist das Ganze sonnenklar … Aber wenn du eine andere Antwort hören willst …«
Ich ließ sie nicht ausreden. Ich hatte genug Geduld bewiesen, aber irgendwann ist Schluß.
»Stimmt, vielleicht sollte ich wirklich besser mit einem Kumpel reden. Mit jemandem, der genauso fühlt wie ich. Ein Mann, der meine verfickte Lage von den Eiern her begreift«, sagte ich mit leicht erhobener Stimme.
»Ist ja gut, ist ja gut … Du hast recht, ich geb’s auf.«
»Marily, du bist meine allerbeste Freundin. Wir haben uns Seite an Seite für soziale Belange eingesetzt. Du bist Psychologin, und unsere Freundschaft hat sich erhalten, obwohl sich – geben wir’s ruhig zu – mit der Zeit unsere Meinungsverschiedenheiten durchaus verschärft haben. Vielleicht habe ich, gerade weil wir so verschieden sind und uns trotzdem mögen, gedacht, du könntest mir noch irgendwelche Tips geben, hättest vielleicht einen Rat, was weiß ich …«
»Ich dir was raten?« Marily prustete wieder los, aber diesmal machte sie sich über sich selbst lustig. »Ich bin keine gute Ratgeberin, professionelle Deformation, weißt du? Aber wo du mich nun schon fragst, sag ich dir eins: Mit der Wahl seines Ratgebers hat man sich den Rat bereits gewählt.«
Ich lächelte über diesen paradoxen Satz, und sie fuhr fort:
»Welchen Rat und welche Sichtweise kannst du von mir erwarten, Demian? Ich bin Psychologin, psychoanalysesüchtig, chronische Therapiepatientin und engagierte Verfechterin des sozialen Gedankens. Ich bin vierzig Jahre alt, alleinstehend und stark geprägt vom Geist der Siebziger.«
Marily lachte lustvoll los und hob ihr Glas erneut zum Anstoßen.
»Auf die Freundschaft«, sagte sie diesmal und sah mir mit demselben verschmitzten Lächeln in die Augen, wie ich es immer vor mir hatte, wenn ich an sie dachte.
Maria Lidia trank einen Schluck und sprach weiter:
»Also, wenn du mich fragst, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder du kommst zum Arbeiten mit mir ins Sozialzentrum – wo wir übrigens dringend einen Arzt gebrauchen könnten –, das lenkt dich mit Sicherheit ein bißchen von deiner blödsinnigen Nabelschau ab …«
»Oder …?« fragte ich.
»Oder du suchst dir einen Therapeuten und findest heraus, was wirklich mit dir los ist.«
Innerhalb knapp einer Woche waren der Gedanke an den Dicken und die Idee, wieder in die Therapie zu gehen, zum zweiten Mal aufgekommen. Eigentlich war es gar nicht so abwegig, jedenfalls nicht so sehr wie die Alternative, mich wieder dem Kampf für die soziale Sache zu widmen. Dazu mangelte es mir am Glauben, die Welt könnte in irgendeinem Sinne gerettet werden … Und an der aberwitzigen Vorstellung, diese Aufgabe benötige jetzt unbedingt meine Unterstützung. Nein. Dafür war im Moment weiß Gott nicht der richtige Zeitpunkt.
Kapitel 2
Ich dachte noch lang über mein Gespräch mit Maria Lidia nach, vor allem über ihren Ausspruch »mit der Wahl des Ratgebers hat man sich den Rat schon gewählt«.
Und das erste Mal seit Wochen empfand ich wieder so etwas wie Spaß, als ich mir nämlich überlegte, wer wohl für welche Art von Rat in Frage käme.
Meine Mutter wäre mit Sicherheit die richtige Ansprechpartnerin, wenn ich mir bestätigen lassen wollte, wie wichtig es sei, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Denn das Wort, das sie in letzter Zeit am häufigsten gebrauchte, wenn es um mich ging, war »Kinder«, und »Enkel«, wenn es um sie selbst ging. Jedes Gespräch begann ganz beiläufig damit, daß irgend jemand ein wunderschönes Baby bekommen hatte oder daß meine Kusine wieder schwanger war (weil sie »einen Jungen und ein Mädchen« wollen), oder mit der Tochter irgendeiner Nachbarin, die sich verzweifelt eine künstliche Befruchtung wünschte, um die ersehnte Schwangerschaft herbeizuführen (ob ich nicht einen guten Spezialisten kennen würde, der ihr helfen könnte?). Sofort landete die Unterhaltung beim Thema »welches Glück einem Kinder bescheren«, daß das bei mir wohl niemals klappen würde (ich sei nicht für diese Art von Glück geschaffen, die soviel Zeit und Aufwand erfordert), um unausweichlich darin zu münden, wie sehr sie sich Enkelkinder wünsche, solange sie noch jung und bei Kräften sei (und bevor sie sterbe), und daß sie ihre Schwester Maria um das Glück beneide, die Hochzeit ihrer Enkelkinder erleben zu dürfen (»natürlich«, fügte sie stets hinzu, »sie hat ja auch zwei Töchter«).
Abgesehen von meiner Mutter konnte ich zum Beispiel Charly um Rat fragen, die unangefochtene Kapazität in Sachen überstürzte Abgänge und magische Verflüchtigungen, die selbst einen Houdini vor Neid erblassen lassen würden.
»Du mußt den Teufel mit dem Beelzebub austreiben«, würde er mir sofort sagen. »Überlaß das mal mir. Ich mache morgen abend eine kleine Party, und du wirst sehen, wie schnell du das alles vergessen hast. Ich hab da am Montag eine fesche Braut kennengelernt, die bestimmt die ein oder andere Freundin mitbringen kann.«
Oder aber ich konnte mich mit Héctor verabreden, meinem Exkumpel aus der Therapiegruppe.
Er würde mir stundenlang zuhören, nach den belanglosesten Details fragen und mit chirurgischer Präzision »einen Leidensprozeß« diagnostizieren, den »nur die Zeit heilen kann«.
»Nur nichts überstürzen und bloß keine Panik«, würde er anschließend orakeln, sich gemächlich eine Zigarette anstecken und nach Intellektuellenmanier dem Rauch nachsehen. »Laß ein paar Monate ins Land ziehen«, (ein paar Monate?!), »und du wirst sehen, schon geht’s dir besser. Solang bleibst du am besten zu Hause und nutzt die Gelegenheit zum Nachdenken …«
Und dann fiel mir ein, daß ich ja auch Gaby um Rat fragen könnte. Keiner kannte mich so gut wie sie.
Gaby! War das möglich? Ich dachte immer noch an sie …
Ich entschloß mich, bei Pablo vorbeizuschauen. Pablo, »die Murmel«.
»Bei unlösbaren Problemen hilft nichts besser als Bewegung, aktiv werden, sich ablenken, das Hirn abschalten«, würde er sagen und mir so fest auf den Rücken klopfen, daß es kaum mehr als Zeichen der Zuneigung gelten konnte. »Du mußt Körper und Geist in Bewegung halten, das lockert nicht nur die Muskeln, sondern macht auch den Kopf frei, und die Antworten kommen von ganz allein.«
Pablo traf sich einmal die Woche mit ein paar Freunden in der Nähe seiner Arbeit zum Fußballspielen. Als ich ihn anrief, war seine Antwort mehr oder weniger wie erwartet, inklusive der pseudowissenschaftlichen praktisch-theoretischen Ausführungen und der Einladung zur »kleinen Kickerei«.
Ich kam am Donnerstag abend auf den letzten Drücker an, es war ein klassisches Fußballduell zwischen Arbeitskollegen: der vierte Stock gegen den achten.
Es dauerte nicht lang, da wußte ich, ich hatte mir den Ratgeber mit dem passenden Rat ausgewählt. Schon kurz nach Spielbeginn schien ich eine wundersame mystische Wandlung zu durchleben, so jedenfalls hätte es wohl der Dicke in der Sitzung genannt. Ich fühlte mich, als wäre ich plötzlich wieder zwanzig, und all meine schmerzhaften Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht hätten niemals stattgefunden.
Ich machte mir nicht vor, mein Körper reagiere wie früher, aber kaum war ich losgerannt, spürte ich, wie mit dem Blut, das in meine Adern schoß, die Energie wiederkehrte und sich mein Körper so lebendig anfühlte wie schon lange nicht mehr.
Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel so genossen: Ich nahm an, ich dribbelte, ich flankte … und dann … das Traumtor. Mein Jubel darüber war größer als der Maradonas beim Weltmeisterschaftsspiel gegen die Engländer in Mexiko.
Was für ein Spaß!
Dann, ich war wieder am Ball (großartig, Demian), und die Flanke (unglaublich), wie ich den riesigen Verteidiger aus dem Achten tunnelte und …
Ich schoß schlecht …
Sehr schlecht.
Ich weiß nicht, war da ein Stein oder war da keiner (nein, ich werd nicht wieder davon anfangen), jedenfalls spürte ich, wie mein Knöchel umknickte, und ich fiel.
Ich wußte sofort, das war mehr als ein bloßer Fehltritt.
Da ich nicht von selber aufstand, kamen Pablo und der getunnelte Riese mir zur Hilfe und schleppten mich vom Platz.
Ich konnte noch nicht mal auftreten, doch ich tat keinen Mucks und hielt durch bis zum Ende des Spiels, das wir vier zu eins verloren (kein Wunder, in Unterzahl sind diese Sechs-zu-sechs-Spiele nicht zu gewinnen) …
Und gleich danach brachte mich Pablo ins Krankenhaus. Auf der Unfallstation hatte ein Freund von mir Dienst.
»Es ist nichts Schlimmes, Demian«, sagte mir Antonio, »sieht aus wie eine Verstauchung. Wenn du willst, verzichten wir auf den Gips, aber du mußt mir versprechen, daß du eine Woche lang liegen bleibst.«
»Versprochen«, sagte ich kleinlaut.
»Und zweimal am Tag nimmst du eine von diesen«, schloß er, drückte mir eine Schachtel in die Hand und wandte sich schon wieder dem nächsten Patienten zu.
Eine Stunde später war ich zu Hause. Pablo stellte meine Tasche gleich neben der Tür ab und zog von dannen (»Tut mir echt leid. So ein Pech!«), fast ein bißchen schuldbewußt.
Und da lag ich nun, allein auf dem Sofa, den verletzten Fuß auf zwei Kissen gebettet, und sah einem Arbeitsausfall von mindestens zehn Tagen entgegen.
War das Zufall, oder gab es da einen Zusammenhang? Hatte ich es insgeheim so gewollt? Was hätte der Dicke dazu gesagt?
In meinem Gedächtnis kramte ich nach der passenden Geschichte für diese Situation, und mir fiel ein alter Witz ein, den mir mein Großvater Elias einmal erzählt hatte.
Es war einmal ein alter Milchverkäufer in einem Dorf. Seine kostbare Ware gab er von der Ladefläche eines Karrens aus, den ein müder alter Klepper zog. Der Milchmann war knauserig, ehrgeizig und ein bißchen dumm.
Eines Nachmittags, während er ein wenig Futter auf den besagten Karren lud, mußte er an das ganze Geld denken, das er sparen würde, wenn sein Pferd nicht jeden Monat so viel fressen würde.
Er erinnerte sich daran, daß der Dorfarzt seinem Nachbarn einmal geraten hatte, mit dem Rauchen aufzuhören. Als der Patient behauptet hatte, es sei ihm ganz und gar unmöglich, gegen dieses Laster anzukämpfen, hatte ihm der Doktor eine Methode »zur Entwöhnung« empfohlen. Der Nachbar solle jeden Tag eine Zigarette weniger rauchen, bis er das Laster ganz und gar losgeworden sei. Mit Geduld und Durchhaltevermögen würde er es sich allmählich abgewöhnen und innerhalb weniger Monate gänzlich rauchfrei leben.
Der Milchmann hielt es für eine glänzende Idee, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft für sein Geschäft einzusetzen, und er beschloß, sein Pferd Stück für Stück daran zu gewöhnen, ohne Nahrung auszukommen.
Von da an gab der Milchmann dem Pferd jeden Tag zehn Gramm weniger Futter als am Tag zuvor.
Er hatte sich ausgerechnet, daß das Tier, wenn er die Kur durchzog, innerhalb eines Jahres zum perfekten Kollegen würde. Ein Mitarbeiter, der einem nicht auf der Tasche lag.
Eines Tages hörte man in den Straßen des Dorfes das laute Wehklagen des Milchmannes, der sich selbst vor seinen Karren gespannt hatte und unter großer Anstrengung die Tour absolvierte.
»Und was ist mit deinem Pferd?« fragten seine Kunden.
»Ein Dummkopf«, antwortete der Mann und bewies damit, daß man sich selbst sogar auf Tiere projizieren konnte, »ich wollte ihm beibringen, wie man ohne Futter auskommt. Und gerade, als es das kapiert hatte, ist es gestorben!«
Ausgerechnet in dem Moment, in dem ich mir nichts sehnlicher wünschte, als mich zu bewegen, durchzuatmen, mich mit Adrenalin vollzupumpen und das Grübeln seinzulassen, war ich zu vollkommenem Stillstand verdammt.
Während der folgenden Woche dachte ich mir weiter Antworten aus, wie Jorge sie darauf gefunden hätte.
Schließlich wurde mir klar, daß ich sie von ihm selbst hören mußte.
Kaum konnte ich aufstehen, da verließ ich auch schon das Haus, nahm ein Taxi und bat den Fahrer, mich zum Dicken zu bringen, meinem ehemaligen Therapeuten.
Kapitel 3
Vor der Tür des alten Gebäudes in der Calle Tucumán 2400 stieg ich aus und humpelte durch die Eingangshalle zum Aufzug. Alles schien wie früher. Der frisch gewienerte Boden, der Blumenduft aus dem Garten, das Geklapper der Teller und Töpfe, das man durch die Holztüren der Wohnungen im Erdgeschoß hörte.
Automatisch schaute ich ans Ende des langen Ganges und suchte vergeblich nach den Umrissen von Don José, dem Portier. Ein Mann, der vor fünfzehn Jahren schon an die Achtzig gewesen sein mußte und Jorges Patienten immer als erster in Empfang nahm. Ich hatte seine mehr als aufdringliche, kontrollierende Anteilnahme zu schätzen gelernt (»Beeilen Sie sich, Sie sind schon fünf Minuten zu spät«, »Nur die Ruhe, Ihr Vorgänger ist immer noch drinnen«, »Der Doktor ist schon oben« …), und es tat mir leid, daß er offenbar nicht mehr da war, gar nicht mehr dasein konnte.
Ich wartete eine Weile auf den Aufzug, und als er nicht kam, begann ich zu Fuß die Marmortreppe hinaufzugehen.
Während ich mich Stockwerk um Stockwerk nach oben schleppte, spürte ich, wie nach und nach die Erinnerungen auf mich niederprasselten.
Fünfzehn Jahre war es her, daß ich den Dicken zuletzt gesehen hatte. Völlig verunsichert war ich zu ihm gekommen, gänzlich überfordert von den Problemen mit meinen Eltern, meinen Freunden, der Arbeit, mit mir selbst und – auch damals schon – mit Gaby.
Die Behandlung durch den Dicken hatte allmählich meine Zweifel beiseite gefegt, meine wahren Wünsche offenbart, mein Selbstwertgefühl wiederhergestellt.
An dem Tag, als mich Jorge das letzte Mal zum Abschied an die Tür brachte, hatte er mir gesagt:
»Demian, heute trennen sich unsere Wege, und ich hoffe, du weißt, du kannst immer zu mir kommen und mir alles erzählen. Was auch geschieht: Zähl auf mich!«
Das schien mir ein unglaublicher Satz. Von jemandem gesagt, der all sein Wissen und all seinen Rat über Erzählungen vermittelte, nahm ich dieses »Zähl auf mich« als weiteren Beleg für unsere Verbrüderung über das Erzählen! Die gemeinsam verbrachte Zeit hatte uns miteinander verschworen, und dies war eine ungeheuere Vertrauensbekundung.
Als ich damals wieder auf die Calle Tucumán trat, fühlte ich mich (abgesehen vom Trennungsschmerz) befreit, erleichtert und endlich lebensfähig, ohne den ganzen Druck und all die Fremdbestimmungen.
Seitdem war offenbar eine Menge Zeit vergangen, und nun stand ich also wieder da, vor Jorges Apartment im vierten Stock.
Irgend etwas war schiefgegangen bei mir, und ich wußte nicht was. Irgend etwas hinderte mich daran, glücklich zu sein oder zumindest auf dem Weg dahin, im Einklang mit meinen Entscheidungen, zufrieden mit mir selbst … Etwas in mir war in Aufruhr, machte mir angst, drückte mich nieder.
Während meiner damaligen Therapie war ich mit Gaby zusammen, wenn man das so nennen will, jedenfalls forderte sie einen Platz in meinem Leben ein, Platz für sich und für uns als Paar, und ich vegetierte vor mich hin und versuchte mir alles offenzuhalten. Wir verhandelten miteinander, anstatt Lösungen zu finden.
Der Dicke hatte immer gesagt, daß Verhandeln Geschäftssache und ein Lebensprojekt nicht verhandelbar sei, sondern Übereinstimmung verlange. Und er hatte recht.
Als mich Gaby eines Tages in der Praxis abholen kam, rief Jorge sie herein, und nach ein paar Matetees erzählte er uns diese Geschichte:
Es war einmal ein König, der ging sehr gern auf Wildschweinjagd. Einmal pro Woche verließ er in Begleitung seiner engsten Freunde und der besten Bogenschützen den Palast und schlug sich in den Wald, auf der Suche nach den gefährlichen Tieren, die ein ständiges Ärgernis für alle Bauern und Grundbesitzer des Königreichs waren. Zu seiner Abenteuerlust gesellte sich also die Gewißheit, den Untertanen einen Dienst zu erweisen, indem er sie von ihren schlimmsten Feinden, diesen räuberischen Mördern, befreite.
Das Jagdprozedere war immer das gleiche, eine Gruppe Wildschweine wurde ausgemacht, sie wurden eingekreist und auf eine Lichtung getrieben, wo man sie gut ins Visier nehmen konnte.
Um der Jagd ihren sportlichen Aspekt zu belassen, mußte der Jäger (einer der Begleiter oder gar der König selbst) vom Pferd steigen und sich vor dem Tier aufbauen, mit nichts anderem bewaffnet als mit einer Lanze und einem scharfen Dolch. Es galt, seine ganze Beweglichkeit einzusetzen, um den spitzen Hauern auszuweichen, und sich auf seine Reflexe zu verlassen, damit einen der Angriff des Viehs nicht zu Boden stieß. Großes Geschick und Schnelligkeit waren vonnöten, um die Spitze der Lanze an einer empfindlichen Stelle zu plazieren, und es brauchte Mut, sich auf das verletzte Tier zu stürzen, um ihm mit dem Messer schließlich den Garaus zu machen.
Der königliche Bogenschütze war die einzige Rückversicherung des Jägers für den Fall, daß etwas schiefging. Während alle den Schauplatz umringten und den Kampf im Auge behielten, wachte er mit hochkonzentriertem Blick, den Bogen schon gespannt und den Pfeil in Position. Von der Genauigkeit seines Schusses konnte es abhängen, ob der Jäger mit dem Schrecken davonkam oder ob ein nicht wieder gutzumachendes Unheil eintraf.
Als er eines Tages eine Gruppe Wildschweine verfolgte, die den westlichsten Zipfel seines Königreichs verwüstete, begab sich der König mit seinen Jagdgefährten in ein Waldstück, das er noch niemals zuvor betreten hatte. Es unterschied sich nicht wesentlich von anderen Wäldern, bis auf die Tatsache, daß fast auf jedem Baumstamm eine notdürftige Zielscheibe aufgezeichnet war. Drei konzentrische Kreideringe mit einem weißen Kreis in der Mitte. Was dem König ins Auge stach, waren nicht die aufgezeichneten Scheiben auf den Stämmen, überrascht war er einzig davon, daß genau in der Mitte jeder dieser Zielscheiben ein Pfeil steckte.
Dreißig bis vierzig Baumstämme zeugten von höchster Treffsicherheit, auf jedem Baum ein weißer Kreis, in jedem weißen Kreis ein Pfeil, jeder Pfeil exakt in der Mitte. Pfeile, deren Befiederung stets in derselben Farbe schillerte. Die gleichen Pfeile, höchstwahrscheinlich alle vom selben Schützen abgeschossen.
Der König fragte ein paar Begleiter nach dem Urheber dieser präzisen Treffer, aber niemand kannte die Antwort.
»Ein solcher Bogenschütze wäre die größte Sicherheitsgarantie für den König«, bemerkte einer.
»Mit einem Leibwächter, der immer ins Schwarze trifft, würde ich mit einer Nähnadel auf Löwenjagd gehen …«, lachte ein anderer.
»Hoffentlich gibt es nur einen von der Sorte«, sagte der königliche Bogenschütze, »sonst bleibt für uns nichts mehr zu tun.«
Der König nickte, rieb sich den Bart, schickte nach seinem persönlichen Diener und sagte: »Morgen nachmittag möchte ich diesen Bogenschützen im Palast sehen. Entweder er kommt freiwillig mit oder auf Befehl, und falls nötig, bringst du ihn mit Hilfe der Wachen zu mir, haben wir uns verstanden?«
»Ja, Majestät«, sagte der Diener, stieg auf sein Pferd und ritt auf der Suche nach dem unfehlbaren Schützen ins Dorf.
Am nächsten Tag klopfte ein Page an die Tür des königlichen Schlafgemachs, um dem Herrscher zu melden, daß sein Diener zurückgekehrt war und um eine Unterredung mit dem König bat.
Eilig kleidete der König sich an, und in Vorfreude auf die Begegnung mit dem Besucher ging er hinunter.
Im Empfangszimmer sah er neben seinem Gesandten niemanden außer einem Bürschchen von etwa fünfzehn, sechzehn Jahren, das mürrisch einen kleinen Bogen in der Hand hielt.
»Wer ist dieses Jüngelchen?« fragte der König.
»Das ist der, den ich dir bringen sollte«, sagte der Diener, »der, der die Pfeile im Wald abgeschossen hat.«
»Ist das wahr, Kleiner? Du bist der Schütze? Lüg mich bloß nicht an, Freundchen, es könnte dich Kopf und Kragen kosten …«
Der Junge senkte den Blick und antwortete ängstlich stotternd:
»Es ist wahr, ich habe die Pfeile geschossen.«
„Alle?« fragte der König.
»Jeden einzelnen von ihnen«, antwortete der Junge.
»Wer hat dir das Bogenschießen beigebracht?« fragte der Monarch.
»Mein Vater«, antwortete der Schütze.
»Und wo ist der?« beharrte der König.
»Er ist vor sechs Monaten gestorben«, sagte der junge Mann traurig.
›Wir haben zwar nicht den Meister‹, dachte der König, ›aber wir haben seinen besten Schüler vor uns.‹
»Und was ist das Geheimnis deiner Fertigkeiten?« fragte der König.
»Geheimnis? Fertigkeiten?« wiederholte der Junge.
»Na, daß der Pfeil immer genau in der Mitte der Zielscheibe landet«, erklärte der König.
»Ganz einfach«, sagte der Bursche, »ich schieße zuerst den Pfeil auf den Baum, und dann mal ich die Kreise drum herum.«
Und der Dicke hatte gleich weitergesprochen:
»Ich halte es für keine so gute Idee, ein Beziehungsmodell zu entwickeln, das sich rund um eure Schwierigkeiten und fehlende Übereinstimmung drapiert.« Und zum Abschluß gab er uns noch folgende Worte mit auf den Weg: »Eine dauerhafte Beziehung aufzubauen verlangt ein gewisses Geschick, und das erreicht man nur durch Übung. Sobald ihr euch geeinigt habt, auf welchen genauen Punkt in eurer Verbindung ihr hinauswollt, müßt ihr in diese Richtung zielen. Bevor ihr euch nicht dafür entscheidet, zunächst einmal eure Pläne miteinander abzustimmen, das heißt, darüber klarwerdet, auf welche weiße Mitte ihr eure Pfeile richtet, wird euer Glück immer blanker Zufall sein oder ein Scheingebilde, mit dem ihr anderen was vormacht. Und warnen möchte ich euch vor allem vor einem: Solang die Liebe bleibt, bringt fehlende Übereinstimmung immer doppelten Schmerz mit sich, meinen eigenen Schmerz und den Schmerz, die geliebte Person leiden zu sehen, auch wenn ich weiß, daß ich ihr auf ihrem Weg nicht weiter folgen kann.«
Hand in Hand und sehr erschrocken hatten Gaby und ich das Sprechzimmer verlassen. Die roten Warnlämpchen, die der Dicke aufblitzen ließ, hatten wir nicht verstanden und wollten wir wohl auch nicht verstehen. Jetzt im Rückblick sehe ich, daß wir tatsächlich so weitergemacht haben bis zum Schluß: Wir haben konzentrische Ringe um jede unserer Handlungen gezogen, um uns selbst und dem anderen Leid zu ersparen. Gaby hatte vieles von dem erreicht, was sie sich wünschte (immerhin waren wir seit mehr als fünf Jahren verheiratet), aber ich muß zugeben, daß ich mich niemals vollständig eingebracht hatte. Ich war zwar sehr geschickt darin geworden, meine eigenen Freiräume zu verteidigen, aber ich konnte mit meiner Frau nie teilen, was mir wirklich Freude machte, und wie oft mußte sie bekennen, daß sie sich nicht mit mir über die Dinge freuen konnte, bei denen sie keine Rolle spielte. Das ging so weit, daß die Trennung fast wie ein Befreiungsschlag für uns beide war und sich bei mir ein häßliches Gefühl einstellte, irgendwo zwischen Schuld und Erlösung, weil ein riesiges Gewicht von mir abgefallen war.
Jetzt, wo mir ihr Bild immer wieder vor Augen getreten war, hatte ich beim Klingeln an der Apartmenttür das Gefühl, Gaby wäre an meiner Seite und bestärkte mich darin, meine Zweifel zu überwinden und mir Beistand zu suchen.
Kapitel 4
Fünfzehn Minuten lang drückte ich immer wieder auf die Klingel. Nicht nur, weil ich inzwischen nicht mehr vor verschlossenen Türen auf einen Termin wartete, ohne mich vorher irgendwie bemerkbar zu machen, »um bloß nicht zu stören« (diese allererste Lektion des Dicken – da kannten wir uns noch kaum 20 Sekunden – war mir unvergeßlich geblieben), sondern auch weil ich immer wieder glaubte, ein Geräusch zu hören, ein Türenschlagen oder ein paar Schritte, und ich nicht ausmachen konnte, ob sie aus seinem Apartment kamen oder vom Stockwerk darüber.
Als schließlich das Telefon im Sprechzimmer klingelte, wartete ich gespannt ab.
Ich lauerte, fast ohne zu atmen, das Ohr an die Tür gepreßt, aber der Apparat klingelte noch mindestens fünf Minuten unbeirrt weiter, ohne daß jemand abnahm. Weder der Dicke noch seine Sekretärin würden das Telefon so lang ignorieren.
Ich mußte mich wohl damit abfinden, daß keiner von beiden in der Praxis war. Also schrieb ich meine Telefonnummer auf einen Zettel und bat Jorge, er möge sich bitte so bald wie möglich mit mir in Verbindung setzen. In den Satz »Es ist dringend«, der mir wie von selbst herausgerutscht war, fügte ich nachträglich ein NICHT ein und ergänzte: »Aber ich muß mit dir reden, Dicker.« An den Schluß setzte ich: »Ganz im Sinne dessen, was du mir vor fünfzehn Jahren gesagt hast: Ich zähl auf dich!« und unterzeichnete mit: »Demian«.
Ich faltete das Blatt zusammen und versuchte es unter der Tür durchzuschieben, aber der Spalt war zu schmal. Als ich in die Hocke ging, um es durch den Schlitz zu drücken, bekam ich den ersten Hinweis darauf, was sich später bestätigen sollte, denn ein Haufen Briefe versperrte den Türspalt. Ich überlegte, daß der Dicke meines Wissens jeden Tag Sprechstunde hatte und daher unmöglich soviel Post einfach liegenbleiben konnte. Genausowenig wie er zum selben Zeitpunkt Urlaub gemacht hätte wie seine Sekretärin.
In dem Augenblick kam eine Nachbarin aus der gegenüberliegenden Wohnung.
»Da ist niemand zu Hause«, sagte sie im Vorbeigehen.
Ich folgte ihr bis zum Aufzug.
»Wissen Sie nicht zufällig, an welchen Tagen der Doktor Sprechstunde hat?«
»Er hält keine Sprechstunden mehr. Schon seit Jahren.«
»Ist er umgezogen?«
»Keine Ahnung«, sagte die Frau und stieg schulterzuckend in den Aufzug.
Ich schnappte mir meinen Rucksack und fuhr mit ihr ins Erdgeschoß, um den Hausmeister zu fragen.
Ein Kerl in meinem Alter öffnete die Tür:
»Ja, bitte?« fragte er.
»Sagen Sie, der Doktor aus dem vierten Stock, praktiziert der nicht mehr?« fragte ich ihn verzweifelt.
»Nein, ich hab ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ab und zu kommt ein junger Mann, vielleicht der Neffe, holt ein paar Mahnungen und haut wieder ab. Aber von ihm weiß ich gar nichts.«
»Hat er denn keine Adresse hinterlassen oder eine Telefonnummer?«
»Nein, vielleicht bei der Hausverwaltung …«
Ich bedankte mich und wandte mich schon zum Gehen, da fiel mir ein:
»Und Don José, lebt der noch?«
»Was für ein Don José?« fragte er zurück und bestätigte damit, daß tatsächlich eine Menge Zeit verstrichen war, nicht nur in meinem Leben, sondern überhaupt.
»Ach, ist nicht so wichtig, danke«, sagte ich und humpelte, noch viel stärker als bei meiner Ankunft, von dannen.
Wie konnte es sein, daß der Dicke nicht da war? War er umgezogen? Warum hatte er mir nicht Bescheid gegeben? Hatte er etwa keine Telefonnummer von mir? Wußte er nicht, daß seine Patienten ihn eventuell brauchen könnten? Verzweiflung überkam mich. Das war nicht fair. Ich mußte unbedingt mit ihm sprechen. Und er war einfach nicht da. Wie vom Erdboden verschluckt. Spurlos verschwunden, ohne den geringsten Hinweis auf seinen Verbleib.
»Verdammt!« schrie ich, bevor ich in ein Taxi stieg, das mich zurück nach Hause fuhr.
›Entscheidungsfreiheit ist ja schön und gut, aber mit dem Leben von anderen herumzuspielen, wie es einem grad in den Kram paßt, da hört der Spaß auf!‹ dachte ich, aber kurz danach wurde mir bewußt, daß ja eigentlich ich derjenige war, der gerade gern über das Leben des Dicken verfügt hätte.
›Was soll’s‹, sagte ich mir, ›von wegen verschwunden und so, wenn ich will, krieg ich schon raus, wo er hingezogen ist. Natürlich kann ich ihn suchen … Rausfinden, wo er praktiziert …‹
Ich gab dem Taxifahrer meine Adresse, schloß die Augen und hob das Bein ein bißchen an, damit ich den Knöchel auf dem Sitz ablegen konnte, ich hatte auf einmal höllische Schmerzen.