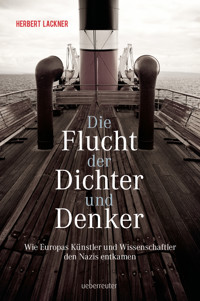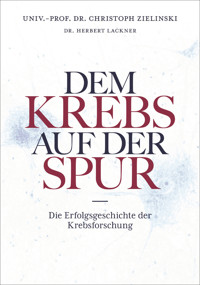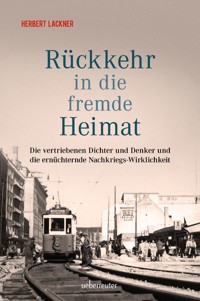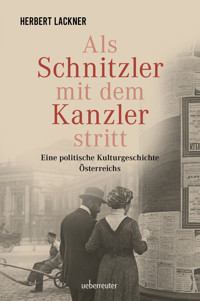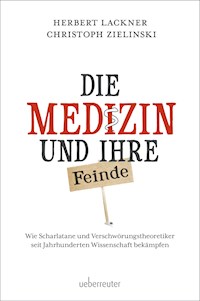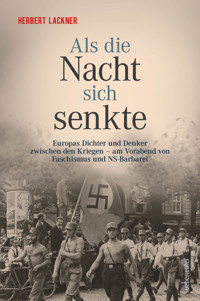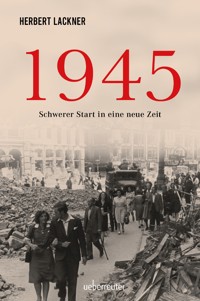
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zeitgeschichte lebendig und ergreifend dargestellt - Die dramatische Geschichte des letzten Kriegsjahres! Über das Jahr 1945 sind viele Bücher erschienen, aber dieses erzählt die dramatische Geschichte dieses letzten Kriegsjahres neu. Sie werden in diesem Buch lesen, wie Oskar Werner mit seiner Familie vor der herannahenden Front durch den Wienerwald floh. Sie werden den Mann kennenlernen, der Bruno Kreisky vor dem KZ bewahrte und 1945 zum Kriegsverbrecher wurde. Sie werden erfahren, warum der Regisseur Franz Antel 1945 im Zuchthaus saß und es geht um einen prominenten Arzt mit NS-Vergangenheit, der sich zuletzt zum Retter des Wiener AKH machte. Der Autor berichtet von einem späteren Sektionschef, der Vorgesetzte erschoss, weil sie Soldaten noch in letzter Stunde in den Tod hetzen wollten und der dafür sein Leben lang angefeindet wurde. Und Sie werden lesen, warum die berühmte Weihnachtsrede Leopold Figls eine Erfindung ist: Er hat 1945 gar keine Weihnachtsrede gehalten. Es ist auch Herbert Lackners persönlichstes Buch. Er erzählt anhand von Tagesbuchnotizen seiner Eltern, wie junge Menschen die letzten Monate des Weltkriegs erlebt haben: Anni, 17, als Verkäuferin in einem Wiener Brotgeschäft; Hans, 16, als von der Schule geholter Luftwaffenhelfer, der zuletzt noch in russische Kriegsgefangenschaft gerät. Aus dem Inhalt: Jänner 1945 - Diese Zeit braucht Helden Oberst Rudel bekommt einen Orden und verliert ein Bein – Die Wehrmachtsspitze schwört Hitler die Treue – Was sie in Auschwitz sehen, schockiert selbst kampferfahrene Rotarmisten Februar 1945 - Haltet durch! Ein sündteurer Propagandafilm soll Stimmung machen – Im Mühlviertel beteiligt sich die Bevölkerung an einer Menschenjagd – Budapest fällt, der Weg nach Wien ist frei März 1945 - "Die Russen kommen!" Wie sich Niederlagen im Wehrmachtsbericht lesen – Bomben auf die Wiener Innenstadt – Todesmarsch quer durch Österreich – Hauptmann Kirchschläger im Fronteinsatz – ein Fußballmatch im Prater 1. bis 15. April 1945 - Das blutige Ende Ein Kriegsverbrecher soll Wien verteidigen – Oskar Werner flieht mit seiner Familie durch den Wienerwald – Im Wiener AKH rutscht ein bekannter Arzt eher zufällig in eine Heldenrolle – Die SS flieht, Wien ist frei 16.- 30 April 1945 - Herr Prikryl wird Wiener Bürgermeister Die ersten Tage nach der Befreiung – Attnang-Puchheim erleidet ein "Dresden-Schicksal" – Franz Antel verlässt das Gefängnis. Aber warum war er drinnen? – Prominente Künstler begehen Selbstmord Mai 1945 - Fluchtpunkt "Alpenfestung" Salzburg, Linz und Innsbruck werden kampflos übergeben – Nazi-Größen versuchen, sich und ihre Beute im Ausseerland zu verstecken – Drama am Polarkreis: Ein späterer Sektionschef erschießt Vorgesetzten – Der Krieg ist vorbei Juni 1945 - Der Kriegsverbrecher, der Kreisky rettete Wie "der Sepp" zum Täter wurde – Der tot geglaubte Altbürgermeister Seitz wird aufgefunden – Das süße Leben der Familie Blaschke Juli 1945 - Junge Juden auf Nazi-Suche Selbstjustiz in den Hohen Tauern – Otto Habsburg agitiert in den USA gegen die Regierung Renner – Es gibt jetzt Besatzungszonen August 1945 - "Als Hitler in meinen Armen lag ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf em Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter
Über das Buch
Über das Jahr 1945 sind viele Bücher erschienen, aber dieses erzählt die dramatische Geschichte des letzten Kriegsjahres neu und pakkend.
Lesen Sie wie Bruno Kreisky mithilfe eines späteren Kriegsverbrechers dem KZ entkam, wie ein NS-belasteter Arzt zum Retter des Wiener AKH wurde, warum der Regisseur Franz Antel 1945 im Zuchthaus saß, wie Oskar Werner mit seiner Familie vor der Roten Armee floh und warum die berühmte Weihnachtsrede Leopold Figls eine Erfindung ist: Er hat 1945 gar keine Weihnachtsrede gehalten.
Herbert Lackner macht Geschichte lebendig – mit dramatischen Schicksalen und überraschenden Enthüllungen. Es ist auch sein persönlichstes Buch. Lackner erzählt anhand von Tagebuchnotizen seiner Eltern, wie junge Menschen die letzten Monate des Weltkriegs erlebt haben.
Über den Autor
Dr. Herbert Lackner, geboren in Wien, studierte Politikwissenschaft und Publizistik, war stellvertretender Chefredakteur der „Arbeiter Zeitung“ und danach 23 Jahre lang Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „profil“. Er ist Autor zahlreicher zeithistorischer Beiträge in „profil“ und „Die Zeit“.
Bereits bei Ueberreuter erschienen:
Als die Nacht sich senkte
Die Flucht der Dichter und Denker
Rückkehr in die fremde Heimat
Als Schnitzler mit dem Kanzler stritt
Sowie gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Christoph Zielinski:
Die Medizin und ihre Feinde
Dem Krebs auf der Spur
Inhalt
VORWORT
JÄNNER 1945
Diese Zeit braucht Helden
FEBRUAR 1945
Haltet durch!
MÄRZ 1945
„Die Russen kommen!“
1.–15. APRIL 1945
Das blutige Ende
16.–30. APRIL 1945
Herr Prikryl wird Wiener Bürgermeister
MAI 1945
Fluchtpunkt „Alpenfestung“
JUNI 1945
Der Kriegsverbrecher, der Kreisky rettete
JULI 1945
Junge Juden auf Nazi-Suche
AUGUST 1945
„Als Hitler in meinen Armen lag …“
SEPTEMBER 1945
Die neuen Politiker werden durchleuchtet
OKTOBER 1945
Lebt Hitler?
NOVEMBER 1945
Ein Prozess wie kein anderer
DEZEMBER 1945
Die Weihnachtsrede, die nie gehalten wurde
Vorwort
Über das Kriegsende 1945 sind großartige Bücher erschienen, in denen es um Frontverläufe, Bombennächte und Nachkriegselend geht. Es gibt aufwendige Bildbände, wunderbare Biografien und Dokumentensammlungen, Militärhistorisches und Politanalytisches.
Aber dieses dramatische Schicksalsjahr lässt sich auch anders erzählen: Mit einfachen, „kleinen“ Geschichten, die sich ebenso zu einem großen Ganzen fügen und die Zeit lebensnäher beschreiben als militärgeschichtliche oder polittheoretische Abhandlungen. Und genau das soll hier versucht werden.
Sie werden in diesem Buch lesen, wie Oskar Werner mit seiner Familie vor der herannahenden Front durch den Wienerwald flieht, während im Wiener Prater noch immer Fußball gespielt wird. Sie werden den Mann kennenlernen, der Bruno Kreisky vor dem KZ bewahrt hat und 1945 zum Kriegsverbrecher wird. Sie werden den ersten Wiener Bürgermeister nach dem Krieg treffen, dessen Namen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben und Sie werden erfahren, warum der Filmregisseur Franz Antel 1945 im Zuchthaus saß. Ich will Ihnen erzählen, auf welche Weise sich hochrangige Nazis davonmachten und wie unangenehm berührt britische Vernehmungsoffiziere waren, als sie zum ersten Mal mit Karl Renner und Leopold Figl sprachen. Es geht um einen prominenten Arzt mit düsterer NS-Vergangenheit, der sich zuletzt zum Retter des Wiener AKH machte. Ich erzähle Ihnen von einem späteren Sektionschef, der im Krieg Vorgesetzte erschoss, weil sie Soldaten noch in letzter Stunde in den Tod hetzen wollten, und der dafür sein ganzes Leben lang angefeindet wurde. Aber natürlich erzähle ich Ihnen auch von den militärischen Entwicklungen, die schließlich zur Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus geführt haben.
So verschieden alle diese Geschichten auch sind – es zieht sich durch sie ein roter Faden: Sehr schnell, manchmal vielleicht allzu schnell, kehrte Österreich wieder zu einer „Normalität“ zurück – einer Normalität, die einen klaren Blick auf die Monstrositäten von Krieg und Faschismus noch lange verstellte. Vieles von dem, was Österreich heute ausmacht, wurde in diesem Jahr 1945 angelegt – im Guten wie im Schlechten. Es aufzuspüren, war eine meiner Absichten beim Schreiben. Ich habe diesem Buch aber auch noch einen privaten Teil hinzugefügt.
Meine bereits verstorbenen Eltern – sie kannten einander 1945 noch nicht – haben einige wenige Briefe, Notizen und im Fall meiner Mutter auch Eintragungen in einem Jahreskalender hinterlassen, die zeigen, wie junge Menschen diese letzten Monate des Weltkriegs erlebt haben: Anni, 17, als Verkäuferin in einem Brotgeschäft in der Wiener Leopoldstadt; Hans, 16, als von der Schule abgezogener Luftwaffenhelfer, der schließlich noch in russische Kriegsgefangenschaft gerät.
Wie so oft nach dem Tod der Eltern wünscht man sich, man hätte diese viel eingehender über ihr Leben befragt.
In diesem wie auch in meinen früheren Büchern habe ich auf das Setzen ermüdender und den Lesefluss unterbrechender Fußnoten verzichtet. Originalzitate sind kursiv gesetzt, die Quelle ist bei Zitaten aus Zeitungen im Text, bei Fachliteratur überdies im Anhang angegeben. Alle Zitate sind jederzeit belegbar.
Ich wünsche viel Gewinn bei der Lektüre!
Herbert Lackner
JÄNNER 1945
Diese Zeit braucht Helden!
Oberst Rudel bekommt einen Orden und verliert ein Bein – Die Wehrmachtsspitze schwört Hitler die Treue – Was sie in Auschwitz sehen, schockiert selbst kampferfahrene Rotarmisten
Alle sind sie an diesem letzten Tag des Jahres 1944 im Führer-Hauptquartier „Adlerhorst“ nördlich von Frankfurt am Main angetreten: Hermann Göring, Chef der deutschen Luftwaffe, Karl Dönitz, Befehlshaber der Marine, Panzer-Generaloberst Heinz Guderian, Alfred Jodl, Wehrmachtschef, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Außenminister Joachim von Ribbentrop und natürlich Adolf Hitler selbst. Der Grund für die Versammlung der illustren Runde ist entsprechend bedeutsam: Es gilt, den prominentesten Soldaten des Deutschen Reiches auszuzeichnen, den Jagdflieger Hans-Ulrich Rudel, 28. Der junge Rudel soll keinen gewöhnlichen Orden bekommen, sondern den allerhöchsten, den der NS-Staat zu vergeben hat und der noch nie einem Angehörigen der Wehrmacht verliehen wurde: das „Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten“. Gleichzeitig wird er zum Oberst befördert.
Wie hat sich der junge Mann diese außergewöhnliche Dekoration verdient?
Nun, Rudel, unter anderem in Graz-Thalerhof zum Sturzkampfbomber-Piloten ausgebildet, hat an der Ostfront mit waghalsigen Flugmanövern mehr als 500 Panzer der Roten Armee zerstört, Dutzende sowjetische Landungsboote und vor Leningrad sogar ein großes Schlachtschiff versenkt. Er hat Versorgungszüge bombardiert und Brücken pulverisiert. Rudels Einsätze sind meist spektakulär. Im August 1944 wurde er in Kurland abgeschossen und schlug sich zu Fuß zu den deutschen Linien durch. Im November wurde ihm über Ungarn der linke Oberschenkel durchschossen, eine weitere noch darin steckende Kugel entfernte man ihm im Lazarett. Wenige Tage später trat Rudel mit Gipsverband wieder zum Dienst an.
Flieger-Ass Hans-Ulrich Rudel: Kurz nach seiner Beinamputation saß er wieder in seinem Bomber – solche Helden brauchte der untergehende NS-Staat.
Solche Kerle braucht das Reich besonders jetzt, da es an allen Ecken und Enden ausblutet, Beispiele ungebrochener Wehrhaftigkeit müssen dem Volk präsentiert werden, um nur ja keine Kriegsmüdigkeit aufkommen zu lassen. Bereit zu leiden, bereit zu töten, bereit zu sterben.
Der Frontverlauf zu Jahresbeginn 1945 lässt keinen Zweifel mehr zu: Hitler-Deutschland ist im Begriff, diesen Krieg zu verlieren. Seit der Schlacht bei Stalingrad, im Jänner 1943, der Landung der Alliierten in Italien im September desselben Jahres und der Invasion an der Normandie im Juni 1944 ist die deutsche Wehrmacht an allen Fronten auf dem Rückzug.
Die Rote Armee steht im Jänner 1945 vor Ostpreußen, hat weite Gebiete Polens von den Nazis befreit und bereitet sich auf eine große Offensive an einer 1200 Kilometer langen Front quer durch Mitteleuropa vor.
Die deutsche Offensive an der Westfront, in den winterlichen Ardennen, ist zusammengebrochen, die Wehrmacht befindet sich schon nach zwei Wochen wieder auf dem Rückzug. Ziel des deutschen Gegenangriffs, der erfolgversprechend begann, war die Rückeroberung des Hafens Antwerpen, um den Nachschub der Alliierten zu blockieren. 40.000 Soldaten beider Seiten hatten bei diesem gescheiterten Gegenangriff ihr Leben gelassen.
In Italien rücken die Alliierten immer weiter nach Norden vor und stehen schon vor der Poebene.
Da braucht es eben beispielgebende Heldengestalten wie Rudel.
Der Orden wird nur kurz gefeiert, schon am 3. Jänner fliegt Hans-Ulrich Rudel wieder Einsätze und nimmt Panzer der Roten Armee aufs Korn. Wenige Tage später wird seine Junkers 87, ein einmotoriger Sturzkampfbomber, über Frankfurt an der Oder von einer sowjetischen Flak getroffen, Rudel wird schwer am rechten Bein verletzt. Nach der Notlandung muss ihm der Unterschenkel amputiert werden. Sechs Wochen später sitzt er mit noch nicht verheiltem Beinstumpf wieder in seiner Ju 87.
Am 8. Mai, dem Tag des Waffenstillstands, fliegt Rudel hinter die amerikanischen Linien und ergibt sich. Seine elfmonatige Kriegsgefangenschaft verbringt er im Lazarett und eröffnet dann einen Fuhrwerksbetrieb nahe Dortmund. 1948 wandert Hans-Ulrich Rudel nach Argentinien aus und verhilft mehreren Kriegsverbrechern zur Flucht aus Deutschland. Vor Ort unterstützt er den KZ-Arzt Josef Mengele und andere SS-Größen beim Untertauchen in Brasilien und Argentinien. Seinen Lebensunterhalt verdient sich Rudel als Waffenhändler und Militärberater, unter anderem in den Diensten der Diktatoren Alfredo Stroessner (Paraguay) und Augusto Pinochet (Chile). Siemens macht ihn zum Vertreter der Konzerninteressen in Südamerika.
Der ungebrochene Nationalsozialist Rudel veröffentlicht neben Artikeln in einschlägigen Magazinen auch Bücher in rechten deutschen Verlagen und kandidiert – allerdings erfolglos – 1953 für die rechtsextreme „Deutsche Reichspartei“.
Oft besucht er Österreich, wo ihn Gesinnungsgenossen entsprechend feiern. Zunehmend wird er zu einer Societyfigur. 1960 etwa nimmt Rudel in Mayrhofen im Zillertal trotz seiner Beinprothese an einem Tennisturnier teil und belegt den dritten Platz. Er bekommt dafür als Preis eine Obstschüssel, wie sogar der „Spiegel“ ehrfürchtig berichtet.
Hans-Ulrich Rudel stirbt 1982 nach einem Schlaganfall in Rosenheim. Bei seinem Begräbnis erheben knorrige Kameraden den Arm zum Hitlergruß und eine Ehrenformation von Starfighter-Jets der Bundeswehr überfliegt den Friedhof.
*
Die hochrangige Versammlung der Wehrmachts- und Parteielite, die Rudel am letzten Tag des alten Jahres den höchsten Orden verlieh, veröffentlicht am Neujahrstag 1945 in der Tageszeitung „Völkischer Beobachter“ ihre traditionellen Aufrufe.
Man überbietet einander mit Huldigungen an Adolf Hitler. Marinechef Dönitz verspricht: „In stählerner Geschlossenheit steht das deutsche Volk hinter dem Führer. Sein Wille weist auch der Kriegsmarine den Weg. In bedingungsloser Einsatzbereitschaft werden wir im kommenden Jahr den Feind angreifen, wo immer wir ihn treffen. Fanatische Kühnheit wird uns zum Sieg führen!“
Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe gelobt „in stolzer Trauer vor unseren Toten, die an der Front oder in der Heimat ihrLeben für Deutschland gaben, unwandelbar zu sein in unserer Treue zu unserem geliebten Führer.“
Heinz Guderian, Generaloberst der Panzer-Streitmacht, huldigt in seinem Neujahrsaufruf pflichtgetreu: „Im unerschütterlichen Glauben an den Führer strahlt uns durch die lodernden Flammen der Schlachten das Fanal des Sieges.“
Da will Propagandaminister Joseph Goebbels natürlich nicht nachstehen: „Ein Volk von Arbeitern, Bauern und Kriegern und an seiner Spitze ein Führer, der sein Volk nicht nur führt, sondern auch verkörpert. Unsere Feinde werden sich an dieser Einheit die Zähne ausbeißen.“
Adolf Hitler selbst gibt sich auch in seinem letzten Neujahrsaufruf antisemitischen Tiraden hin: „Der jüdisch-östliche Bolschewismus entspricht in seinen Ausrottungstendenzen den Zielen des jüdisch-westlichen Kapitalismus. In jedem Fall sollen freie Völker zu Sklaven gemacht werden … Das deutsche Volk wird sich aus diesem Glutofen von Prüfungen stärker und fester erheben, als jemals zuvor in seiner Geschichte. Die Macht aber, der wir dies alles verdanken, der jüdisch-internationale Weltfeind, wird bei diesem Versuch, Europa zu vernichten und seine Völker auszurotten, nicht nur scheitern, sondern sich die eigene Vernichtung holen.“
Auffallend oft spricht Hitler in diesem Neujahrsaufruf vom „unerforschlichen Willen des Allmächtigen“, er will „dem Herrgott danken für die Hilfe, die er Führung und Volk immer wieder hat finden lassen“ und er legt „gegenüber dem Allmächtigen“ das Gelübde ab, seine Pflicht auch im neuen Jahr zu erfüllen.
Adolf Hitler hat an diesem 1. Jänner 1945 noch vier Monate zu leben.
*
Die große Offensive der Roten Armee beginnt am 12. Jänner. Am 17. Jänner wird Warschau besetzt, am nächsten Tag räumen die Deutschen Krakau. Am 21. Jänner überschreiten sowjetische Truppen in Ostpreußen die Reichsgrenze, einen Tag später stehen sie im Süden vor Breslau. Hitlers Heeresgruppe Mitte, einst die wichtigste Einheit im Russlandfeldzug, blutet bei der Verteidigung des schlesischen Industriegebiets völlig aus. Schon bei den heftigen Kämpfen im Sommer und Herbst 1944 sind 200.000 ihrer Soldaten gefallen, 150.000 weitere gerieten in Kriegsgefangenschaft. Die Überlegenheit der Roten Armee ist eklatant: Bei der Artillerie beträgt sie 20:1, bei der Infanterie 11:1und bei den Panzern 9:1. Generaloberst Heinz Guderian bittet Hitler dringend um den Abzug eines Teils der deutschen Truppen aus Norwegen um die Ostfront zu verstärken. Hitler lehnt ab.
*
In Südpolen erobert die Rote Armee am Nachmittag des 27. Jänner den größten Konzentrationslager-Komplex, auf den sie auf ihrem bisherigen Vormarsch gestoßen ist, es ist auch der größte des gesamten Deutschen Reiches: Auschwitz. Im Lager befinden sich noch rund 7000 halb tote Häftlinge. 60.000 KZ-Insassen waren in den Tagen zuvor von der SS mit Zügen und auf Todesmärschen Richtung Westen in andere Konzentrationslager getrieben worden. Ein Viertel von ihnen starb schon bald nach dem Abmarsch an Hunger, Kälte oder Erschöpfung.
Aber davon wissen die Rotarmisten nichts, die jetzt vor diesem Lagerkomplex stehen.
Major Anatoly Shapiro (1913–2005) bricht als Kommandeur seiner Spezialeinheit das Lagertor auf. Die Hälfte von Shapiros Bataillon ist zuvor in den Kämpfen gefallen, aber das hier übersteigt an Grauen alles, was er am Schlachtfeld gesehen hat. „Die Menschen, die da standen, waren nur Haut und Knochen, sie standen da wie Tote. Obwohl es Winter war, trugen sie nur dünne Fetzen am Leib und hatten keine Schuhe an.“
Die Soldaten betreten eine Baracke, in der Frauen untergebracht waren: „Als ich die Tür öffnete, sah ich Blut und Tote, dazwischen lagen einige nackte Frauen, die gerade noch lebten. Es stank entsetzlich, man hielt es in dieser Baracke kaum aus. Meine Soldaten sagten: ‚Gehen wir, hier können wir unmöglich bleiben.‘“
In einer anderen Baracke finden sie nur noch zwei Kinder, alle anderen wurden vergast oder bei medizinischen Experimenten ermordet. Die Kinder beteuern panisch, sie seien keine Judenkinder, weil sie glauben, die Soldaten würden auch sie zur Vergasung abholen.
Die Mannschaften der SS haben das Lager schon einige Tage zuvor Richtung Westen verlassen. Rudolf Höß, der berüchtigte langjährige Kommandant des Konzentrationslagers, der mit seiner Frau und den fünf Kindern seit 1940 in einer Villa am Rand des Lagers lebte, war schon im November 1944 ins KZ Ravensbrück nördlich von Berlin versetzt worden. Zuvor hatte es in Auschwitz eine für ihn unangenehme Affäre gegeben. Höß hatte eine Gefangene geschwängert, die aus Wien stammende kommunistische Ärztin Eleonore Hodys, und er hatte versucht, sie im Steharrest verhungern zu lassen, um die Schwangerschaft zu vertuschen. Zufällig befand sich ein SS-Richter am Gelände, der Fälle von persönlicher Bereicherung durch Wachmannschaften untersuchen sollte. SS-Männer hatten das ermordeten Häftlingen aus den Kiefern gebrochene Zahngold gestohlen. Der Richter veranlasste Höß, die geschwängerte Frau sofort freizulassen, danach wurde das Kind abgetrieben. SS-Reichsführer Heinrich Himmler ließ die Affäre unter den Teppich kehren. Eleonore Hodys überlebte und sagte später gegen Höß aus. Sie starb 1964 in Wien.
Rotarmisten mit befreiten Auschwitz-Häftlingen: „Als ich die Tür öffnete, sah ich Blut und Tote, dazwischen lagen einige nackte Frauen, die gerade noch lebten.“
Höß gelingt es 1945, sich von Ravensbrück nach Flensburg abzusetzen, wo er einige Monate später unter dem Namen Franz Lang als Marinemaat wieder auftaucht. Kurz in britischer Kriegsgefangenschaft heuert „Franz Lang“ als Landarbeiter auf einem Bauernhof nahe Flensburg an. Erst im März 1946 wird seine eigentliche Identität aufgedeckt. Höß wird von den Briten festgenommen und gesteht alles. Danach wird er nach Warschau überstellt und nach einem Kriegsverbrecherprozess im April 1947 vor seiner ehemaligen Villa in Auschwitz gehenkt.
Hunderte Häftlinge überleben in diesem Jänner 1945 ihre Befreiung trotz medizinischer Hilfe um nur wenige Tage.
Insgesamt wurden im Konzentrationslager Auschwitz seit 1940 etwa 1,5 Millionen Menschen ermordet, wahrscheinlich sogar mehr. Die genaue Zahl konnte nie ermittelt werden, weil viele mit den Zügen Ankommende sofort in die Gaskammern getrieben wurden, ohne registriert zu werden.
*
An diesem 27. Jänner, an dem die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit, wird in Wien angeordnet, der Lichtstromverbrauch in Gaststätten, Büros und Verkaufsräumen dürfe höchstens 70 Prozent des Verbrauchs im Vergleichsmonat 1942 betragen. Wenn jemand seine Wohnung mit Gaskochgeräten oder Backrohren beheizt – angesichts des eklatanten Kohlemangels eine verbreitete Heizmethode –, werden Haftstrafen verhängt. Wasser zum Baden oder Waschen darf weder mit Gas noch mit Strom erwärmt werden.
Schon im Spätherbst 1944 wurden „Kronen Zeitung“, „Wiener Zeitung“, „Kleines Blatt“ und „Volksblatt“ wegen Papiermangels eingestellt und zur „Kleinen Wiener Kriegszeitung“ zusammengelegt.
*
Am 30. Jänner, dem zwölften Jahrestag seiner Machtübernahme, hält Adolf Hitler in Berlin eine Rede. „Die Lage im Osten wird gemeistert“ betitelt die „Kleine Wiener Kriegszeitung“ den Bericht darüber. In einigen Passagen rechtfertigt Hitler seinen so blutig gescheiterten Überfall auf die Sowjetunion mit skurrilen Argumenten: „Europa wäre schon längst von der innerasiatischen Sturmflut weggefegt worden“, hätte er 1941 nicht präventiv zugeschlagen: „Ein wehrloses Deutschlandwäre infolge seiner Ohnmacht zum Opfer der jüdisch-internationalen Weltverschwörung geworden.“
Auch in Wien werden am zwölften Jahrestag der Machtübernahme Weihestunden abgehalten. Im Großen Saal des Konzerthauses hält SS-Brigadeführer und Vize-Gauleiter Karl Scharitzer die Festrede. In „markigen, von Leidenschaft erfüllten Worten“, so die „Kleine Wiener Kriegszeitung“, erklärt der für die Deportation der Wiener Juden mitverantwortliche Scharitzer die Lage: „Wenn der Winter auch hart ist und uns die schwersten Entbehrungen auferlegt, so kann sich an seinem Ende jeder voll Stolz sagen, was so ein echter Nazi doch aushält.“
Was „so ein echter Nazi“ sonst noch tut, zeigt sich einige Hundert Kilometer weiter nördlich. Einen Tag nach den Feierlichkeiten zum Jubiläum der Machtübernahme, am 31. Jänner, bringen SS-Männer, Angehörige des „Volkssturms“, „Hitlerjungen“ und örtliche NS-Funktionäre rund 3000 jüdische Frauen aus dem ostpreußischen KZ Stutthof an einen nahe gelegenen Ostseestrand. Dort werden sie ins eisige Meer getrieben, erschossen oder erschlagen.
*
Der Krieg frisst die Kinder. Die Industriellenfamilie Schoeller aus Wien-Döbling (Bankhaus Schoeller, Leipnik-Lundenburger, Schoeller-Bleckmann Metallwerke) teilt in einer Anzeige im „Völkischen Beobachter“ den Tod ihres Sohnes Rütger mit: „Er starb im Alter von 19 Jahren im Westen den Heldentod.“ Rütgers um fünf Jahre älterer Bruder Philipp steht als Rittmeister in einem Kosakenreiter-Regiment ebenfalls an der Front. Philipp Schoeller überlebt den Krieg, übernimmt 1950 das Unternehmen und wird in den 1980er-Jahren Vizepräsident der Industriellenvereinigung. Er stirbt 2008.
Eine andere Seite des „Heldentods“ zeigt die Sterbeanzeige eines Vaters: „Mein einziger Sohn, der Erbe all meiner Hoffnungen, Helmuth Wilhelm fiel im blühenden Alter von 21 Jahren. Er folgt damit seiner Mutter nach vier Monaten in die Ewigkeit. In tiefstem Schmerz. Hans Wilhelm.“
Der Gefreite Ernst Steinbrecher lebte in Marchegg in Niederösterreich, bevor er im Alter von 19 Jahren in Italien „in soldatischer Pflichterfüllung“ starb, wie die Eltern in der Todesanzeige einfügen lassen.
Ende Jänner 1945 werden alle männlichen Jugendlichen des Jahrgangs 1929 einberufen und auf den Fronteinsatz vorbereitet. Eine Befreiung von dieser Einberufung wird nur im Fall einer ernsten Erkrankung gewährt.
*
In den Billboard-Charts der USA führt in dieser letzten Woche des Jänner 1945 der Calypso „Rum and Coca-Cola“ von den Andrews Sisters:
„If you ever go down Trinidad
They make you feel so very glad
Calypso sing and make up rhyme
Guarantee you one real good fine time“
Aber das ist eine andere Welt.
*
WIE JUGENDLICHE DAS JAHR 1945 ERLEBTEN – DIE GESCHICHTE MEINER ELTERN
Anni Bäuml ist 17 und verbringt den Jahreswechsel 1944 / 45 zu Hause. Sie wohnt mit ihren Eltern und ihren Großeltern in einer Zimmer-Küche-Wohnung in Atzgersdorf, dem Industrieviertel des damals 25. Wiener Gemeindebezirks Liesing. Anni ist Verkäuferin bei Hammerbrot. Sie ist als Springerin eingesetzt, arbeitet also in wechselnden Filialen, meist aber in der Praterstraße, in der Taborstraße oder am Fleischmarkt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind diese innerstädtischen Standorte aus dem entlegenen Vorort frühmorgens kaum zu erreichen, schon gar nicht 1945, im sechsten Kriegsjahr.
Es trifft sich daher günstig, dass Annis Tante „Fini“, eigentlich Josefine Schuster, Mieterin einer Wohnung in der Heinestraße 42, also direkt am Praterstern ist, ganz in der Nähe der Filialen, in denen Anni arbeitet.
Tante Fini hat ihre eigene Geschichte. Sie lebte seit 1925, da war sie noch eine ganz junge Frau, mit der jüdischen Familie Bernstein in deren Mietwohnung in der Heinestraße.
Die Bernsteins betrieben in der Heinestraße das „Café Tegetthoff“, Fini arbeitete dort als „Sitzkassierin“. Damals bezahlte man, wie heute noch oft in Italien, beim Verlassen des Lokals.
1938 hieß die Heinestraße plötzlich Schönererstraße nach dem deutschnationalen Hitler-Vordenker Georg von Schönerer (1842–1921) und die Bernsteins mussten emigrieren. Fini blieb mit der Großmutter zurück, die für die Flucht schon zu schwach war. Ihr war es vergönnt, im Bett zu sterben, Finis jüdischen Geliebten ermordete man später im KZ. Sie wird ihr ganzes Leben unverheiratet bleiben.
Warum die Hausverwaltung Fini 1940 in den Mietvertrag eintreten ließ, ist nicht überliefert. Aber in der Wohnung ist Platz, Fini quartiert eine Arbeitskollegin ein, sie nimmt einen weiteren Untermieter auf und auch ihre Nichte Anni kann während der Woche dort wohnen. Die Wochenenden verbringt sie bei den Eltern am Schrailplatz in Atzgersdorf.
Anni (vorne r.; hinter ihr ihre Mutter) im Hof ihres Wohnhauses in Wien-AtzgersdorfAnni liebt das Leben im Zentrum der Stadt, den Prater und die vielen Kinos, die es hier gibt. Aber sie fürchtet sich panisch vor den Bomben, die nun immer öfter auch auf Wien abgeworfen werden. Bis zu ihrem Tod, 74 Jahre später, wird sie davon sprechen.
Neun Monate zuvor, im März 1944, gab es den ersten Angriff auf das Wiener Stadtgebiet, der sich aber auf Industrieanlagen in Simmering und Schwechat beschränkte. Im Mai 1944 wurde erstmals auch Annis Heimatbezirk Liesing bombardiert. Angriffsziele waren die Fabriken, vor allem das kriegswichtige Gräf & Stift-Werk, in dem LKWs gebaut wurden. Es lag nur zweihundert Meter vom Haus am Schrailplatz entfernt, in dem Anni wohnt.
Im September 1944 fielen auch auf die Leopoldstadt Bomben – Ziel war der Nordbahnhof. Der Luftdruck zertrümmerte die Fenster von Tante Finis Wohnung am unmittelbar daneben gelegenen Praterstern.
Die Alliierten führen auf Österreich keine gezielten Flächenbombardements durch wie auf deutsche Städte, sie nehmen vor allem Industrieanlagen, Raffinerien und Bahnhöfe ins Visier. Die Zielgenauigkeit ist wegen der großen Flughöhe – 8000 Meter – eher gering. Bei Schlechtwetter oder bei starkem Beschuss werden oft auch auf Wohngebiete Bomben abgeworfen.
Bis Kriegsende sterben in Wien fast 9000 Menschen im Bombenkrieg, doppelt so viele wie in allen anderen Bundesländern zusammen. Wien galt lange als „der Luftschutzkeller des Reiches“, weil die Stadt erst später als andere deutsche Großstädte bombardiert wurde. Entsprechend niedriger sind die Opferzahlen: In Hamburg wurden 48.000 Luftkriegstote registriert, in Berlin 35.000 und in Dresden 25.000.
Die Intensität der Angriffe auf österreichische Städte nimmt seit dem Herbst 1944 deutlich zu. Ab Oktober gibt es in Wien durchschnittlich dreimal pro Woche „Fliegeralarm“. Das bedeutet: Wird im Radio ein Kuckucksruf gesendet, ist der Luftschutzkeller aufzusuchen. Sirenen kündigen den eigentlichen Angriff an, ein einminütiger Dauerton gibt Entwarnung. 160 Stunden verbrachten die Menschen in Wien in diesem Jahr 1944 in Luftschutzkellern, wurde später errechnet.
Anni hasst diese Keller, den „Kuckuck“ fürchtet sie panisch. Ihr erster Eintrag im Taschenkalender 1945, geschrieben am 8. Jänner, lautet denn auch: „Voralarm“. Zwei Tage später trägt sie ein: „Hut gekauft“. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen, und da gibt es diesen jungen Soldaten, den sie im Spätsommer kennengelernt hat, wie und wo weiß man nicht. Seit September 1944 schreiben sie sich Briefe.
Josef Kainz, so heißt der junge Mann, ist etwa so alt wie sie, sicher nicht älter als 18, wie die dem Brief vom 14. Jänner 1945 beigelegte Fotografie zeigt. Auf die Rückseite des Fotos schreibt er einen Vers: „Wenn des Nachts die Wogen rauschen / möchte ich gerne bei Dir sein. / Möchte Küsse mit Dir tauschen / und mit Dir gern glücklich sein.“ Er unterzeichnet mit „Zum Andenken an Deinen treuen Pepi“.
Annis Verehrer Josef Kainz: „Denn einmal kommt der Tag ja doch …“Pepi ist mit seiner Einheit in Sachsen stationiert, im Osten Deutschlands, dort, wo demnächst der Großangriff der Roten Armee zu erwarten ist. Josef „Pepi“ Kainz, Dienstgrad Gefreiter, der seinem verehrten „Fräulein Anni Bäuml, Wien II. Bez. Schönererstraße 42“ diesen Brief schreibt, weiß davon natürlich nichts. Er kann nur bedauern, dass er nun doch nicht nach Wien kommen kann, weil er unerwartet nicht wegdarf und er versteht das auch irgendwie: „Denn jetzt wird es in einigen Tagen oder Wochen an die Front gehen und da bekommt man dann so leicht keinen Urlaub.“ Pepi schließt seinen Brief erwartungsfroh: „Hoffe, dass Du mich ein wenig lieb hast und mir treu sein willst. Denn einmal kommt der Tag ja doch, wo man wieder auf einige Tage nach Hause kommt. Es küsst Dich herzlich Dein Pepi.“
Dann fügt er doch noch ein kleines Postskriptum hinzu: „Drei Rosen im Garten, / drei Lilien im Wald / und wenn Du mich gern hast / dann schreibe mir bald.“
Für Anni Bäuml beginnt Mitte Jänner eine schwere Zeit. Am 15. Jänner trägt sie in ihren Kalender ein: „Großangriff auf die Stadt, überall“. Tatsächlich sind an diesem Tag Bezirke in allen Teilen Wiens betroffen: Innere Stadt, ihr Wohnbezirk Leopoldstadt, Landstraße, Josefstadt, Alsergrund, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Währing, Döbling und Floridsdorf melden Treffer.
Nicht immer kommen die angekündigten Bombenflugzeuge tatsächlich. Am Wochenende 19. / 20. / 21. Jänner, Anni ist bei ihren Eltern in Atzgersdorf, gibt es jeden Tag Voralarm oder gar Alarm, alles stürmt in die Keller, es fallen aber keine Bomben.
„Frau Eggenberger, Gasvergiftung“, trägt die 17-Jährige am 23. Jänner ein. Ihre ältere Arbeitskollegin aus der Hammerbrot-Filiale auf der Praterstraße hatte in einem von Fliegerbomben beschädigten Haus gewohnt, aus dessen Rohren „Leuchtgas“ geströmt war. Leuchtgas, so der damals gebräuchliche Name, ist das durch Kohlevergasung erzeugte Stadtgas mit hohem Kohlenmonoxid-Anteil.
Am selben Tag, an dem ihre Kollegin ins Krankenhaus gebracht wird, schreibt ihr wieder Josef „Pepi“ Kainz. Er wurde ein Stück weiter nach Osten verlegt, nach Liegnitz in Schlesien. Seine Einheit soll der Roten Armee entgegengeworfen werden und deren Vormarsch stoppen. „Es wurde eine Panzer-Nahkampftruppe zusammengestellt, da war ich auch dabei“, berichtet Pepi nicht ohne Stolz. Aber es ist ihm nicht mehr nach Versen zumute wie noch in seinem Schreiben drei Wochen zuvor, sein Brieftext ist eher nüchtern: „Schreiben kannst Du mir nicht, denn wir werden nie lange an einem Ort sein. Das ist zwar bitter, aber da kann man nichts machen.“
Am folgenden Wochenende ist Anni wieder bei ihren Eltern in Atzgersdorf und macht einen kleinen Ausflug zu einem beliebten Heurigenlokal auf dem Maurerberg zwischen den Bezirksteilen Mauer und Rodaun. In ihrem Kalender vermerkt sie: „Mit E, M, F beim Stachl. Sehr gemütlich!“
Wer sich hinter den Initialen verbirgt, bleibt ungeklärt. Der Jänner endet mit einem Fliegeralarm.
FEBRUAR 1945
Haltet durch!
Ein sündteurer Propagandafilm soll Stimmung machen – Im Mühlviertel beteiligt sich die Bevölkerung an einer Menschenjagd – Budapest fällt, der Weg nach Wien ist frei
Am 1. Februar 1945 läuft in den Kinos in den von der Roten Armee bereits bedrohten Städten Königsberg, Breslau und Danzig, in Berlin und im von den Alliierten eingeschlossenen U-Boothafen La Rochelle ein Film an, der den Namen einer Hafenstadt in Westpommern als Titel trägt: Kolberg.
Die Idee zu diesem Film stammt von Propagandaminister Joseph Goebbels, der wohl weit früher als andere ahnte, dass dieser Krieg für Nazi-Deutschland nicht zu gewinnen ist. Schon im Juni 1943, vier Monate nach der Kapitulation der 6. Armee bei Stalingrad, erteilte er dem Regisseur Veit Harlan brieflich den Befehl: „Hiermit beauftrage ich Sie, einen Großfilm ‚Kolberg‘ herzustellen. Aufgabe dieses Films soll es sein, am Beispiel einer Stadt, die dem Film den Titel gibt, zu zeigen, daß ein in Heimat und Front geeintes Volk jeden Gegner überwindet.“
Die kleine Ostseestadt Kolberg wurde 1807 zur Legende, als deren Bürger der Übermacht der anstürmenden Truppen Napoleons so lange standhielten, bis in Tilsit ein Friedensabkommen zwischen dem preußischen König und dem russischen Zaren auf der einen und Napoleon auf der anderen Seite abgeschlossen wurde.
Und genau diese Botschaft will Goebbels mit dem in Auftrag gegebenen Film vermitteln: durchhalten um jeden Preis, auch um den des eigenen Lebens. „Wir sind hier groß geworden, wir kennen hier jedenStein und jedes Haus“, lässt Regisseur Veit Harlan seinen Hauptdarsteller Heinrich George sagen: „Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in den Boden einkrallen an unserer Stadt: Wir lassen nicht los.“ Ein anderer Honoratior der Heldenstadt fügt hinzu: „Die freien Bürger der alten Hansestadt Kolberg wollen sich lieber unter den Trümmern ihrer Mauern begraben lassen, als ihren Eid auf den König und Herrn zu brechen.“
Als die Monarchen in Tilsit Frieden schließen, liegt das wochenlang von französischen Kanonen beschossene Kolberg tatsächlich in Trümmern – aber es hatte durchgehalten. Veit Harlan macht sich an die Arbeit. Mit Heinrich George und Christina Söderbaum stehen ihm zwei ganz große Stars des deutschen Films zur Verfügung.
„Kolberg“-Hauptdarsteller Heinrich George, Christina Söderbaum: Goebbels gab den Durchhaltefilm bereit zur Jahresmitte 1943 in Auftrag.
„Kolberg“ ist der aufwendigste und teuerste Propagandastreifen, der während der NS-Zeit in Deutschland gedreht wurde. Tausende Wehrmachtssoldaten und mehr als tausend Pferde wurden dafür von ihren Einheiten abgezogen. An den Drehorten in Kolberg, Königsberg und Berlin wurden Heerscharen von Statisten aufgeboten, darunter der damals sechsjährige Egon Krenz, ab 1989 letzter SED-Chef in der DDR. Krenz wurde in Kolberg geboren und während der Dreharbeiten mit Hunderten anderen Kindern der Komparserie zugeteilt. Um auch im Sommer Schneeszenen drehen zu können, wurden mitten im Krieg hundert Eisenbahnwaggons mit Salz nach Pommern gebracht.