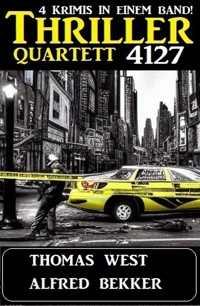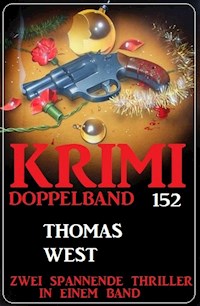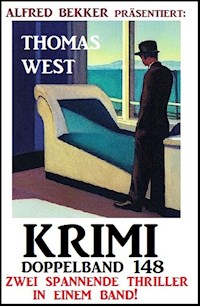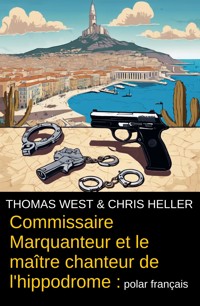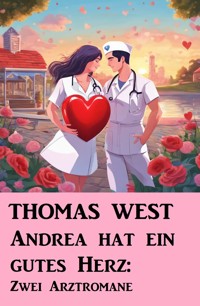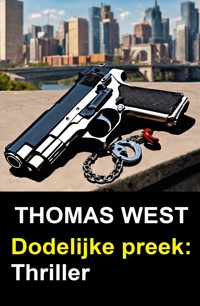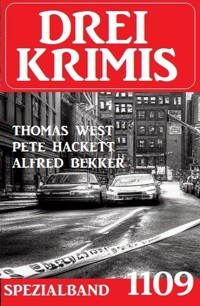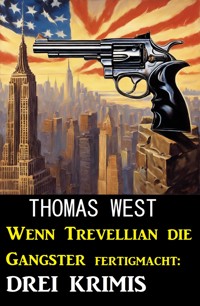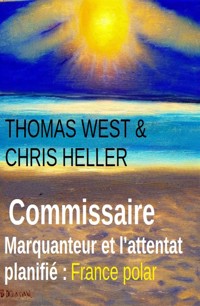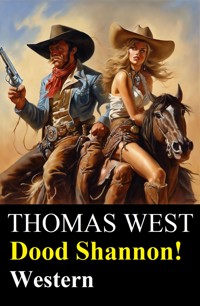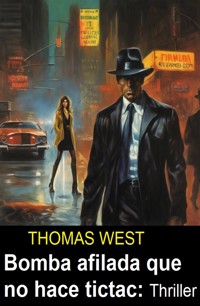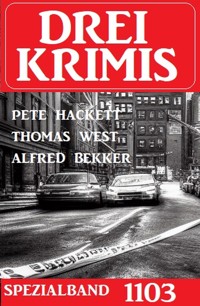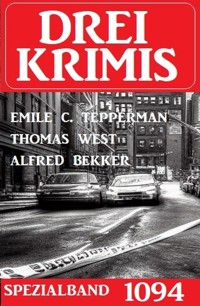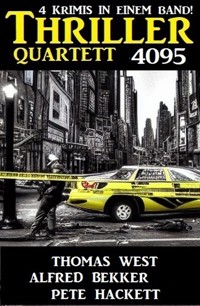Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Arztromane: (399XE) Der Pilot ihres Herzens (Thomas West) Die falsche Ärztin (Thomas West) Das Leben ist zu kostbar (Thomas West) Frau Dr. Alexandra Heinze hat verschlafen. Eilig macht sie sich auf zum Marien-Krankenhaus. Prompt schnappt ihr eine junge, ihr unbekannte Frau den Parkplatz weg, was sie ziemlich wütend werden lässt. Aber ihre Wut verraucht bald, und sie freundet sich mit der neuen Ärztin an. Alexandra spürt jedoch, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West
3 Romane um Dr. Alexandra Heinze: Super Arztroman Sammelband
Inhaltsverzeichnis
3 Romane um Dr. Alexandra Heinze: Super Arztroman Sammelband
Copyright
Der Pilot ihres Herzens
Die falsche Ärztin
Das Leben ist zu kostbar
3 Romane um Dr. Alexandra Heinze: Super Arztroman Sammelband
Thomas West
Dieser Band enthält folgende Arztromane:
Der Pilot ihres Herzens (Thomas West)
Die falsche Ärztin (Thomas West)
Das Leben ist zu kostbar (Thomas West)
Frau Dr. Alexandra Heinze hat verschlafen. Eilig macht sie sich auf zum Marien-Krankenhaus. Prompt schnappt ihr eine junge, ihr unbekannte Frau den Parkplatz weg, was sie ziemlich wütend werden lässt. Aber ihre Wut verraucht bald, und sie freundet sich mit der neuen Ärztin an. Alexandra spürt jedoch, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A. PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Der Pilot ihres Herzens
Ärztin Alexandra Heinze
Arztroman von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 149 Taschenbuchseiten.
Die Hobbies von Wolf Hager führen dazu, dass seine Frau ihn verlässt. Sie ist nicht länger bereit, ihn mit seinem Beruf, dem Bergsteigen, Motorradfahren und Drachenfliegen zu teilen. Als er zu einem Einsatz am Hochwasser führenden Rhein gerufen wird, muss er feststellen, dass seine Frau und ein fremder Mann in Not sind...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit fegte die Maschine die Rübenacherstraße herunter, bremste vor dem Parkplatz des Bundeswehrkrankenhauses scharf ab und bog in die Zufahrt zum Personalwohnheim ein.
Der Fahrer, ein athletisch gebauter, groß gewachsener Mann, stieg ab und befreite sich von seinem Helm. Ein trotz des langen Winters braungebranntes Gesicht kam zum Vorschein: Das Gesicht von Wolfram Hager, Oberleutnant der Bundesluftwaffe, Hubschrauberführer des SAR-Stützpunktes 73, neununddreißig Jahre alt. Er strich sich über seinen pechschwarzen Bürstenhaarschnitt und schloss die Harley-Davidson ab.
Ein großer Ford hielt neben ihm. Mahler stieg aus, der Stabsarzt. „Verdammt, Hager, Sie fahren wie eine gesengte Sau!“ Wolfram nahm Haltung an. „Schon das dritte Mal in dieser Woche, dass Sie mit so einem halsbrecherischen Überholmanöver an mir vorbeipreschen! Das nächste Mal sehe ich mich gezwungen, Meldung zu machen!“ Mahler war sauer. Wolfram hatte dieses Unwetter schon seit zwei Wochen heraufziehen sehen. Seit die Straßen schneefrei waren und er wieder mit seiner Maschine zum Dienst fuhr. Er ließ es über sich ergehen, ohne mit der Wimper zu zucken.
„Sie sind langsam alt genug, um zu begreifen, dass ein Soldat eine öffentliche Person ist!“, bellte Mahler.
„Jawohl, Herr Major!“
„Sie haben eine Vorbildfunktion, verdammt noch mal, wann geht das endlich in ihren Dickschädel?“ Mahler wandte sich dem Eingang des Personalwohnheimes zu. „Und wenn Sie sich den einrennen, ist das auch nicht nur Ihre Privatsache“, knurrte er schon wesentlich leiser, „immerhin hat der Staat über eine Million Mark in Ihre Ausbildung investiert.“
„Jawohl, Herr Major!“
Der Offizier verschwand im Eingangsbereich des Gebäudes, und Wolfram begann pfeifend seine Maschine abzudecken. Mahler würde so schnell keine Meldung machen. Er war sein Ausbilder gewesen, und Wolfram hatte einen Stein im Brett bei dem Major. Der mochte Draufgänger.
Die Räume der Besatzung lagen im ersten Stock des Personalwohnheimes: Zwei Schlafräume und das Dienstzimmer. Da saß bereits der Bordmechaniker. Lu – Ludwig Bär – stand immer schon zehn Minuten vor Dienstbeginn in den Startlöchern. Und Yogi – der Luftrettungsmeister Joachim Werne – trudelte wie immer fünf Minuten zu spät ein.
„Hallo Jungs.“ Yogi hastete an seinen Spind im Schlafraum und zog sich in Windeseile um. „Die Sache läuft, Wolf – morgen machst du deinen ersten Flug.“
Wolframs Züge hellten sich auf. „Ehrlich?“
„Klar, der Drachen ist repariert, morgen gibt’s Vorfrühlingswetter mit schönen Aufwinden, ich werde dich fliegen.“ Yogi griff in seine Sporttasche und zog ein Buch heraus und warf es seinem Freund auf den Tisch. Perfektion im Drachenflug, las Wolfram. „Wenn du zwischen den Einsätzen dazu kommst, lies mal die Kapitel Start, Gelände und Landung.“
Plötzlich legte sich Wolfs Stirn in Falten. „Scheiße.“
„Was ist los?“
„Ich hab’ Kersten versprochen, morgen mit ihr zu ihren Eltern nach Duisburg zu fahren.“
Yogi seufzte. „Überleg dir, was dir wichtiger ist. Morgen ist der einzige Samstag, den wir in diesem Monat frei haben. Und zu Frühlingsbeginn schlägt gewöhnlich das Wetter um.“
Yogi verabschiedete sich von Wolf und Lu. Zusammen mit dem Stabsarzt ging er hinüber in die Klinik. Er arbeitete dort in der Anästhesie und Mahler im OP. Bei Einsätzen trafen sie sich mit Wolf und dem Bordtechniker am Hubschrauberlandeplatz.
Wolf ging zum Telefon und wählte seine Nummer. „Hallo, Kersten, hör mal zu, das klappt nicht morgen.“ Ohne Umschweife kam er zur Sache. Das war eine seiner Stärken. Kersten weinte fast am Telefon.
„Wolf, das geht nicht, du hast es mir seit Wochen versprochen!“
„Wir holen es nach, Süße!“
„Ich akzeptiere niemals, dass du jetzt auch noch mit dieser Drachenfliegerei anfängst! Bergsteigen, Motorradfahren, Hubschrauberfliegen, und jetzt auch noch das!“ Kerstens Stimme überschlug sich. Zetern nannte Wolf das. Er grinste.
„Ich bring’ dir das auch bei, Süße, du wirst begeistert sein.“
Kersten dachte nicht daran, begeistert zu sein. Der Frust des ganzen letzten halben Jahres brach aus ihr heraus.
„Ich habe keine Lust mehr, mir ständig Sorgen um dich zu machen!“, schrie sie. „Und ich geb’ mich auch nicht mehr länger mit den Almosen zufrieden, die du mir gnädigerweise alle vier Wochen einmal von deiner Zeit abgibst.“ Vergeblich versuchte Wolf sie zu beruhigen. „Wenn du mit dieser Drachenfliegerei anfängst, hat das Folgen, das versprech’ ich dir! Und dem Yogi bestell einen Gruß von mir: Der Teufel soll ihn holen!“ Dann klickte es in der Leitung.
„Süße?“
Kersten hatte aufgelegt.
Der Techniker grinste ihn an. „Stress?“
„Was denn sonst?“, grinste Wolf zurück.
Gemeinsam gingen sie in die Halle, zogen die Bell heraus und machten sie startklar. Der erste Einsatzbefehl von der Rettungsleitstelle ging um 9.04 ein: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 48. Der Notarztwagen des Marien-Krankenhauses hatte Verstärkung angefordert.
Als sie in der Luft waren, beugte sich Yogi von hinten über Wolfs Schulter. „Und?“
„Kersten lässt dich grüßen“, rief Wolf nach hinten, „der Teufel soll dich holen.“ Yogi lachte, und der Stabsarzt schüttelte grinsend den Kopf. „Die beruhigt sich schon wieder“, sagte Wolf, „um wie viel Uhr morgen?“
„Gegen zwölf.“
„Alles klar.“
2
Dieser Freitag begann für Hans Kremer schon um halb fünf. Die Schmerzen weckten ihn auf. Nichts Besonderes, er schlief schon seit einem halben Jahr nicht mehr durch. Seit seinem vorletzten Krankenhausaufenthalt. Er tastete nach dem Tablettenröhrchen auf seinem Nachttisch und nahm eine Morphiumtablette.
In einer Art Dämmerzustand lag er danach in seinem Bett und hörte klassische Musik auf WDR 3. Gegen sechs richtete er sich langsam auf und blieb etwa eine halbe Stunde lang am Bettrand sitzen. Solange brauchte sein Kreislauf, um einigermaßen in Gang zu kommen. Dann stand er auf.
Er ging ins Bad, trank eine Kleinigkeit und setzte sich ans Fenster seines Wohnzimmers. Allmählich schälten sich im Garten seiner Villa die Konturen der Tannen, Birken und Sträucher aus der Dunkelheit, und der Morgen dämmerte herauf. Der Himmel schien klar zu sein, und Hans Kremer lächelte: Die Reihe der Vorfrühlingstage schien auch heute noch nicht abzureißen. Wie schön!
Auf der Birke begann eine Amsel zu singen. Vorsichtig öffnete er das Fenster. Fasziniert hörte er dem Gesang des Vogels zu. Ein warmer Strom pulsierte durch seinen ausgemergelten Körper. Seit einigen Wochen erlebte er das immer wieder, dieses Glücksgefühl. Plötzlich fiel ihm ein, wie ihm das in jungen Jahren öfter begegnet war. Vor fast dreißig Jahren in Barcelona zum Beispiel, vor dem ersten großen Tennisturnier, das er gewann. Neunzehn Jahre alt war er damals.
Er war am Vorabend des ersten Matches in der Stadt unterwegs gewesen. Auf einem Marktplatz war er auf eine Menschenansammlung getroffen, die einigen Straßenmusikern zuhörte. Kleine, braungebrannte Indios, sie spielten auf südamerikanischen Zupfinstrumenten und Panflöten. Die Melodien hatten ihn ins Herz getroffen damals, hatten ihn verzaubert. Und als diese Woge des Glücksgefühls ihn davontrug, hatte er sich leicht und unbesiegbar gefühlt: Von diesem Moment an hatte es für ihn keinen Zweifel mehr gegeben – er würde das Turnier gewinnen.
So war es auch jetzt: Das Gezwitscher der Amsel fesselte seine ganze Aufmerksamkeit, und er hatte das Gefühl, nie zuvor den Gesang einer Amsel gehört zu haben. Er lächelte und registrierte verwundert, dass er weder den dumpfen Schmerz in den Knochen, noch das Stechen im Bauch empfand, obwohl es schon fast zwei Stunden her war, dass er die Tablette genommen hatte. Und mit der gleichen Klarheit, mit der er damals in Barcelona seinen Sieg vorausgesehen hatte, wusste er plötzlich, dass er den Frühlingsanfang nicht mehr erleben würde.
Er schloss die Augen, nickte seufzend und genoss den Frieden, der sich still und warm in seiner Brust ausbreitete. Hans Kremer ging zum Regal und holte ein Fotoalbum heraus. In diesem Album sammelte er die für ihn wichtigsten Bilder: Fotos, die seine größten Erfolge als Tennisprofi festhielten, ein Hochzeitsfoto, wenige Bilder seiner drei Kinder und nur solche, auf denen sie noch sehr klein waren, denn seit der Scheidung vor zweiundzwanzig Jahren hatte er sie selten gesehen, und seit etwa fünf Jahren hatten sie den Kontakt zu ihm völlig abgebrochen. Sie schrieben nicht mal zu Weihnachten.
Wenigstens hatte sein Ältester ein Foto seines ersten Kindes geschickt. Glücklich betrachtete Hans Kremer das Bild seines Enkels. Glücklich und sehnsüchtig. Auch ein Bild von seinem letzten Krankenhausaufenthalt hatte er hier eingeheftet: Frau Dr. Lore Keller, die Oberärztin, und Marion, die Stationsschwester neben seinem Bett. Über Weihnachten war er zur Chemotherapie im Marien-Krankenhaus gewesen. Das sechste Mal bereits, seit er vor zwei Jahren seine Krebsdiagnose erhalten hatte.
Und plötzlich fiel sein Blick auf ein Foto jenes Aussichtspunktes auf einem der Hügel, die das Rheinufer säumten. Es zeigte eine Steinbank auf einem von Sträuchern umgebenen Felsvorsprung, seine Kinder strahlten ihm entgegen. Das Bild musste uralt sein. Er schlug das Album zu und sah nachdenklich in den sonnigen Morgen. Und er wusste mit einem Mal, dass er für diesen Tag ein Ziel hatte, ein schier unerreichbares und wahrscheinlich sein letztes, aber er würde versuchen, es zu erreichen.
Gegen sieben kam wie immer die Schwester des ambulanten Pflegedienstes. Sie half ihm beim Duschen, Anziehen und Rasieren, machte das Bett, kochte Haferschleim und Kamillentee, und gab ihm seine Medikamente.
„Schwester Renate“, sagte er, kurz bevor sie mit ihrer Arbeit fertig war, „das Wetter ist herrlich, es herrschen frühlingshafte Temperaturen, und ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr.“ Er sah sie entschlossen an. „Ich möchte an den Rhein.“
Die Schwester machte ein verblüfftes Gesicht. „Aber Herr Kremer, Ihre Übelkeit, Ihr Kreislauf, Ihre Schmerzen – das ist völlig unmöglich!“
Er log ihr vor, schon seit gestern Abend ohne Beschwerden zu sein, holte einen Fünfzigmarkschein heraus und registrierte zufrieden, dass die Frau weich wurde.
„Aber wie wollen Sie denn zurückkommen“, bäumte sie sich noch ein letztes Mal auf, „ich komme doch an dieser Stelle erst gegen Mittag wieder vorbei!“
„Ganz einfach: Sie setzen mich am Rheinufer ab, ich bleibe ein Stündchen auf einer Bank sitzen, und dann holt mich ein Taxi ab.“ Er griff nach seinem Telefongerät. „Und damit Sie ganz beruhigt sind, werde ich das Taxi gleich bestellen.“ Seufzend gab die Schwester ihren Widerstand auf. Während er für neun Uhr ein Taxi zu der vereinbarten Stelle bestellte, packte sie ihm etwas zum Trinken, eine warme Decke und ein paar Medikamente ein.
Am Rhein stieg er aus und winkte ihr nach. Gegen neun kam das Taxi. Statt zurück nach Hause, ließ er sich aus der Stadt hinausfahren. „Und nun den Berg hoch Richtung Burgruine“, lotste er den Taxifahrer.
„Sind Sie sicher?“ Besorgt musterte der Chauffeur das gelbe, eingefallene Gesicht seines Fahrgastes. Die Haut spannte sich pergamentartig über spitz hervorstehenden Wangenknochen. Nur ein spärlicher Flaum bedeckte den kahlen Schädel.
„Natürlich bin ich sicher.“ Am Waldparkplatz ließ Hans Kremer sich absetzten. Die Zweifel des Taxifahrers zerstreute er mit einem dicken Trinkgeld. Auf einer Bank ruhte er ein Weilchen aus. Ein Gesunder brauchte von hier aus etwa zwanzig Minuten zur Burgruine, die nur fußläufig zu erreichen war, und dann noch einmal fünf Minuten bis zu jener Steinbank auf dem Felsvorsprung. Er würde wahrscheinlich viermal solange brauchen.
Gegen elf Uhr machte er sich auf den Weg. Er ging langsam und ruhte immer wieder aus. Je näher er der Ruine kam, desto länger wurden die Pausen. Bei der Burgruine überfiel ihn ein leichter Schwindel. Er breitete die Decke aus und legte sich ein Weilchen hin. Danach füllte er an einem Brunnen seine Wasserflasche auf und nahm das letzte Drittel des Weges in Angriff.
Sein hohles Gesicht verzog sich zu einem triumphierenden Lächeln, als er am noch schneebedeckten Berghang stand und auf den Strom herabblickte. Die wenigen Meter hinunter zur Steinbank auf dem Felsvorsprung fielen ihm besonders schwer. Er glitt auf einem Schneefeld aus, stürzte und verstauchte sich den Knöchel.
Er ließ sich ein kurzes Steilstück hinabrollen und schleppte sich dann auf allen Vieren zu der Steinbank. Befriedigt ließ er sich darauf nieder. Der Knöchel pochte schmerzend, die Glieder zitterten von der Anstrengung und der Kälte, aber Hans Kremer war glücklich. An diesem Platz hatte er schon als Kind gespielt, auf dieser Bank hatte er mit seinem Vater gesprochen, kurz vor dessen Tod, hier hatte er sich für seine Laufbahn als Profisportler entschieden, hier hatte seine Frau ihm ihr Ja-Wort gegeben, hier wollte Hans Kremer sich von der Welt verabschieden.
3
„Entweder sind die Freitagabende eine Katastrophe, oder es passiert rein gar nichts.“ Jupp Friederichs mischte die Karten und gab aus. Uschi Thamm – sie hatte heute Abend Röntgenbereitschaft – saß mit den beiden Sanitätern im Bereitschaftszimmer. Seit einer Stunde schon spielten sie Skat.
„Weiß gar nicht, was du hast“, brummte Ewald Zühlke, „es passiert doch ’ne ganze Menge. Fast fünf Mark habe ich euch schon abgeknöpft.“
Am Schreibtisch schob Alexandra Heinze einige Papiere zusammen und stand auf. „Ich gehe mal eben an die Pforte und bringe die Briefe hier ins Postfach.“ Sie öffnete die Tür. „Danach finden Sie mich auf der Inneren in Frau Dr. Kellers Büro.“
Alexandra genoss den ruhigen Dienstnachmittag. Die ganze Woche schon war relativ harmlos verlaufen. Ihre erste Dienstwoche nach einigen Urlaubstagen in der Schweiz. Werner hatte seine Praxis geschlossen, und sie waren zum Skilaufen gefahren. Wie gut hatte das getan! Die Urlaubssonne lag noch auf ihrem gebräunten Gesicht. In der Tasche ihres Arztmantels trug sie schon den ganzen Tag Urlaubsbilder mit sich herum und zeigte sie allen möglichen Kollegen. Lore Keller hatte sie noch nicht gesehen.
An der Pforte dudelte ihr Piepser los. Die Ambulanz brauchte sie. Alexandra hörte schon auf dem Gang das Stöhnen eines Mannes. Im Behandlungszimmer krümmte er sich vor Schmerz auf der Trage. Alexandra untersuchte ihn. „Sieht ganz nach einer Nierenkolik aus“, sagte sie zu Schwester Grit. Sie verabreichte dem Mann ein Schmerzmittel und fuhr ihn dann zusammen mit der Schwester auf die Innere.
Auch Lore Keller, die Oberärztin der Inneren, hielt die Symptome für die Anzeichen einer Nierenkolik. Der Mann wurde aufgenommen. Alexandra sprengte die Skatrunde telefonisch. „Hallo Frau Thamm, Schwester Grit bringt gleich einen Patienten ins Röntgen, wir brauchen eine Nierenaufnahme. Dr. Wendel hat Dienst, er wird das Kontrastmittel spritzen.“
Grit Mindermann fuhr den Patienten zum Aufzug. Falls die Diagnose sich durch das Röntgenbild bestätigen sollte, würde der Mann erst einmal literweise Wasser trinken und dann ein paar Stunden lang das Treppenhaus auf und ab wandern müssen. Vielleicht würde sich der Nierenstein dann lösen.
„Und? Wie war euer Urlaub?“, wollte Lore Keller wissen.
Alexandra schwärmte von Sonne, Schnee und Werner und zeigte ihr die Fotos. „Die Woche war so ruhig, ich bin noch gar nicht richtig angekommen.“
Es klopfte, und eine Schwester betrat Lore Kellers Zimmer. Eine schwarzhaarige, etwa vierzigjährige Frau. „Frau Doktor, Herr Knies hat wieder starke Schmerzen, ob wir ihm noch eine Ampulle Morphium spritzen können?“
„Spritzen Sie es ihm, Schwester Edith, viel mehr können wir nicht mehr für ihn tun.“ Die Stimme der Oberärztin klang resigniert. Alexandra vermutete sofort, dass es sich um einen sterbenden Krebspatienten handelte.
„Übrigens, Schwester Edith“, Lores Miene hellte sich auf, „haben Sie Frau Dr. Heinze schon kennengelernt?“ Alexandra ging auf die Schwester zu und gab ihr die Hand. Sie hatte sie bisher nur von Weitem gesehen und nur flüchtig wahrgenommen.
„Edith Schwarz“, stellte sie sich vor, „ich habe erst zum Jahresbeginn im Marien-Krankenhaus angefangen.“
„Freut mich, Sie kennenzulernen“, lächelte Alexandra, „und wo haben Sie vorher gearbeitet?“
„Ich habe zwei Jahre pausiert“, ein Schatten huschte über Schwester Ediths Gesichtszüge, „ich hatte einen Pflegefall in der Familie.“
„Sie ist eine Perle“, sagte Lore Keller, als sich die Tür hinter der Schwester geschlossen hatte, „keiner versteht es so gut, mit Sterbenden umzugehen wie sie.“
„Mit Sterbenden?“ Alexandra wurde neugierig. Sie wusste, dass viele Schwestern und Pfleger dazu neigten, sich vor der Pflege Sterbender zu drücken. Und nicht nur innerhalb des Pflegepersonals, auch bei Kollegen hatte sie diese Scheu beobachtet. Auf Lore Kellers Abteilung befanden sich naturgemäß die meisten Sterbenden. Häufig Patienten, die schon über Jahre zur Chemotherapie ins Haus kamen.
„Ja“, Lore Keller nickte, „ich bin sehr froh, dass wir sie haben. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Mann verloren, Krebs. Das ist der Pflegefall, von dem sie sprach. Sie arbeitet ehrenamtlich im städtischen Sterbehospiz mit und organisiert auch hier im Haus Seminare für das Pflegepersonal.“
„Solche Leute können wir brauchen.“ Sie plauderten noch ein Weilchen, dann drehte Alexandra eine Runde durchs Haus und betrat eine Stunde später wieder das Bereitschaftszimmer. Friederichs las Zeitung, Zühlke saß mit geschlossenen Augen am Tisch. „Hoffentlich wird Ihnen nicht langweilig, meine Herren.“
„Wo denken Sie hin“, brummte Zühlke, „ich meditiere.“
„Nach meiner Erfahrung kriegen wir heute noch einen Notfall“, sagte Friederichs, „und zwar genau fünf Minuten vor Dienstschluss, während wir schon ungeduldig auf den Nachtdienst warten.“
„Mal den Teufel nicht an die Wand“, knurrte Zühlke.
4
Es waren mindestens hundertzwanzig Leute, soweit er das überblicken konnte. „Guido Elba, guten Abend.“ Soviel Publikum hatte er zuletzt an Silvester in Hamburg gehabt. Er begrüßte jeden einzelnen Gast mit Handschlag an der Tür und ließ sich seinen Namen nennen. „Wie heißen Sie? Borkowsky? Ah, danke!“ Wahrscheinlich gab es hier in der Gegend die eine oder andere Kurklinik, die seine Vorstellung in ihren Veranstaltungskalender aufgenommen hatte. „Guido Elba, mein Name. Und Sie sind?“ Er würde in seiner Adressenkartei nachschauen, denn die Kurkliniken mussten natürlich auch besucht werden. Jedenfalls war er zufrieden.
Manche der Besucher hatten verdammt komplizierte Namen. Einer hieß Treskojanowitsch, ein anderer Krnjoschk und eine Frau Öcegörünte. Die Hände derer mit den besonders komplizierten Namen hielt er solange fest, bis er sich die Namen eingeprägt hatte.
Eine Viertelstunde stand er schon an der Tür. Jetzt war es gleich acht Uhr – Zeit, auf die Bühne zu gehen. Er zog seinen Frack an, schlang einen roten Seidenschal um seinen Hals und setzte sich seinen Zylinder auf. Dan trat er an den Rand der kleinen Bühne.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßt habe ich Sie bereits, bleibt mir nur, Ihnen einen vergnüglichen Freitagabend zu wünschen.“ Er tat, als wollte er sich dem Tisch mit seinen Utensilien zuwenden, drehte sich aber plötzlich wieder zum Publikum. „Ach ja, ich sollte mich besser noch einmal vorstellen“, er zog seinen Zylinder, „Guido Elba, Zauber- und Gedächtniskünstler. Vielleicht haben ja einige meinen Namen schon wieder vergessen.“ Das Publikum klatschte. „Ach, Herr Borkowsky, würden Sie bitte die Tür schließen, oder Sie, Frau Müller.“ Das Publikum lachte und applaudierte wieder. Elba sprach jetzt eine Frau in der ersten Reihe an. „Sie lachen, Frau Öcegörünte, aber es gehört doch zum guten Ton, sich die Namen seiner Mitmenschen einzuprägen, oder was meinen Sie, Herr Keller?“ Das Publikum war begeistert.
So stieg er immer ein. Mal hatte er das Publikum schon nach einem halben Dutzend Namen gewonnen, wie heute, mal musste er zwanzig oder dreißig seiner Gäste mit Namen ansprechen, bevor die Stimmung jenen Weichegrad erreichte – so pflegte er das zu nennen – ab dem das Gros der Zuschauer willig genug war, sich von jedem Zaubertrick täuschen zu lassen.
Er begann mit einigen einfachen Nummern, verwandelte Tücher in Blumen, Blumen in Bälle und warf die Bälle ins Publikum. Selbstverständlich nicht ohne den jeweiligen Fänger mit seinem Namen anzusprechen.
Die etwas komplizierteren Nummern leitete er mit dem uralten Trick ein, mit dem er noch bei jeder Veranstaltung Staunen erntete, ob Galafete oder Kindergeburtstag: Er faltete eine alte Zeitung zu einer trichterförmigen Röhre, goss ein Glas Wasser hinein, ließ Frau Ellerkamp und Herrn Trampert auf die Bühne kommen, um die Zeitung zu entfalten – keine Spur von Wasser – und forderte dann Herrn Treskojanowitsch auf, das Glas zu halten, in das sich dann aus der wieder zusammengerollten Zeitung das Wasser ergoss.
Es folgten dann die Tricks an einzelnen Personen, die er namentlich aus dem erstaunten Publikum auf die Bühne bat. Und als Höhepunkt in der zweiten Programmhälfte dann die Gedächtniskunststücke. Er ließ sich zum Beispiel zweihundert Begriffe zurufen – ein Zuschauer protokollierte sie – und gab anschließend jeden einzelnen korrekt und in der richtigen Reihenfolge wieder.
Oder er öffnete einen großen Koffer, drehte ihn so zum Publikum, dass er selber ihn nicht einsehen konnte, und forderte seine Zuschauer auf den leeren Koffer mit persönlichen Gegenständen zu füllen. Bevor dann der Lippenstift, das Feuerzeug oder das Taschentuch in dem Koffer verschwand, durfte er fünf Sekunden draufschauen. Anschließend wurde der Koffer geschlossen und von der Bühne auf den Mittelgang zwischen den beiden Zuschauerblöcken getragen.
Von der Bühne aus nannte Elba nun nicht nur die Gegenstände im Koffer, sondern auch den Namen seines Besitzers, der ihn sich dann jeweils wieder herausholen musste. Er nannte sogar noch Besonderheiten, Farben und Formen der Gegenstände, wenn es sich um Taschentücher, Feuerzeuge oder ähnliches handelte, die natürlich mehrfach im Koffer gelandet waren.
Am Ende der Vorstellung verabschiedete er jeden einzelnen seiner Zuschauer an der Tür. Mit Namen natürlich.
5
Etwa um die gleiche Zeit parkte Konrad Vollmer seinen Jeep auf dem Waldparkplatz. Er holte das Gewehr und die Taschenlampe aus dem Heck und machte sich auf den Weg zur Burgruine. Vollmer war Förster und hatte in den letzten Wochen Spuren von Wildschweinen im Stadtwald gefunden. Einige Wanderer wollten sie sogar gesehen haben. Ihn interessierte vor allem der Bestand.
Es war etwa gegen zehn, und Vollmer konnte es sich nicht verkneifen, von der Ruine aus – hier wollte er die Nacht verbringen – noch schnell einen Abstecher an den Hang zu machen. Er liebte es, auf den Rhein herunterzuschauen. Obwohl man von dem Strom um diese Zeit nicht mehr sah als ein paar Lichter, die sich im Wasser widerspiegelten oder, wenn man Glück hatte, die Positionslampen eines vorbeiziehenden Frachtschiffes.
Konrad Vollmer überquerte die noch schneebedeckte Lichtung, die sich von der Burgruine zum Hang hin erstreckte. Fünf Minuten später stand er am Abhang. Die Scheinwerfer vorbeifahrender Autos und eines Zuges zogen tief unter ihm am Ufer des Stromes entlang. Von fern drang das Brausen der Bahn und das Brummen der Motoren zu ihm herauf. Lange Zeit stand er so und genoss die Konturen des Flusstales und die nächtliche Stille. Er wollte sich gerade wieder abwenden und zur Ruine zurückkehren, als er ein Krächzen hörte.
Der Förster zuckte zusammen. Was war das? Ein Rabe? Eine Elster? Oder ein Fuchs? Da – wieder das keuchende Krächzen. Hustete da nicht jemand? Er schlich gebückt am Hang entlang, bis er es nicht weit unter sich ganz deutlich hörte: Jemand hustete. Ein Mensch befand sich irgendwo hier auf dem Berghang. „Hallo?“ Er ließ den Lichtkegel seiner Stablampe über Felsen, Sträucher und Moos wandern. „Ist da jemand?“ Keine Antwort. War da unten nicht eine Steinbank auf einem Felsvorsprung?
Vollmer fand den zugewachsenen Hohlweg, der nach unten führte. Er legte seinen Rucksack ab. Mehr rutschend als kletternd erreichte er den Vorsprung. Die Umrisse einer menschlichen Gestalt zeichneten sich in der Dunkelheit ab. Er ließ die Lampe aufflammen. Auf der Steinbank kauerte ein in eine Decke gehüllter Mann. „Was machen Sie denn hier?“
Vollmer trat näher. „Ich sitze hier.“ Die Stimme des Mannes klang heiser und gebrochen. Vollmer leuchtete ihn an. Das Gesicht des Fremden war fahlgelb und eingefallen. Er schloss geblendet die tief in den Höhlen liegenden Augen. Sein kahler Schädel war von grauem Flaum bedeckt. Der Förster erschrak. Den Tod persönlich schien er hier aufgespürt zu haben. Er überwand die aufbrandende Panik und ging noch näher an den Mann heran. Er zitterte wie Espenlaub. Wieder wurde er von einem Hustenanfall geschüttelt.
„Sind Sie krank?“
„Kann sein“, sagte der Mann. Jetzt bemerkte Vollmer, dass er nur noch aus Haut und Knochen bestand. Kein Zweifel – er hatte einen Schwerkranken vor sich.
„Wie kommen Sie denn hierher?“
„Genau wie Sie.“ Wieder ein Hustenanfall. „Bitte gehen Sie einfach weiter, und tun Sie so, als hätten Sie mich nicht gefunden.“
Vollmer setze sich neben den Mann und tastete seinen Puls. Der raste. Seine Haut fühlte sich kaltschweißig an. „Mann, Sie brauchen ärztliche Hilfe.“
„Brauche ich nicht, ich will …“, der Rest ging in Husten unter.
Vollmer stieg wieder den Hohlweg hinauf. Der Mann krächzte ihm irgendetwas Unverständliches hinterher. Oben angekommen kramte er sein Handy aus dem Rucksack. Wenn er nachts auf Pirsch war, pflegte er gegen elf immer noch einmal seine Frau anzurufen. Jetzt wählte er die Nummer der Rettungsleitstelle.
6
Jupp Friederichs stand am Spind und wollte eben in seinen Parka schlüpfen, als das Telefon klingelte. Alexandra Heinze nahm ab. An ihrem Gesichtsausdruck und der konzentrierten Art, wie sie die Informationen des Anrufers notierte, las der Sanitäter ab, was die Stunde geschlagen hatte. Er hängte seinen Parka zurück in den Spind.
„Habe ich es nicht gesagt? Fünf Minuten vor Feierabend noch ein Notfall. Ich hätte mit dir wetten sollen.“
Ewald Zühlke verdrehte die Augen. „Und noch keine Spur von der Ablösung!“
Alexandra legte auf. „Die Rettungsleitstelle, meine Herren. Wir dürfen.“
„Und wohin und warum?“ Zühlke erhob sich seufzend.
„Ein Schwerkranker hängt im Berghang über dem Rheintal. Und zwar …“, sie ging auf die Wandkarte zu, „am besten, wir schauen uns das mal an.“
Sie studierten die Karte. „Ich glaub’, mich tritt ein Pferd“, jammerte Zühlke, „von dem Parkplatz bis zum Berghang sind es mehr als zwei Kilometer!“
Das Gesicht der Notärztin nahm einen hilflosen Ausdruck an. „Und dann mit einer Trage nachts durch unwegsames Gelände, ich glaub’, wir haben ein Problem.“ Sie telefonierte wieder mit der Rettungsleitstelle. Auch dort wurde jetzt die Karte genauer studiert.
„Hier neben der Burgruine ist eine Lichtung verzeichnet“, Friederichs zeigte auf die Stelle, „die sollen doch nochmal mit dem Anrufer telefonieren. Vielleicht kann der herausfinden, ob sich das Gelände als Hubschrauberlandeplatz eignet.“
Zühlkes verdrossene Züge hellten sich auf. „Stimmt, das ist eigentlich ein Fall für die SAR.“
Fünf Minuten später kam die Rückmeldung von der Rettungsleitstelle. Sie hatten den Rettungshubschrauber der Bundeswehr schon verständigt. „Die bitten drum, einen Notarzt des Marien-Krankenhauses aufnehmen zu können. Ihr eigener Arzt steckt mitten in einer Notoperation.“
Mitleidig schauten Zühlke und Friederichs ihre Notärztin an. Es war klar, dass sie mitfliegen würde. Alexandra gab ihr o.k. durch. Es wurde vereinbart, dass ein Sanitäter des Roten Kreuzes sie mit dem Notarzt-Porsche bis zum Parkplatz in der Nähe der Ruine fahren würde. Der Sanitäter sollte sich um die Einweisung des landenden Hubschraubers kümmern, und Alexandra den Kranken erstversorgen.
Seufzend sah die Ärztin ihre beiden Kollegen an. Friederichs hatte wieder seinen Parka aus dem Spind geholt, und Zühlke packte pfeifend seine Thermoskanne ein. „Sanitäter müsste man sein.“
Zwei Minuten später raste Alexandra in einem Porsche mit Blaulicht und Martinshorn aus der Stadt.
7
„Rettungsleitstelle ruft Christoph dreiundzwanzig.“
Lu griff nach dem Mikro. „Hier Christoph dreiundzwanzig, kommen Sie.“
„Die Notärztin wird von einem unserer Leute zum Einsatzort gefahren. Der wird eine Leuchtkugel abschießen und Sie einweisen. Kommen.“
Wolf zuckte mit den Schultern. „Auch gut.“
„Christoph dreiundzwanzig, verstanden. Bitte Koordinaten durchgeben.“
Wolf fuhr die Rotoren auf volle Leistung, die Bell hob ab. „Rettungsleitstelle an Christoph dreiundzwanzig. Fliegen Sie Planquadrat 122 F wie Foxtrott. Das ist eine Lichtung neben einer Burgruine. Achten Sie auf das Leuchtsignal und Lichtzeichen. Der Kollege wird mit einem Scheinwerfer blinken und den Förster mit seiner starken Stablampe postieren, so dass Sie den Landeplatz markiert finden. Kommen, ob verstanden.“
„Christoph dreiundzwanzig an Leitstelle, verstanden.“
Die Beleuchtung im Passagierraum ging an. Yogi kramte in einem Aktenordner nach einer Karte. Lu drehte sich zu ihm um. „Es muss die Nummer 92 sein.“ Yogi fand die Karte im Maßstab 1 : 50 000 sofort. Er reichte sie nach vorne, und Lu, der als Bordmechaniker auch für die Navigation zuständig war, beugte sich über sie. „Grobe Flugrichtung 280 Grad“, gab er Wolf über den Helmfunk durch. Das Pochen der Rotoren erfüllte den Innenraum. Die Männer waren das gewohnt.
Nach acht Flugminuten Kurskorrektur. „270 Grad“, gab Lu durch. Wolf ging auf den neuen Kurs. „400 Fuß“, sagte der Bordmechaniker, „du kannst auf 380 runtergehen.“
Drei Minuten später stieg eine Leuchtkugel nicht weit vor ihnen auf. „Dort ist es!“ Lu deute nach vorne. Wolf zog eine Schleife über der Stelle, wo der schon verglühte Schweif des Geschosses aufgestiegen war. „Außenscheinwerfer an!“ Lu bediente die entsprechenden Knöpfe. Die Umrisse der Burgruine wurden sichtbar. Ein Scheinwerfer blinkte etwa zwanzig Meter unter ihnen, zehn Meter weiter eine schwächere Lichtquelle. Wolf setzte zur Landung an.
Kaum hatte die Bell Bodenberührung, riss Yogi die Seitentür ganz auf. Schon im Landeanflug hatte er sie einen Spalt geöffnet, um seinen behelmten Kopf herauszustrecken. Über den Bordsprechfunk hatte er Informationen über Bodenbeschaffenheit und Umgebung des Landeplatzes an seinen Kutscher durchgegeben. So wurden die Piloten gerne genannt. Der schneebedeckte Boden war eben, es standen keine Bäume in der Nähe – kein Grund also, Alarm zu schlagen. Yogi sprang heraus und lief geduckt unter den Rotorblättern auf den Mann in der roten Leuchtjacke zu.
„Der Verletzte liegt noch am Hang!“, schrie der.
„Stell die Kiste aus, Wolf“, funkte Yogi, „wir müssen unseren Patienten erst noch bergen.“
Fünf Minuten später standen sie zu fünft am Berghang. „Wie sieht es aus da unten, Frau Doktor?“
„Schwere, innere Erkrankung“, rief Alexandra Heinze zurück, „der Mann ist unterkühlt, der Kreislauf war kurz vor einem Kollaps. Ich habe eine Infusion gelegt. Aber ich weiß nicht, wie wir ihn hier unten weg kriegen sollen!“
Yogi stieg auf den Felsvorsprung herunter und sah sich die Sache genauer an. Hans Kremer lag in eine Rettungsdecke gewickelt auf der Steinbank. Die Notärztin hielt die Infusion über ihm.
Sie holten ein Seil, und Yogi sicherte seinen Patienten mit der Rettungsschlinge. Dann nahm er ihn Huckepack und ließ sich von den anderen über den Hohlweg hochziehen. Dort wartete schon die Trage.
Etwa eine halbe Stunde nach der Landung schoben sie Hans Kremer auf seiner Trage an Bord. Alexandra Heinze nahm neben Yogi Platz. Die Bell hob ab und nahm Kurs auf das Marien-Krankenhaus.
8
Gegen Mitternacht stand Guido Elba im Bad seines Hotelzimmers unter der Dusche. Unter dem Strahl des warmen Wassers entspannte sich sein Körper. Er stöhnte genüsslich. Die tiefe Befriedigung, die sich nach jeder Vorstellung einstellte, erfüllte ihn wohltuend. Guido liebte es, auf der Bühne zu stehen, er genoss es, das Publikum zu verblüffen und anderthalb Stunden lang Mittelpunkt zu sein. Seitdem er mit diesen Vorstellungen sein Geld verdiente, liebte er es, im Applaus zu baden. Er war regelrecht süchtig danach.
Seit fast vier Jahren trat er als Zauber- und Gedächtniskünstler auf. Vorher hatte er sich als Versicherungsvertreter durchgeschlagen, und davor war ihm der Versuch, eine Agentur für Partnerschaftsvermittlung aufzuziehen, restlos in die Hosen gegangen. Davor war er ein halbes Jahr lang arbeitslos gewesen. Seit Inges Tod. Und davor hatte er jahrelang erfolgreich als Pharmareferent gearbeitet. Aber das war lange her. So lange, dass es schon fast nicht mehr wahr war. Mein erstes Leben, pflegte er zu sagen. Wenn er überhaupt darüber sprach. Er sprach so gut wie nie darüber. Und was Inges Tod betraf, so versuchte er sogar, seine Gedanken fernzuhalten von dieser tiefen Wunde.
Er stellte das Wasser ab und griff nach dem Handtuch. Das Publikum hatte keinen blassen Schimmer davon, wie viel Kraft so eine Vorstellung kostete. Weniger die Zaubertricks. Das war reine Technik. Ein Handwerk, das jeder erlernen konnte, der einigermaßen geschickte Hände hatte. Und genügend Leidenschaft im Blut und Hartnäckigkeit im Schädel, um zwei bis drei Jahre lang Tag für Tag zu trainieren.
Guido frottierte seine vollen, grauen Haare. Er besaß beides: Hartnäckigkeit und Leidenschaft. Allerdings hatte es drei Jahre gedauert, bis diese Stärken in ihm zu neuem Leben erwacht waren. Nach Inges Tod war er nur noch ein Wrack gewesen …
Die Zauberei betrachtete er allerdings eher als Zugabe. Seine eigentliche Kunst bestand in der Gedächtnisakrobatik. Darauf war er stolz. Und die kostete Kraft. Nach jeder Vorstellung war er schweißgebadet.
Er schaute in den Spiegel und begann sein Gesicht einzucremen. Ein großflächiges Gesicht mit runden, freundlichen Zügen aus denen kleine, braune Augen blitzten. Danach stellte er sich auf die Waage. Einhundertacht Kilo. Gestern Abend waren es noch einhundertzehn gewesen. Und dabei hatte er gleich nach der Vorstellung eine Riesenpizza verschlungen. Aber das war seine Erfahrung nun schon seit vier Jahren: Die ungeheure Konzentration verbrauchte mehr Kalorien als ein Waldarbeiterjob. Guido war zufrieden damit. So wurde er wenigstens nicht allzu fett.
Er war wirklich nicht schlank – sein massiger, eins-neunzig großer Körper wirkte hünenhaft und fast ein wenig grobschlächtig. Sein freundliches Gesicht glich diesen Eindruck aber sofort wieder aus.
Er goss sich einen Whisky ein. Es wurde Zeit, sich dem Vormittagsprogramm des kommenden Tages zu widmen. Er holte seine Adressenkartei aus der Reisetasche. Hier hatte er sämtliche Institutionen vermerkt. Die Adressen waren nach den Städten geordnet, in denen er regelmäßig auftrat. Von A wie Augsburg über R wie Rosenheim und S wie Saarbrücken bis hin zu Z wie Zwickau. In seiner Zeit als Pharmareferent, in seinem ersten Leben, hatte er eine gewisse Pedanterie in organisatorischen Dingen gelernt.
Die Adressen von Kliniken und Altenheimen waren auf roten Karteikarten festgehalten. Es gab zwei Krankenhäuser in der Stadt, mehrere Altenheime, und in der näheren Umgebung vier Kurkliniken. Zwei davon Privatkliniken. Die würde er meiden, denn mit Privatkliniken hatte er schlechte Erfahrungen gemacht. Die anderen beiden würde er morgen Vormittag besuchen. Die Samstage waren immer sehr einträglich gewesen. Am Montag dann die Altenheime und danach die beiden Krankenhäuser.
Guido öffnete seinen Koffer und holte die schwarze Lockenperücke heraus. Und den Schnurrbart, den er sich morgen ankleben würde. Die Bronzekette mit Kruzifix lag schon auf seinem Nachttisch. Auch das kleine Gebetbuch. Dann öffnete er den Schrank und nahm den Bügel mit dem schwarzen Anzug heraus. Er hängte ihn ins Licht und begann ihn liebevoll abzubürsten. Das Jackett hatte einen Stehkragen mit einer schwarz glänzenden Seidenstickerei und schwarze, runde Stoffknöpfe
Es war die Garderobe eines Geistlichen. Eines katholischen Priesters, genauer gesagt. Er hatte sie sich in Paris maßschneidern lassen. Vor zwei Jahren.
Guido war alles andere als ein Geistlicher. Obwohl er vor undenkbaren Zeiten – fünfundzwanzig Jahre war es sicher her – vier Semester katholische Theologie studiert hatte. Ja, er wollte einmal Priester werden. Aber nur solange, bis er Inge kennenlernte …
Was sie wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass er zwei Jahre nach ihrem Tod wieder an diesen alten Berufswunsch angeknüpft hatte? Sein Gewissen regte sich. Und die Traurigkeit. Er schob den Gedanken an Inge beiseite.
Guido hatte nichts von einem Priester. Rein gar nichts. Trotzdem würde er morgen als Priester in die Kurkliniken gehen. Vorfreude erfasste ihn, eine prickelnde Lust fast. Die Lust, endlich das zu tun, was er nun schon seit fast zwei Jahren nicht lassen konnte, wenn er in eine fremde Stadt kam.
9
Unten auf der Felsplattform hatte Alexandra nur den Namen des Mannes aus ihm herausbringen können. Jetzt, im Hubschrauber, hinderte der Lärm der Rotoren sie daran, mit ihm zu sprechen. Aber durch die Bordbeleuchtung konnte sie sein Gesicht sehen. Es war das Gesicht eines Todkranken. Sie war lange genug Ärztin, um gleich nach dem ersten Blick eine zumindest vage Diagnose stellen zu können: Dieser Mann litt an Krebs. Wie um alles in der Welt hatte er es in seinem Zustand nur geschafft, auf diese Bank am Berghang zu gelangen? Und was hatte er dort gewollt?
Der Co-Pilot hatte auf ihre Bitte hin bereits das Marien-Krankenhaus verständigt. Soweit Alexandra sehen konnte, brauchte der Patient keine Intensiv-Pflege. Er gehörte auf die Innere. Der Co-Pilot drehte sich zu ihr und hob den Daumen seiner rechten Hand. Das hieß wohl: Auf der Inneren war noch ein Männerbett frei.
Nach der Landung fuhr sie Hans Kremer zusammen mit zwei der Besatzungsmitglieder auf die Station. Sie kannte alle beide von mehreren Einsätzen: Wolfram Hager, der Pilot und Joachim Werne, der Sanitäter. Luftrettungsmeister, wie das bei den Soldaten hieß. Die Crew von Christoph dreiundzwanzig genoss einen sehr guten Ruf unter den Notärzten der Region. Alexandra hatte noch nie einen derart fähigen und gut ausgebildeten Sanitäter erlebt, wie Joachim Werne.
„Und, wie war der Flug?“, wandte er sich im Aufzug an Hans Kremer. Der nickte. „Es ging.“ Er blickte den Piloten an. „Was heißt eigentlich SAR?“ Offenbar hatte er beim Ausladen im Flutlicht des Hubschrauberlandeplatzes das Emblem auf der Maschine gelesen.
„Search and rescue“, antwortete Wolfram Hager, „suchen und retten.“
„Apropos suchen“, mischte Alexandra sich ein, „was haben Sie eigentlich dort oben auf dem Berg gesucht?“
Hans Kremer wich ihrem Blick aus. „Ich wollte noch einmal an einem Platz sein, der mir viel bedeutet.“ Er sprach heiser und mit schwacher Stimme. „Und dort wollte ich in Ruhe sterben. Aber das haben Sie ja nun verhindert.“
Hager und Werne sahen sich nur an. Der Pilot presste seine Lippen zusammen, und der Sanitäter zog scharf die Luft ein. Alexandra verstand gut, dass die beiden sich ärgerten. Immerhin war so ein Rettungseinsatz nicht ohne Risiko. Und nun so ein Dankeschön … Andererseits berührte sie die Offenheit und Ruhe, mit der dieser Mann über seinen Tod sprach.
Die Aufzugtür öffnete sich. Sie schoben die Trage über die Schwelle zur inneren Station. Die Nachtschwester kam ihnen entgegen. Alexandra kannte sie. Sie hieß Greta und war Schülerin im dritten Jahr, eine schlanke, bildhübsche Blondine. Sie machte große Augen, als sie Kremer sah. „Ja, Herr Kremer, was machen Sie denn für Sachen?“ Offenbar kannte sie ihn.
Sie öffnete die Tür ins Behandlungszimmer. Dr. Gerd Wendel, der diensthabende Arzt, übernahm den Patienten.
Alexandra plauderte noch ein wenig mit Wolfram Hager, den sie sehr schätzte. Trotz seiner braungebrannten Sportlichkeit wirkte er auf sie fast seriös und ernst. Ein Eindruck, der gar nicht zu den Gerüchten passen wollte, die sie ab und zu über ihn hörte. Demnach sollte er ein ziemlich ruppiger Draufgänger sein.
Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Joachim Werne mit Greta flirtete. Die junge Frau stand mit gerötetem Gesicht an den Türrahmen des Schwesternzimmers gelehnt und schien vor dem Charme des mindestens zehn Jahre älteren Sanitäters dahinzuschmelzen. Alexandra grinste. Hager bemerkte ihren Blick und drehte sich zu seinem Freund und Kollegen um. „Ich glaube, jetzt muss ich jemanden retten“, lächelte er.
„Den Sani oder die Schwester?“, lachte Alexandra.
„Komm Yogi, wir müssen.“ Er schnappte sich die Trage und schob sie in Richtung Ausgang. Greta und der Sanitäter lösten sich notgedrungen, und Joachim Werne lief seinem Hubschrauberführer hinterher.
„Bis bald!“ Er winkte noch einmal.
„Bis bald“, sagte Alexandra gedankenlos. Früher, als ihnen lieb war, sollten sie sich wiedersehen.
10
Wolf kam erst nach Mitternacht nach Hause. Kersten schlief schon. Zumindest tat sie so. Er aß einige Käsebrote, trank ein Bier und schlief danach wie ein Stein.
Am nächsten Morgen kam es, wie es kommen musste. „Ich habe kein Auge zugemacht“, jammerte Kersten, während er die Kaffeemaschine anwarf, „ich hab’ mir solche Sorgen gemacht um dich.“
„Hast recht, ich hätte anrufen sollen, dass es später wird“, versuchte Wolf einzulenken.
„Und heute willst du mich schon wieder allein lassen!“ Kersten ließ nicht locker. Sie lag ihm so lange in den Ohren, bis er wütend wurde.
„Nun ist aber gut, verdammt noch mal!“ Er knallte die Frühstücksteller auf den Tisch. „Ich gehe in einer Stunde aus dem Haus und bin spätestens um fünf wieder hier, na und?“ Ärgerlich warf er den Lappen in die Spüle. „Immer noch Zeit genug für einen schönen Abend!“
Spätestens wenn Wolf wütend und laut geworden war, pflegte Kersten noch lauter und noch wütender zu werden. „Ich will nicht, dass du mit dieser Drachenfliegerei anfängst! Mir reichen die hundert anderen Gelegenheiten schon, bei denen du dir den Hals brechen kannst! Entweder der Drachen oder ich!“ Dann rannte sie ins Schlafzimmer und schloss sich ein.
Wolf setzte sich trotzig an den Frühstückstisch und versuchte so zu tun, als könnte es ihm besser gar nicht schmecken. Aus dem Schlafzimmer hörte er ihr Schluchzen. Nach dem Frühstück packte er scheinbar ungerührt seine Sachen, setzte sich auf seine Maschine und brauste davon.
Kersten sah ihm durchs Schlafzimmerfenster hinterher. Sie war fassungslos. Bis zum Schluss hatte sie gehofft, dass er es sich noch einmal überlegen würde. „Sturer Bock!“, fluchte sie. „Ich hätte es wissen müssen!“ Händeringend und heulend lief sie eine Zeitlang in der Wohnung herum. Dann setzte sie sich an den Frühstückstisch, schenkte sich Kaffee ein und zündete eine Zigarette an.
Sie rauchte hastig. Etwa vier hintereinander. Dann straffte sich ihr Körper, und sie wurde ruhiger. „Wie du willst!“, zischte sie und verschwand im Bad.
Die nächsten zwei Stunden liefen so geordnet und folgerichtig ab, als hätte Kersten sie seit Langem geplant. Nachdem sie sich angezogen hatte, führte sie als erstes ein Telefongespräch. Kein langes, wie eine Frau, die ihr Herz bei ihrer Freundin ausschütten muss. Sie telefonierte höchstens fünf Minuten.
Dann schrieb sie einen Brief und legte ihn auf den Frühstückstisch. Danach holte sie zwei Koffer vom Speicher und räumte gezielt die Schränke aus. Nach einer halben Stunde waren die Koffer prall gefüllt. Sie stellte sie vor die Wohnungstür.
Mit einer Zigarette ging sie schließlich nachdenklich durch die Wohnung. Hier und da blieb sie stehen und betrachtete wehmütig das eine oder andere Möbelstück, Bild oder Buch. Besonders lange verharrte sie im Schlafzimmer.
Es klingelte. Kersten rannte auf den Balkon. Ein schwarzer Mercedes stand vor der Tür. Und ein elegant gekleideter Mann mittleren Alters. Er winkte ihr zu.
Noch einmal sah Kersten sich um, bevor sie die Tür öffnete. Sie seufzte tief. Der Mann nahm sie in den Arm und küsste sie. Gemeinsam trugen sie die Koffer zu seinem Auto und fuhren davon.
11
Die schwarze Hose zog Guido Elba schon im Hotel an. Perücke, Schnurrbart, Kruzifix, Gebetsbuch und Jackett trug er in einer Tasche zu seinem Auto. Er fuhr etwa zwanzig Kilometer, dann hielt er auf einem Waldparkplatz.
Er überzeugte sich davon, dass ihn niemand beobachtete und öffnete dann seinen Kofferraum. Aus einer Decke wickelte er einen kleinen Garderobenspiegel. Den stellte er auf und legte die schwarz-gelockte Perücke, den Schnurrbart und das Kruzifix an. Er tauschte den Mantel gegen die schwarze Jacke. Bis zum obersten Knopf schloss er sie.
Kritisch blickte er in den Spiegel und drehte sich wohlgefällig. Die Amtstracht stand ihm hervorragend. Guido schloss den Kofferraum und setzte die Fahrt fort.
Die Rheumaklinik lag im Randbezirk des Kurortes. Er fuhr langsam an dem Gebäudekomplex vorbei und parkte dann zwei Straßen weiter. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt betrat er das Foyer der Klinik. „Pater Johannes“, stellte er sich beim Pförtner vor. Der Mann wies Hochwürden – so sprach er ihn tatsächlich an – den Weg zu den Stationen.
Befriedigt ließ Guido den Aufzug kommen. „Die Leute im Rheinland wissen wenigstens noch, was sich gehört“, dachte er. Die wenigen Schwestern, denen er begegnete, grüßten ihn zuvorkommend. Er klopfte einfach an die erstbeste Tür und trat ein.
Er sei der Vertreter des Geistlichen, der am Ort für die Kurseelsorge zuständig sei, erklärte er, und erkundigte sich freundlich nach dem Befinden der Patienten.
Natürlich war er nicht überall willkommen. „Ich bin nicht in der Kirche“, oder „ich bin evangelisch“, wiesen ihn viele Patienten ab. Doch etliche konnte er für ein Gespräch gewinnen, und manche waren sogar ausgesprochen dankbar für den Besuch eines Seelsorgers.
Selbstverständlich griff er nicht überall zu. Meistens nur, wenn er allein mit einem Gesprächspartner war, vor allem in Einzelzimmern. Und auch nur dann, wenn das Risiko praktisch gleich Null war, wenn also die Brieftasche oder der Schmuck so gut erreichbar lagen, dass ein einigermaßen geübter Dieb sie ohne Gefahr erreichen konnte. Und Guido Elba war mehr als nur einigermaßen geübt.
Er nahm auch nichts mit, dessen Verschwinden dem Besitzer aller Wahrscheinlichkeit nach sofort auffallen würde. Schließlich verbrachte er gewöhnlich bis zu zwei Stunden in einem Haus. Und er brauchte einen kalkulierbaren Vorsprung.
Auch achtete Guido drauf, nie mehr als höchstens fünfmal zuzugreifen. Das war nach seiner Erfahrung eine Häufung, bei der das Personal zunächst noch an einen Insider als Täter dachte. Der Kurseelsorger wurde sowieso nie verdächtigt. Jedenfalls hatte er in den Zeitungsberichten über seine Beutezüge nie dergleichen gelesen. Und wenn irgend möglich, versuchte er nur die Scheine aus den Geldbörsen und Brieftaschen einzustecken. Das gelang natürlich nicht immer.
In dieser Klinik schaffte er das dreimal. Außerdem stahl er eine ganze Brieftasche und einen Brillantring. Äußerlich ruhig, aber innerlich in lustvoller Erregung verließ er die Klinik. Nicht ohne dem netten Pförtner Gottes Segen zu wünschen.
Er fuhr etwa dreißig Kilometer, hielt dann am Ufer eines Stausees und sichtete die Beute. Dreihundertachtzig Mark, zweihundertfünfzig Mark aus der Brieftasche, das Kleingeld nicht mitgerechnet, natürlich. Für den Brillantring würde ihm sein Hehler sicher achthundert bis tausend bezahlen.
Der Brieftasche entnahm er sonst nur den Personalausweis. Auch hierfür hatte er Abnehmer. Die Scheckkarte rührte er nicht an. Grundsätzlich nicht. Er fand es unfair, Konten zu plündern, ohne dass ihr Besitzer eine Chance hatte. So etwas schien selbst Guido eine ordinäre Art von Kriminalität zu sein. Sein Stil dagegen hatte etwas Sportliches. Fand Guido jedenfalls. Und war nicht ohne Unterhaltungswert. Für Guido jedenfalls. Und ein paar Hunderter konnten doch die meisten verkraften. Davon jedenfalls war Guido überzeugt.
Nur ungern gestand er sich ein, dass er diese Art von Freizeitbeschäftigung wie unter einem inneren Zwang ausübte. Er hatte anfangs versucht, dagegen anzukämpfen. Es war ihm nicht gelungen. Also hatte er sein Verfahren stattdessen perfektioniert.
Guido blickte sich um. Niemand war zu sehen. Er warf die Brieftasche in den See. Die nächste Klinik lag eine Autostunde entfernt. Hier stellte er sich als Pater Remigius vor. Die Ausbeute in bar fiel nicht ganz so hoch aus wie in der Rheumaklinik, dafür fiel ihm eine teure Herrenarmbanduhr in die Hände.
Am frühen Nachmittag fuhr er zurück in sein Hotel. Er war tief befriedigt.
12
Wolf kam schon um halb zwölf auf dem Berg an. Neben der hölzernen Startrampe am Hang standen vier bunte Drachen. Wolf wurde es ein wenig mulmig zumute. Er schloss seine Maschine ab und ging an den Hang zu den Männern, die sich schon in ihre Kluft quälten.
„Hallo Wolf“, begrüßte ihn Yogi, „der Wind ist günstig, nicht zu schnell und nicht zu langsam.“ Er hatte seinen großen Drachen startklar gemacht. Ein teures Gerät, das sich für den Flug zu zweit eignete.
„Hier ist deine Montur“, er wies auf ein Bündel neben dem Drachen, „ziehe sie ruhig allein an, ich kontrolliere dich dann, mal sehen, was du gelernt hast.“
Sie hatten die Startvorbereitung sicher zehnmal geübt. Theoretisch kannte Wolf jeden Handgriff. Er schlüpfte in die dicke, gut isolierte Montur. Yogi überprüfte den korrekten Sitz der Kleidung.
„Sehr gut, Wolf“, kritisch sah er seinen Freund an, „sag mal, du machst ja ein Gesicht, als hätte dir beim Frühstück jemand eine tote Maus unter die Cornflakes geschmuggelt!“
„So ähnlich“, brummte Wolf, „Kersten hat einen Aufstand gemacht, weil ich jetzt noch mit der Drachenfliegerei anfangen will.“ Yogi machte ein mitleidiges Gesicht. „Wird schon wieder“, grinste Wolf, „ist manchmal ein bisschen hysterisch, die Gute. Und du? Du scheinst bester Laune zu sein, was?“
Yogi grinste. „Sag mal, war das ein Traum gestern Abend, oder habe ich wirklich mit einer blonden Göttin geschäkert?“
Lachend schlug ihm Wolf auf die Schulter. „Du bist einfach unverbesserlich!“
„Ich hab’ die halbe Nacht an diese Schwester gedacht. Greta hieß sie, nicht wahr?“ Wolf nickte. „Ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich glaub’, mich hat es ernsthaft erwischt.“ Gemeinsam traten sie an den Drachen heran. „Und? Hast du Schiss?“
„Ein bisschen schon“, gestand Wolf.
„Das ist normal“, sagte Yogi. Er drehte sich zu den anderen Piloten um. Sie standen am Hang, beobachteten die Wolken und maßen die Windgeschwindigkeit. Yogi beugte sich an Wolfs Ohr. „Sieht du den auf der Rampe mit dem blauen Helm?“, flüsterte er. Wolf nickte. „Der hat sich bei seinem ersten Flug in die Hosen geschissen.“ Sie lachten schallend. Die Anekdote erleichterte Wolf. „Und heute unterrichten er und ich gemeinsam in der Drachenflugschule.“
Dann wies er Wolf noch einmal in das Gerät ein. „Du nimmst diesen Gurt. Wie nennt man den?“
„Schlafsackgurt mit integriertem Fallschirm“, sagte Wolf brav.
„Na also“, Yogi war zufrieden, „und der hier?“
„Ein Kniehängergurt.“
„Genau, und den werde ich nehmen. Anlaufen wie geübt, dann in die Waagrechte. Ich übernehm’ den Steuerbügel zunächst allein, und du tust weiter nichts, als mir auf die Finger zu schauen und mir soviel blöde Fragen zu stellen, wie dir einfallen. Klar?“
„Roger.“
„Also, dann los.“ Yogi führte den Vorflug-Check durch. Rohre, Kauschen, Verspannungen, Zentralgelenk, Aufhängung – er prüfte das Fluggerät noch einmal auf Herz und Nieren. Wolf musste jeden Handgriff wiederholen. Das nahm ihm einen beträchtlichen Teil seiner Unruhe. Nach dem Check forderte Yogi Wolf auf, ihn noch einmal alleine durchzuführen. Gewissenhaft befolgte er die Anweisung. Die meisten Unfälle werden durch unkonzentrierte Startvorbereitungen verursacht, hatte Yogi ihm eingeschärft.
Schließlich klinkten sie sich ein und rollten den Drachen auf die Startrampe hinauf. Wolf betrachtete den Hang mit sehr gemischten Gefühlen. Er war relativ flach, aber nach etwa zweihundert Metern fiel er plötzlich steil ab. Genau dorthin wollte Yogi. Er hatte eine Runde über das Rheintal geplant.
Dann erfolgte die Liegeprobe und ein letzter Blick auf den Windgeschwindigkeitsmesser. „O.k.“, Yogi hob den Daumen, „jetzt rollen wir das Gerät bis zur Kante.“
Sie schoben den Drachen bis zu der Stelle, an der die Rampe steil abfiel. Dann justierte Yogi die Spitze des Fluggerätes, bis sie in einem Winkel von etwa zwanzig Grad zum Hang stand. „Eins, zwei, los!“ In einem oft geübten Gleichschritt spurteten sie die Rampe hinunter, der Wind hob das Fluggerät hoch, und schon schwebten sie über den Hang.
„Das ist ja geil!“, jubelte Wolf. Begeistert sah er den schneebedeckten Boden unter sich dahingleiten. Der Drachen segelte über die ersten Baumwipfel. Gleich würden sie den Steilhang erreicht haben.
„Das ist ja echt super, Mann!“ Er wandte seinen behelmten Kopf zu Yogi, um seine Begeisterung mit ihm zu teilen. Plötzlich ging ein Ruck durch das Gerät. Wolfs Jubelgeschrei erstarrte ihm auf den Lippen: Yogi war seitlich weggekippt und aus dem Bauchgurt gerutscht.
„Scheiße!“, hörte er seinen Freund noch rufen, dann stürzte Yogi in die Tiefe. Mit weit aufgerissenen Augen sah Wolf ihn durch das Geäst einer Birke brechen und dann in einer Schneewehe des Steilhangs verschwinden. Fassungslos starrte er den leeren Gurt an, in dem eben noch sein Freund gelegen hatte. Sollte Yogi tatsächlich vergessen haben, sich anzuschnallen?
Ein Aufwind blies unter die Segel und trug den Drachen nach oben.
13
Hans Kremer lag in einem Einzelzimmer. Schwach fühlte er sich, allein schon den Kopf zu wenden, wenn eine Schwester zur Tür hereinkam, fiel ihm schwer. Die Ochsentour gestern schien seine letzten Kraftreserven erschöpft zu haben. Und erkältet hatte er sich. Ein trockener Husten quälte ihn.
Es klopfte. Hans brachte nur ein krächzendes „Herein“ zustande. Ein große, kräftig gebaute Frau Ende dreißig trat ein, eine Ärztin. Er erkannte sie sofort. „Guten Tag, Frau Dr. Keller“, sagte er leise.
Die Schwester, die der Oberärztin folgte, musste neu sein. Bei seinem letzten Aufenthalt auf dieser Station hatte Hans sie noch nicht gesehen. „Schwester Edith Schwarz“, stellte sich die schwarzhaarige Frau vor. Sie trug eine rote Brille und war ungefähr im gleichen Alter wie die Ärztin.
„Guten Tag, Herr Kremer.“ Lore Keller blieb an seinem Bett stehen. „Was machen Sie denn für unglaubliche Geschichten.“
Hans lächelte müde. „Da sehen Sie mal, wie fit ich noch bin, Frau Doktor.“
Sie runzelte die Stirn. „Den Eindruck machen Sie ganz und gar nicht. Ich glaube, Sie haben sich gehörig übernommen gestern, oder?“
Hans zuckte leicht mit den Schultern. „Wissen Sie, dass ich mir gestern morgen noch ein Foto von Ihnen angeschaut habe?“
„Ein Foto von mir?“, staunte Lore Keller.
„Ja, es entstand auf der letzten Weihnachtsfeier, Schwester Marion ist auch drauf.“
„Ach ja, ich erinnere mich“, sie musterte ihren Patienten aufmerksam, „und da haben Sie Sehnsucht nach uns bekommen?“
Er schüttelte den Kopf. „Nein, Sehnsucht nach meiner geliebten Steinbank über dem Rheintal.“
Die Ärztin nahm ihr Stethoskop und hörte die Lungen ihres Patienten ab. „Da rasselt es aber gewaltig, die Bergtour hat Ihnen eine ausgewachsene Bronchitis beschert, Herr Kremer.“
„Den Preis zahl’ ich gern.“
Lore Keller wandte sich an Schwester Edith. „Noch heute Vormittag eine Thoraxaufnahme. Und am Montag die nächste. Wir müssen die Lunge im Auge behalten. Nicht, dass er eine Pneumonie entwickelt.“ Innerlich war sie schon davon überzeugt, dass Hans Kremer auf dem besten Weg zu einer Lungenentzündung war. Ein Blick auf den ausgezehrten Körper genügte ihr: Der Mann besaß wohl kaum noch irgendwelche Abwehrkräfte.
Sie verordnete hustenlösende Medikamente, Einreibungen und Inhalationen. Edith schrieb alles auf. Hans betrachtete die Schwester aufmerksam. Sie machte den Eindruck einer ernsten, reifen Frau. Die dunklen Ränder unter ihren Augen fielen ihm auf.
Die beiden Frauen gingen aus dem Zimmer. Auf dem Gang begegneten sie Alexandra Heinze. Die Notärztin hatte Wochenenddienst.
„Hallo Alexandra, schön, dass du uns besuchst“, begrüßte sie Lore Keller.
„Ich dachte, vielleicht läuft mir auf der Inneren mein Nachmittagskaffee über den Weg“, sagte Alexandra, „aber vorher wollte ich nach meinem nächtlichen Bergwanderer schauen, immerhin sind wir zusammen im Hubschrauber geflogen. Wie geht’s ihm denn?“
Sorgenfalten legten sich auf Lore Kellers Stirn. „Ich befürchte, er entwickelt eine Pneumonie. Er war das letzte Mal schon sehr schwach.“
„Das letzte Mal?“, wunderte sich Alexandra. „Du kennst ihn also?“
„Er kommt schon seit Längerem ins Haus, zur Chemotherapie“, seufzte die Oberärztin, „wenn mich mein Gefühl nicht trügt, ist das sein letzter Aufenthalt bei uns.“
Alexandra schwieg betroffen. Plötzlich piepste es in ihrer Tasche. Sie zog das Gerät heraus und warf einen Blick aufs Display. „Meine Sanis rufen mich, sieht ganz nach einem Notfall aus.“ Sie eilte auf den Ausgang zu.
Lore Keller wandte sich an Edith. „Ich glaube, Herr Kremer hat keine Angehörigen. Jedenfalls wollte nie jemand mit mir sprechen. Und den Schwestern fiel auf, dass er nur selten Besuch bekam. Ich fürchte, Schwester Edith, das ist ein Fall für Sie.“
14
Yogi spuckte Holz und Schnee aus. Die Schneedecke färbte sich rot. Er hatte sich gewaltig auf die Zunge gebissen. Sein Knöchel schmerzte, und seine Hände waren völlig aufgeschürft. Er schüttelte sich. „Verdammt – ich leb’ ja noch!“ Etwa fünfzig Meter über sich sah er seinen Drachen schweben. Mit Wolf im Gurt. Yogi sprang auf, rutschte aus und schlug sofort wieder hin. Er schlitterte bäuchlings hangabwärts.
„Das ist nur ein Traum“, keuchte er, „lieber Gott, lass es bitte nur ein Traum sein!“ Er starrte zu seinem Drachen hinauf. Der gewann zunehmend an Höhe. Nein, es war kein Traum. Wolf, der noch nie einen Drachen geflogen hatte, stieg dort über ihm in den blauen Märzhimmel. Höher und höher. Und er lag hier auf dem Steilhang in einer Schneewehe.
Stöhnend bohrte er seine Stirn in den nassen Schnee. „Ich Idiot!“, flüsterte er. „Darf das wirklich wahr sein, dass ich Idiot vergessen habe, mich anzuschnallen?“ Die Scham stieg ihm heiß ins Gesicht. „Ich Arschloch!“, brüllte er. „Ich hirnrissiges Arschloch!“ Wieder sah er zu dem Drachen mit Wolf hoch. Mindestens hundertfünfzig Meter hatte der inzwischen. Er ließ seinen Kopf fallen und heulte. Vor Wut und vor Scham.
Etwas fiel schwer auf seinen Rücken. Er sah auf. Oben an der Kante des Steilhangs, etwa sechzig Meter über ihm, erkannte er drei behelmte Köpfe. Seine Kameraden hatten ihm ein Rettungsseil zu geworfen. Sie winkten. Yogi winkte erschöpft zurück. Für einen Augenblick wünschte er sich, tot zu sein oder wenigstens bewusstlos. Dann hätte er den anderen nicht erklären müssen, dass er vergessen hatte … „Oh Gott, ich verdammter Idiot!“
Er schlang das Seil um seinen Oberkörper, gab seinen Rettern ein Handzeichen, und hielt sich fest. Seine aufgescheuerten Handflächen schmerzten, als sie ihn Meter für Meter nach oben zogen. Er fürchtete den Moment, in dem er die Kante erreicht haben würde. Unweigerlich würden sie ihn fragen, was passiert war. „Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot!“
Ihm fiel ein, was er seinen Flugschülern immer einschärfte: Beim Drachenfliegen passieren keine Unfälle – beim Drachenfliegen werden allenfalls Unfälle verursacht …
Er spürte misstrauisch durch seinen Körper. Die Beine ließen sich schmerzfrei bewegen. Nur im linken Knöchel empfand er einen stechenden Schmerz. Sonst nur das Brennen von Schürfwunden. Vor allem in den Händen. Wie hoch mochte der Drache gewesen sein, als er fiel? Mindestens zwanzig Meter. Sollte er das wirklich ohne größere Verletzungen überstanden haben? Die Baumkrone hatte seinen Sturz erheblich abgedämpft. Und natürlich die Schneeverwehung. Offensichtlich hatte er ein unverschämtes Glück gehabt. Aber Wolf … o Gott – Wolf!
Er war am Gipfel des Steilhanges angelangt. Hände streckten sich im entgegen. Die Kameraden zogen ihn hinauf. „Bist du o.k.?“
„Geht schon.“ Yogi klopfte sich den Schnee von seinem Schutzanzug und zerrte den Helm von seinem Kopf. Er vermied es, irgendeinen der anderen Männer anzuschauen. Schweigend stapften sie vor ihm zur Startrampe hinauf. Er hinkte ihnen hinterher.
Die Männer an der Rampe starrten gebannt auf den Drachen mit Wolf. Klein wie ein bunter Papierfetzen schwebte er hoch über dem Rheintal. Keiner stellte ihm die peinliche Frage. Kein einziger. „Wir haben einen Notarzt angefordert“, sagte einer, „aber du scheinst keinen zu brauchen.“
„Ich nicht“, sagte Yogi. Er schirmte seine Augen mit den Händen ab und beobachtete Wolfs Flug. „Aber ich glaube, wir bestellen ihn besser nicht ab.“
15
„Da oben fliegt einer.“ Ewald Zühlke deutete nach oben. Jetzt sah auch Alexandra den Drachenflieger. „Fliegt ganz schön hoch.“ Zühlke schürzte bewundernd die Lippen. „Ich hab’ den Rhein erst ein einziges Mal aus der Luft gesehen. Bei einem Rundflug vor drei Jahren.“
Mit Blaulicht und Martinshorn bogen sie von der Bundesstraße ab und rasten die Steigung in den Bergwald hinauf. „Keine zehn Pferde würden mich an so ein Fluggerät bringen.“ Allein schon der Gedanke ließ Friederichs schaudern.
Das Funksignal. „Leitstelle an NAW, kommen.“
„NAW hört, kommen.“
„Im Augenblick steht kein einsatzbereiter Hubschrauber zur Verfügung, kommen.“
„Verstanden.“ Zühlke hängte das Mikro ein. Sie hatten sich gewundert, dass bei einem Unfall mit einem Drachenflieger nicht der Hubschrauber den Einsatz übernommen hatte. Zumal der Unfallort relativ weit von der Stadt entfernt lag.
„Fragen Sie doch mal, ob sich der Verletzte überhaupt in der Nähe der Startrampe befindet“, wandte sich Alexandra an Zühlke. Der Sanitäter sprach mit der Leitstelle. Die Auskunft war erstaunlich.
„Leitstelle an NAW, kommen.“
„NAW hört, kommen.“
„Wir haben noch mal mit den Drachenfliegern gesprochen. Im Augenblick gibt es noch keinen Verletzten. Kommen, ob verstanden.“
Sie sahen sich erstaunt an. Friederichs tippte sich an die Stirn.
„NAW an Leitstelle, verstanden schon, aber nicht kapiert, kommen“, funkte Zühlke.
„Leitstelle an NAW, da ist einer mit einem Drachen gestartet, der nicht fliegen kann. Fahren Sie einfach mal hin, ohne Sondersignal. Kommen, ob verstanden.“ Zühlke bestätigte kopfschüttelnd.
Friederichs ging vom Gas und stellte Martinshorn und Blaulichter ab. „Ich glaub’, ich spinne – da ist einer gestartet, der nicht fliegen kann“, wieder tippte er sich an die Stirn.
„Scheint ja ein interessanter Einsatz zu werden“, sagte Alexandra.
Zwölf Minuten später hatten sie die Hanglichtung erreicht. An einer hölzernen Startrampe stand ein halbes Dutzend Männer und starrte in die Luft. Offensichtlich beobachteten sie den einzelnen Drachenflieger, den auch das Notarztteam zuvor gesehen hatte. Ein Mann machte sich an einem der Fluggeräte zu schaffen. Alexandra und die beiden Sanitäter gingen zur Startrampe.
„Komisch, normalerweise rennen uns die Leute immer entgegen, wenn wir an einen Einsatzort kommen“, wunderte Zühlke sich, „die da vorne nehmen nicht mal Notiz von uns.“
Sie erreichten die Männer. „Nanu, wir kennen uns doch!“ Alexandra wandte sich an Joachim Werne. „Hallo, Frau Dr. Heinze“, Yogi nickte ihr zu, „so sieht man sich wieder.“
„Sind Sie verletzt?“ Alexandra sah sofort die aufgerissenen Hände und das verschrammte Gesicht des Luftrettungsmeisters. Zühlke und die Ärztin verbanden seine Wunden. „Der Knöchel ist geschwollen, wir nehmen Sie mit“, erklärte die Notärztin, „das muss geröntgt werden.“
Yogi starrte die ganze Zeit in die Luft auf den Drachenflieger über dem Rheintal. Alexandra und ihre beiden Sanitäter folgten seinem Blick. „Ist das der Mann, der angeblich nicht fliegen kann?“, fragte die Ärztin. „Wir sind aus den Informationen der Rettungsleitstelle nicht schlau geworden.“
„Das ist der Hubschrauberführer von Christoph dreiundzwanzig, der Sie gestern Abend ins Marien-Krankenhaus geflogen hat“, erklärte Yogi, „Oberleutnant Hager. Fliegen kann der schon, nur nicht mit so einem Drachen.“
Die drei schauten sich verständnislos an. Diedrichs’ Finger zuckte schon, und fast hätte er sich wieder an die Stirn getippt. „Das müssen Sie uns genauer erklären“, brummte Zühlke.
„Na ja“, Yogi wurde rot, und seine Stimme klang noch heiserer, „er wollte heute seinen ersten Flug machen. Mit mir zusammen. Aber ich bin kurz nach dem Start aus dem Gurt gerutscht …“
Friederichs prustete los. Ihm Nu war Yogi auf den Beinen. „Was gibt’s da zu lachen, Mann!“ Er griff nach Friederichs’ Jacke. Alexandra musste dazwischengehen.
„Ist ja gut, Herr Werne!“ Der Mann schien noch ziemlich unter Schock zu stehen. „Es ist einfach sehr ungewöhnlich, was Sie da erzählen. Herr Friederichs meint das nicht so.“
„Ungewöhnlich?“ Yogi war sehr erregt. „Für den da kann das tödlich enden!“ Er deutete auf den Flieger.
Die Männer an der Startrampe hatten sich umgedreht. Einer kam zu ihnen und legte seinen Arm um Yogis Schultern. „Beruhig’ dich, Yogi, du bist fertig, ist doch klar.“