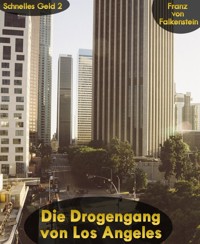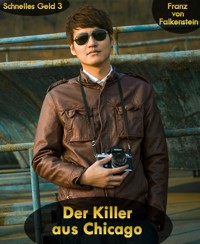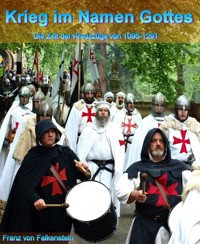0,00 €
Mehr erfahren.
Im oberbayrischen Rosenheim gilt es eine mysteriöse Mordserie an Frauen aufzuklären, denn der Täter hinterläßt merkwürdige lyrische Gedichte. Ein klassischer Krimi, dessen Handlungsverlauf einem üblichen Schema folgt. Es wird aus der Sicht der Ermittelnden geschildert, die allmählich dem Täter auf die Spur kommen. Diese althergebrachte Art ist durchaus etwas Besonderes für meinen Stil, da meine anderen Werke unkonventionellere Handlungsmotive aufgreifen, auch was die Erzählperspektive angeht.
Zeitlich spielt das Ganze während der legendären WM 2006 und deshalb ist das natürlich auch ein Thema - wen interessieren schon ein Paar Morde nebenher, wenn Deutschland vielleicht Weltmeister wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
4 + 3
Die Serienmorde von Rosenheim
Meiner Geburtsstadt gewidmetBookRix GmbH & Co. KG81371 München1
Rosenheim am Inn, eine Kleinstadt in Oberbayern im Alpenvorland mit knapp sechzigtausend Einwohnern am Zusammenfluß von Inn und Mangfall. Nicht nur kulturelles, sondern auch wirtschaftliches Zentrum Südostbayerns, das wegen seiner Nähe zu Österreich auch zahllose Pendler aus dem Nachbarland, besonders aus Kufstein sowie Salzburg, anlockt. Bereits zu Zeiten des Römischen Reichs existierte im heutigen nördlichen Stadtaußenbereich ein Übergang über den Inn, der die Provinzen Noricum und Raetia miteinander verband. Die frühesten Besiedlungsspuren weisen schätzungsweise auf das Jahr 2500 vor Christus zurück. Die erste urkundliche Nennung der Siedlung findet 1234 in Form der Burg Rosenheim statt, die, auf dem Schloßberg auf der östlichen Innseite gelegen, von einem Grafen aus dem etwa 40 Kilometer weiter flußabwärts gelegenen Wasserburg erbaut wurde. Dessen Rosenwappen, das noch heute das Stadtwappen prägt, war wohl für den Namen der Stadt maßgeblich mitverantwortlich. Wirtschaftliche Bedeutung erlangte die Stadt im Mittelalter vor allem durch die Innschifferei, die sich bedingt durch die verkehrstechnisch gute Lage bis auf die Donau ausdehnte. Das direkt am Innufer befindliche Innschiffahrtsmuseum gibt Einblicke in diesen einst wichtigen Beruf. Im Jahr 1810 errichtete man in der heutigen Salinstraße die dritte bayrische Saline zur Gewinnung von Salz, welche bis 1958 in Betrieb blieb. Eishockey-Fans werden bei Nennung der Stadt sofort an die Erfolge des Sportbunds Rosenheim denken, der in den Jahren 1982, 1985 und 1989 deutscher Meister wurde. Besonderen Freizeitwert bietet der Landkreis durch die Nähe zu Simssee und Chiemsee sowie zu den Alpen. Nicht umsonst heißt die Gegend Voralpenland.
In eben dieser Stadt surrte gerade ein Wecker in einer Wohnung im zweiten Stock. Erneut lärmte es durchdringend, eine Hand tappte blind nach dem Verursacher des nervigen Geräuschs, um den Mechanismus abzustellen. Endlich Ruhe! Ein unwilliges Brummen folgte, das unter einer aufgetürmten Bettdecke hervorkam. In Zeitlupe warf jemand die Bettdecke mit dem Blümchenmuster zurück, um sich gähnend aufzurappeln. Die Füße bekamen Bodenkontakt und arbeiteten sich in die Filzpantoffel hinein, die vor dem Bett standen. Mehr schlurfend als gehend schleppte sich die Gestalt im grauen Schlafanzug zur Tür. Vom Gang ging es weiter in den Nebenraum – das Bad. Dort gönnte sich der Mann erst einmal einen Blick in den Spiegel. Zu früh aufgestanden, eindeutig. Bartstoppeln allüberall, vor Müdigkeit noch halb geschlossene, blaue Augen ohne Leuchtkraft. Um etwas munter zu werden, wusch er sich das Gesicht mehrmals mit kaltem Wasser, ehe er seine schwarzen Haare kämmte und etwas zielstrebiger die Küche anpeilte.
Die üblichen Handgriffe waren schon Routine: Milch aus dem Kühlschrank holen, nach Augenmaß in einen Topf gießen, auf die Platte stellen, auf Stufe 6 justieren, Deckel drauf, Brot aus dem Brottopf nehmen, zwei Scheiben abschneiden, mit Butter und Honig bestreichen, während die Milch warm wurde, die Kleidung für den Tag auswählen und anziehen – zurück zur Milch, weil das ganz schlecht ist, wenn die überkocht. Das gibt eine einzige Sauerei, mit der man als Junggeselle an die Grenzen dessen kommt, was bewältigbar ist. Die heiße Milch in eine Tasse mit vorbereitetem Kabapulver einschenken, endlich kann das Frühstück beginnen. Danach Zähne putzen, gründlich waschen, rasieren, noch mal ein bißchen herumstöbern und los zur Arbeit, wo Kriminalkommissar Franz Stangelmayr nach zehn Minuten zügigem Fußmarsch eintraf.
2
Nach der Begrüßung des Pförtners begab er sich, inzwischen nicht nur körperlich aufgewacht, in sein Büro, einen länglichen Raum, dessen linke Seite von seinem einfachen, aber zweckmäßigen Schreibtisch besetzt war. Die rechte Seite bildete das Reich seines Kollegen Hans-Jörg Ebersdorfer, der aber um diese Uhrzeit noch nicht anwesend war. Ein hoffnungsloser Langschläfer. Gelobt sei die Gleitzeit, die endlich auch in deutschen Amtsstuben Einzug hielt. Auf beiden Schreibtischen standen ein heutzutage unvermeidlicher Flachbildschirm, davor eine Tastatur sowie eine Maus, der Rechner selbst mußte auf die billigen Plätze – also unter den Tisch. Da störte dann immerhin das penetrante Lüftergeräusch nicht so. Wird Zeit, daß die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zum Musikhören Soundkarten in ihre Rechner bekommen …
Stangelmayr hängte seine Jacke an einen der Kleiderhaken neben der Tür, setzte sich anschließend an seinen Arbeitsplatz und schaltete erst mal den PC ein. Sein Blick fiel auf etliche Akten, die rechts neben der Tastatur lagen. Zu erledigen, bedeutete das. Noch nicht vollständig aufgeklärte Fälle, an denen gerade gearbeitet wurde. Abgeschlossene pflegte er stets auf der linken Seite abzulegen. Warum auf diese Weise? Na, ganz einfach: wenn der Chef hereinkam, dann fiel sein Blick sofort auf den rechten Stoß mit den noch zu klärenden Fällen und man konnte dadurch psychologisch gesehen mehr Tätigkeit vortäuschen als vielleicht vorhanden war. Außerdem stellte der Stapel eine Art Schutzwall dar, hinter dem man sich verstecken konnte. Eine Sprache, die der Chef verstand: solange einige Akten auf dem Tisch liegen, ist der Mitarbeiter beschäftigt. Man wurde dann nicht sofort mit irgendwelchen neuen Aufgaben betraut oder anderweitig belästigt. Zumindest nicht sofort. Während der Computer gemächlich startete, blieb genug Zeit die Fallakten kurz durchzugehen. Ein Vermißter, mehrere Fälle wegen Betrugs, zwei Einbrüche – wahrscheinlich begangen vom selben Täter – , Verbreiten von Falschgeld, einmal schwere und zweimal leichte Körperverletzung. Eine nette Ausbeute. Seufzend machte sich der Kripobeamte an die Arbeit. Hatte schon seine Nachteile in einer Kleinstadt Dienst zu tun. Da mußte man dann auch als Beamter der Kriminalpolizei mal als eine Art mobile Feuerwehr „niedere“ Verbrechen aufklären, falls es keine Kapitalfälle – wie im Moment – gab. Aber deswegen nach München ziehen? Nein, die Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt und die bayrische Landeshauptstadt war ihm einfach ein bißchen zu steril. Mal ganz abgesehen von den vielen Leuten, dem ewigen Verkehrslärm sowie der schlechten Luft. Wenn man mehrere Tage in München verbracht hat und dann nach Rosenheim zurückkommt und aus dem Zug aussteigt, dann meint man, man steht in einem Wald, so frisch erscheint einem die Luft. Aber zurück zur Arbeit, private Gedanken werden nicht bezahlt. So, Akte 1, der Vermißte. Der dringlichste, aber auch interessanteste Fall. Stephan Torkamp, 37 Jahre alt, Stephan mit „ph“. Bis zuletzt wohnhaft in der Klepperstraße 17. Vermißt seit 22.5.2006 16 Uhr 37. Seine Ehefrau hatte ihn als vermißt gemeldet, da er nicht von der Arbeit nach Hause gekommen war. Seitdem waren sieben Tage vergangen, noch immer keine Spur von ihm. Bei seinem Arbeitgeber, einem Holzverarbeitungsbetrieb, tauchte er nicht auf. Freunde und Bekannte hatte man auch schon erfolglos abgeklappert. In keinem Krankenhaus, keinem Leichenschauhaus noch sonst wo hatte man ihn aufspüren können. Keiner wußte, wo er sich aufhielt. Das erinnerte ein wenig an diese Krimiserie, die zur Zeit auf Kabel 1 ausgestrahlt wurde: Spurlos verschwunden. Aber Fiktion und Wirklichkeit sind häufig nicht identisch. Für das Verschwinden von Stephan Torkamp kamen prinzipiell drei Möglichkeiten in Betracht: es geschah freiwillig, etwa weil der gute Mann sein bisheriges Leben Leid hatte und irgendwo anders neu anfing. Auf diese Art wäre das aber ein denkbar merkwürdiges Vorgehen, denn er hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Stadt nahe der Volkshochschule stehen gelassen, sein Bankkonto blieb unangetastet und ferner hatte er keinerlei persönlichen Dinge mitgenommen. Ein Selbstmord wäre theoretisch auch möglich, aber dann müßte man doch eine Leiche finden. Selbst wenn sich jemand von der Innbrücke stürzt, kommt er früher oder später wieder ans Tageslicht. Staustufen gibt es ja genügend. Sieben Tage … hmm … das dürfte schätzungsweise ausreichen, um einen leblosen Körper bis in die Donau zu befördern – doch davor gab es eben die besagten Staustufen, an denen die Kollegen sicher schon etwas gefunden hätten, wenn es etwas zu finden gäbe. Blieb also noch der Fall des unfreiwilligen Verschwindens übrig. Eine Entführung schied aus, denn sonst hätte es längst eine Lösegeldforderung gegeben. Mal ganz abgesehen davon waren die Torkamp nicht gerade eine wohlhabende Familie, eher untere Mittelschicht. Nur ein völliger Idiot würde so jemanden entführen.
Ein Gewaltverbrechen drängte sich geradezu auf. Doch warum sollte jemand einen Arbeiter eines holzverarbeitenden Betriebs ermorden? Totschlag im Streit? Unbekannt. Ein Unfall wäre natürlich auch im Bereich des Möglichen, aber wobei sollte man unbemerkt von Passanten beim Heimweg von der Arbeit zu Tode kommen? Durch einen defekten Gullideckel in die Kanalisation gefallen und sich das Genick gebrochen? Äußerst unwahrscheinlich. Ferner hätte das dann jemand bemerkt, wenn ein Gullideckel offenstand. Es schien fast so, als hätte sich Stephan Torkamp in Luft aufgelöst. Doch dieses Phänomen gibt es nur bei einem Gas. Ja, definitiv ein kniffliger Fall.
So, der Computer hatte inzwischen auch schon ausgerattert, dann schauen wir doch mal, ob Emails eingetroffen sind. Stangelmayr tippte sein Paßwort zur Anmeldung im System ein – sinnigerweise sein Vorname, weil leicht zu merken – und startete das Emailprogramm. Siebenundzwanzig neue Nachrichten. Was über das Wochenende so alles kommt – der Wahnsinn! Doch halt, was ist das wieder für ein Zeug? Werbung für Viagra in englischer Sprache, Kaufoptionen für thailändische Aktien in Grundschulenglisch geschrieben, Grüße aus Australien mit Sender unbekannt, billige Software (garantiert illegal gepreßt), dubiose Angebote für Geldtransfers (zu deutsch: Geldwäsche oder Betrug oder beides), Untersuchungsverfahren gegen Sie eingeleitet (vom Absender [email protected]), als ob das per Email geschehen würde … kurzum: von den 27 Nachrichten konnte man alle bis auf zwei sofort löschen. Das Internet ist wirklich ein Segen der heutigen Zeit. Da kann jeder Trottel zu jedem Dreck irgendeinen Schmarren verschicken. Schöne neue Zeit.
Stangelmayr dachte an das, was ihm der Informatikexperte der Kripo neulich mitgeteilt hatte. Daß man keinen weltweiten „Broadcast“ machen konnte, also nicht an alle Rechner der Welt die gleichen Daten schicken konnte. Wenn das funktionieren würde, dann bräche vermutlich das gesamte Internet binnen einer Stunde zusammen. Aber wäre das so schlimm? Dann könnte man zumindest die Delikte der Computerkriminalität der Vergangenheit zurechnen. Speziell also Computerbetrug, Urheberrechtsverletzungen oder unerlaubte Verbreitung von Pornographie. Auf der anderen Seite würden sich die kriminellen Elemente dann vermutlich auf andere Gebiete stürzen, die mehr Zulauf bekämen. Letztlich blieb es völlig gleich.
Stangelmayr klickte auf die erste Botschaft seines Vorgesetzten Adonis Keller. Man kann sich vorstellen, daß so mancher Witz über den ungewöhnlichen Vornamen kursierte, zumal Herr Kriminalrat Keller als Mittfünfziger kein besonders schöner Mann war. Er war weiß Gott nicht häßlich, entsprach jedoch „nur“ der gewöhnlichen Normalität. Um so lustiger waren die Vergleiche mit dem echten Adonis, dem Jüngling, der in der Mythologie selbst die Göttin Aphrodite betörte. Natürlich fanden derlei amüsante Späße nur im Geheimen statt, wollte man es sich doch beim Vorgesetzten nicht verderben. Ansonsten drohte vielleicht die vorübergehende Strafversetzung ins Archiv, das einmal gründlich sortiert werden müßte – das Risiko wollte keiner eingehen. Was da unten im Keller alles in Kisten und Akten verstaubte … sehr pessimistische Gedanken, schnell zurück zur nunmehr geöffneten Email.
In seiner Mitteilung vom vergangenen Freitag Nachmittag kam „Adonis“ auf einen aktuellen Fall zu sprechen und fragte nach, wie es denn derzeit aussähe, was als nächstes geplant sei und so fort. Ferner sollte ihn Stangelmayr baldmöglichst in seinem Büro aufsuchen zwecks allgemeiner Lagebesprechung.
„Gehe ich gleich zum Chef oder verschiebe ich das auf später“, dachte er laut. Er entschied sich für sofort. Den Gang runter die letzte Tür – das war das Büro des Chefs. Gleich 9 Uhr, da war er sicher schon da. Als gutes Beispiel für alle Mitarbeiter konnte man das durchaus erwarten. Höflich klopfte Stangelmayr an die Tür, bevor er eintrat.
„Ah, Herr Stangelmayr, schön daß Sie Zeit gefunden haben. Setzen Sie sich bitte.“
Damit deutete er auf einen freien Sessel vor seinem Schreibtisch. Sein dunkles Haar war dabei zu ergrauen, doch seine lebendigen, blauen Augen täuschten etwas über die Tatsache hinweg, daß er schon 56 Jahre alt war. Die Brille mit den dicken Gläsern offenbarte eine starke Kurzsichtigkeit, die ihn aber nicht weiter störte, da er sie schon seit Kindestagen hatte. Was man nicht anders kennt, kann einen auch nicht besonders stören. Es wird zur Normalität. In seiner Freizeit bevorzugte er Golf spielen sowie Angeln. Letzteres mag vermutlich etwas verwundern, denn Herr Keller mochte Fisch gar nicht. Da er aber sowieso nie etwas fing, spielte das keine Rolle. Einige Mitglieder des Anglervereins, dem Herr Keller auch angehörte, wußten gar mit einem Schmunzeln davon zu berichten, daß er stets ohne Köder fischte. Wie sollte man da einen Fisch fangen? Aber jedem das seine.
Als überzeugter Anhänger des autoritären Führungsstils neigte er mitunter dazu, sehr förmlich mit seinen Mitarbeitern umzugehen, was auch die distanzierte Begrüßung zeigt. Ansonsten konnte man mit ihm recht gut umgehen, wenn da nicht seine Leidenschaft für Zigarren wäre. Stangelmayr haßte den Gestank des Rauchs, der selbst bei passiver Beräucherung noch Tage später in den Klamotten hing. Ekelhaft. Aber man konnte dem eigenen Chef schlecht das Rauchen verbieten, obwohl es auch besser für seine eigene Gesundheit wäre. Nicht umsonst steht bekanntlich auf jeder Zigarettenschachtel, daß die EU-Gesundheitsminister auf Grund gesundheitsschädlicher Folgen vor dem Konsum warnen. Wer nicht hören will …
„Herr Stangelmayr, von welchen Fortschritten können Sie mir im Fall Torkamp berichten?“ Förmlicher kann man es wohl kaum mehr ausdrücken. Typisch Keller.
„Wir sind in die Ermittlungen eingestiegen, sichten Material und werten die Details aus“, faßte Stangelmayr die bisherigen Bemühungen oberflächlich zusammen. „Wir wissen derzeit nicht, wo der Vermißte ist, weil wir weder verwertbare Spuren noch eine Person gefunden haben, die ihn nach 17 Uhr des betreffenden Tages des Verschwindens gesehen hat.“
„Verstehe. Was gedenken Sie als nächstes zu tun?“ – „Ihn finden. Durch Analyse der vorhandenen Spuren und Sammeln von neuen Hinweisen.“
Adonis Keller nickte zustimmend, als habe er eben eine brillante Lösung für den Fall gehört. Manchmal konnte man ihn mit ganz einfachen Sätzen zufrieden stellen wie „Wir werden den Fall lösen.“, „Wir finden den Täter.“ Doch eines durfte man nicht sagen: „Wir tun, was wir können.“ Diesbezüglich hatte Kriminalrat Keller eine Allergie. Der fragliche Satz stellte für ihn nämlich die Ausrede jedes faulen Beamten dar. Gerüchte behaupteten, die Genehmigung seines Wintergartens sei bei den Behörden jahrelang mit dem genannten Zitat verschleppt worden, was seine Abneigung begründen würde.
„Sehr gut, Herr Stangelmayr. Dann machen Sie mal weiter.“
3
Auf dem Weg zurück zum Büro lief Stangelmayr auf dem Gang der Sekretärin Karin Dormeier über den Weg, einer kleinen, unscheinbaren Person mit blonden Locken, die es aber in sich hatte. „Na? Wie ist er heute drauf?“ machte sie eine Geste zum Chefbüro.
„Wie immer. Ausnahmsweise mal nicht verqualmt, aber ich schätze mal er steckt sich gleich eine an. Wie war dein Wochenende?“
„Kurz. Sehr kurz, ich habe dir ja erzählt, daß wir am Freitag nach Österreich zu einer Bergtour wollten. Wir haben es aber erst am Samstag Vormittag geschafft, weil Rolf noch was Unaufschiebbares im Büro zu erledigen hatte. Tja, war halt dann ein etwas kurzes Wochenende.“ Rolf war der zu beneidende Ehemann von diesem flotten Geschöpf. Seit zwei Jahren verheiratet, seit fünf Sekretärin der Abteilung Kapitaldelikte der Kripo Rosenheim.
„Vielleicht wird es diese Woche besser“, meinte Stangelmayr hoffnungsvoll. „Wir sehen uns eh in der Kantine, dann reden wir ausführlicher. Bis nachher.“
Nach dem Öffnen seiner Bürotür stellte er fest, daß sein Kollege Hans-Jörg Ebersdorfer, von allen nur Hajo genannt, auch schon den Weg in die Arbeit gefunden hatte. Seine braunen Haare waren noch etwas verstrubbelt. Offenbar hatte er keinen Kamm zur Hand gehabt. Seine braunen Augen blickten dafür freundlich, was ein gutes Zeichen war. Offensichtlich war das gestrige Rennen auf dem Nürburgring nach seinem Geschmack verlaufen.
„Morgen. Na, hat der gnädige Herr gut geschlafen? So vergnügt bist du doch sonst nie.“
„Ja“, bekräftigte Hajo. „Hast du gestern kein Radio gehört?! Schumacher hat gewonnen! Das mußte ich natürlich noch ein bißchen begießen …“
Hajo war ein fanatischer Motorsportfan, der kein Formel 1 – Rennen ungesehen verstreichen ließ. Selbst die Überseerennen in Malaysia, Japan und Australien schaute er sich immer live an, was identisch mit um vier Uhr aufstehen ist. Für Stangelmayr war Formel 1 gleichbedeutend mit stundenlang im Kreis fahren, aber für Hajo eben eine begeisternde Welt der Unterhaltung. „Der Große oder der Kleine?“
Entgeistert starrte Hans-Jörg seinen Kollegen an. „Wann hat der Ralf zum letzten Mal ein Rennen gewonnen? Wen meine ich sonst immer, wenn ich ‚Schumacher’ sage? Natürlich wurde der Michael Erster. Der Ralf zerreißt nichts im Schatten seines Bruders … aber der kommt noch, spätestens wenn der Michi in Rente geht. Na ja, sein Vertrag bei Ferrari geht noch bis mindestens 2007. Mal schauen, ob er verlängert oder was er sonst macht.“
„Was kam denn bei den Vernehmungen heraus, die du am Freitag Nachmittag noch durchgeführt hast?“ wechselte Stangelmayr das Thema, weil er bei Formel 1 eh nicht mitreden konnte. Nicht jeder mag Motorsport.
„Nichts Besonderes. Sonst hätte ich dich außerdem angerufen. Aber wenn ich nicht weiß, was ich dir erzählen soll, weil nichts vorgefallen ist, dann rufe ich dich doch auch nicht an, nur um dir das zu sagen.“ Er grinste. „Das tun höchstens Mädchen in Heiratslaune.“
Stangelmayr wandte sich seinem PC zu, wo er die Datenbank der vermißten Personen des Polizeihauptrechners durchsuchte, deren Verschwinden vielleicht mit dem von Peter Torkamp in Verbindung stehen konnte. Ebersdorfer hatte seinen PC ebenfalls angeworfen und surfte zur allgemeinen Zerstreuung ein wenig im Internet. Er nahm es mit der Differenzierung zwischen Arbeits- und Freizeit nicht so ganz genau. Als Nachfahre von steinzeitlichen Jägern und Sammlern war bei ihm vor allem der Sammeltrieb stark ausgeprägt. Deshalb lud er sich über eine Tauschbörse häufig Musikalben, Spiele, Programme oder Kinofilme herunter, die er zwar allesamt nicht brauchte, aber wenn er sie eventuell in hundert Jahren vielleicht mal brauchen könnte, dann mußte er sie sich nicht extra besorgen, sondern hatte sie schon vorrätig. Da das laden von größeren Daten normalerweise ziemlich lang dauert, hatte er es sich angewöhnt, am Morgen die Ladeliste zu aktualisieren, damit der Rechner den ganzen Tag über was zu tun hatte. Am Ende einer Woche kopierte er sich die Daten dann üblicherweise auf seine externe Festplatte. Auf DVD brennen ging leider nicht, weil sich die Polizei keine Rechner mit Brennern leisten konnte. Wenigstens reichte es für eine recht flotte Internetverbindung, auch schon was. Stangelmayr hatte ihn zwar schon mal darauf angesprochen, wieso er immer – auch bei Außendiensteinsätzen – seinen PC laufen ließ. Ebersdorfer hatte ihm erklärt, daß er ein Datentransferprogramm am Laufen hatte, was ziemlich lange dauerte. Damit hatte sich Stangelmayr anfangs zufrieden gegeben, weil er nichts von PCs verstand. Im Lauf der Zeit hatte er dann soviel Erfahrung gewonnen, um einstufen zu können, was sein Kollege da trieb. Eigentlich waren das lauter verbotene Sachen, Verstöße gegen das Urheberrecht etwa. Er gedachte aber nicht das hinauszuposaunen. Unter Kollegen gilt halt der Ehrenkodex „Nichts gesehen, nichts gehört.“
Außerdem entstand kein unmittelbarer Schaden, wenn sich Hajo ein paar Filme saugte, um sie daheim anzuschauen oder ein paar MP3s, das sind komprimierte Musik-Dateien. Vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen war natürlich beides nicht erlaubt und bei einem Polizeibeamten sähe so etwas doppelt schlecht aus. Aber mein Gott – so ist die Welt. Jeder hat Dreck am Stecken. Bei den meisten kommt es nur nicht ans Tageslicht. Das ist der große Unterschied zwischen einem Verbrecher und einem unbescholtenen Bürger. Das hatte Stangelmayr in sieben Jahren Kripotätigkeit gelernt. Es galt lediglich zu differenzieren zwischen hellbrauner und ganz schwarzer Weste. Um eine wirklich weiße Weste zu haben, dürfte man nicht mal falsch parken. Wer ist schon unfehlbar? Aber immerhin stand die Polizei auf der guten Seite und trug um einiges sauberere Westen als die Bösewichter. Stangelmayrs Ansichten bezüglich Recht und Unrecht konnte man im Endeffekt wie folgt definieren: solange etwas keinen anderen stört oder ihn schädigt, kann es nicht so schlimm sein. Beispiele hierfür wären das Radfahren bei Tag ohne Rücklicht, Falschparken oder auch das private Weitergeben von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Weitaus schlimmer jedoch war da schon das illegale Kopieren und Verkaufen von Filmen, Musik oder Software. Das stellte dann einen direkten umrechenbaren Schaden für die Herstellerfirma dar. Bei Dingen wie Rauschgifthandel, Diebstahl und dergleichen liegt die Situation ganz klar auf der Hand: das sind wirklich Verbrechen, die es zu ahnden gilt mit der ganzen Schwere des Gesetzes.
Aber ist einer, der einem Freund eine Musik-CD kopiert gleich ein Verbrecher? Entsteht der Plattenfirma dadurch ein Schaden, wenn ein Album kopiert wird, daß sich der Empfänger niemals selbst gekauft hätte? Eher nicht. Dem Recht nach ist es zwar kein Verbrechen, aber zumindest ein „Vergehen“. Vergehen nennt man ja die harmloseren Straftaten. Klar, das Recht stand an oberster Stelle, aber wenn man immer alles nach Vorschrift behandeln und nie ein Auge zudrücken würde, dann träte man ständig auf der Stelle. Ein Fall, an den sich Stangelmayr diesbezüglich erinnern konnte, war ein Einbruchsdiebstahl vom letzten Jahr, bei dem ein Sechzehnjähriger in eine Autowerkstatt eingebrochen war, um dort Ersatzteile zu klauen. Dabei war er gesehen und später von der Polizei erwischt worden. Da es sich bei dem Jungen um einen reuigen Sünder gehandelt hatte, war man mit dem Werkstattbesitzer übereingekommen, auf eine Anzeige zu verzichten und statt dessen den Jungen als Schadenswiedergutmachung einige Tage in der Werkstatt arbeiten zu lassen. Mit blendendem Erfolg, denn der Besitzer war vom technischen Verständnis des begabten Hauptschülers so begeistert, daß er ihn nach der 10. Klasse in die Lehre nahm.
Eine Anzeige mit zu erwartender Jugendstrafe hätte wohl zu einer wesentlich pessimistischeren Zukunft geführt. Noch dazu, wo heutzutage ein Hauptschulabschluß scheinbar gar nichts mehr zu zählen schien. Es gab selbst Akademiker, die arbeitslos waren. Wer würde dann wohl einen vorbestraften Hauptschüler einstellen?
Man sollte jedem Mensch eine zweite Chance geben, denn einen Fehler macht jeder irgendwann. Soweit die Gerechtigkeitsauffassung von Stangelmayr. Ebersdorfer sah es ähnlich, vielleicht sogar noch ein bißchen lässiger, wie er überhaupt alles nicht so eng sah. Er trug auch zum Großteil zur Entstehung neuer Witze über den Chef bei. Einmal hatte er mit der Sekretärin auf dem Gang geschäkert und dabei eine auf den Vornamen des Chefs abgezielte Szene zum Besten gegeben: „Oh liebste Aphrodite, meine Leidenschaft verzehrt sich nach dir, du schönste aller Göttinnen.“ Genau in diesem Moment tauchte Adonis Keller hinter ihm auf, der die Darbietung mit einem kurzen „Ach Herr Ebersdorfer, schön daß Sie schon wach sind. Ich habe einen kleinen Spezialauftrag für Sie …“ beendete. Mit Hajo erlebte man immer lustige Momente. Seine bloße Anwesenheit lockerte auch den bedrückendsten Fall ein bißchen auf. Einmal hatte er sich beim jährlichen Sommerfest der Dienststelle etwas geleistet, woran man noch Jahre danach mit einem Grinsen dachte: Hajo hatte ordentlich Bier getrunken und war dementsprechend angeheitert. In diesem Zustand rempelte er unabsichtlich einen Kollegen mit Anzug an, den er nicht kannte. In seiner unnachahmlichen Art hatte er dem Mann fest auf die Schulter geklopft und gesagt: „Entschuldigung, Kamerad, ich bin nicht mehr so ganz standfest … dich sehe ich heute übrigens das erste Mal. Bist du die Verstärkung für unsere Abteilung? Ein Frischling? Herzlich willkommen bei uns. Wieso hast du denn kein Bier in der Hand? So geht das doch nicht. Franz – ein Bier für unseren neuen Kollegen. Wie wäre es mit einem Wettsaufen? Der Verlierer ist derjenige, der nicht mehr stehen kann.“
In diesem Moment zog der auf die Szene aufmerksam gewordene Stangelmayr seinen Partner mit sanfter Gewalt zur Seite.
„Weißt du denn nicht, mit wem du gerade gesprochen hast?“ zischte er ihm zu.
„Nicht direkt“, verneinte Hajo. „Der Kollege wurde mir noch nicht namentlich vorgestellt.“
„Das ist Lothar Gruber, der neue Polizeipräsident von Rosenheim. Der ist doch mit Wirkung ab heute zu uns versetzt worden.“
Blankes Entsetzen breitete sich über das Gesicht von Hajo aus, der trotz seines alkoholisierten Zustandes das einzig Richtige tat: sich entschuldigen. Das war typisch für Hajo – er dachte meist nicht lange nach, sondern handelte intuitiv. Im Studium hatte er in einem Semester mal vergessen sich rückzumelden und war deshalb exmatrikuliert worden, doch nachträglich hatte man ihn dann doch wieder immatrikuliert. Die eine oder andere Prüfungsanmeldung hatte er auch aus Unbeschwertheit glatt übersehen. Nur das hier sein nachträglicher Antrag auf eine Prüfungszulassung nur zweimal akzeptiert wurde. Beim dritten Mal weigerte sich der Leiter der Prüfungskommission beharrlich. Hajo nahm wirklich alles zu locker, aber das entsprach nun mal seinem Charakter.
„Was meinst du, wer dieses Jahr Weltmeister wird?“ schwenkte Hajo auf sein zweites Lieblingsthema neben Autorennen ein: Fußball. Noch dazu, wo die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Deutschland stattfand. Besser konnte es nicht mehr laufen. Bis zum Eröffnungsspiel am 9. Juni dauerte es nur noch eineinhalb Wochen.
„Also unsere Jungs sind ja immer noch ziemlich schlecht. Die drei oder vier Spiele, die wir von denen zu sehen bekommen … aber ich freue mich auf Portugal, denn die haben in der Europameisterschaft vor zwei Jahren ganz gut gespielt. Es freut mich tierisch, daß die Griechen sich nicht qualifizieren konnten. Das war schon eine Sauerei, daß die unverdient mit einem Glückstor Europameister geworden sind. Die Portugiesen sind einfach stärker gewesen.“
„Portugal, ja, von denen erhoffe ich mir mindestens den Einzug ins Halbfinale. Das würde ich Luis Figo gönnen, wenn er Weltmeister werden würde. Als letzter Vertreter der alten Garde. Aber vielleicht macht auch irgendein Außenseiter das Rennen. Trinidad, Togo, Ghana, da gibt es ja genügend Kandidaten. Auf alle Fälle finde ich …“
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Hajo hob ab. „Ja. Ja, wir kümmern uns drum. Ja Herr Keller, machen wir. Versteht sich doch von selbst. Auf Wiederhören.“
Fragend blickte ihn Stangelmayr an.
„Leg die Akten zur Seite. Wir haben einen dringlicheren Fall – ein Mord im Wohnheim.“
„Gehen wir. Tatortbesichtigung!“ Mit einem zivilen Wagen fuhren die beiden vom Polizeipräsidium zur hiesigen Fachhochschule im Nordwesten der Stadt, an die das Studentenwohnheim direkt angrenzte. Wie immer fuhr Hajo, der Möchtegern-Schumacher, der sich in der Stadt aber sehr akkurat an die vorgeschriebenen 50, oder 30 Stundenkilometer in manchen Seitenstraßen, hielt.
„Wenn du in der Formel 1 zu schnell durch die Boxengasse fährst, dann bekommst du 10 Sekunden Zeitstrafe oder darfst es noch einmal üben. Das nennt man dann Durchfahrstrafe. Ist beides sehr schlecht für die Rundenzeit. Eine schlechte Rundenzeit bewirkt, daß man von anderen Fahrern überholt wird, was die Chancen auf WM-Punkte reduziert. Weniger WM-Punkte mindern die Möglichkeit Weltmeister zu werden und das ist doch letztlich Sinn und Zweck der Formel 1“, begründete er grinsend die Notwendigkeit zum Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit.
Da um diese Uhrzeit – es war inzwischen 14 Uhr 20 – wenig Verkehr auf der Hauptstraße herrschte, kam man relativ schnell an. In zwei Stunden würde hier wohl wieder die Hölle los sein. Die Bauarbeiten in der Innstraße führten bereits seit Wochen zu Staus. Wohl dem, der nicht mit dem Auto durch die Stadt mußte. Hajo parkte den dunkelblauen BMW auf einem Parkplatz schräg gegenüber des Haupteingangs. Von dieser Stelle aus stach vor allem das sechsstöckige Hauptgebäude der FH ins Auge, auf dessen oberster Dachkante direkt am Hauseck gerade eine Amsel sang. Auf der rechten Seite fiel zuerst die Mensa auf, über der etliche Verwaltungsetagen lagen. Verbunden wurden die beiden Gebäude durch einen niedrigeren Zwischenbau, der auch den Eingang beinhaltete. Doch dort hinein mußten die Beamten gar nicht. Über einen kleinen Seitenweg gelangten sie an einigen Hörsälen vorbei, wo gerade Vorlesungen stattfanden, zum Wohnheim, das sich hier über eine ganze Handvoll an Reihenhäusern erstreckte.
Nach kurzem Suchen fand man das richtige Haus, was durch ein ganz in der Nähe abgestelltes Polizeiauto natürlich maßgeblich erleichtert wurde. Ein Beamter der Schutzpolizei kam gerade heran, mit dem man ein paar Worte wechselte. Von ihm erfuhr man, daß die Leiche, eine gewisse Tanja Schuster, von ihrem Mitbewohner entdeckt worden war. Die betreffende Person stand neben dem Polizeiwagen und hatte soeben ihre Aussage zu Protokoll gegeben.
„Sprich du mit ihm“, wies Stangelmayr auf den bleichen Studenten. „Ich schau mich am Tatort um.“
Stangelmayr, wollen wir ihn doch mal zur Abwechslung Franz nennen, betrat das Wohnheim und stieg über die Treppe zum zweiten Stock hinauf, wo die Tür zur besagten WG bereits offen stand. Bei den Wohngemeinschaften handelte es sich hier um – wie der Name es bereits andeutet – Gemeinschaftsräume, die allen zur Verfügung standen. Daneben hatte natürlich jeder Student ein eigenes Schlafzimmer. Man teilte sich Bad, Küche und Wohnraum. Franz begrüßte auf dem Gang drei Leute der Spurensicherung, die sich alle Mühe gaben zwischen den Spuren der zwei Mitbewohner und der Toten zu unterscheiden. „Wie sieht es denn aus?“
„Wir sind gerade erst gekommen. Der Polizeiarzt ist auch noch nicht da. Sie können sich aber gern selbst ein Bild machen.“
Stangelmayr erkundete zuerst die Zimmer der WG. Ein Bad, in dem sich in einer Ecke die dreckige Unterwäsche stapelte, eine Küche, wo neben zwei Kästen halb verbrauchtem Bier, deren Flaschen überall herumstanden, vor allem das benutzte, turmartig aufgestapelte Geschirr auffiel. Eine typische Studentenwohngemeinschaft eben. Mehrere Poster an der Wand stellten offenbar einen weiblichen Popstar dar, den Stangelmayr nicht kannte. Er interessierte sich mehr für Musik aus den 80ern, speziell für den Synth-Pop, also den von Synthesizerklängen dominierten Pop wie ihn unter anderem die Gruppe „Depeche Mode“ spielt, als für den heutigen Kommerzsound, bei dem das Wackeln der Sängerin mit dem Hintern scheinbar wichtiger ist als der eigentliche Gesang.
Die Küche schien geradezu der Tummelplatz für alle Bewohner zu sein, denn hier sah man auf den ersten Blick viele Dinge, die nicht recht zueinander passen wollten. Auf dem Tisch mehrere Skizzen eines Bauplans sowie eine Zeitschrift der Bundeswehr mit einem wuchtigen Panzer auf der Titelseite, auf einer Kommode ein Anhänger mit dem Peace-Zeichen, auf einem Stuhl mehrere Aufkleber mit der Forderung „Keine Macht den Drogen“, auf dem Fensterbrett eine halb volle – oder halb leere, je nachdem wie man es betrachtet – Schachtel Zigaretten der Marke Marlboro. Eine Fernsehzeitung lag offen neben der Spüle. Der Film „Terminator 2“, der am Abend desselben Tages um 20:15 Uhr laufen sollte, war mit einem roten Stift eingekreist worden. Offenbar eine Gedächtnisstütze zur Vormerkung für die Abendunterhaltung. Mehrere Papierkügelchen lagen neben der Zeitschrift, deren Sinn man nur erraten konnte. Auf einer Ablage über dem Tisch stand eine Reihe von Büchern, darunter zwei über Vektorrechnung, eins über Kunstgeschichte und der Rest interessierte keinen.
Ein Zimmer diente wohl als Gemeinschaftswohnraum, denn hier stand neben einem Fernseher auch eine Stereoanlage herum. Mehrere CDs von Manowar, Rammstein und Böhse Onkelz lagen hier herum. Daneben ein ganzer Stapel an selbst gebrannten Rohlingen. Der Verdacht lag nahe, daß es sich hierbei um Raubkopien handelte, wobei der Begriff schwachsinnig ist, denn Raub ist bekanntlich gewaltsamer Diebstahl. Das heißt, jemand, der eine Raubkopie besitzt, der müßte sich das Original mit Gewalt gestohlen haben, um es zu kopieren. Das ist in den allermeisten Fällen jedoch nicht zutreffend, weshalb der Begriff „illegale Kopie“ wesentlich passender ist. Doch Stangelmayr interessierte sich nicht für etwaige Urheberrechtsverletzungen seitens der Mitbewohner dieser WG. Er war hier, um den Tod dieser Tanja Schuster zu untersuchen. Das hatte Vorrang vor den Existenzproblemen der armen Plattenindustrie. Obwohl häufig in der Zeitung steht, daß wieder einmal ein bemitleidenswerter Plattenfirmenchef verhungert ist.
Der nächste Raum war abgeschlossen. Das lag daran, daß es sich hier um den Schlafraum eines Mitbewohners handelte, der aber noch in der Vorlesung zu sein schien, am Baggersee lag, sich sinnlos betrank oder sonst was trieb. Das Zimmer des Studenten, der die Leiche gefunden hatte, stand natürlich offen. Ein flüchtiges Überfliegen genügte, das Zimmer machte den Eindruck eines fleißigen Studenten, denn hier lagen offen aufgeschlagene Lehrbücher herum. Keine Spur von Unterhaltungsmedien wie Computer oder Fernseher. Sonderbar. Das entsprach so gar nicht den üblichen Klischees, die man über Studenten verbreitet.
Den finalen Abschluß bildete die Inspektion des Zimmers der Getöteten. Hier war es etwas eng, denn die Leute der Spurensicherung bemühten sich gleichzeitig um eine lückenlose Erfassung aller Spuren im Raum. Die Tote lag mit dem Rücken auf dem Boden. Ihr Kopf war zur linken Seite, zum Bett hin, geneigt, die Augen geschlossen. Das machte einen recht friedlichen Eindruck, was noch durch die langen, blonden Haare verstärkt wurde, die zu beiden Seiten des Gesichts den Fußboden bedeckten. Ihre Hände hielt sie krampfhaft an den Leib gepreßt, aber vielleicht sah das auch nur so aus. Die Leichenstarre ist ein erstaunlicher Vorgang. Irgendwie beängstigend, aber zumindest für einen Mediziner hochinteressant. Auffallend war die Kleidung der Toten. Barfuß, keine Schuhe, gelbe Bluse, hellblau-graue Jeans, deren Reißverschluß offenstand.
„Na? Wie sieht es denn aus?“ kam in diesem Moment Hajo dazu, der die Vernehmung des Zeugen abgeschlossen hatte und jetzt neugierig über Stangelmayrs Schulter lugte, um einen Blick von der Toten zu erhaschen. „Das arme Ding. Weiß man schon die Todesursache?“
„Du siehst doch selbst, daß der Arzt noch nicht da ist. Was hat denn der Student ausgesagt, der die Leiche gefunden hat?“
„Er heißt übrigens Julian Semmelwein, sagt dir der Name was?“ – „Nein, woher denn?“
„Das ist der Sohn vom stellvertretenden Bürgermeister. Er kam um kurz nach 13 Uhr von einer Vorlesung zurück und wollte sich in der Küche etwas zum Essen machen. Da er wusste, daß Tanja montags vorlesungsfrei hat, schaute er kurz in ihr Zimmer, um sie zu fragen, ob sie mitessen will. Da hat er sie dann gefunden.“
Während dem Wirkenlassen dieser Informationen trat von hinten ein Mann herein. „Lassen Sie mich doch bitte mal durch, meine Herren. Ich bin Arzt.“ Der Gerichtsmediziner, der diesen Witz so häufig brachte, daß ihn längst niemand mehr lustig fand, beugte sich über die Tote, untersuchte sie und kam zu dem unwiderlegbaren Schluß, daß sie schon seit einigen Stunden tot sei.
„Bravo, Doktor. Das haben wir auch schon herausgefunden“, meinte Hajo zynisch.
„Wenn Sie beide seit neuestem als Ärzte tätig sind, wieso rufen Sie mich dann?“ gab Gustav Reich bissig, aber mit einem vagen Lächeln zurück. „Gründen Sie doch eine Praxis, da verdienen Sie wesentlich mehr als ein Beamter im Staatsdienst.“
„Uns ist eine Arbeitsstelle auf Lebenszeit halt lieber. Ferner haben wir uns gedacht, bei unserem mickrigen Gehalt, da machen wir uns nicht die Finger schmutzig.“
„Dieses Risiko bestand gar nicht“, erklärte der Gerichtsmediziner, dessen ernster gewordene Stimme verriet, daß die Zeit zum Scherzen nun vorbei war. „Die Tote hat keinerlei Stichwunden. Größerer Blutaustritt fand also nicht statt. Dafür habe ich beim Abtasten des Hinterkopfes eine Delle entdeckt. Das könnte die Todesursache sein.“
„Geht das vielleicht ein bißchen genauer?“ konkretisierte Stangelmayr.
„Nicht sehr viel mehr. Diese Verletzung könnte von einem Schlag oder einem Zusammenprall mit einem harten Gegenstand wie diesem Heizungsrohr herrühren.“ Damit deutete er auf den quaderförmigen Heizkörper, der unter dem Fenster stand. Nicht weit entfernt vom Kopf der Toten. „Kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden?“ bohrte Hajo weiter.
„Wie lautet der Spruch?“ stellte Gustav Reich eine rhetorische Frage. „Näheres wie immer nach der Obduktion. Falls alles nach Plan läuft, bekommen Sie die Resultate morgen vormittag.“ Durch die Aussage des Arztes nicht sehr viel weiter gekommen, beratschlagten sich die beiden Beamten.
„Einen Selbstmord können wir wohl ausschließen, denn wer käme auf die Idee, sich rückwärts mit dem Hinterkopf auf eine Heizung fallen zu lassen? Das wäre dem typischen Selbstmörder zu unsicher, weil er die Erfolgschance kaum abschätzen kann. Außerdem sieht es so aus, als wollte sich das Opfer gerade umziehen. Würdest du dich umbringen, wenn du gerade dabei bist, deine Hose auszuziehen?“
„Kaum“, pflichtete Hajo bei. „Ich würde die Hose wohl zuerst ganz ausziehen oder sie anlassen.“
„Was folgern wir daraus?“ Hajo strich sich eine Haarsträhne glatt, die in sein Gesicht hing.
„Es bleiben Fremdverschulden und höhere Gewalt übrig. Die Unfalltheorie scheint mir etwas weit hergeholt, denn der Körper liegt völlig gerade da. Wäre sie etwa beim An- oder Ausziehen der Hose gestrauchelt und auf die Heizung geknallt, dann müßte sie jetzt ganz anders daliegen. Deutet geradezu auf einen netten kleinen Mord hin.“
„Diese Ansicht teile ich. Zumindest sollten wir davon ausgehen, solange uns keine weiteren Informationen vorliegen. Ich schlage vor, während die Spusi (Spurensicherung) hier jeden Zentimeter Boden untersucht, befragen wir diejenigen Kommilitonen, die entweder hier im Haus oder nebenan wohnen. Vielleicht hat von denen jemand was beobachtet. Teilen wir uns auf? Du nimmst das andere Haus, ich übernehme hier.“ – „Geht klar. Bis nachher.“
Da Stangelmayr eigentlich am liebsten zuerst mit dem dritten Mitbewohner, der noch immer nicht gekommen war, gesprochen hätte, beauftragte er einen Herrn der Schutzpolizei damit, ihn bei dessen Eintreffen sofort per Mobiltelefon zu verständigen.
„Wird gemacht, Herr Kommissar“, versprach der Beamte von der Stadtpolizei.
Die Dienstränge bei der Kriminalpolizei heißen übrigens von unten beginnend wie folgt: Kriminalkommissar, Kriminaloberkommissar, Kriminalhauptkommissar, Kriminalrat, Kriminaloberrat, ja, und was darüber liegt, das ist irrelevant, denn der höchste Grad bei der Kripo Rosenheim war nun mal eben der des Kriminalrats, den Adonis Keller bekleidete.
Die Befragung der Nachbarn begann im selben Stock, ein Zimmer weiter. 204 stand auf der Tür. Eine Brünette von vielleicht 20 Jahren öffnete und sah neugierig auf den ihr hingehaltenen Ausweis, der den Träger als Mitglied der Kripo auswies, ehe sie ihn herein bat.
„Sie kommen wegen Tanja? Das ist einfach total schrecklich, was da passiert ist. Gestern sind wir noch gemeinsam in der gleichen Vorlesung gewesen und heute ist sie tot. Ich sage es ja immer wieder, die Welt ist nicht gerecht.“ – „Sie kannten die Tote näher?“
„Ja klar, wir sind im selben Semester … waren muß ich wohl inzwischen sagen. Das ist so furchtbar …“ Sie machte in der Tat einen verschreckten Eindruck, was sich auch an den nur mühsam unterdrückten Tränen bemerkbar machte.
„Haben Sie in den letzten Stunden irgend etwas Verdächtiges bemerkt?“
„Nein, ich war in meinem Zimmer und habe für eine Klausur gelernt. Aber vielleicht kann Ihnen Andreas etwas sagen. Der ist ein paar Mal zum Rauchen raus gegangen. Unsere WG-Regeln verbieten nämlich das Rauchen im Haus zum Schutz der Nichtraucher.“
„So ist das bei euch. Na dann fragen wir doch mal diesen Andreas. Wo finde ich den?“
„In seinem Zimmer. Ich hole ihn. Brauchen Sie mich noch?“
„Nein, vorerst nicht.“ Aus einem Nebenraum kam ein sportlich wirkender Jüngling heraus, dessen Haare wie Öl glänzten. Der mußte eine ganze Packung Gel verschüttet haben. Vielleicht gehörte das auch so. Weiß man nicht, die Jugend von heute …
„Herr Wachtmeister, was kann ich für Sie tun?“
„Kommissar“, korrigierte Stangelmayr gelassen. „Wachtmeister ist ein Dienstgrad bei der österreichischen Armee, die unserem Feldwebel entspricht. Aber zum Thema: haben Sie heute bei Ihren Raucheraustritten irgend etwas Ungewöhnliches gesehen? Vielleicht einen Fremden, der das Haus betreten hat? Merkwürdige Geräusche?“
„Wenn Sie mit ‚merkwürdigen Geräuschen’ Leidenschaft meinen, dann habe ich in der Tat etwas gehört. Aus der Zimmer der Tanja. Ihr Zimmer liegt nämlich genau neben meinem. Da schien es ziemlich rund zu gehen. Seit sie ihren neuen Freund hat, wackeln die Wände … aber mich stört das nicht. Ich lebe ja auch nicht asketisch … hört sich außerdem ganz nett an, wenn mal ein Stöhner herüberdringt. Was wollten Sie sonst noch wissen? Ach ja, beim Rauchen habe ich nichts Besonderes bemerkt. Drüben auf dem Bolzplatz haben sie Fußball gespielt, eine Mannschaft der Holztechniker gegen die Elektrotechniker. Die Holztechniker lagen drei Tore vorn, als ich wieder hineinging. Das weiß ich so genau, weil ich einen der Ersatzspieler gefragt habe. Ansonsten war da nichts los.“
„Mhm“, machte Stangelmayr. „Um wie viel Uhr war denn Ihre Nachbarin ‚aktiv’?“
„Weiß ich nicht so genau. Ich habe nämlich keine Armbanduhr, brauche ich nicht. Man sollte das Phänomen Zeit nicht so eng nehmen. Mit einem Bier in der Hand und einer schönen Frau im Arm ist Zeit eh nicht meßbar. Da scheinen Stunden wie Minuten zu vergehen und Minuten wie Sekunden.“
„Sehr interessante philosophische Ansätze. Erinnern mich an mein eigenes Studium. Können Sie zumindest den Zeitraum grob eingrenzen?“
„Ungefähr um 11? Könnte in etwa hinkommen. Ich habe um ungefähr 13 Uhr 30 zu Mittag gegessen und davor habe ich eine Runde am Computer gezockt. Das könnten schon zwei oder drei Stunden gewesen sein. Wenn ich erst nachmittags Vorlesung habe, vertreibe ich mir die Zeit ganz gern mit einem Spielchen. Man muß doch den Tag herumbringen.“
„Wissen Sie wer der Freund von Tanja Schuster ist?“
„Sicher. Der Max aus dem Erdgeschoß, Zimmer 005. Die sind schon seit einigen Monaten zusammen.“ Seit einigen Monaten, wie er das sagte, klang das gerade so, als wäre das verhältnismäßig viel. Zumindest deutete die Art der Betonung in diese Richtung.
„Was war denn davor?“ wollte Stangelmayr instinktiv aufhorchend wissen.
„Da hatte sie einen anderen Typen. Der war aber kein einziges mal hier.“
„Woran könnte das gelegen haben?“ – „Das weiß ich doch nicht. Vielleicht haben sie sich immer bei ihm getroffen? Was weiß ich … geht mich nichts an. Die Tanja fand ich eh nicht so geil.“
„Gut, das wäre alles. Einen schönen Tag noch.“
Der letzte Satz mochte vielleicht wie Hohn klingen, aber das Leben geht immer weiter, auch wenn in der Nachbarschaft jemand getötet wird und es nicht nach einem natürlichen Tod aussieht. Aber zumindest diesen Andreas ließ es relativ kalt, was von seiner kleinen Welt nur durch eine Mauer getrennt geschehen war. Für einen Verdacht war diese Kaltherzigkeit nicht ausreichend, aber dennoch wurde sie zur Kenntnis genommen. Als nächstes begann die Befragung der anderen Nachbar-WG.
„Kripo Rosenheim, ich hätte Ihnen ein paar Fragen zu stellen“, eröffnete Stangelmayr das Gespräch mit einem Studenten, der einen Cowboyhut auf dem Kopf trug. Ohne Zweifel ein Holztechnikstudent im letzten Semester. Bei denen war es üblich, dann mit einem solchen Hut durch die Gegend zu laufen wie John Wayne. Da die Kunde vom vermutlichen Mord an Tanja Schuster bereits wie ein Lauffeuer die Runde im Heim machte, mußte Stangelmayr nicht mehr lange auf den Grund seines Kommens eingehen. „Wie gut kannten Sie die Tote?“ begann er daher ohne Umschweife.
„Nicht sehr gut. Hin und wieder traf ich sie auf dem Gang, aber außer einem ‚Servus’ tauschten wir kaum Worte. Sie war etwas eigen.“ – „Inwiefern?“
„Zickig, leicht arrogant, aber mit den Kerlen konnte sie es ganz gut.“
„Könnten Sie etwas konkreter werden? Hatte sie viele Männerbekanntschaften?“
„Allerdings“, bekräftigte der Hutträger. „Die hat ständig einen neuen abgebusselt. Wenn sie mich fragen: eine kleine Schlampe. Stimmt es, daß es Mord war?“
„Wir ziehen es in Erwägung, können aber noch nichts mit Sicherheit sagen.“
„Vermutlich hat sie ein Kerl in Eifersucht erwürgt. Würde mich nicht wundern bei den vielen Kerlen, die sie anschleppte. Da kann man sich doch ausrechnen, wie viele von denen sie recht unsanft aus dem Bett gestoßen hat. Das hat vielleicht einem nicht besonders gefallen.“