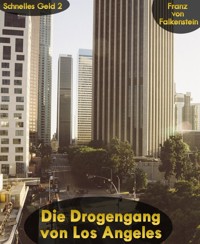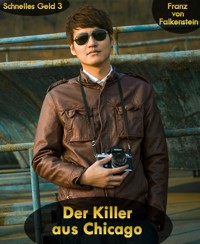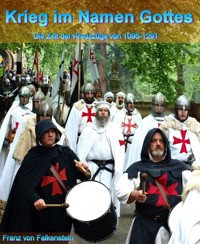0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein deutscher Agent wird während des Zweiten Weltkriegs nach England gesandt, um dort eine Flugzeugfabrik zu sabotieren. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit der britischen Spionageabwehr beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Agenten geben kein Pardon
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Liebe Leser,
Welches Wort ist die schwächste Konjunktion im Deutschen? Ganz sicherlich das "und". Wenn man sich die Mühe macht, die Häufigkeit eben dieses Wortes in diversen Romanen zu untersuchen, dann wird man feststellen, daß es recht oft vorkommt. Dazu habe ich mehrere sogenannte Bestseller-Werke aus sogenannten Qualitätsverlagen ausgesucht, sie in digitalisierte Form gebracht, damit ich sie mit einem Programm statistisch auswerten kann, ohne mühsam per Hand abzählen zu müssen. Betrachten wir etwa Markus Heitz - Der Krieg der Zwerge, einen langatmigen Schinken, der es auf einen "und"-Anteil von 2,99 % bringt, was dem Wörtchen Platz 2 der häufigsten Wörter in jenem Roman einbringt. Das ist eine reife Leistung.
Zum Vergleich: in diesem hier vorliegenden Kurzroman weist "und" einen Anteil von lediglich 1,17 % auf, womit es gerade mal auf dem 8. Platz der häufigsten Wörter landet. Das ist definitiv ein optimierter Wert, der verdeutlicht, wie fahrlässig manche Schreiberlinge Sätze oder Phrasen verknüpfen. Interessanterweise scheint das niemandem aufzufallen, was einen gewissen Dilettantismus sowohl bei bestimmten Autoren als auch bei bestimmten Lesern erahnen läßt.
Das Vorwort dieses Romans kommt übrigens völlig ohne das Wort "und" aus - lediglich mit Anführungszeichen taucht es auf, was dann aber keine verknüpfende Funktion hat. Warum schaffen das so viele Autoren nicht? Diese Frage möchte ich an literarisch tiefergehend interessierte Leser weitergeben. Jetzt aber viel Spaß mit dieser spannenden Agentengeschichte! Ab jetzt erlaube ich mir dann auch die Freiheit "und" als Konjunktion zu verwenden.
Der Autor
Agenten geben kein Pardon
„Ihr Name für diesen Einsatz ist John Miller. Hier haben Sie den englischen Paß.“
Mein Vorgesetzter überreichte mir den Ausweis, den ich interessiert durchlas. Die hatten mich doch glatt 3 Jahre älter gemacht als ich eigentlich war. Geburtsstadt: Edinburgh – auch nicht gerade nach meiner Vorstellung. Wenigstens sah mir der Typ auf dem Foto halbwegs ähnlich, der mir blöd entgegen lächelte. Bei der Aufnahme wollte unser Fotograf Hermann unbedingt, daß ich grinste. „Alle Engländer grinsen auf ihrem Paßfoto.“
Und wenn es noch so blöd aussah, wie eben auch auf meinem Foto.
Ich steckte den Ausweis in meine Jackentasche und wandte mich wieder Major Keller zu, der hinter seinem Schreibtisch saß und mich aufmerksam musterte.
„Auf Grund ihrer guten Englischkenntnisse werden Sie einen Spezialeinsatz in England durchführen“, eröffnete er mir. „Waren Sie schon mal in Norfolk? Nicht? Auch egal. Dort steht zentral in der Stadt Norwich eine Flugzeugfabrik von Vickers, in der Bomber produziert werden, die primär für Angriffe auf unsere Heimat eingesetzt werden. Dem müssen wir Einhalt gebieten.“
„Das heißt, ich soll das Werk sprengen?“ brachte ich die Sache auf den Punkt.
Major Keller nickte kurz. „Genau. Wir haben leider kein Luftbild von der Fabrik, geschweige denn einen Plan. Unser Aufklärer, der Aufnahmen machen sollte, wurde leider bereits auf dem Hinflug abgeschossen. Sie müssen sich also vor Ort selbst um die Informationen bemühen, die Sie brauchen. Sie fahren übrigens per U-Boot. Der Kapitän wird sie einige Kilometer vor der Ostküste Englands mit einem Schlauchboot an Land lassen. Ab da sind Sie völlig auf sich selbst gestellt und können nur noch per Funk mit uns kommunizieren. Auf Grund der Peilungsmöglichkeit durch den Feind würde ich von dieser Möglichkeit aber nur bei sicherer Umgebung sowie wichtigem Grund Gebrauch machen. Weitere Anweisungen erhalten Sie bei Bedarf vor Ort per Funk und zwar nach Ihrem ersten Funkspruch an uns. Jeweiliger Zeitpunkt unserer Antwort: 14 Uhr am selben oder falls nicht mehr möglich am folgenden Tag. Versuchen Sie daher also generell immer um diese Zeit ungestört zu sein, denn falls wir Ihnen etwas mitzuteilen haben, ausschließlich zu dieser Uhrzeit. Haben Sie noch Fragen?“
„Ja“, bekannte ich. „Wann geht es los?“
„Melden Sie sich morgen um 15 Uhr in Kiel am Pier beim zuständigen Offizier. Die Parole lautet Sommergewitter. Welches U-Boot Sie mitnehmen wird, ist noch nicht geklärt. Das hängt davon ab, welches morgen fähig zum Auslaufen ist. Viel Glück! Heil Hitler!“
Er drückte mir die Hand und ich verabschiedete mich.
Nachdem ich das unscheinbare Gebäude verlassen hatte, dem man die brisanten Aktionen, die aus dem Inneren gelenkt wurden gar nicht ansah, stieg ich in meine Horch-Limousine ein, um zurück nach Lübeck zu fahren. Das würde endlich mal wieder eine längere Mission im Feindesland sein. Das hatte für mich einfach den besonderen Nervenkitzel. Vermutlich hatte ich mich deshalb zu diesem Verein freiwillig gemeldet.
Den restlichen Tag verbrachte ich in meiner Heimatstadt Lübeck. Jener ehrwürdigen alten Hansestadt an der Ostsee. Dort war ich als Erwin Steiner am 18.4.1919 geboren worden, doch meine wahre Identität kannten in der Organisation nur sehr wenige.
Nicht mal meine Eltern ahnten, daß ich für das Großdeutsche Reich Spionage betrieb. Offiziell arbeitete ich in der Verwaltung beim Militär.
Am nächsten Nachmittag war es schließlich so weit: nach der circa einstündigen Fahrt nach Kiel meldete ich mich beim Hafenkommandanten, einem griesgrämigen Korvettenkapitän zur See, der mir den Liegeplatz meines Bootes verriet, mit dem ich fahren sollte.
An der angegebenen Reede fand ich U-139, ein VI-C U-Boot, vor, das hier vor Anker lag. Über einen Steg war das Kai mit dem Boot verbunden. Kurzerhand ging ich an Deck, wo mir bereits vor dem Turm das 88 mm Deckgeschütz auffiel, dessen Rohr drohend gen Bug gewandt war.
In diesem Moment tauchte auf dem Kommandoturm eine Gestalt auf. Es handelte sich um den 1. Wachoffizier, wie ich an den Schulterstücken sowie der Uniform erkannte.
„Sie sind wohl der Passagier, den wir transportieren sollen?“
„Genau“, bestätigte ich, ehe ich die Leiter hinauf auf den Turm stieg, von wo aus es abwärts in die Röhre ins Innere des Bootes ging. Unten angekommen begrüßte mich der Kommandant – Kapitänleutnant zur See Hans-Günther Kuhlmann.
„Willkommen an Bord. Hoffentlich haben Sie sich an Land ordentlich die Beine vertreten. Hier unten werden Sie dazu mangels Raum keine Möglichkeit finden.“
Mir war klar, was er meinte, denn es war verdammt eng. Das nicht gerade viel Platz verfügbar sein würde, war mir klar, aber so schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ich fühlte mich wie die sprichwörtliche Sardine in der Büchse.
Der 1. Offizier ließ es sich nicht nehmen, mir meine Koje persönlich zu zeigen. Nicht recht viel breiter als vielleicht 70 Zentimeter. Das würden sicher tolle Nächte werden.
Nachdem ich mein Gepäck, zwei Rucksäcke mit Funkgerät, Sprengstoff sowie anderen Utensilien auf mein Bett gestellt hatte, bugsierte ich mich zur Zentrale, wo ein hektisches Treiben herrschte.
„Wann legen wir ab?“ erkundigte ich mich neugierig.
„In einer halben Stunde“, klärte mich der Navigationsoffizier auf. Beruhigt über diese Angabe kehrte ich zu meiner Ausrüstung zurück. Meine Schlafstelle grenzte unmittelbar an die von diversen Matrosen an. Dazwischen der schmale Durchgang, durch den ständig Leute hin und her liefen. Da ich nichts besseres vor hatte, las ich mir die Unterlagen durch, die mir Major Keller gegeben hatte. Insbesondere also die Daten meiner neuen Identität. Aus Zeitmangel bezüglich dem Beginn der Operation mußte ich diese Informationen nämlich auf dem Boot auswendig lernen.
Aber dazu würde ich laut Kommandant beinahe eine Woche Zeit haben, denn so lange dauerte es bei einer mittleren Geschwindigkeit von 12 Knoten, um die dänische Halbinsel zu umschippern und daraufhin bis zur Ostküste Englands zu kommen. Sechs Tage in einer engen Stahlröhre zusammen mit 45 Mann Besatzung.
Gerade hatte ich die zweite Seite meiner Dokumente durchgelesen, als der Wachoffizier vor mir stand.
„Na? Möchten Sie mit nach oben auf die Brücke kommen? Solange wir nicht tauchen müssen, würde ich als Landratte nämlich schon ab und zu mal ganz gern nach oben schauen wollen.“
„Ja, gern“, akzeptierte ich und begleitete den Mann mit der weißen Seemannsmütze bis zur Zentrale und von dort hinauf auf die Brücke des Bootes. Dort standen neben einem Bootsmaat noch zwei Matrosen herum, die den Horizont zu beobachten schienen. Auf mein etwas blödes Geschau hin meinte der Maat mit dem Finger gen Himmel deutend: „Fliegergefahr“.
„Ja aber wir sind doch in deutschen Hoheitsgewässern“, wunderte ich mich. „Unterbindet unsere Luftwaffe nicht das Eindringen von feindlichen Fliegern?“
Milde lächelnd drehte sich der Wachoffizier zu mir um.
„Das war vielleicht früher mal so, aber inzwischen hat sich das geändert. Sie bekommen bei ihren Einsätzen auch nicht viel von der Wirklichkeit mit, oder? Sie hören sich vermutlich nur die glorreichen Propagandareden an!?“
„Nun ja“, erwiderte ich unschlüssig. „Also in Südfrankreich, wo ich zuletzt Spionageabwehrtätigkeiten verrichtet habe – wenn ich das überhaupt verraten darf – habe ich keinen einzigen Feindflieger gesehen.“
„Na dann werden Sie hier aber Augen machen. Die klotzen uns die Hucke voll.“
In der Stunde, in der ich oben auf Deck war, blieb jedoch alles ruhig. Als die Wellen etwas größer wurden und sich stoßweise über die Brücke ergossen, zog ich es vor mich ins Bootinnere zurückzuziehen.
„Verweichlichte Landratte“, meinte einer der beiden Matrosen belustigt. Unten angekommen trat ich dezent an den Kartentisch heran, wo der NO (Navigationsoffizier) bereits eine Route eingezeichnet hatte.
„Diesen Weg nehmen wir also“, folgerte ich, was mir nickend bestätigt wurde. „Wann treffen wir am Zielpunkt ein?“
„Jo, das hängt davon ab“, antwortete der NO, dem Akzent nach ein Ostfriese. „Bei der aktuellen Geschwindigkeit von 13 Knoten in fünf Tagen, aber vor England treiben sich viele Patrouillenflieger herum. Dadurch werden wir sicher mal ein paar Stunden untertauchen müssen. Wird also mindestens einen Tag länger dauern – wenn alles glatt geht.“
Nun denn, sei es wie es sei. Den restlichen Tag verbrachte ich mit Studium der Identitätsunterlagen. Ich, John Miller, war am 7.8.1916 in Edinburgh geboren worden und hatte dort auch den Großteil meines bisherigen Lebens verbracht. Beruflich verdiente ich mit dem Verkauf von Traktoren mein Geld. Dazu mußte ich mir extra mehrere Seiten Beschreibungen über diese Gefährte verinnerlichen. Wenigstens würde ich dann auf dem Land keine Aufmerksamkeit erregen, wenn ich mich von Bauernhaus zu Bauernhaus durchfragte.
Als meine wasserdichte Armbanduhr 22 Uhr anzeigte, streckte ich mich lang. Der Mann unter mir trat soeben seine Schicht an, während der Matrose auf der anderen Seite des Gangs ebenfalls schlafen ging.
„Gute Nacht“, wünschte ich, was er mit einem Murren quittierte. In der Tat sollte es keine all zu gute Nacht werden. Das stakkatoartige Hämmern der beiden Dieselmotoren hatte ich zwar im Verlauf der letzten Stunden schon verinnerlicht, nicht jedoch das penetrante Schnarchen meines Nachbarn. Erst als ich mir etwas Watte in die Ohren gesteckt hatte, fand ich die Ruhe, nach der ich mich jetzt so sehnte.
Doch pünktlich um 6 Uhr am nächsten Morgen wurde ich durch eine Hektik wach, die das Boot zu ergreifen schien. Die Morgenschicht trat ihren Dienst an, während sich die Nachtwache in die Matten haute. Ein ewiger Zyklus, so wie mir schien.
Durch den ganzen Trubel beeinträchtigt stand ich nun ebenfalls auf. Hier würde ich ja doch nicht wieder einschlafen können. In der Kombüse, der Schiffsküche, holte ich mir mein Frühstück ab, das ich hungrig in mich hineinschlang. Wenigstens die Verpflegung war in Ordnung. In der Zentrale, wo der 1. Offizier zusammen mit einem Maat sowie dem NO gerade den weiteren Kurs besprach, erkundigte ich mich nach unserem augenblicklichen Standpunkt.
„192 Grad südwestlich von Oslo“, informierte mich der NO. Wie mir weiter mitgeteilt wurde, schlief der Kommandant noch, während der WO (Wachoffizier) oben auf der Brücke Ausschau hielt.
„Kann ich mir oben etwas die Beine vertreten?“ fragte ich den 1. Offizier, der mir sein Einverständnis gab. Also stieg ich die Leiter hinauf zur Brücke, wo mich der WO willkommen hieß, als er mich gähnen sah.
„Schlecht geschlafen?“ fragte er grinsend.
„Nicht besonders gut. Da war ich bisher andere Verhältnisse gewöhnt ...“
„Gar nicht so leicht, das U-Bootfahrerleben, was?“
„In der Tat“, bestätigte ich. „Ziemlich eng da unten – wie ihr das monatelang aushaltet, ist mir ein einziges Rätsel. Respekt!“
Der WO wandte sich wieder seinem Fernglas zu, mit dem er gewissenhaft den Horizont absuchte.
„Was war eigentlich eure längste Feindfahrt?“
„3 Monate, 4 Tage“, murmelte der Wachoffizier hinter seinem Fernglas hervor. „Davon waren wir beinahe drei Wochen an einem Konvoi dran. Weiß der Henker, wie wir da wieder heil herausgekommen sind.“
Auf mein Bitten hin erzählte er von den Erlebnissen der Konvoischlacht. Wie das Boot seinen ersten Angriff auf den Konvoi HX51 unternommen hatte und dabei von einem Zerstörer entdeckt sowie abgedrängt worden war. Vier Stunden hatte der sie gejagt, mit Wabos (Wasserbomben) überhäuft und am Ende war er zum Schiffsverband zurückgekehrt. Daraufhin dauerte es mehrere Tage, ehe das Boot erneut in einer günstigen Angriffsposition stand. Doch diesmal gelang es ihnen in Schußlage zu kommen und sie versenkten einen 5 Tausend BRT (Bruttoregistertonnen) Frachter sowie einen etwas kleineren Tanker, der in einer großen Flammensäule in die Luft flog. Wiederum wurde U-139 unter Wasser gezwungen und abermals mehrere Tage vom Konvoi ferngehalten, ehe sie noch einmal zuschlagen konnten: ein Frachter mit 9 Tausend BRT versank in den unendlichen Tiefen des Atlantiks. Danach war allerdings der Ofen aus, denn das Boot konnte zwar noch
Fühlung halten, jedoch kam es nicht mehr bis auf Schußnähe heran beziehungsweise wurde zu zeitig von Zerstörern attackiert.
„Das war unsere vorletzte Feindfahrt“, bemerkte er. „Auf unserer letzten hatten wir bloß Pech. Mal sehen wie diese wird.“
Tja, das betraf mich auch – zumindest in den nächsten Tagen, denn solange saßen wir quasi im selben Boot. Ab dann war ich auf mich allein gestellt – genau wie das U-Boot, das weiter in den Atlantik fahren würde. Dorthin also, wo momentan die großen Konvoischlachten stattfanden.
Ich blieb noch rund zwei Stunden an Deck, ehe ich mich nach unten begab. Es war Zeit mich weiter in meine Unterlagen einzuarbeiten. Wo war ich gestern stehen geblieben? Ach ja: bei den Traktoren. Also ich würde als Reisender durch die Ortschaften ziehen, um vor Ort Abnehmer für meine Fahrzeuge zu finden, primär also wohl Bauern. Zumindest würde ich einige Gespräche in der Richtung führen müssen, damit ich im Fall der Fälle etwas vorweisen konnte. Beispielsweise wenn mich die englische Militärpolizei aus irgendwelchen Gründen festnähme.
Die zu zerstörende Fabrik lag etwa 50 Kilometer landeinwärts von dem Punkt, wo man mich an Land setzen würde, mitten in der Stadt Norwich des Bezirks Norfolk.
Theoretisch konnte ich per Bus dorthin fahren. Allerdings ging ich dann das Risiko ein, bei stichprobenartigen Durchsuchungen festgenommen zu werden, wenn man den Rucksack mit Sprengstoff bei mir vorfand. Das mußte ich halt abschätzen, bevor ich mich für die eine, Bus, oder die andere Methode, zu Fuß, entschied. Aber das konnte ich ja vor Ort sicher am besten herausfinden. Indem ich unauffällig Bauern wie beiläufig zu diesem Thema befragte. Informationsbeschaffung war schließlich eine meiner leichtesten Übungen als Agent.
Da ich wie bereits angedeutet alle zur Verfügung stehenden Unterlagen vernichten mußte, ehe ich den Einsatz beginnen würde – damit der Feind nicht herausbekam, weswegen ich hier war, selbst wenn er mich enttarnen konnte – war es also erforderlich, daß ich mir die entsprechenden Daten genau einprägte. Immerhin besaß ich ein gutes Gedächtnis, was durchaus von Vorteil ist. Gedicht auswendig lernen in der Schule ein Klacks.
Am nächsten Tag fielen mir nach dem Aufstehen als erstes meine Bartstoppeln auf. Da ich sah, daß auch die Matrosen und selbst die Offiziere langsam einen Bartansatz bekamen, verkniff ich mir die Frage, ob ich mir Trinkwasser zum Rasieren nehmen konnte. Meines Wissens war es auf einem U-Boot auch sehr unüblich sich zu rasieren. Da ich ohnehin schon den Ruf der Landratte weg hatte, gedachte ich nicht, diesen noch zusätzlich zu intensivieren.