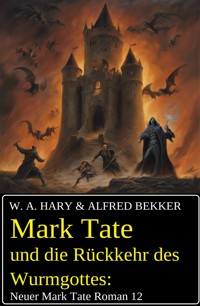Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält folgende Spannungsromane: Wilfried A. Hary: Wenn die Hölle Feuer speit Wilfried A. Hary: Die Katastrophe von L.A. Wilfried A. Hary: Jesse Trevellian und der große Boss Wilfried A. Hary: Aktion Dunkelmord Wilfried A. Hary: Mike Borran auf der Todesinsel Ein Vulkanausbruch auf der Insel Tobago stellt die Welt auf den Kopf. Die Menschen versuchen sich in Sicherheit zu bringen, doch der unberechenbare Vulkan, dessen Krater immer wieder verstopft, droht die ganze Insel in Stücke zu reißen. Inmitten des Chaos versuchen einzelne Menschen, ihre eigenen Pläne, notfalls mit Gewalt, zu verfolgen. Die Rettung ist zweifelhaft, denn der Vulkan will seine Opfer nicht fliehen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
W.A.Hary
Inhaltsverzeichnis
5 Thriller Sonderband Oktober 2022
Copyright
Wenn die Hölle Feuer speit
Jesse Trevellian und der große Boss
Die Katastrophe von L.A.
Aktion Dunkelmord
Mike Borran auf der Todesinsel
5 Thriller Sonderband Oktober 2022
W. A. Hary
Dieses Buch enthält folgende Spannungsromane:
Wilfried A. Hary: Wenn die Hölle Feuer speit
Wilfried A. Hary: Die Katastrophe von L.A.
Wilfried A. Hary: Jesse Trevellian und der große Boss
Wilfried A. Hary: Aktion Dunkelmord
Wilfried A. Hary: Mike Borran auf der Todesinsel
Ein Vulkanausbruch auf der Insel Tobago stellt die Welt auf den Kopf. Die Menschen versuchen sich in Sicherheit zu bringen, doch der unberechenbare Vulkan, dessen Krater immer wieder verstopft, droht die ganze Insel in Stücke zu reißen. Inmitten des Chaos versuchen einzelne Menschen, ihre eigenen Pläne, notfalls mit Gewalt, zu verfolgen. Die Rettung ist zweifelhaft, denn der Vulkan will seine Opfer nicht fliehen lassen.
Copyright
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
COVER A. PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Wenn die Hölle Feuer speit
von Wilfried A. Hary
Der Umfang dieses Buchs entspricht 112 Taschenbuchseiten.
Ein Vulkanausbruch auf der Insel Tobago stellt die Welt auf den Kopf. Die Menschen versuchen sich in Sicherheit zu bringen, doch der unberechenbare Vulkan, dessen Krater immer wieder verstopft, droht die ganze Insel in Stücke zu reißen. Inmitten des Chaos versuchen einzelne Menschen, ihre eigenen Pläne, notfalls mit Gewalt, zu verfolgen. Die Rettung ist zweifelhaft, denn der Vulkan will seine Opfer nicht fliehen lassen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Der alte Indio trieb seine Schafe den Hang empor zum erloschenen Vulkan, der die Main Ridge, die Bergkette von Tobago, beherrschte. Der Indio nannte diesen Ort Teufelsauge. In der weiten Mulde des Vulkankegels herrschte hohe Luftfeuchtigkeit, und es gab zwei heiße Quellen.
Die Schafe hatten sonst immer die Angewohnheit, sich sofort zu zerstreuen. Heute aber blieben sie beisammen. Sie waren nervös.
Der Indio erkannte, dass der Herde eine Gefahr drohte, die nicht zu sehen war. Er schaute sich wachsam und misstrauisch um.
Und da sah er einen seiner Hunde am Boden. Etwas bewegte sich schlängelnd über den reglosen Leib des Tieres.
Im selben Augenblick rannten die Schafe los. Kopflos und wie irrsinnig geworden.
Der Indio rettete sich auf einen alten Lavabrocken und schaute verständnislos der Herde nach. Die Panik schien auch auf die Hunde übergegriffen zu haben. Sie sausten kläffend und jaulend den Schafen hinterdrein.
Mit einer fürchterlichen Angst im Herzen blickte der Indio zur tiefsten Stelle der Mulde, wo die Herde in Panik geraten war.
Er ahnte etwas.
Und dann erblickte er sie mit eigenen Augen: Schlangen!
Hunderte! Tausende!
Die Mulde war die reinste Schlangengrube.
Wo kamen die Biester her?
Sie wimmelten zwischen gebissenen und bereits verendeten Schafen herum und gebärdeten sich, als seien sie mit Feuer in Berührung gekommen.
Der Indio sprang vom Lavabrocken herunter, und während er lief, was die alten Knochen hergaben, schoss ihm durch den Kopf, dass die Massenwanderung der Schlangen nur einen einzigen Grund haben konnte: Der Vulkan begann sich zu rühren!
Dröhnte nicht schon der Boden?
Stiegen dort drüben bei den heißen Quellen nicht schon schweflige Dämpfe auf?
Der Indio stolperte über die eigenen Füße, fiel der Länge nach zu Boden, und schlug mit dem Kopf auf einen Stein. Eine unsichtbare Macht entriss ihm das Bewusstsein und warf es in einen schwarzen Höllenschlund, in dem es keine Erinnerung gab.
Lautlos kamen die Schlangen.
Und verhalten bebte der Boden und machte die empfindlichen Reptilien wahnsinnig.
2
Collin Johns stand an diesem Morgen etwas später auf als sonst. Das lichte Haar hing ihm strähnig in die Stirn. Die verquollenen Augen und das Stoppelkinn verliehen ihm ein furchterregendes Aussehen.
Am Abend hatte er mal wieder voll hingelangt, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte einen in der Krone gehabt, und eine Massenschlägerei in Jonny’s Pub war nur noch dadurch verhindert worden, dass sie Collin Johns einfach vor die Tür gesetzt hatten.
Er hatte keinen blassen Schimmer, wie er in sein Bett gekommen war. Immerhin war es von Gelfi drüben mindestens eine Meile Fußmarsch; eine reife Leistung für einen stockbetrunkenen Mann.
Knurrend federte Johns aus dem in allen Fugen ächzenden Kastenbett und verzog schmerzlich das Gesicht. Schnelle Bewegungen taten ihm alles andere als gut.
Er wankte hinaus zum Brunnen. Fließendes Wasser gab es hier nicht. Collin Johns vermisste es wenig. Er war in das Hochland der Insel Tobago gekommen, weil er der seiner Meinung nach beschissenen Gesellschaft den Rücken kehren wollte. Vor Jahren hatte er es geschafft, eine kleine Kaffeeplantage zu erwerben, die er seither betrieb.
Natürlich hatte er die Zivilisation nicht verlassen, bevor er nicht aus irgendwelchen Quellen eine hohe Summe kassiert hatte. Nun, auf dieser Insel stellte niemand Fragen. Das Geld hatte Collin gereicht. Collin Johns gab einigen Mitgliedern der dunkelhäutigen, größtenteils im Elend lebenden, Bevölkerung von Tobago Arbeit. Das zählte. Sie hausten einen Steinwurf entfernt in ihren Wohnhütten und fühlten sich einigermaßen wohl.
Im Augenblick ließ sich keiner der Farbigen blicken. Sie kannten ihren Boss und gingen ihm aus dem Weg, bis er sich einigermaßen erholt hatte.
Einer hatte vorsorglich einen vollen Eimer, Wasser gezogen und ihn auf den Brunnenrand gestellt.
Collin Johns griff mit seinen schaufelähnlichen Händen danach. Jeder sagte ihm, er solle sich eine Pumpe anschaffen. Aber er beharrte auf seinem vorsintflutlichen Ziehbrunnen.
Das eiskalte Wasser rann ihm erst tropfenweise in das Genick. Johns biss die Zähne zusammen und schloss die Augen. Dann kippte er sich den gesamten Inhalt des Eimers einfach über.
Dabei fiel ihm der Grund für die mächtige Sauferei vom gestrigen Abend ein: Seine Tochter kehrte heute nach Hause zurück. Ferien. Sie war in einem Internat untergebracht.
Zu diesem Schritt hatte sich Johns erst spät entschlossen. Der Erfolg war, dass Cecile Johns mit zwanzig Jahren noch immer die Schulbank drückte.
Er ballte bei dem Gedanken daran, dass er dafür auch noch bezahlen musste, die mächtigen Hände zu Fäusten und stampfte zum Doppelzwinger. Hier draußen kam man ohne Hunde kaum aus.
Einer seiner Leute hatte das Fressen für die beiden vierbeinigen Wächter bereitgestellt. Außer Collin Johns und seiner Tochter durfte sich niemand in die Zwinger wagen. Es hätte tödlich enden können.
Johns griff den großen Eimer, in dem es blutig schwappte, und löste die Verriegelung des Zwingers. Die Tür öffnete sich nach innen.
Collin Johns wurde erstmals misstrauisch, als ihn ein zorniges Knurren empfing. Doch sein Gehirn war noch zu umnebelt, um daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Unbeirrt schob er die Tür weiter auf.
Und da sah er den einen Hund!
Das Tier hatte sich in die Ecke verkrochen, saß zusammengekauert, den Schwanz halb zwischen die Hinterbeine gezogen. An sich war das eine Demutshaltung, aber die Tatsache, dass die Augen zu glühen schienen und die Lefzen gezogen waren, sprach dem entschieden entgegen.
Collin Johns blieb stehen wie vom Donner gerührt.
„He, Washington, was ist los mit dir?“, grollte er.
Ein wenig vorsichtiger geworden schlurfte er näher, den Eimer fest in der Hand.
Irrte er sich, oder peilte der Hund zur offenen Tür?
Wieder erklang das abgrundtiefe Knurren, das zur Vorsicht mahnte. Das Tier legte die Ohren an und bleckte sein gefährliches Gebiss.
Collin Johns erkannte es im Ansatz. Das rettete ihm wahrscheinlich auch das Leben.
Der Hund sprang, riss dabei weit das Maul auf und schnappte Johns nach der Kehle.
Collin ließ den Eimer los, riss beide Arme hoch und traf den Hund an der Unterseite.
Das Tier krachte gegen das Dach, schlug zu Boden und wischte wie der Blitz aus dem Zwinger.
Mit weit ausholenden Sprüngen hetzte es davon.
Collin Johns erwachte aus seiner momentanen Erstarrung und rannte hinterdrein. Dabei fuchtelte er wild mit den Armen und stieß schrille Pfiffe aus.
Der Hund ließ sich nicht beirren. Er jagte am Haus vorbei und entschwand aus Collins Blickfeld.
Keuchend blieb der Plantagenbesitzer stehen. Seine Arme hingen herab. Hinter seiner umwölkten Stirn wogten die Gedanken. Vergeblich versuchte er, sich einen Reim auf das Verhalten des Hundes zu machen.
Er besah seine rechte Hand. Blutige Striemen, aber nicht schlimm. Für Collin waren das nur Kratzer.
Viel schlimmer war, dass der Hund frei war.
Washington war eine Gefahr. Wie Collin ihn kannte, dauerte es nicht lange, und der Hund wilderte.
Es half alles nichts, er musste den Polizeiposten drunten in Parlatuvier in Kenntnis setzen. Oder sollte er zu Jonny’s Pub? Dort gab es ein Telefon!
Aber erst musste er nach dem zweiten Hund sehen. Für alles gab es schließlich eine Begründung.
Er stakste zum Doppelzwinger zurück. Diesmal ging er umsichtiger zu Werk. Ehe er das Gatter öffnete, lugte er in das Innere des Zwingers.
Auch Lord Nelson benahm sich seltsam. Er lief unaufhörlich im Kreis. Als er seinen Herrn witterte, kam er winselnd zur Tür und wedelte mit dem Schwanz.
„Beim dreimal Gehenkten!“, fluchte Collin Johns. „Hat es dich ebenfalls erwischt, Lord? Da soll doch ...“
Er vollendete den Satz nicht mehr, denn Lord Nelson änderte seine Verhaltensweise. Als er sah, dass sein Herr nicht willens war, die Tür zu öffnen, zog er sich in die Mitte des großen Zwingers zurück, setzte sich auf die Hinterhand, hob die Schnauze und heulte schauerlich.
Collin Johns konnte nicht verhindern, dass ihm kalte Schauer über den Rücken rieselten.
Hastig schaute er sich um. Er war allein. Keine Menschenseele war zu sehen. Der um diese Jahreszeit aus dem Westen kommende stetige Passatwind strich über ihn hinweg und ließ den Mann trotz der sich schon abzeichnenden Tageshitze frösteln.
Collin Johns hätte es sich nie selbst eingestanden, aber in diesen Sekunden hatte er Angst.
Unerklärliche Dinge gingen vor. Eine Bedrohung schwebte in der Luft noch unsichtbar, aber fast schon zu greifen.
Das Verhalten von Washington konnte nur eine Begründung haben: Angst! Aber vor wem oder vor was hatte er diese Angst gehabt?
Und was war mit Lord Nelson?
Der Hund jaulte noch immer. In welche Richtung hielt er die Schnauze?
Lag da nicht der gigantische Vulkankegel?
Collin Johns schaute hinüber. Oben, am zackigen Rand des Kraters, hingen ein paar Wölkchen.
Collin Johns erschrak. Es sah fast so aus, als kämen die Wolken aus dem Innern.
Plötzlich hatte es Johns sehr eilig. Er ließ den Hund im Zwinger, fuhr den Jeep aus dem Schuppen und steuerte ihn in Richtung Gelfi.
Niemand wusste, wer dem Kaff diesen eigenartigen Namen gegeben hatte. Auf jeden Fall bestand Gelfi aus einer Reihe von schäbigen Hütten und war wenig einladend. Was die umliegenden Farmer anzog, waren Jonny’s Pub und der einzige Drugstore weit und breit.
Die Kaffeeplantagen hier oben lagen über tausend Meter hoch. Hierher verirrte sich kein Tourist. Die bevorzugten die schönen Strände wie Store Bay, Man o’War Bay, Milford Bay, Crown Point, Pigeon Point und die Rockly Bay südlich der Hauptstadt Scarborough. Bestenfalls mühten sie sich über den beschwerlichen Weg zu den Craig Hill Falls und dem interessanten alten Sklavenfriedhof.
In Jonny’s Pub bediente Jonny eigenhändig das Telefon, als Collin ihm von dem Ausreißer erzählt hatte. Er wählte die Nummer der Polizei von Parlatuvier.
„Mann, hoffentlich passiert keine Katastrophe!“, meinte er besorgt, während aus dem Hörer das Freizeichen tönte.
Collin Johns konnte diesen frommen Wunsch nur teilen und war wenig später wieder mit seinem Jeep unterwegs. Er hatte sich die ungefähre Richtung gemerkt, in die Washington gelaufen war. Es fiel ihm dabei nicht auf, dass der Hund sich schnurgerade von dem Vulkan wegbewegte.
Der Jeep begann unvermittelt zu springen, und ein dumpfes Grollen war in der Luft. Verstört bremste Johns.
Nur langsam begriff er, dass ein heftiger Stoß durchs Land gegangen war und den Jeep gebeutelt hatte.
3
Die Schlangen umwimmelten den Indio. Er war bewusstlos vom Sturz und bewegte sich nicht, und das rettete ihm das Leben.
Schlangen reagierten nur auf Dinge, die sich bewegten. Die Tiere waren bemüht, so schnell wie möglich aus der Nähe des schwarzen Vulkankegels zu kommen.
Als der alte Indio endlich wieder zu sich kam, wusste er nicht, wie lange sein unfreiwilliger Schlaf angedauert hatte. Verständnislos blickte er herum. Er brauchte eine Weile, bis er sich in der neuen Situation zurechtgefunden hatte. Er setzte sich auf und griff sich an den schmerzenden Schädel. Die dicke Beule an der Stirn war aufgeplatzt. Der dünne Blutfaden, der sich herunterzog, war angetrocknet und hatte die Augenbraue verklebt. Die Wunde schmerzte, doch der Alte war nicht zimperlich. Er vergaß seinen Sturz und die pochenden Kopfschmerzen und besann sich auf seine Aufgabe.
Suchend blickte er umher. Von den Schafen fehlte jegliche Spur.
Der Alte lauschte. Da war nur das leise Pfeifen des Westwindes, der durch das lichte Gestrüpp strich, hie und da kleine Staubfontänen aufwirbelte, und sich im zernarbten Vulkangestein verfing.
Der Gedanke kehrte wieder zurück; der Gedanke, der ihm kurz vor dem Sturz gekommen war. Seine Augen suchten den mächtigen Bergkegel.
„Verdammt!“, entfuhr es ihm, „sollte das Teufelsauge zu glühen beginnen? Sollte sich die Hölle öffnen, um Feuer zu speien? Das kann doch nicht sein!“
Er kam taumelnd auf die Beine, stand da mit hängenden Schultern und starrte hinüber. Vergeblich versuchte er, eine Veränderung festzustellen.
Wie, zum Teufel, kam es, dass die Schlangen die drohende Gefahr erahnten und der Mensch völlig arglos blieb?
Er erinnerte sich der Erzählungen von Weißen. Danach mieden Schlangen die Nähe von Autostraßen, weil ihnen die unmerklichen Vibrationen zuwider waren.
Der Indio schöpfte tief Luft. Er brauchte alle Willenskraft, um sich dem jetzt drohend auf ihn wirkenden Bergkegel zu nähern. Der Weg wurde merklich steiniger, felsiger. Bald musste der schmale Einschnitt zu sehen sein.
Unermüdlich lief der alte Mann weiter. Er dachte nicht mehr an seine Schafe. Hier galt es, einer Sache auf den Grund zu gehen, die wesentlich bedeutsamer war.
Irgendwann erreichte er sein Ziel. Vor dem Einschnitt blieb er stehen.
Vor Zeiten hatte brodelnde Lava den hohen Rundwall des Kraters überquollen und sich einen Weg gegraben. Der Einschnitt war entstanden. Der Boden war hier regelrecht glasiert. Er vermeinte, ein Brodeln und Zischen zu hören und ein dumpfes Grollen.
Der Wind pfiff ihm um die Ohren, und es schien, als treibe er den Mann vorwärts, näher an den Spalt heran.
Der Einschnitt war etwa drei Yards breit, zumindest hier unten, an der tiefsten Stelle.
Der Westwind rauschte herein und wurde durch den engen Kanal beschleunigt. Dabei bauschte er die Kleidung des Hirten und spielte mit dem schütteren Haar. Das Rauschen und Pfeifen peitschte die Nerven des Indios.
Dennoch kehrte er nicht um. Er war nun einmal da, und er brauchte Gewissheit.
Er überwand den Durchgang und betrat das weite Rund.
Vier, fünf Quellen waren entstanden, wo es zuvor keine gegeben hatte.
Er steuerte schnurstracks auf die nächste zu. Sie kam aus dem Boden, gab eine Menge Dampf ab und versickerte gleich wieder in Felsspalten.
Er erreichte sie und starrte fasziniert auf das schäumende Nass. Das Wasser war braun!
Und einen Lidschlag später zischte es in einem mächtigen Strahl empor.
Dabei mischte sich immer mehr Farbe hinein. Bis es aussah, als blute die Erde und verspritze weithin ihren Lebenssaft.
Und dann kamen die ersten Erschütterungen durch, begleitet von einem fernen Grollen, das anrollte wie ein Trommelwirbel, dabei stetig an Macht gewinnend.
Der Indio stierte mit flackernden Augen zu dem Zackenkranz am Kraterrand hoch. Es staubte. Erste Brocken lösten sich und polterten zu Tal. Ihr Geräusch wurde übertönt.
Der Schock, der den alten Mann auf die Stelle bannte, löste sich durch ein irres Kreischen. Der Indio begann zu rennen. Es ging viel zu langsam, wirkte wie in Zeitlupe. Schneller waren die alten Beine nicht mehr. Immer wieder kam er ins Stolpern, doch die Panik riss ihn jedes Mal hoch.
Er merkte, dass er in einer grässlichen Falle steckte.
Fast hatte er den Einschnitt erreicht. Auch dort prasselte es plötzlich nieder. Geröll bildete sich am Boden.
Der nächste Erdstoß riss dem Indio den Boden unter den Füßen weg. Er schlug der Länge nach hin und wandte mit gesträubten Nackenhaaren den Kopf.
Hinter ihm brach eine Gluthölle auf an der spritzenden Quelle. Der unterirdische, gespeicherte Druck schleuderte mit ohrenbetäubendem Krachen einen Gesteinspfropfen empor. Es geschah mit solcher Kraft, dass der mächtige Brocken mit Leichtigkeit den hohen Wall überwand und irgendwo
jenseits hinsegelte.
Ein dicker Strahl roten Wassers wurde nachgespuckt. Dann versiegte die Quelle. Der Wasserstrahl wurde abgelöst von einer gewaltigen Wolke von Schwefel, die empor puffte und rasch den weiten Kegel füllte.
Immer mehr Geröll prasselte vom Kraterrand herunter.
Und dann kroch ein glühender Wurm aus der Erde. Sein Rücken bestand aus schwarzer Asche und wirkte schuppig, sein Leib aber war Magma, direkt aus der Erde geboren.
Die Hitze wurde unerträglich und trieb den alten Mann, der sich inmitten der Hölle wähnte, auf die Beine. Seine Augen brannten. Die Haare fingen fast Feuer.
Jetzt gab es kein Halten mehr für ihn.
Er war alt, aber nicht bereit, hier sein Leben zu lassen.
Er scherte sich nicht um das herabregnende Gestein, das den schmalen Einschnitt zu verschließen begann.
Mitten hinein in den steinernen Hagel rannte er, die Arme schützend über den Kopf gehoben.
Der Magmawurf erreichte den anwachsenden Geröllberg im gleichen Augenblick, als der Hirte in das rettende Freie trat.
Die Lava vermischte sich mit dem kalten Gestein und kühlte ab, was durch den stetigen Wind beschleunigt wurde.
Dadurch wurde der schmale Einschnitt geschlossen.
Der Indio hatte für diese Dinge kein Auge. Er achtete nicht einmal auf die Verletzungen, die er sich bei der Flucht zugezogen hatte. Der abwärts weisende Hang beschleunigte seine Schritte. Er kannte sich hier aus. Sein Weg würde ihn direkt nach Gelfi führen.
Doch weit kam er nicht.
Der Indio hielt sich an einem verkrüppelten Baum fest, den er gerade passierte. Damit verhinderte er seinen Sturz.
Voller Furcht wandte er den Blick zurück.
Über dem schwarzen Kegel des Teufelsauges stand eine feurige Lohe. Dunkle Schatten wirbelten empor: Asche.
Immer größere Wolken von Schwefelgas gelangten ins Freie. Sie bildeten vereint einen gewaltigen Strahl, der oben pilzförmig aufquoll wie bei einer Atomexplosion. Inmitten irrlichterte es. Die Wolke stieß gegen den Himmel und färbte diesen gelblich-braun.
Der Indio glaubte darin das Gesicht des Leibhaftigen zu sehen, der auf die arglosen Menschen herabgrinste und sich auf ihre Seelen freute.
Der Atem des Alten ging rasselnd. Das Vernünftigste wäre gewesen, er hätte sich schleunigst eine Deckung für den bevorstehenden Ascheregen gesucht. Auf die Idee kam er jedoch nicht. Ihn beherrschte der Urinstinkt des Selbsterhaltungstriebes. Es gelang ihm nicht mehr, einen klaren Gedanken zu fassen.
Er rannte einfach los. Er wollte nur noch weg vom Vulkan.
In seiner Kopflosigkeit irrte er sich in der Richtung. Er kam nicht bei Gelfi heraus, sondern in der Nähe von Collin Johns’ Kaffeeplantage.
Erst als er die ärmlichen Hütten der farbigen Arbeiter passierte, wurde ihm das bewusst.
Die Arbeiter hatten mit ihren Familien noch nicht die Flucht angetreten. Sie standen dem Ereignis sehr hilflos gegenüber.
Dem einen stürzte der Indio beinahe vor die Füße.
„Das Teufelsauge ist zum Höllenschlund geworden!“, ächzte der Hirte.
„Die Hölle speit Feuer! Da ...!“
Der Schwarze schrie seinen Leuten etwas zu. Zu dritt widmeten sie sich dem Indio, der einfach nicht mehr konnte. Er hatte seinen abgearbeiteten Körper bereits überfordert. Die Frauen nahmen ihre Kinder auf die Arme. Andere rafften in eiliger Hast ein paar Habseligkeiten zusammen.
Collin Johns hatte nichts dagegen, wenn seine Arbeiter Haustiere hielten. Die Leute ließen die paar Ziegen und Schweine frei, die hier oben nicht gerade üppig gediehen. Die Tiere stürmten wie tollwütig geworden davon.
Sogar die Hühner waren völlig verrückt, und das nicht erst seit dem Ausbruch des Vulkans. Die meisten wurden an den Beinen zusammengerafft und mitgenommen.
„Achtung!“, schrie jemand.
Viele der Männer und Frauen reagierten. Sie liefen zu ihren Hütten zurück. Leider waren nicht alle so schlau.
Die glühende Asche kam aus dem Himmel und fiel auf die Erde. Krachend kamen da und dort auch kopfgroße Brocken herunter.
Der Indio musste von einem Fenster aus zusehen, wie eine der Gesteinsbomben, die alle anderen an Größe übertraf, auf einen Schwarzen schlug. Der Mann wurde regelrecht zermalmt.
Glühende Asche zündete die langen Kleider zweier Frauen an, die sich sofort schreiend am Boden wälzten.
Die Hitze stieg sprunghaft an.
Eine der Auswurf-Bomben ging durch das Dach der Hütte, in der sich der Indio mit einigen Arbeitern verborgen hatte. Ein Mann wurde getroffen. Es riss ihm die Hand ab.
Entsetzt starrte der Schwarze auf den blutigen Stummel.
Der Schock lähmte ihn noch.
Aber dann begriff er. Sein Brüllen ging im entstandenen Chaos unter.
Der Indio schaute voller Furcht hinaus. Er konnte den Weg sehen, auf den die Gesteinsbrocken schlugen.
Gelfi lag dem Vulkan näher als diese Hütten. Der Indio erkannte, dass dort auf dem Weg Jonny und seine Frau gerannt kamen. Jonnys Hemd war verbrannt und zerfetzt. Und hinter den beiden Weißen kamen Farbige, kopflos und verstört.
Unvermittelt endete der Ascheregen. Aber das Haar von Jonnys Frau begann ausgerechnet jetzt zu brennen.
Das Fallen der Steine hatte höchstens eine halbe Minute gedauert. Für die Betroffenen hatte es gewirkt wie eine halbe Ewigkeit.
Einer der Schwarzen sah die hilflosen Bemühungen von Jonny und eilte herbei. Mit einem löcherigen Unterhemd gelang es den beiden endlich, das Feuer auf dem Kopf von Jonnys Frau zu löschen. Die Unglückliche hatte bereits erhebliche Wunden davongetragen. Sie würde überleben.
Weinend lag sie auf den Knien und schlug die Hände vor das Gesicht.
Jonny ließ ihr keine Zeit. Er zerrte sie hoch.
„Wir müssen abhauen! Der Berg hat sich nicht beruhigt. Bald geht es wieder los.“
Auch den anderen war das klar. Die wenigen, denen es gelang, einen kühlen Kopf zu bewahren, sammelten die Verletzten und Geschundenen ein.
Jetzt stand der Flucht nicht mehr viel im Wege.
Fünf Tote hatte es gegeben, zwei auf dem Weg, einen vor und zwei in den Hütten. Es blieb nicht die Zeit, etwas für sie zu tun, ja, nicht einmal Trauer für sie zu empfinden. Draußen war alles voller Rauch und Gestank. Büsche brannten, Bäume qualmten, eine Hütte stand schon in Flammen.
Alle liefen sie in Richtung Parlatuvier. Es waren einige Kilometer. Eine schier endlose Strecke angesichts der Gefahr.
„Warum hast du nicht deinen Jeep genommen?“, rief einer der Schwarzen erbittert Jonny zu.
„Hat gleich ’n Steinbrocken auf ’n Motor gekriegt!“, war Jonnys Antwort.
Die Menschen rannten weiter, stolpernd, keuchend und ächzend.
Rauchschwaden folgten ihnen.
Der Indio befand sich unter den Flüchtenden. Das Grauen hatte tiefe Kerben in sein Gesicht gegraben. Er hatte die Hölle mit eigenen Augen gesehen, und dieser Anblick hatte sich in ihm festgebrannt. Er hatte wenig Hoffnung, dass ihnen die Flucht gelang.
4
Nach dem heftigen Erdstoß fuhr Collin Johns wie der Teufel. Seiner Schätzung nach befand sich sein Hund Washington auf dem Weg nach Parlatuvier. Er musste sich also beeilen. Luftlinie waren es von Gelfi aus nur zirka drei Meilen. Für Washington bestand kein Grund, das zu benutzen, was man hier als Straße bezeichnete. Für Collin Johns war das anders.
Gottlob war der steinige und sandige Weg mit der deutlichen Fahrspur trocken. Während der Regenzeit war er fast unbenutzbar.
Hinter dem Wagen wirbelte der Staub in dicken, rauchähnlichen Wolken auf. Träge schwebten sie auseinander. Es würde lange dauern, bis sie sich wieder auf den Boden herabsenkten.
Ständig ließ Collin Johns seine Blicke schweifen sofern er überhaupt seine Aufmerksamkeit von der Straße ablenken konnte.
Washington sichtete er nicht. Dafür etwas anderes.
Die Straße schlängelte sich hier teilweise in steilen Serpentinen tiefer. Von links, aus Richtung Vulkan, wälzte sich eine mächtige Staubwolke auf ihn zu.
Das überraschte ihn dermaßen, dass er mit beiden Füßen in die Bremsen stieg. Schlingernd kam das Fahrzeug zum Stehen.
Die Wolke näherte sich beängstigend schnell.
Dann hörte Collin Johns das verängstigte Blöken von Schafen. Dazwischen das Bellen von Hunden.
Steil stieg Collin in seinem Jeep auf.
Die erste Linie der großen Schafherde schob sich auf ihn zu. Die wollenen Felle der Tiere waren staubbedeckt.
Es gab hier nur einen einzigen Hirten, und das war der alte Indio, der seine Geburtsstätte irgendwo drüben auf Trinidad hatte.
Wo war der Alte? Und wieso kam hier seine Herde?
Etwas hatte sie in Panik versetzt. In einer Art Stampede gingen sie durch, und es gab für sie kein Halten mehr. Wenn sie so weiter preschten, kam mindestens die Hälfte in dem unwegsamen Gelände um.
Schlagartig wurde Collin Johns bewusst, in welch tödlicher Gefahr er sich befand.
Nur noch hundert Yards war die dunkle Masse der durchgedrehten Tiere von ihm entfernt, und er verbaute ihnen den Weg.
Wenn er nicht schleunigst zusah, dass er Land gewann, überlebte er das nicht!
Der Motor tuckerte noch. Collin trat auf das Gaspedal. Das Fahrzeug machte einen Satz nach vorn, hoppelte über eine Bodenwelle. Das rechte Vorderrad krachte in ein Schlagloch, dass es dem Mann fast das Steuer aus der Hand riss. Mit dem Heck rutschte er vom Weg herunter. Das verzögerte seine Fahrt.
Rasch den Allradantrieb einschalten. Abermals Gas geben. Weiter ging es.
Wie eine staubige Flut kamen die Schafe heran. Die ersten stießen blind gegen den Jeep, der bedenklich zu wanken begann und abermals aus der Richtung kam.
Die Kurve nahte.
Verdammt, das schaffe ich nicht mehr!, dachte Collin Johns verzweifelt.
Wie ein Schatten tauchte ein Baum auf. Die Äste hingen teilweise recht tief.
Es gab einen mörderisch lauten Schlag, als der Jeep den Stamm erwischte. Johns hob es aus. Er flog aus dem Fahrzeug am Stamm vorbei und überschlug sich ein Stück weiter am Boden.
Ächzend setzte er sich auf, als sich der Staub gelegt hatte, spuckte den Sand und Dreck aus, prüfte die Festigkeit seiner Zähne und sagte sauer: „Scheiße!“
Der Weg hinter ihm dröhnte. Die Schafe rannten verstört vorbei. Und dann war der ganze Spuk weg.
Collin Johns hustete. In der Staubwolke erkannte er nur noch einen humpelnden Hund, der sich bemühte, Anschluss zu behalten. Washington war es nicht.
Erst jetzt bemerkte Collin Johns, wie sehr seine Knie zitterten. Er blieb einfach hocken.
Mit gemischten Gefühlen hielt er nach seinem Jeep Ausschau. Nichts war zu sehen. Er musste warten, bis sich der Staub ein wenig gelegt hatte.
Da lag das Wrack. Beim Baum.
Collin Johns fluchte lange und gewalttätig und ging schließlich in Richtung Weg zurück.
Ein neuer Erdstoß durchlief das Land und stieß Johns von den Beinen.
Ein mächtiges Grollen drang aus dem Boden. Collin Johns erhob sich hastig. Sein Blick flog zum Vulkan hinüber, den er auch von hier aus gut sehen konnte.
Die Erdstöße wurden heftiger.
Im selben Moment löste sich eine Wolke von Dampf vom oberen Kraterrand.
Fassungslos starrte Collin Johns bergan. Sein Verstand weigerte sich, das Geschehene zu begreifen.
Er verstand es schließlich doch. Plötzlich war alles ganz klar. Nichts Geheimnisvolles war mehr im Benehmen der beiden Hunde oder im Durchgehen der großen Schafherde zu sehen.
Eine Binsenweisheit, dass Tiere als erste auf Katastrophen reagierten, lange, bevor der Mensch etwas spürte.
Sogar die Seismographen mussten kapitulieren, denn sie nahmen erst Katastrophen wahr, die bereits im Gange waren.
Collin Johns hätte sich ohrfeigen können. Hatte er sich nicht wie ein Narr benommen?
Jetzt war es zu spät, sich noch Vorwürfe zu machen, zu spät fast für alles.
Erst dachte Collin Johns an seine Tochter. Heute Mittag hatte sie kommen wollen. Gottlob erst in einigen Stunden. Somit war sie noch in Sicherheit.
Collin Johns ahnte nicht, wie sehr er in dieser Hinsicht irrte.
Als zweites erinnerte er sich an etwas anderes. Er musste unter allen Umständen zurück zu seinem Haus. Das, was er dort verborgen hielt, durfte nicht vergehen, oder gar anderen in die Hände fallen.
Einen letzten Blick warf er auf den hohen Vulkanberg, das Wahrzeichen dieser Insel. Aus dem Krater schlug jetzt Feuer.
Ein Schatten zischte hoch über Collin weg. Ein Vorbote der Hölle. Unwillkürlich schaute der Mann nach.
Er ahnte nicht, dass es sich um den Gesteinspfropfen handelte, den der Indio hatte hochgehen sehen. Die Explosionskraft, die bei dem Loslösen dahintergesteckt hatte, verwandelte den tonnenschweren Stein in ein teuflisches Geschoss, das in Richtung Parlatuvier flog. Nach Lage der Dinge würde es die Stadt nicht ganz erreichen, aber es gab auch Häuser, die vorgelagert waren.
Fasziniert beobachtete Collin Johns die Flugbahn, um sich anschließend wieder dem Berg des Unheils zuzuwenden. Offenbar waren die Asche und die Wolken von Gas direkt nach dem Gesteinspfropfen zutage getreten. Der Himmel verdunkelte sich rasch, wie bei einem aufziehenden Unwetter.
Aber ein Unwetter wäre gegen das, was der Insel bevorstand, eine wahre Kleinigkeit gewesen.
Daran dachte Collin Johns voller Sorge. Er begann zu rennen, widersinnigerweise direkt in Richtung Vulkan. Für ihn jedoch war das alles andere als widersinnig. Die Wohnhütte, in der er seit über zehn Jahren hauste, barg ein kleines Geheimnis. Es war so wichtig, dass er sogar sein Leben dafür aufs Spiel setzte.
Es dauerte nicht lange, da wurde er vom Ascheregen überrascht.
Ihn nahm es nicht ganz so schlimm mit wie seine Leute, da er sich weiter entfernt aufhielt.
Dennoch streifte ihn ein kleinerer Gesteinsbrocken knapp an der Schulter und verursachte eine schlimme Schramme, die sich quer über den Rücken zog. Es blieb Johns nichts anderes übrig, als irgendwo Deckung zu suchen.
Das war leichter gesagt als getan.
In der Nähe fing ein Baum Feuer. Es schien, als habe ihn ein Blitz getroffen.
Feuriger Regen ging nieder. Zum Glück geschah das nicht geschlossen, sondern strichweise. So kam es, dass Collin Johns mit dem Leben davonkam.
Gehetzt schaute er in die Runde.
Er erkannte eine überhängende Felsnase an einem steilen Stich in der Nähe. Dorthin trugen ihn seine Füße, so schnell sie konnten. Unterwegs rutschte Collin Johns zweimal ab und verstauchte sich den Fuß.
Aufatmend warf er sich in Deckung. Die Felsnase ließ Sand auf ihn herabrieseln und krachte bedenklich, als sie einmal direkt getroffen wurde. Aber sie hielt. Collin Johns kauerte sich Schutz suchend darunter und blickte mit geweiteten Augen hinaus. Die Zerstörungswirkung dieses Ausbruchs des friedlich geglaubten Vulkans hielt sich in Grenzen. Das hieß allerdings nicht, dass es der Vulkan dabei beließ.
Wie es aussah, war das alles erst der kleine Anfang.
Collin Johns war so verbohrt, sich dennoch nicht von seinem einmal gefassten Entschluss abhalten zu lassen. Als der Ascheregen zu Ende war, wagte er sich hervor und setzte unbeirrt seinen Weg durch Rauch und Qualm fort.
Einmal schaute er hoch. Immer mehr Rauch und Gase verließen den Höllenschlund und quollen in die Atmosphäre. Die entstandene Wolkenformation bedeckte bereits eine Fläche von mehreren Quadratkilometern. Dicke, schwarze Bänke hatten sich gebildet.
5
Cecile Johns war schon mit der Morgenmaschine angekommen, statt mit dem Abendflugzeug.
So kam es, dass sie allein auf dem Flughafen Crown Point stand. Niemand erwartete sie in der Ankunftshalle.
Sie nahm ihr Gepäck vom Band und verfrachtete es auf einen Karren, den sie sich vorsorglich besorgt hatte, denn aus Erfahrung war ihr bekannt, dass die Dinger recht rar waren.
Am Ausgang erwartete sie eine Überraschung: Hank Matthews! Das war sozusagen ein Nachbar zu Hause. Seine Kaffeeplantage lag näher an Parlatuvier. Zwischen ihm und Johns befanden sich mehr oder weniger steile Hänge aus erstarrtem oder aufgeschüttetem Gestein, durch die sich die Straße ihren Weg nach Gelfi hinauf bahnte.
Vulkangestein war manchmal recht fruchtbar, wenn es Pflanzen erst einmal gelungen war, Wurzeln zu schlagen. Im Laufe der Jahrzehnte hatte sich stellenweise Humus gebildet. Bevor man darangegangen war, dort Kaffee anzupflanzen, hatten sich Eichen-Kiefern-Wälder breitgemacht. Sie waren in den Bergen überhaupt, neben dem sogenannten Stielfruchtbaum, dominierend.
Erst glaubte Cecile Johns, Hank Matthews sei ihretwegen hier. Sie musste bald einsehen, dass sie sich getäuscht hatte. Hank bemerkte sie gar nicht. Er schenkte seine Aufmerksamkeit anderen Ankömmlingen: Zwei Männern und einer Frau. Mit einem neidlosen Blick stellte Cecile fest, dass die vielleicht Fünfundzwanzigjährige recht hübsch war. Zu welchem der Männer sie gehörte, war auf Anhieb zu erkennen. Er trug einen Ehering.
Hank begrüßte erst den anderen Mann. Neugierig ging Cecile näher. Sie hörte, wie der Begrüßte sagte: „Hank, wie du siehst, habe ich Wort gehalten. Das sind meine Freunde. Susan Watt kommt aus Chicago, ihr Mann Edgar wie ich aus New York. Ich muss dir mal erzählen, wie sich die beiden kennengelernt haben. Ist wirklich interessant.“
„Okay, Jim“, meinte Hank Matthews lachend und reichte jedem der Neuankömmlinge die Hand.
Cecile Johns betrachtete die Gruppe.
Hank Matthews war an die Vierzig. Er war verheiratet, seine Frau ein wahrer Drachen. Cecile verzog das Gesicht, als sie daran dachte. Dann widmete sie sich Susans Mann, diesem Edgar Watt. Eine stattliche Erscheinung. Was Cecile an ihm nicht gefiel, war der Schnurrbart. Sie mochte keine Bärte.
Schade, dachte sie. Dieser Jim würde bestimmt ausgezeichnet aussehen, obwohl die Figur ein wenig zu muskulös ist. Er wirkt wie der amtierende Mister Amerika. Aber dieser grässliche Vollbart! Mit einem Oberlippenbewuchs hat er sich nicht einmal zufriedengegeben!
Sie schüttelte sich.
Soll ich oder soll ich nicht?, überlegte sie. Ich soll!
Sie ging auf die Gruppe zu, die sich gerade in Bewegung setzte, nachdem Hank Matthews gemeint hatte: „Schlage vor, wir essen erst einmal was im Restaurant. Ihr werdet einen Bärenhunger haben, schätze ich.“
„Na gut“, sagte Jim, „ehe wir uns schlagen lassen ... Aber so lang war die Reise gar nicht. Von Trinidad bis hierher waren es nur zwanzig Minuten.“
„Und vorher? Ihr seid doch auf Trinidad nur umgestiegen“, widersprach Hank. „Sag mal, wie teuer ist der Flug von Trinidad im Moment eigentlich?“
„Hin und zurück 15 Dollar pro Nase“, gab Jim Auskunft.
„Wird auch immer teurer“, kommentierte Hank.
„Nun, mit dem Schiff von Port of Spain aus ist es billiger.“
„Deshalb ist man auch während der viele Stunden dauernden Überfahrt auf der oft stürmischen See sterbenskrank.“
Sie lachten alle.
Das war der Moment, in dem Cecile Johns in die Unterhaltung platzte.
„Oh, Hank, ich hätte Sie beinahe nicht erkannt!“, log sie und schob sich einfach an den anderen vorbei.
Hanks Kinnlade fiel herab. Es war ihm anzusehen, dass ihm die Begegnung nicht sehr angenehm war.
Cecile schlug ihm kameradschaftlich auf die Schulter. Hanks Freunde ignorierte sie total. Daran war nicht zuletzt Jims Vollbart schuld.
„He, da fällt mir ein, wir haben doch denselben Weg, oder? Ich würde Ihr Angebot, mich mitzunehmen, gern annehmen. Vater weiß noch nichts von seinem Glück. Er erwartet mich am Nachmittag. Ich will ihn überraschen. Schließlich ist es recht weit bis nach Gelfi, nicht wahr?“
„Ja, fast über die ganze Insel“, murmelte Hank Matthews, ohne dass ihm das bewusst wurde.
Jim zeigte sich erfreut.
„Natürlich, Hank, das können wir tun. Warum soll die junge Dame nicht mit uns fahren? Eine Nachbarin, eh?“
„Äh ja, Nachbarin.“ Hank war etwas durcheinander. In seiner Not versuchte er zu retten, was noch zu retten war, indem er sagte: „Wir fahren nicht sofort nach Gelfi, Cecile. Tut mir leid, Mädchen, aber ich will meinen Freunden erst die Insel zeigen. Cecile, das ist übrigens der Sohn eines Geschäftspartners. Er hat sein Versprechen endlich wahr gemacht und kommt mich mit seinen Bekannten besuchen. Toll, wie?“
Jim merkte, dass die Situation ins Peinliche geriet. Auch er wollte seinen Teil zur Rettung beitragen.
„Unsinn, Hank, du brauchst uns Tobago ja nicht ausgerechnet jetzt gleich zu zeigen. Wir sind schließlich noch lange genug hier. Bringen wir erst Cecile, ich darf Sie doch so nennen, nicht wahr? Nach Hause.“
.„Miss Johns’ für Sie!“, erklärte Cecile schnippisch. Dann breitete sie die Arme aus und meinte fröhlich: „Aber machen Sie sich keine Umstände! Schauen wir uns ruhig die Insel einmal an.“
So kam es, dass die vier Cecile Johns am Hals hatten.
Jim erkannte bald, was Hank in einem unbemerkten Augenblick mit den Worten meinte: „Die ist noch um einige Grad schlimmer als meine Alte, und Louise erscheint mir oft genug recht kratzbürstig.“
Jim ließ sich nichts anmerken. Er und seine beiden Freunde hielten sich zurück und überließen Hank Matthews den Part. Er wusste besser mit dem schwierigen Mädchen umzugehen.
Der Flugplatz von Tobago liegt im südwestlichen Zipfel am Columbus Point. Mit Hanks Jeep fuhren sie zur Hauptstadt Scarborough. Eine eigene Regierung gibt es hier nicht. Tobago gehört zum Zwei-Insel-Staat Trinidad und Tobago und wird von Port of Spain aus mitverwaltet. Wer beide Inseln kennt, mag nicht glauben, dass sie zusammengehören, so verschieden sind sie und ihr Menschenschlag. Während auf Trinidad mit seinen vielen Völkern der Calypso und die sogenannten Steel-Bands zu Hause sind und pulsierendes Leben herrscht, ist Tobago eher ruhig zu nennen.
In Scarborough machten sie kurz Station, um im berühmten Robinson Crusoe zu essen, wo man ausgezeichnete kreolische Küche serviert bekommt.
Nach der unpassenden Bemerkung von Cecile: „Sie sollten Ihren Gästen nicht soviel zu essen geben, sondern ihnen vielmehr endlich etwas von der Insel zeigen, sonst werden sie zu dick“, fuhren sie weiter über die Küstenstraße nach Speyside, von wo aus sie mit dem Boot nach Little Tobago übersetzten.
Das kleine Inselchen ist ein wahres Vogelparadies.
Hank machte dort eine bedeutsame Feststellung. „Die Vögel benehmen sich so merkwürdig! Sie sind nervös und unruhig. Selbst die einheimischen Quezals flattern aufgeregt hin und her“, sagte er.
Cecile lachte ihn aus. Das nahm den Worten das Gewicht.
Sie verließen die Paradiesvogelinsel, und wenig später holperten sie eine Straße entlang, die der Teufel persönlich gebaut zu haben schien. Die Gegend wurde merklich einsamer. Dieses Bild änderte sich erst, als sie sich Parlatuvier näherten.
Hank Matthews wuchs über sich selbst hinaus und bot Cecile an, noch auf einen Drink mit in sein Haus zu kommen.
Sie willigte ein hatte, sie so doch noch Gelegenheit, mit Jim Reed ein wenig zu streiten.
Als sie gerade die Gläser in der Hand hatten, ließ ein Erdstoß das Haus in den Grundfesten erbeben.
Cecile war die erste, die sich im Freien befand. Hank gesellte sich mit den anderen neben sie. Nur seine Frau Louise blieb im Haus und schimpfte.
Hank starrte zu dem Vulkankegel hinauf und murmelte: „Die Vögel haben es lange vorher gespürt, verdammt!“
„Was hat das zu bedeuten?“, murmelte Susan ängstlich.
„Der Berg regt sich“, gab Hank tonlos zurück. „Ein alter Indio hier nennt ihn Teufelsauge. Er ist oft mit der Schafherde dort oben. Ein Teil der Tiere gehört mir.“
„Aber das ist doch furchtbar!“ Jim blickte in die Runde. „Verdammt, wir müssen etwas tun!“
Aber dazu war im Moment keiner in der Lage. Sie standen nur und stierten zum Teufelsauge hinauf.
Plötzlich vernahmen sie ein hohes Pfeifen, das von einem eigenartigen Wummern begleitet wurde.
Keiner hatte Gelegenheit, sich über den Laut zu wundern — am wenigsten die Frau von Matthews.
Das Unheil raste mit unerhörter Geschwindigkeit heran und traf genau das Wohnhaus von Hank Matthews. Louise Matthews war nicht einmal in der Lage, einen Todesschrei auszustoßen.
Die anderen waren wie versteinert.
Als erstes kam in Hank Bewegung. Sie hatten alle Glück gehabt, dass sie nicht von den herumfliegenden Trümmern getroffen worden waren.
Hank schrie wie ein Verrückter und rannte auf die Reste seines Hauses zu.
Jim setzte sofort nach, holte den Freund ein und wollte ihn zurückhalten. Hank gebärdete sich wie ein Wahnsinniger. Immer wieder brüllte er den Namen seiner Frau. Jim vermochte es trotz seiner großen Körperkräfte nicht, den Mann zu bändigen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als ihn mit einem Fausthieb niederzustrecken.
„Verdammt!“, murmelte Jim Reed bewegt. „Es tut mir leid, dass ich dich schlagen musste, aber du wirst mir noch einmal dankbar sein. In den Trümmern hättest du den Tod gefunden.“
Hank hörte ihn nicht. Jim nahm ihn auf und trug ihn weg, ehe die Hitze ihn versengte.
„Der Vulkan!“, kreischte Susan Watt in diesem Augenblick hysterisch und deutete mit ausgestrecktem Arm zum Berg hinauf.
Die anderen sahen es selber. Tod und Verderben flogen auf feurigen Bahnen durch den Himmel.
Bis in die direkte Umgebung von Parlatuvier gelangte die glühende Aschewolke nicht. Aber weiter oben am Berg begann das Land zu dampfen und zu rauchen. Büsche flammten wie Fackeln auf. Schwarze Steine schlugen dröhnend auf den Boden und sprangen noch die Hänge herab.
„Vater!“, schluchzte Cecile Johns plötzlich. Sie bewies, dass es Dinge gab, die selbst sie erschüttern konnten.
Jim sah das Mädchen auf einmal mit anderen Augen.
6
Collin Johns traf auf halbem Wege mit den Flüchtlingen zusammen.
„Wo sind die Leute von den anderen Plantagen?“, rief er.
Seine Arbeiter zuckten nur die Achseln. In ihren Augen stand das nackte Grauen.
Collin packte den Indio am Kragen. Der alte Mann hing schlapp in seinem Griff.
„Wie konnte das passieren?“, knurrte der bärenstarke Johns.
„Die Schafe sind alle weg“, stammelte der Indio erschüttert.
„Das weiß ich! Beinahe hätten sie mich umgebracht.“
„Ein Schlangenfeld“, beeilte sich der Indio zu berichten. „Die Tiere gerieten hinein. Die Schlangen flüchteten vor der Katastrophe. Die Schafe konnte ich nicht mehr halten. Sie ahnten auch etwas.“
Collin Johns ließ ihn los.
„Tut mir leid!“ Ein seltener Satz aus seinem Mund. Er stolperte ein paar Schritte weiter.
„He, Boss, wohin denn?“, fragte einer seiner Vorarbeiter verdattert.
Collin Johns ging gar nicht darauf ein.
„Tiere sind das beste Frühwarnsystem“, meinte er geistesabwesend. „Es wird Zeit, dass wir das endlich begreifen.“ Er setzte seinen Weg fort. Ein paar seiner Arbeiter machten Anstalten, ihm zu folgen. Sie wollten den Chef nicht im Stich lassen.
Aber dann ließen sie es sein.
Es war Wahnsinn, sich dem Vulkan noch zu nähern. Im Moment war er zwar ein wenig ruhiger geworden, aber das hatte nichts zu bedeuten.
Sollte Collin Johns doch in sein Verderben laufen, wenn er es nicht anders haben wollte!
7
Hank Matthews erwachte aus der Bewusstlosigkeit. Ehe es Jim verhindern konnte, stürzte sich Cecile Johns auf den Mann.
„Hank, verdammt, kommen Sie zu sich!“, rief sie eindringlich. „Hank, wir müssen etwas unternehmen!“
Es war offensichtlich, dass Hank Matthews Schwierigkeiten hatte, sich zurechtzufinden. Cecile packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn durch.
„Hank! Hank Matthews, so hören Sie doch endlich! Mein Vater er er sitzt da oben da oben, wo der Vulkan ... Hank, wir müssen eingreifen, ihn retten! Wir können ihn doch nicht sich selbst überlassen! Sagen Sie doch endlich etwas!“
Hank Matthews stieß einen gurgelnden Laut aus und befreite sich aus dem Griff des Mädchens.
Jim wurde die Sache zu bunt. Unsanft zog er Cecile weg.
„Lassen Sie ihn! Sie sehen doch, in welchem Zustand er sich befindet! Er hat seine Frau verloren!“
Im nächsten Augenblick biss er sich auf die Zunge, doch die Worte waren heraus. Als Hank das von seiner Frau hörte, zuckte er zusammen wie unter einem Peitschenhieb. Er rollte mit den Augen und kam wankend auf die Beine. Vornübergebeugt, den Blick stier auf das zerfetzte und davongewirbelte Haus gerichtet, die Linke am Knie abgestützt und die Rechte haltlos pendelnd, stand er da.
„Louise!“, stöhnte er. „Louise!“
Jim Reed zog es die Kopfhaut zusammen.
Sogar Cecile sah jetzt ein, dass sie Hank nicht mit ihren eigenen Problemen belästigen durfte; nicht in dieser Situation.
„Louise!“ Es zerriss einem schier das Herz.
Es war bisher kaum anzunehmen gewesen, dass Hank Matthews an seiner Frau hing. Sie war schließlich nicht gerade das gewesen, was man sich allgemein unter einer liebenden Ehefrau vorstellte.
Jim nahm Cecile am Arm und winkte seinen beiden Freunden zu. Sie zogen sich zurück.
Hank richtete sich steif auf. Mit hängenden Schultern schlurfte er auf die Trümmer zu. Kurz davor blieb er stehen. Er sagte etwas, aber keiner der anderen konnte es verstehen.
„Was ist mit Ihrem Vater?“, fuhr Jim das Mädchen an.
Cecile Johns schrak zusammen. Unfähig, ihren Blick von Hank Matthews zu lösen, kehrte sie in die Wirklichkeit zurück. Sie wandte sich an Jim.
„Wir wir haben eine Kaffeeplantage, vielleicht dreitausend Fuß höher.“ Sie deutete auf die Hänge, die hier erst sanft anstiegen, dann steiler. Zernarbtes Land, an den meisten Stellen dicht bewuchert, aber nicht landwirtschaftlich genutzt. Weiter oben war es flacher, bis hin zur letzten Steigung vor dem Kegel des Vulkans. Dort befanden sich die Plantagen.
„Ein winziger Ort liegt unweit des Teufelsauges, eine Barackensiedlung. Irgendein Irrer nannte sie schlicht und einfach Gelfi. Keine Ahnung, was das bedeutet. Jim, zum Teufel, Sie haben den Ascheregen gesehen! Er ging genau in dem Gebiet nieder, in dem unser Haus steht! Mein Vater wartet auf mich! Ich sollte heute Abend kommen. Er wollte mich am Flugplatz abholen. Aber jetzt ist er noch da oben!“
„Wie stellen Sie sich das vor?“ Jim winkte ab, als sie aufbrausen wollte. „Ich weiß sehr wohl, auf was Sie hinauswollen! Glauben Sie mir, es ist Wahnsinn, jetzt hinaufzufahren. Jeden Augenblick kann der nächste Ausbruch kommen.“
Als wäre dies ein verabredetes Zeichen gewesen, erschütterte sich der Boden. Sie glaubten, im nächsten Moment müsse sich die Erde öffnen, um sie zu verschlingen. Es dröhnte und polterte minutenlang.
„Da haben Sie es!“, brüllte Jim Reed. „Absoluter Wahnsinn! Es gibt nur eine Möglichkeit: Die Stadt hier muss sofort evakuiert werden. Bis zum Vulkanberg dort drüben sind es Luftlinie höchstens vier Meilen eher weniger. Von Parlatuvier bleibt nicht viel übrig, fürchte ich. Fahren wir sofort los! An der Südwestspitze der Insel dürften wir in Sicherheit sein.“
„Sie verdammter bärtiger Feigling!“, schrie Cecile ihn an. Ehe sich Jim versah, hämmerte sie mit ihren zierlichen Fäusten ein wahres Trommelfeuer gegen seinen breiten Brustkorb.
„Ein Mann müsste ich sein, ein richtiger Mann! Euch Waschlappen würde ich es zeigen.“
So unvermittelt sie ihn angegriffen hatte, so rasch ließ sie auch wieder von Jim Reed ab. Angriffslustig blickte sie in die Runde. „Hank hat einen Jeep! Niemand hindert mich daran, ihn mir zu nehmen. Damit werde ich hinauffahren!“
„Das lassen Sie schön bleiben!“, begehrte Edgar Watt auf. „Jetzt habe ich endgültig genug.“ Er deutete mit dem ausgestreckten Arm zum Teufelsauge hinüber. Die hoch quellenden Rauchwolken und Schwefeldämpfe rissen gar nicht mehr ab. Der Himmel war schon total verhangen. Obwohl helllichter Tag, schien die Dunkelheit hereinzubrechen.
Wenn sich jetzt Regen bildete, würde er den ganzen Dreck aus der Luft waschen und das Land damit übergießen. Der starke Westwind drückte gegen die Wolken und versuchte sie abzudrängen. Sie waren zu wuchtig und zu schwer und wurden immer mehr aufgefüllt.
Ein neuer Erdstoß beutelte das Land.
„Sie sehen doch, was passiert“, brüllte Edgar Watt. „Wollen Sie uns hier im Stich lassen? Wir brauchen den Jeep, sonst holt uns der Teufel!“
Cecile ging nicht darauf ein. Sie sprintete los, direkt auf den Jeep zu.
Hank Matthews zeigte sich unberührt von den Ereignissen. Stoisch murmelte er vor sich hin und rührte sich nicht von der Stelle. Irgendwo in dem rußigen Schutt lag die zermalmte Leiche seiner Freu. Nur das zählte für ihn.
Edgar setzte dem Mädchen nach und erwischt es gerade noch am Fahrzeug.
Cecile verwandelte sich in eine Furie. Sie kratzte und biss und schlug wie wahnsinnig um sich.
„Ihr verfluchten Schurken! Meinen Vater wollt ihr im Stich lassen! Lassen Sie mich los ... Sie...! Loslassen, sage ich!“
Mit vernünftigen Argumenten kam er ihr nicht bei eben sowenig wie Hank Matthews.
Der dritte Erdstoß riss sie fast von den Beinen. Fernes Donnergrollen ließ sie die Köpfe wenden. Eine glühende Aschewolke verließ den Feuerschlund und schwebte majestätisch und langsam auf die Stelle zu, an der Gelfi lag.
Diesmal war der Ausstoß geringer. Es war offensichtlich, dass wieder etwas die Auslassöffnung verschloss. Das war kein gutes Zeichen. Es würde ein furchtbarer Stau entstehen. Die Folgen waren unabsehbar. Im Extremfall würde die gesamte Insel Tobago von der Bildfläche verschwinden.
Edgar Watt wurde einen Augenblick abgelenkt. Cecile nutzte es aus und schlug ihm die Zähne in die Schulter, dass der Mann wütend aufschrie.
Jim Reed erreichte die beiden mit schnellen Schritten. Rücksichtslos riss er Cecile zurück und verpasste ihr zwei schallende Ohrfeigen. Alle Finger zeichneten sich auf den Wangen ab.
Aber die Maßnahme hatte Erfolg. Cecile wurde ruhig.
Ein dumpfes Brummen war in der Luft ein Dröhnen.
Es stellte sich als Motorengeräusch heraus. Ein Lastwagen schwankte heran. Mit kreischenden Bremsen hielt das Fahrzeug vor ihnen. Ein Mestize verließ das Führerhaus und starrte auf die Reste des Hauses.
„Verdammt, was ist denn hier los? Hank, um Gottes willen!“, fragte der Mann verstört.
Hank Matthews wandte sich unendlich langsam um. Sein Blick war seltsam verschleiert. „Ach, du bist es? Louise …“ Er machte eine kraftlose Handbewegung zu den Trümmern hin.
„Mein Gott, Hank, mein Gott!“ Der Mestize schien es nicht fassen zu können. „Ausgerechnet dieses Haus! Wir haben es gehört. Klang wie ein Einschlag.“ Der Mann schluckte.
„Was ist eigentlich los mit Ihnen?“, mischte sich Jim ein und fasste den Mestizen scharf ins Auge. „Wohin wollen Sie?“
„Nach dem Rechten sehen! Ich glaube, es ist besser, wir sammeln mit dem Lastwagen alle auf, die kein eigenes Beförderungsmittel haben. Ich lasse alles im Stich. Mein Leben ist mir lieber.“
„Lastwagen?“, merkte Cecile auf. Sie rannte zum großen Schuppen hinüber und zerrte das unverschlossene Tor auf. Triumphierend deutete sie auf den schweren Lastwagen, der dahinter zum Vorschein kam.
„Geht er?“, erkundigte sie sich bei Hank. Dieser nickte.
Cecile lief zum Jeep zurück. Der Mestize betrachtete sie verwundert.
Diesmal wurde Cecile nicht mehr aufgehalten. Sie ließ den Motor an und steuerte den Jeep auf den Ausgang des Hofes zu.
Auf halbem Wege stoppte sie und wandte den Kopf zurück.
„Wenn unter euch nur ein halbwegs männlicher Mann wäre, dann würde er mitkommen“, sagte sie. „Oben in Gelfi gibt es genug Leute, die keinen eigenen fahrbaren Untersatz besitzen. Ich denke nur an die Landarbeiter.“
„Und was wollen Sie dann mit dem Jeep ausrichten?“, rief Jim. „Nehmen Sie doch den Lastwagen!“
„Er ist zu schwer für mich. Sie kennen ja nicht den Weg.“
„Also gut, Sie haben mich überredet! Steigen Sie aus, wir fahren zusammen! Außerdem sind wir in dem großen Fahrzeug geschützter. Ich hoffe es jedenfalls“, knurrte Jim.
Der Mestize schüttelte den Kopf.
„Absolut verrückt!“, kommentierte er.
Edgar Watt dachte anders darüber.
„Ich bin auch mit von der Partie!“, meldete er sich zu Wort.
Seine Frau hielt ihn am Arm fest. „Nein!“, schrie sie. „Mein Gott, Edgar, du bleibst hier!“
„Du bist doch sonst nicht so zimperlich!“, tadelte Edgar Watt. Es wirkte, Susan ließ verblüfft los. „Geh zu Hanks Nachbar. Er wird dich hier herausbringen, gemeinsam mit Hank.“
Cecile hatte nicht lange überlegt. Sie war mit dem Vorschlag Jims einverstanden. Zu dritt kletterten sie in das wuchtige Führerhaus, das schon einiges vertragen konnte, wenn es darauf ankam. Die schwere Maschine bullerte regelrecht, als Jim sie startete. Er konnte zwar nicht behaupten, dass er auf einem solchen Gefährt groß geworden war, aber seine Kenntnisse mussten zur Not ausreichen. Er fuhr das Fahrzeug aus dem Schuppen, wobei er das Tor abriss.
„Fängt ja gut an“, kommentierte Cecile schnippisch.
„Sie sind unausstehlich“, parierte Jim.
„Und Sie werden die beiden Hiebe von vorhin noch bitter bereuen, Sie bärtiger Hundesohn!“, prophezeite sie. „Wir kommen darauf zurück, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Eine Cecile Johns vergisst so was nicht.“
Jim warf einen Seitenblick auf sie. Das Mädchen meinte es zweifelsohne bitterernst.
Jim Reed gab Gas.
Sie ließen den Mestizen zurück, und ein paar neugierig lugende Männer, die auf der Ladefläche von dessen Fahrzeug kauerten. Hank Matthews schaute ihnen stumpf nach, und Susan Watt heulte sich alles aus dem Leib, was sie im Moment empfand. Es verübelte ihr niemand.
Es sah tatsächlich so aus, als würden sich die drei Menschen auf direktem Wege in die Hölle begeben.
Der Berg war eine lodernde Fackel und wies ihnen die Richtung.
Plötzlich deutete Edgar Watt zum Himmel. Jim beugte sich vor, um es ebenfalls zu sehen. Cecile Johns, die sich zwischen sie geklemmt hatte, tat es ihm gleich.
Ein Flugzeug!
In Drei Teufels Namen, was wollen die da oben? Waren die denn noch bei Trost?
Die Maschine zog hoch und sprang über die Schwefelwolke hinweg, die sich wie ein fettes Untier aus der Urzeit ausbreitete. Dabei entschwand das Flugzeug dem Blickfeld der Beobachtenden.
„Was soll man dazu sagen?“, murmelte Edgar Watt.
„Todeskommando!“, fasste es Cecile Johns in einem Wort zusammen.
Und Jim meinte dazu: „Genau wie wir!“ Und damit traf auch er den Nagel auf den Kopf.
8
Die Polizei von Parlatuvier war nicht zu unterschätzen. Beim Anruf von Jonny, dass einer der gefährlichen Hunde von Collin Johns ausgerissen war, schöpften sie noch keinen Verdacht. Aber sie waren gerade auf dem Weg, sich der Sache anzunehmen. Da geschah es. Der Vulkan meldete sich seit einer Ewigkeit.
Die Polizisten zählten eins und eins zusammen und kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine größere Sache handeln musste, die sich anbahnte. Das zeigte schon das merkwürdige Verhalten der Tierwelt, für das Johns’ Hund ein gutes Beispiel war.
Sie zögerten keinen Augenblick und telefonierten mit dem Hauptquartier in Scarborough. Die Kollegen dort glaubten erst nicht, ihren Ohren trauen zu können, aber die Erdstöße, die jetzt schon bis zu ihnen durchdrangen, ließen sich nicht am Telefon wegdiskutieren. Sie versprachen rasche Hilfe.
Sie setzten sich mit dem Flughafen Crown Point in Verbindung und forderten eine Maschine an, die nach dem Rechten sehen sollte.
Diese Maschine war jener Vogel, den Jim Reed, Edgar Watt und Cecile Johns gesichtet hatten.
Deutlich war für die beiden Piloten zwei Jungs, die weder Tod noch Teufel fürchteten, die ferne Schwefelwolke zu sehen. Sofort meldeten sie das dem Tower, der die Sichtung weitergab nach Scarborough.
Die fielen dort aus allen Wolken. In aller Eile wurde ein Krisenstab ins Leben gerufen. Das Unmögliche war wahr geworden: Tobagos Wahrzeichen stand in Flammen, und den Ängstlichen der Inselbewohner erschien es fast so, als habe der Teufel ein Ventil geöffnet, um die Insel zum Sinken zu bringen.
Diese Vorstellung war natürlich kindisch, obzwar sie der Wahrheit zumindest im bildlichen Sinne recht nahe kam.
Mit Vollgas jagten Mike Freedom und David Miller, so hießen die beiden Piloten, der Stelle des Unheils entgegen. Sie waren mutig, aber nicht todesmutig, und ließen Vorsicht walten. Im weiten Bogen umrundeten sie die Wolke, als diese erreicht war. Es gab teuflische Turbulenzen, dass die Tragflächen ins Flattern kamen und der Kasten jeden Augenblick zu bersten drohte. Manchmal sah es so aus, als stünde die Maschine unbeweglich in der Luft und versuchte vergeblich vorwärtszukommen.
„Sieht böse aus!“, kommentierte David Miller.
Mike Freedom antwortete nicht sofort. Er ließ das Flugzeug zur Seite driften.
„Auf jeden Fall möchte ich nicht da unten sein“, gab er endlich zu.
„Schauen wir der Hölle einmal in den Schlund?“, erkundigte sich Miller fast fröhlich.
Mike gönnte ihm einen entgeisterten Blick.
„Werde nicht übermütig, mein Guter. Du siehst, dass der stetige Passatwind aus Westen versagt. Er schafft die Wolke nicht. Unterschätzen wir nicht die Luftströmungen hier oben.“
„Tu ich nicht. Mir ist klar, warum die Schwefelwolke nicht abgedrängt wird. Der Wind strömt landwärts und wird von der Hitze des Vulkans regelrecht angesaugt. Dabei entsteht ein erheblicher Aufwind am Kegel, der den Dreck mitreißt und jenes Pilzdach entstehen lässt. Die Turbulenzen leiten den nachströmenden Wind an den Wolkenkanten nach unten ab.“
„Bin froh, dass du das begriffen hast.“
„Es zeigt jedoch auch, dass man relativ gefahrlos über den Krater selbst fliegen kann, falls man so schlau ist und genügend Höhe einhält.“
„All right, bin überredet. Sind wir einmal so schlau.“
Er zog die Maschine hoch und überwand den äußersten Rand. Für einen Atemzug lang sah es so aus, als beutele es sie. Gottlob fingen sie sich wieder und kletterten höher und höher.
Von ganz oben bot das Geschehen ein faszinierendes Schauspiel. Inmitten einer weiten, wallenden Fläche, die aus Schlamm zu bestehen schien, durchzogen mit farbigen Streifen, die langsam zerflossen, befand sich das glühende Auge, das einem Devil’s Eye tatsächlich nicht unähnlich sah.
Ein Wunder, dass der Indio zu dieser Bezeichnung gekommen war, obwohl er noch nie in seinem Leben ein Flugzeug von innen gesehen hatte, geschweige denn einen tätigen Vulkan von oben.
Den Aufwind hatten die beiden Piloten erheblich unterschätzt. Das zeigte sich nur zu bald. Obwohl sie auf zehntausend Fuß gegangen waren, traf sie an der Unterseite ein Gluthauch. Ihnen wurde wärmer, und das nicht allein nur deshalb, weil sich tatsächlich die Außenhaut der Maschine erhitzte. Es wurde ihnen recht mulmig in der kleinen Mühle. Es ist alles andere als ein Vergnügen, ein Spielball der Gewalten zu sein und dabei über dem glutheißen Inhalt eines Vulkankraters herum gebeutelt zu werden.
Eines erstaunte die beiden Piloten. Sie flogen diese Route nicht zum ersten Mal und erinnerten sich, dass der Kegel ursprünglich einen schmalen Durchlass hatte. Dieser Durchlass war jetzt verschwunden. Er hatte sich aus ungeklärten Gründen geschlossen oder verstopft. Kein Tropfen Magma gelangte ins Freie. Das war ungewöhnlich und barg mitunter eine weitere Gefahr in sich. Der Krater würde sich möglicherweise mehr und mehr mit seinem brodelnden Inhalt füllen. Bis es irgendwo keinen Widerstand mehr gab. Mit einmal würde sich die gesamte Lava als glutende Flut über das Land ergießen. Die Menge würde ausreichen, sogar bis zum Meer zu gelangen, oder vielleicht bis Scarborough, obwohl das fast zehn Meilen Luftlinie waren.
Daran mochten die beiden Männer besser nicht denken.
Ein weiterer Umstand kam ihres Erachtens hinzu, obgleich sie keine Experten waren. Der momentan ausbleibende Ausstoß von Asche war das beste Zeichen dafür, dass sich der Feuerschlund verstopfte. Es konnte nur bedeuten, dass der Vulkan zu einem vernichtenden Schlag ausholte. Er würde regelrecht explodieren. Die Katastrophe, die dabei geschah, war unüberschaubar. Von der Insel Tobago würde möglicherweise nicht sehr viel übrigbleiben.
Der Motor spuckte. Es wurde Zeit, dass sie die Gefahrenzone verließen. Die Luft, die ihnen Auftrieb gab, war stark erhitzt und dadurch sauerstoffarm. Das bedeutete, dass der Motor nicht genügend Nachschub bekam. Schlimmstenfalls gab er seinen Geist ganz auf.
Die beiden sonst unerschrockenen Piloten sahen sich schon in dem großen Teich aus rotem Glutfluss landen. Kein angenehmes Gefühl. Auf einmal wurde ihnen trotz der Hitze eiskalt. Die dicken Schweißperlen auf ihrer Stirn schienen zu gefrieren.
Sie mühten sich verzweifelt, die Mühle wieder unter ihre Herrschaft zu bekommen. Sie bockte wie ein Wildpferd und schüttelte sich wie ein nasser Hund. Kein reines Vergnügen. Speiübel war es den gewieften und erprobten Fliegern.
Sie schafften es endlich und mit knapper Not. Ein Gluthauch packte sie. Wie ein welkes Blatt segelten sie aus den größten Turbulenzen hinaus und bewegten sich auf den Rand des giftigen Feldes zu.
„Nie wieder!“, gelobte Mike Freedom.
Das war eine glatte Lüge, denn erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt.
Die beiden Männer brachten die Maschine auf Kurs Heimatflughafen. Dazu war es höchste Zeit. Sie hatten bei ihrem unverantwortlichen Manöver eine Menge Sprit verloren. Beeilten sie sich nicht, ging es ihnen an den Kragen, getreu dem Grundsatz: Runter kommt man immer!
Sie waren gespannt, was die Experten zu ihren Beobachtungen sagen würden. Wie sie über Funk erfuhren, waren ein paar Fachleute bereits auf dem Wege. Sie würden mit ihrem Jet nicht zuerst in Trinidad landen, wie das üblich war, sondern direkt Crown Point anfliegen. Die Landebahn war zwar reichlich kurz, aber man hatte dem Rechnung getragen und eine Maschine ausgesucht, deren Landegeschwindigkeit nicht sehr hoch war.
„Wie die Sache aussieht, werden die sich mit theoretischen Dingen beschäftigen. Das Unheil selber kann niemand abwenden. Es bleibt nur, dafür zu sorgen, dass endlich die vielen Menschen da unten aus der Gefahrenzone kommen.“ Das war die Meinung von David Miller zu der Sache.
Und sein Kumpel Mike Freedom meinte: „Wie willst du das anstellen? Ist keine Kleinigkeit, eine solche Insel zu evakuieren. Denke daran, wie wenig Zeit zur Verfügung steht.“
Ein Blick zurück ließ sie erkennen, dass sich wieder einmal ein Pfropfen gelöst hatte. Der Stein war groß wie ein Hochhaus, bröckelte jedoch im Flug auseinander und segelte schnurgerade auf Parlatuvier zu.
Anfangs wurde er von einer gewaltigen Dampf- und Schwefelwolke begleitet. Sie verpuffte schließlich. Dass nicht sofort neuer Nachschub folgte, deutete darauf hin, dass der Ausgang aus der Hölle sofort wieder größtenteils verstopft war.
Der Kessel kochte vor sich hin. Und immer häufiger drang ein dumpfes Grollen aus der Erde.
9
Hank Matthews brauchte nicht zuerst seine Habe zusammenzuraffen. Er hatte keine mehr! Der Mestize, Robert Tepton hieß er, holte ihn und Susan Watt zu sich ins Führerhaus. Zu dritt fanden sie gut Platz darin. Der Laster war größer als der, mit dem Jim Reed, Cecile Johns und Edgar Watt unterwegs waren.
Das schwere Gefährt brauste aus dem Hof und ließ die rauchenden Trümmer zurück.
Auch sie gewahrten die über ihren Köpfen kreisende Maschine, schenkten dieser jedoch weiter keine Beachtung. Sie hatten eigene Probleme, die es zu bewältigen galt.
Die gesamte Stadt befand sich in Aufruhr. Überall trafen sie auf Flüchtende. Das führte dazu, dass die Straßen sich verstopften.
Es gab jedoch auch Unentwegte, die einfach nicht wahrhaben wollten, wie groß die Gefahr war, in der sie schwebten.
Andere wiederum besaßen keinen fahrbaren Untersatz. Es waren die weitaus meisten, denn hier war es üblich, seine Geschäfte entweder zu Fuß oder schlicht mit dem Fahrrad zu tätigen. Einige der Unglücklichen nahm der Mestize kurzerhand mit auf die Ladefläche. Bis das einfach nicht mehr ging.
Sie mussten halten, denn vorn gab es einen Stau. Ein paar Fahrer begannen zu hupen und veranstalteten ein entsetzliches Konzert. Robert Tepton öffnete die Tür und stellte sich auf das Trittbrett, um besser sehen zu können.
„Schöne Bescherung!“, schimpfte er. „Da vorn steht ein Bus quer zur Fahrbahn. Die Achse scheint gebrochen zu sein. Kein Wunder, denn er ist noch immer total überladen, wie Trauben hängen sie daran. Keiner will seinen mühsam erkämpften Platz aufgeben. Wenn denen eine Achse bricht, soll das schon was heißen. Ihr kennt inzwischen wahrscheinlich die Landstraßen. Hier draußen sind das bessere Feldwege. Entsprechend robust sind die Fahrzeuge gebaut. Es hat den Bus ganz schön gebeutelt. Wie ich sehe, rutschte er mit dem Heck gegen ein Haus. Kein schöner Anblick!“
Er verzichtete auf eine Fortführung seines Berichtes. Die anderen waren im Bilde. Details von dem Chaos waren nicht notwendig.
Zurück konnten sie auch nicht mehr. Sie waren eingekeilt, denn auch von hinten drängten Flüchtlinge nach.
Lieber Gott, dachte der Mestize, ich hätte nie geahnt, dass die Kleinstadt Parlatuvier so viele Menschen zählt!
Nervös hämmerte Robert Tepton auf dem Lenkrad herum. Susan Watt neben ihm weinte still vor sich hin. Es zerrte mehr an seinen Nerven als der Verkehrsstau, doch wollte er nichts zu ihr sagen.
Die Vibrationen des Bodens schwollen an und verebbten wieder. Es erschien dem Mestizen so, als wären die Erdstöße jedes Mal stärker. Bereitete sich wieder etwas vor?
Er irrte sich nicht.
Der nächste Stoß verlief offenbar strahlenförmig. Er war nicht an allen Stellen in gleicher Stärke zu spüren. Wenige Schritte vor Teptons Laster platzte mit einem lauten Bersten der Straßenbelag. Es knirschte und knisterte, ein Riss entstand.
Unglücklicherweise drängten sich dort ein paar Fußgänger. Sie waren von den anderen Wagen gesprungen und arbeiteten sich vorwärts, vielleicht, um vorn bei den Aufräumungsarbeiten zu helfen.
Der Riss entstand direkt unter ihren Beinen. Giftige Wolken quollen hervor. Schreiend versuchten die Unglücklichen auszuweichen, doch dazu fehlte einfach der Platz.
Der erste wurde von der nachdrängenden Masse in den Erdspalt gestoßen. Sein Brüllen ging durch Mark und Bein. Drei, vier Menschen stürzten noch in den Riss.
Dann schloss sich der Spalt wieder ein Stück. Die Schreie verstummten.
Robert Tepton war es, als würde er Blut empor spritzen sehen. Sofort wandte er sich ab.
Seine Gefühle hatten keine Zeit, sich wieder ein wenig zu beruhigen.
Eine gewaltige Detonation wurde hörbar. War sie die direkte Folge des Bebens?
Unwillkürlich schauten die Menschen zum dicht verhangenen Himmel.
Sie wussten nicht, was zwei Piloten hoch in der Luft in diesem Moment sahen, dass sich nämlich ein zweiter Pfropfen löste, in der Luft teilte und auf die Stadt zuraste.
Alles ging viel zu schnell, als dass sie hier unten das Unheil hätten klar erkennen können.
Ein Heulen, Wummern und Brausen war plötzlich in der Luft, das fast die Trommelfelle zum Platzen brachte.
Dann schlugen die Trümmer ein.
Eines der Stücke traf die Ladefläche von Robert Teptons Laster.
Der Schlag war so mächtig, dass die Fläche bis zum Boden sackte.
Die drei im Führerhaus wurden zwar nicht getroffen, aber durch die indirekten Auswirkungen nach vorn geschleudert. Die Scheibe flog aus dem Rahmen, und sie holten sich blutige Köpfe, Beulen und angestauchte Nasen.
Den Leuten auf der Ladefläche hinten erging es schlechter.
Die Urgewalt zermalmte sie. Nur die Gruppe, die sich direkt hinter dem Führerhaus befand, blieb am Leben: Aber zu welchem Preis!
Einem wurde der Arm abgetrennt. Ein anderer verlor die Füße. Alle aber wurden sie erst gegen das Führerhaus geschleudert, als der Laster hinten in die Knie ging, und fielen dann genau in die feurige Glut, die Funken nach allen Seiten stieben ließ.
Ein kräftiger Schwarzer, der unverletzt geblieben war, fand Halt am Führerhaus und klammerte sich verzweifelt daran fest. Die Hitze strahlte ihn von hinten an. Seine Füße rutschten ab und gerieten in die auseinander gebrochene Asche.
Robert Tepton sah den Schwarzen durch das Rückfenster des Führerhauses — zumindest sein total verzerrtes Gesicht. Der Mund war weit geöffnet, um unmenschliche Laute zu produzieren, die allerdings in dem allgemeinen Tumult völlig untergingen.
Dann konnte sich der Schwarze nicht länger festhalten. Er fiel zurück. Sofort fingen seine Kleider Feuer. Er versuchte, sich aufzurichten und zu fliehen.
Es war der letzte Versuch in seinem Leben.
„Raus hier!“, brüllte Robert Tepton durch den Tumult. Er fasste Susans Arm und zerrte sie einfach mit sich.