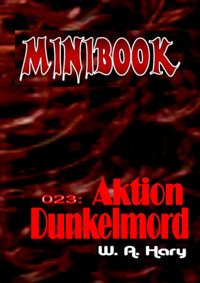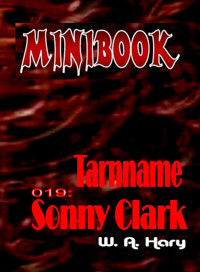10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane:
(1099)
Alfred Bekker: Moronthor und der Affengott
W.A.Hary: Moronthor und die Schädelberg
W.A.Hary: Moronthor - Gefangen im Horror-Haus
W.A.Hary: Moronthor und der Hexenhenker
W.A.Hary: Moronthor und die Truhe des Schreckens
W.A.Hary: Moronthor und der Held von Zartas
Alfred Bekker: Moronthor - Jungdrache und Dämon
Alfred Bekker: Ich darf mich nicht verwandeln
Lloyd Cooper: Moronthor und die Schrecken der Botany Bay
James Melvoin: Moronthor im Reich der großen Schlange
Lloyd Cooper: Moronthor und die Gefangene der Zeit
Lloyd Cooper: Moronthor und das ewig Böse
James Melvoin: Moronthor und Halias Höllenreiter
James Melvoin: Moronthor und die Haut des Vampirs
Lloyd Cooper: Moronthor und die Teufelsnächte
Moronthor lebt auf Schloss Aranaque. Er hat sich dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis verschrieben - und die wichtigste Waffe gegen die dunkle Magie ist das Wissen. Moronthor ist ein Gelehrter, aber um die Finsternis zu bekämpfen, muss er magische Waffen einsetzen und seinen Kampf sowohl in dieser als auch in anderen Welten führen. Ihm zur Seite steht seine Assistentin Nicandra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die große Moronthor Saga: 1500 Seiten Fantasy
Inhaltsverzeichnis
Die große Moronthor Saga: 1500 Seiten Fantasy
Copyright
Moronthor Urban Fantasy Serie
Moronthor und der Affengott
Moronthor und der Schädelberg
Moronthor - Gefangen im Horror-Haus
Moronthor und der Hexenhenker
Moronthor und die Truhe des Schreckens
Moronthor und der Held von Zartas
Moronthor: Jungdrache und Dämon
Ich darf mich nicht verwandeln
Moronthor und die Schrecken der Botany Bay
Moronthor im Reich der großen Schlange
Moronthor und die Gefangene der Zeit
Moronthor und das ewig Böse
Moronthor und Halias Höllenreiter
Moronthor und die Haut des Vampirs
Moronthor und die Teufelsnächte
Die große Moronthor Saga: 1500 Seiten Fantasy
Alfred Bekker, W.A.Hary, James Melvoin, Lloyd Cooper
Dieser Band enthält folgende Romane:
(1099)
Alfred Bekker: Moronthor und der Affengott
W.A.Hary: Moronthor und die Schädelberg
W.A.Hary: Moronthor - Gefangen im Horror-Haus
W.A.Hary: Moronthor und der Hexenhenker
W.A.Hary: Moronthor und die Truhe des Schreckens
W.A.Hary: Moronthor und der Held von Zartas
Alfred Bekker: Moronthor - Jungdrache und Dämon
Alfred Bekker: Ich darf mich nicht verwandeln
Lloyd Cooper: Moronthor und die Schrecken der Botany Bay
James Melvoin: Moronthor im Reich der großen Schlange
Lloyd Cooper: Moronthor und die Gefangene der Zeit
Lloyd Cooper: Moronthor und das ewig Böse
James Melvoin: Moronthor und Halias Höllenreiter
James Melvoin: Moronthor und die Haut des Vampirs
Lloyd Cooper: Moronthor und die Teufelsnächte
Moronthor lebt auf Schloss Aranaque. Er hat sich dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis verschrieben - und die wichtigste Waffe gegen die dunkle Magie ist das Wissen. Moronthor ist ein Gelehrter, aber um die Finsternis zu bekämpfen, muss er magische Waffen einsetzen und seinen Kampf sowohl in dieser als auch in anderen Welten führen. Ihm zur Seite steht seine Assistentin Nicandra.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Moronthor Urban Fantasy Serie
Moronthor lebt auf Schloss Aranaque. Er hat sich dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis verschrieben - und die wichtigste Waffe gegen die dunkle Magie ist das Wissen. Moronthor ist ein Gelehrter, aber um die Finsternis zu bekämpfen, muss er magische Waffen einsetzen und seinen Kampf sowohl in dieser als auch in anderen Welten führen. Ihm zur Seite steht seine Assistentin Nicandra.
Erfahre mehr!
Moronthor und der Affengott
von Alfred Bekker
Moronthor lebt auf Schloss Aranaque. Er hat sich dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis verschrieben - und die wichtigste Waffe gegen die dunkle Magie ist das Wissen. Moronthor ist ein Gelehrter, aber um die Finsternis zu bekämpfen, muss er magische Waffen einsetzen und seinen Kampf sowohl in dieser als auch in anderen Welten führen. Ihm zur Seite steht seine Assistentin Nicandra.
*
Fahles Mondlicht fiel auf das graue Gemäuer des uralten und halb verwitterten Herrenhauses. Ein leichter Wind strich über das hohe Gras und die verwilderten Sträucher im Garten. Für Augenblicke hoben sich dunkle Schwingen pechschwarz gegen das Mondlicht ab. Schwingen, die an die lederigen Flügel einer Fledermaus erinnerten.
Aber das Wesen, das im nächsten Moment im hohen Gras landete, war sehr viel größer.
Ein geflügelter Affe kauerte zwischen Sträuchern und bleckte die raubtierhaften Zähne.
In pechschwarzen Augen spiegelten sich der Mond, die Sterne…
... und der Tod.
*
Pierre de Bressac erbleichte. Er starrte auf den Bildschirm seines Computers und musste unwillkürlich schlucken. Kolonnen von fremdartig wirkenden Schriftzeichen waren dort zu sehen. Ich bin verloren!, durchzuckte es de Bressac. Es gibt nichts, was mich jetzt noch schützen könnte…
Es war zu spät.
De Bressac wusste es.
Mein Tod ist nur noch eine Frage der Zeit!, ging es ihm schaudernd durch den Kopf, während ein heftiger Windstoß dafür sorgte, dass sich das bis dahin nur angelehnte Fenster ganz öffnete. Der Wind fegte die Stapel von Papieren und Computerausdrucken durcheinander, die überall in de Bressacs Arbeitszimmer herumlagen. Ein Stapel Bücher, die über und über mit Lesezeichen gespickt waren, stürzte geräuschvoll um.
Ein stöhnender Laut war daraufhin zu hören, und ein pechschwarzer Kater sprang davon.
»Schon gut, Cesar«, sagte de Bressac laut. »Das war der Wind, mein Kater… nur der Wind…«
Wie gerne hätte er selbst das glauben wollen!
Aber de Bressac wusste nur zu gut um die schreckliche Wahrheit. Die Mächte, mit denen er sich eingelassen hatte, waren zu stark, zu furchtbar, zu grausam…
Aber jetzt konnte er nicht mehr zurück.
Für mich gibt es nur noch den Weg der Verdammnis, ging es ihm durch den Kopf.
Pierre de Bressac ging zum Fenster, um es zu schließen. Der Wind, der mit erneut zunehmender Heftigkeit von draußen hereinblies, war von einer so durchdringenden Kälte, dass de Bressac unwillkürlich fröstelte.
Aber nicht diese Kälte war es, die ihn im nächsten Augenblick bis ins Mark erschauern ließ, sondern eine Bewegung im hohen Gras.
Da war etwas…
Für einen kurzen Moment fielen ihm glühend rot leuchtende Punkte in der Dunkelheit auf.
De Bressac brauchte eine volle Sekunde, um zu begreifen, dass es Augen waren.
Dämonisch wirkende Augen, so hell wie glühende Kohlen. Ein tierischer, fauchender Laut mischte sich in das Aufheulen des Windes hinein.
Sie sind da!, durchzuckte es de Bressac. Die Lemuren der verlorenen Stadt Sarangkôr… Sie sind gekommen, um mich zu vernichten.
Als de Bressac das Fenster schloss, verfinsterte sich jäh der fahle Mond. Zuerst Dutzende, dann Hunderte von geflügelten Wesen hoben sich als dunkle Schatten gegen das leuchtende Oval ab. Ungezählte weitere geflügelte Schatten ließen sich in den Schattenzonen daneben nur erahnen.
»Nein«, flüsterte de Bressac und wich unwillkürlich ein Stück zurück.
Der schwarze Kater verzog sich ängstlich miauend unter einen über und über mit staubigen Büchern bepackten Plüschsessel. Das Tier schien die Gefahr instinktiv zu spüren, die von den geflügelten Affen ausging, die nun massenhaft das alte Herrenhaus belagerten.
Tierhafte Schreie drangen von draußen herein. Krächzende und fauchende Laute, die jedem Zuhörer das Blut in den Adern gefrieren lassen konnten.
Etwas flog auf das Fenster zu. Der Schlag lederiger Schwingen war kurz zu hören, dann prallte der Körper eines Lemuren gegen das Fenster.
Das Wesen war etwa so groß wie ein Schäferhund. Mit seinen siebenfingrigen, mit Krallen bewehrten Händen hielt es sich am Fensterrahmen fest. Die Krallen schnitten offenbar in den Kitt der Scheiben und in das weiche Holz des Rahmens hinein.
Das mit grauenerregenden Raubtierzähnen ausgestattete Maul wurde aufgerissen und stieß einen furchtbaren Schrei aus.
Mit dem sehr kräftigen Schwanz schlug der geflügelte Affe gegen das Glas.
So heftig, dass es splitterte.
Wind toste herein. Mit ein paar weiteren Schwanzschlägen war die Scheibe so weit zerschlagen, dass das alptraumhafte Wesen ins Innere zu gelangen vermochte.
Es machte einen Satz und landete mit einer geradezu katzenhaften Geschmeidigkeit auf dem Boden.
Pierre de Bressac erwachte unterdessen aus der Erstarrung, die ihn bis dahin befallen hatte. Er lief zu seinem Schreibtisch, riss eine Schublade auf und holte einen Revolver hervor. Es handelte sich um eine kurzläufige Waffe der Firma Smith & Wesson vom Kaliber 38. Pierre de Bressac besaß sie seit Jahren zur Selbstverteidigung, hatte allerdings keine besonders große Übung in der Benutzung der Waffe.
Immerhin wusste er, dass sie geladen war.
Er nahm die Waffe mit beiden Händen und richtete sie auf den geflügelten Affen.
De Bressac schoss!
Aber die Kugel ging daneben.
Das Projektil schlug im Parkettboden ein und ließ Holzstückchen heraussplittern.
Dort, wo gerade noch das dämonische Wesen gelauert hatte, war nichts mehr. Der geflügelte Affe hatte blitzschnell einen Sprung vollführt. Jetzt kroch er unter dem Sessel hervor, unter den sich kurz zuvor der Kater geflüchtet hatte.
Doch Cesars Schicksal war nun besiegelt.
Rot tropfte es aus dem Maul des lemurenhaften Wesens.
Blutdurchtränkte Stücke des Katzenfells hatten sich in den Krallen der prankenartigen Hände verfangen.
Das Wesen fauchte de Bressac angriff slustig entgegen. Das dämonische Leuchten seiner Augen wurde noch intensiver.
Ein zweiter geflügelter Affe landete am Fenster, krallte sich am Rahmen fest und sprang anschließend ins Innere des Hauses.
De Bressac feuerte.
Die Kugel traf diesen Neuankömmling mitten in den Körper. Dabei war die Wucht des Geschosses so groß, dass das Wesen einmal um die eigene Achse geschleudert wurde. Es jaulte auf wie ein verwundeter Wolf.
Das Wesen landete auf dem Rücken, rollte sich herum und stand im nächsten Moment wieder auf seinen vier jeweils mit siebenfingrigen Krallenhänden ausgestatteten Extremitäten.
Die Wunde am Bauch war für einen kurzen Moment zu sehen. Blut tropfte aus ihr heraus und sickerte auf den Boden. Der Teppich sog es förmlich auf.
Es ist grünes Blut!, erkannte Pierre de Bressac schaudernd.
Aber war das nicht auch zu erwarten gewesen? Schließlich hatte Pierre de Bressac nahezu alles zusammengetragen, was es an verfügbarem Wissen über die sogenannten Lemuren der verlorenen Stadt Sarangkôr zu wissen gab.
Das Wesen näherte sich ihm, hob dabei den Schwanz, an dessen Ende sich eine Verdickung befand, aus der jetzt ein gutes Dutzend Stacheln herauswuchsen. Das Ganze ähnelte einem mittelalterlichen Morgenstern.
Der Kopf war geduckt.
Das dämonische Leuchten in den Augen wurde abwechselnd stärker und schwächer.
Es pulsierte.
Der andere Lemure näherte sich ebenfalls auf diese Weise.
Am Fenster erschienen kurz nacheinander ein drittes und ein viertes geflügeltes Wesen dieser Art. Nach kurzer Landung am Fenster sprangen sie ins Innere des Arbeitszimmers herein.
Schweißperlen glänzten auf Pierre de Bressacs Stirn.
Er feuerte immer und immer wieder auf die angreifenden Wesen, obwohl er wusste, dass deren Wunden sich nach wenigen Augenblicken wieder schließen würden. Es war einfach ein Akt purer Verzweiflung.
Der letzte Schuss feuerte aus dem 38er Smith & Wesson heraus.
Dann machte es »klick«.
Die Revolvertrommel war leer geschossen, während sich mehrere der geflügelten Affen jaulend auf dem Boden wanden.
Doch nun gab es nichts mehr, was diese Monstren auch nur einen einzigen weiteren Augenblick aufzuhalten vermochte.
Mit gefletschten Zähnen sprang die erste dieser Dämonenkreaturen auf de Bressac zu. Dieser hob schützend die Hände. Die Wucht, mit der ihn der geflügelte Affe angesprungen hatte, riss de Bressac zu Boden. Er schrie und schlug um sich. Die Reißzähne des Lemuren schlugen in seinen Hals. Das Blut spritzte auf. Wie eine Meute hungriger Wölfe stürzten sich nun die anderen Lemuren auf den bereits schrecklich entstellten Körper Pierre de Bressacs.
***
Professor Moronthor, der Meister des Übersinnlichen, saß in seinem im Nordturm des Chateâu Aranaque gelegenen Arbeitszimmer und starrte angestrengt auf den Schirm seines Computers. Dort waren Ablichtungen von uralten Inschriften aus der Hoch-Zeit des versunkenen Khmer-Reiches zu sehen, das vor gut einem Jahrtausend Südostasien beherrscht hatte. Ausgehend von der im Jahr 889 gegründeten Hauptstadt Angkor hatte sich eine der erstaunlichsten und rätselhaftesten Hochkulturen entfaltet, die die Welt je gesehen hatte.
Im Jahr 1431 wurde Angkor von den Thai erobert und zerstört; die Khmer verlegten den Regierungssitz nach Phnom Penh. Ihre steinernen, halb vom Dschungel überwucherten Steinmonumente überdauerten die Zeitalter und lockten seit ihrer Wiederentdeckung im neunzehnten Jahrhundert und Freilegung um 1907 Legionen von Forschern und Touristen in den Dschungel Kambodschas.
Moronthor selbst war auch schon dort gewesen. Gut 22 Jahre lag das jetzt zurück, wie er sich erinnerte. Damals war Angkor noch teilweise gesperrt gewesen, niemand durfte den »verbotenen Tempel« Angkor Wat betreten, der im 12. Jahrhundert errichtet worden war. Moronthor war es dennoch gelungen, diese Sperren unbemerkt zu durchdringen und Angkor Wat zu betreten.
Heute war das alles wesentlich einfacher. Angkor konnte ganz normal betreten werden. Es gab keine Absperrungen mehr. Doch immer noch haftete der Nimbus des Verbotenen an der uralten Tempelanlage.
Damals ging es darum, seltsame Vorfälle im Zuge des massiven Auftauchens der DYNASTIE DER EWIGEN aufzuklären. Zum ersten Mal hatten ihre Agenten sich offiziell zu erkennen gegeben, während das gigantische Sternenschiff der Ewigen im Sonnensystem auftauchte, um die Erde zu bedrohen. Damals zeigte sich auch, dass der ERHABENE selbst an vorderster Front aktiv war; unter dem Namen Erik Skribent war er zum Topmanager des weltweit operierenden Möbius-Konzerns aufgestiegen. Seine Entlarvung war aber zugleich auch sein Ende. Auch Ewige lebten nicht ewig…
Moronthors momentanes Interesse an den Inschriften und Legenden der alten Khmer hatte einen anderen handfesten Grund und entsprang keineswegs nur einem allgemeinen Interesse an alten Kulturen. Schon seit einiger Zeit waren ihm Meldungen über ausgesprochen grausige Todesfälle aufgefallen. Die Opfer waren regelrecht zerfleischt worden, so dass die Polizei den Verdacht aufgeworfen hatte, dass nicht Menschen als die eigentlichen Täter infrage kamen, sondern Tiere.
Abgerichtete Kampfhunde, so hatte der erste Verdacht geheißen. Aber das hatte sich mit der sonstigen Spurenlage wohl nicht so recht in Einklang bringen lassen.
Professor Moronthor hatte von Anfang an den Verdacht, es mit dem Einfluss dämonischer Kräfte zu tun zu haben. Einen handfesten Beweis dafür hatte er aber bislang nicht bekommen.
Auffällig war von Anfang an, dass sämtliche Opfer dieser grausigen Mordserie ehemalige Teilnehmer an einer archäologischen Expedition in den Dschungel Kambodschas gewesen waren, die der verlorenen Stadt Sarangkôr gegolten hatte. Düstere Legenden rankten sich um diesen Ort, dessen Ruinen angeblich noch irgendwo in den unwegsamen Wäldern Kambodschas zu finden waren. Ein Mythos, der von den meisten Archäologen nicht sonderlich ernst genommen wurde.
Jetzt war Professor Dr. Dr. Pierre de Bressac, der Leiter der letzten Expedition, die sich auf die Suche nach Sarangkôr gemacht hatte, in seinem Herrenhaus in der Camargue eines ebenso grausamen Todes gestorben wie zuvor schon einige jener Männer und Frauen, die ihn anderthalb Jahre zuvor in die Tiefe des kambodschanischen Dschungels begleitet hatten.
Seinem untrüglichen Instinkt folgend hatte sich Moronthor daran gemacht, sämtliches über das Internet verfügbare Material zu den Forschungen Pierre de Bressacs zu sichten, denn er war überzeugt davon, dass der Tod des Wissenschaftlers in irgendeiner Form damit in Zusammenhang stehen musste.
Dabei war er auf einige interessante Zusammenhänge gestoßen. So hatte de Bressac eine Monografie von Inschriften veröffentlicht, die von Reliefs bisher unbekannter Ruinen stammten, die nördlich der berühmten Ruinenstädte von Angkor Wat und Angkor Thom gefunden worden waren.
Der Sinn dieser Inschriften war nach wie vor nicht zur Gänze erschlossen, auch wenn de Bressac ein erstklassiger Kenner der Khmer-Sprache sowohl in ihrer modernen als auch in ihrer klassischen Form war.
Es ging um die Legende von der verlorenen Stadt Sarangkôr, die unter die Herrschaft von Heng Son geriet, dem dunklen Bruder des Affengottes Hanuman.
Für Moronthor war dabei ein Umstand von besonderem Interesse.
Einige der Schriftzeichen, die offenbar schon de Bressac einiges an Kopfzerbrechen bereitet hatten und bei denen es dem Wissenschaftler letztlich nicht gelungen war, sie hinreichend zu interpretieren, entsprachen jenen Hieroglyphen, die auf Moronthors handtellergroßem Amulett zu finden waren - Merlins Stern, seiner wichtigsten Waffe im Kampf gegen die Geschöpfe der Finsternis. Einst hatte der Magier Merlin dieses Amulett aus der Kraft einer entarteten Sonne gewonnen. Jetzt benutzte es Professor Moronthor in seinem Kampf gegen die Mächte des Bösen.
Dass dieses Amulett hin und wieder etwas eigenwillig reagierte und er sich insbesondere in letzter Zeit wiederholt nicht auf dieses magische Werkzeug hatte verlassen können, stand auf einem anderen Blatt.
Dennoch blieb Merlins Stern Moronthors wichtigste Waffe, das bedeutendste Artefakt, das er gegen schwarzmagische Bedrohungen aus der Welt des Übersinnlichen einsetzen konnte.
Die volle Funktionsweise war ihm trotz intensiver Studien dabei nach wie vor nicht wirklich klar. Er kannte nur einen Bruchteil der Funktionen, die durch ein Verschieben der Hieroglyphen ausgelöst werden konnten. Daran hatte auch das zusätzliche Wissen, das ihm durch das verhängnisvolle »Buch der 13 Siegel« vermittelt worden war, nicht wirklich sehr viel geändert.
Und manchmal wurde das Amulett aus unerfindlichen und nicht immer nachvollziehbaren Gründen auch ganz von selbst aktiv…
Und nun das…
Hieroglyphen von Merlins Stern in einer Inschrift, die ein unter mysteriösen Umständen verstorbener Wissenschaftler in einer bisher unbekannten Ruine im kambodschanischen Dschungel abfotografiert hatte.
»Seit drei Tagen scheint dich nichts anderes mehr zu interessieren als der Tod dieses Pierre de Bressac«, stellte eine helle weibliche Stimme fest. Sie gehörte Moronthors Lebensgefährtin Nicandra Darrell. Moronthor war dermaßen in seine Arbeit vertieft gewesen, dass er gar nicht mitbekommen hatte, wie die junge Französin den Raum betreten hatte.
Wie oft war sie vollkommen nackt.
Diese, wie Moronthor fand, angenehme Angewohnheit hatte sie zwar in den letzten Jahren weitgehend zurückgenommen, speziell wegen des im Château heranwachsenden Sir Rhett, der inzwischen 14 Jahre alt war, aber zuweilen packte es sie doch wieder.
Moronthor blickte nur kurz an ihrem wohlgeformten Körper herab und deutete dann auf den Schirm. »Schau dir das an«, bat er. »Ich habe eine Formanalyse mit Hilfe des Computers durchgeführt. Bei drei der Zeichen liegt die Übereinstimmung zu den Hieroglyphen meines Amuletts bei hundert Prozent, bei zwei weiteren Zeichen besteht eine Kongruenz von zumindest siebzig bis achtzig Prozent, was auch kein Zufall sein kann.«
Nicandra atmete tief durch. Ihre Brüste hoben und senkten sich dabei. Sie lehnte sich gegen Moronthors Schulter. »Was ist das für eine Sprache, in der dieser Text verfasst ist, in den die Hieroglyphen eingestreut wurden?«, fragte sie.
»Das ist Khmer«, antwortete Moronthor.
»Du kannst Khmer lesen?«, wunderte sich Nicandra.
»Wie du weißt, beherrsche ich so gut wie alle relevanten Sprachen. Wie das möglich ist, mögen die grundgütigen Götter und Götterchen wissen, nur verraten die mir auch nicht alles.«
Nicandra hob die Augenbrauen. »Kein Mensch würde behaupten, dass Khmer eine relevante Sprache wäre… Die meisten Menschen wüssten noch nicht einmal, in welchem Land sie gesprochen wird, wenn man sie danach fragte.«
Moronthor lächelte nachsichtig. »Mag ja sein, dass Khmer keine relevante Sprache mehr ist - aber sie war es in der Vergangenheit sehr wohl. Immerhin war Angkor um das Jahr 1200 herum die größte Stadt der Welt. Auch wenn diese Zeit außerhalb Kambodschas und einer kleinen Schar von Gelehrten, die sich mit dem alten Khmer-Reich befassen, nahezu vollkommen in Vergessenheit geraten ist…« Moronthor atmete tief durch.
Er lehnte sich zurück und blickte Nicandra ernst an. »Chérie, wir werden uns wohl schon sehr bald auf den Weg machen müssen.«
Sie runzelte verständnislos die Stirn. »Auf den Weg? Wohin denn?«, fragte die Französin verständnislos.
»Diese alten Texte sind bruchstückhaft und es scheint so, dass die Zeichen, die denen meines Amuletts entsprechen, wichtige Begriffe des Originals quasi verdecken. Daher kann ich den Sinn bislang nur bruchstückhaft erfassen. Aber so viel ist klar: Es geht um eine große Gefahr, die durch Heng Son, den Bruder Hanumans, ausgeht.«
»Ich verstehe überhaupt nichts«, bekannte Nicandra.
»Vielleicht macht es dir das hier etwas deutlicher«, entgegnete Moronthor, während seine Finger über die Tastatur seines Rechners huschten.
Wenig später erschien auf dem Bildschirm ein Zeitungsbericht vom vorletzten Tag. Nicandra überflog rasch die wenigen dürren Zeilen dieser Meldung, die von einer Agentur unter der Rubrik Vermischtes gemeldet worden war. Ein Pferdehändler in der Camargue, dessen Hof sich in der Nähe der Ortschaft Aiges-Mortes befinden sollte, hatte behauptet, des Nachts Wesen gesehen zu haben, die geflügelten Affen geglichen hatten. Diese Wesen seien auf das ganz in der Nähe befindliche Herrenhaus von Pierre de Bressac zugeflogen und hätten sich dort gesammelt - und zwar genau in jener Nacht, in der de Bressac eines äußerst mysteriösen Todes gestorben war. Der Pferdehändler hatte dies als sachdienlichen Hinweis zur Aufklärung eines Verbrechens gemeint, der von offizieller Seite jedoch nicht sonderlich ernst genommen worden war. Jetzt wurde der Mann auf seinen Geisteszustand hin untersucht.
»Verstehst du nun, was ich meine?«, fragte Moronthor.
»Vielleicht beginne ich gerade zu verstehen, worauf du hinauswillst«, gab sie zurück.
Moronthor tätschelte ihr den Po und meinte: »Dann zieh dich jetzt an, wir fahren in die Camargue.«
»Jetzt - sofort?«
»Natürlich - oder sollen wir erst warten, bis uns die Polizei mit ihrem Erkennungsdienst sämtliche Spuren ruiniert hat?«
Nicandra ging in Richtung Tür. »Irgendwie finde ich, dass du mein Äußeres überhaupt nicht angemessen gewürdigt hast, Chéri!«
Moronthor verdrehte die Augen.
»Du siehst umwerfend aus, Nicandra - wie immer!«
»Ich meinte eigentlich meine neue feuerrote Perücke«, maulte sie. »Und du hast sie anscheinend noch nicht einmal bemerkt!«
Noch bevor Nicandra die Tür erreicht hatte, um den Raum zu verlassen, klopfte es.
»Herein!«, rief Moronthor.
William, der als Butler auf Moronthors Lohnliste stand, trat ein. Er blickte etwas indigniert. Moronthor ahnte, dass irgendein Unglück geschehen sein musste.
»Heraus damit, William!«, forderte er ihn zum Reden auf. »Was ist passiert?«
»Es geht um Fooly…«, begann der Butler zögernd.
Nicandra stemmte die Arme in ihre geschwungenen Hüften.
»Was hat unser Jungdrache wieder angestellt?«
Der Butler trat etwas vor und wandte sich direkt an den Herrn des Chateâu Aranaque. »Sie wissen, dass ich Sie immer eindringlich davor gewarnt habe, in Foolys Nähe irgendetwas Brennbares liegen zu lassen, dass Ihnen vielleicht wertvoll ist!« Der Butler seufzte herzzerreißend und fuhr anschließend fort: »Es geht um ein paar Ihrer alten Folianten aus der Bibliothek, Professor…«
Moronthor erbleichte, als ob ihm eine ganze Armee leibhaftiger Höllendämonen begegnet wäre.
»Nein!«, flüsterte er.
***
Etwa eine halbe Stunde später verließen Moronthor und Nicandra das durch den so genannten M-Schirm vor dem Einfluss schwarzer Magie geschützte Chateâu Aranaque. Sie benutzten dazu Moronthors BMW. Nur das Nötigste hatte der Butler für den Trip in den Süden Frankreichs zusammengepackt.
Moronthors Ankündigung nach handelte es sich ohnehin nur um einen Kurztrip - auch wenn sich der Meister des Übersinnlichen in dieser Hinsicht schon des Öfteren vertan hatte. Als sie das Chateâu hinter sich gelassen hatten, begann Moronthor seiner Freundin zu eröffnen, was er inzwischen herausbekommen hatte.
»Hanuman, der allseits geachtete Gott der Affen, hatte einer Legende nach einen dunklen Bruder namens Heng Son. Heng Son neidete seinem Bruder die Beliebtheit bei den Sterblichen, so berichtet die Überlieferung, auf die de Bressac gestoßen war. Aus diesem Grund beschwor Heng Son lemurenhafte Affendämonen mit lederigen Schwingen und hungrigen Raubtiermäulern.«
»Dann muss er sich zuvor eingehend mit schwarzer Magie befasst haben«, schloss Nicandra messerscharf.
»Durchaus möglich«, gestand Moronthor zu.
»Was geschah dann?«
»Der Legende nach verbündeten sich die anderen Götter gegen Heng Son und verbannten ihn in den Tempel von Sarangkôr, den er sich selbst von den Sterblichen hatte erbauen lassen. Bei den alten Khmer war Stein ein Baumaterial, das den Göttern vorbehalten war, und so gibt es heute nur noch die Ruinen von Tempeln und den Palästen der Gottkönige, während von den Behausungen der einfachen Leute nichts geblieben ist. Wir wissen also nicht, wie groß diese alten Khmer-Städte wirklich waren, da wir nur noch den Kern haben. Aber der Legende nach stellte Sarangkôr die Hauptstadt Angkor weit in den Schatten. In nur einem Jahr hatte Heng Son sie unter Zuhilfenahme magischer Mittel mitten in den Dschungel hineingebaut und einen künstlichen See dazu angelegt, der den quadratischen, ebenfalls künstlich angelegten See von Angkor Thom wie einen kleinen Tümpel aussehen ließ.« Moronthor atmete tief durch und lenkte seinen BMW um eine enge Kurve, in der ihm ein Lieferwagen entgegenkam. Nur Millimeter trennten beide Fahrzeuge im Augenblick ihrer größten Annäherung.
Aber Moronthor blieb vollkommen ruhig.
Er kommentierte die riskante Fahrweise des anderen Fahrers nicht einmal durch eine bissige Bemerkung, sondern fuhr mit seiner Erzählung fort.
»Die anderen Götter verbannten Heng Son in seiner eigenen Stadt und sorgten mit einem gewaltigen Zauber dafür, dass Sarangkôr - mitsamt seinem Herrn, in eine andere Welt versetzt wurde. So wurde aus Sarangkôr die verlorene Stadt, aus seiner Umgebung das verlorene Land… die Legende, die Pierre de Bressac offenbar in einer bislang unbekannten Ruine im Inneren des kambodschanischen Dschungels entdeckte, enthält noch eine Prophezeiung.«
»Wie lautet sie?«
»Dass die Welt unter die Herrschaft Heng Sons fallen wird, wenn sich je wieder geflügelte Affen auf der Erde zeigen sollten. Ein Zeitalter des Bösen würde dann die Folge sein, der Herr des Schreckens würde über die Erde ziehen und seinen unheimlichen Hunger nach Blut und Seelen befriedigen…«
»Klingt fast so, als könnte man da nicht mehr viel machen, sobald diese lemurenartigen Wesen aufgetaucht sind«, stellte Nicandra fest.
»Es gibt immer eine Möglichkeit«, widersprach Moronthor. »Wenn ich in meinem bisherigen Kampf gegen die Mächte der Finsternis eines gelernt habe, dann ist es dies: Man darf niemals aufgeben.«
Nicandra strich sich eine Strähne ihrer Perücke aus dem Gesicht und schwieg einige Augenblicke. Sie dachte an die tödliche Falle, in die der Erzdämon Lucifuge Rofocale sie erst vor kurzem hatte schleudern lassen. Es gab keinen Weg hinaus, und drinnen drohte ihnen die Auflösung in Nichts. Wenn sie aufgegeben hätten, wären sie jetzt tot. Aber sie hatten bis zur letzten Sekunde durchgehalten - und waren gerade noch rechtzeitig gerettet worden.
»Hast du eigentlich schon Kontakt mit der Polizei aufgenommen?«, fragte sie schließlich. »Ich meine, mit der Mordkommission, die doch sicher eingerichtet worden sein wird, um den Tod de Bressacs zu untersuchen.«
Moronthor schüttelte entschieden den Kopf.
»Nein, habe ich nicht.«
»Aber…«
»Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in diesem Fall überhaupt notwendig sein wird… Im Zweifelsfall verlasse ich mich ohnehin lieber auf meine eigenen Ermittlungsmethoden.«
***
Es war später Nachmittag, als sie das Herrenhaus von Pierre de Bressac in der Nähe von Aiges-Mortes erreichten.
Das Anwesen erhob sich auf einem Hügel und wurde von einer völlig verwilderten Parklandschaft umgeben.
Die ursprüngliche Anlage dieses Gartens war nur noch in Ansätzen erkennbar. Offensichtlich war dieses Anwesen und das dazugehörige Land seit Jahren sträflich vernachlässigt worden.
Flatterband grenzte das eigentliche Herrenhaus mit einem Abstand von gut fünfzig Metern ab.
Einen Polizisten, der offenbar abkommandiert worden war, um den Tatort zu bewachen, versetzte Moronthor mittels seiner Hypnosefähigkeiten kurzerhand in Tiefschlaf. Der Uniformierte sank in das ausgesprochen hohe Gras und verschwand beinahe darin.
Die Tür am Portal war versiegelt und verschlossen. Zuerst dachte Moronthor daran, keine Rücksicht auf eventuelle Empfindlichkeiten der Polizei und der Justiz zu nehmen und das Siegel sowie die Tür einfach aufzubrechen. Aber Nicandra fand einen Hintereingang, der überhaupt nicht verschlossen war - geschweige denn versiegelt.
Bevor sie eintraten, zögerte Moronthor. Sein Blick blieb an einer bestimmten Stelle im hohen Gras hängen.
»Was ist los, Chéri?«, fragte Nicandra.
»Ich kann die Magie spüren«, erwiderte der Meister des Übersinnlichen. Sein Amulett wies ihn mit leichter Erwärmung darauf hin. Hier, an diesem Ort, war Magie verwendet worden. Schwarze Magie.
Hatte er zuvor vielleicht noch Zweifel gehegt, ob er im Haus von Pierre de Bressac an der richtigen Adresse war, um mit seinen Nachforschungen zu beginnen, so war diese Frage spätestens jetzt beantwortet.
Sie betraten das uralte Herrenhaus.
Moronthor hatte sich zuvor etwas über das Leben de Bressacs informiert.
Er hatte sich sein Leben lang nichts anderem als seinen Studien gewidmet. Auf einen Lehrstuhl oder eine Anstellung bei einem wissenschaftlichen Institut war er dabei nicht angewiesen gewesen. -De Bressac war der einzige Erbe einer reichen Familie, die über eine Reihe von Landgütern verfügte, welche über ganz Südfrankreich verteilt waren. Pierre de Bressac hatte einen Großteil dieses Vermögens in seine kostspieligen Expeditionen hineingesteckt, die ein Fass ohne Boden gewesen zu sein schienen.
Kaum ein Fachkollege hatte zum Schluss seine Thesen noch ernst genommen, die die Grenzbereiche zum Okkultismus nicht nur streiften, sondern bisweilen ziemlich eindeutig überschritten.
Und jetzt war er tot.
Wahrscheinlich zerrissen von dämonenhaften Kreaturen, für deren Erscheinen vermutlich niemand anderes als er selbst die Verantwortung trug.
Moronthor und Nicandra gingen die langen, hohen Korridore des Herrenhauses entlang. Was den Wandbehang anging, so wurden die teils bereits rissig gewordenen Wände einerseits von großformatigen Gemälden beherrscht, die entweder mehr oder minder berühmte Vorfahren de Bressacs abbildeten, während ein anderer Schwerpunkt auf Kultgegenständen aus dem alten Kambodscha lag. Großformatige Abbildungen von Steinreliefs aus den Tempelruinen von Angkor Wat und Angkor Thom hatte de Bressac auf das Format DIN A1 vergrößern lassen. Tierhafte Göttergesichter wechselten in diesen Reliefs mit den Darstellungen graziler Tempeltänzerinnen ab.
Hin und wieder hingen auch kleinere Kultgegenstände aus Ton oder Holz an der Wand.
Einige dieser Artefakte waren zu Boden gerissen worden. Moronthor blieb stehen und deutete auf Kratzspuren an den Wänden.
Namenlose Wut schien die dämonischen Wesen getrieben zu haben, als sie durch die Korridore des Herrenhauses gestürmt waren.
Moronthor und Nicandra erreichten die Eingangshalle. Sie war weitaus schwerer verwüstet als die Korridore, durch die Moronthor und seine Lebensgefährtin bis jetzt gekommen waren.
Hier waren sämtliche Bilder und sonstiger Wandbehang, darunter auch ein kostbarer persischer Gobelin, zu Boden gerissen und teilweise zerrissen worden. Die Wände waren bis auf eine Höhe von fast drei Metern mit Kratzspuren übersät.
»Es müssen Hunderte dieser geflügelten Affen gewesen sein, die sich hier ausgetobt haben«, sagte Nicandra laut. Der helle Klang ihrer Stimme hallte in dem hohen Gemäuer wider.
Moronthor deutete mit der Hand auf einige dieser Spuren. »Siehst du die unterschiedliche Größe dieser Spuren? Die Wesen, die dieses Haus heimsuchten, sind offenbar ebenfalls von sehr unterschiedlicher Größe.«
Sie gingen die Wendeltreppe hinauf, die in das obere Stockwerk führte.
Nachdem sie mehrere weitere, völlig verwüstete Räume kurz durchstöbert hatten, gelangten sie in de Bressacs Arbeitszimmer.
Auch hier herrschte das pure Chaos.
Markierungen zeigten an, wo die sterblichen Überreste des Wissenschaftlers gefunden worden waren. Die Stellen waren nummeriert und über die gesamte Fläche des Arbeitszimmers verstreut.
Allein der Gedanke an das Grauen, das sich hier zugetragen haben musste, konnte einem das Blut in den Adern gefrieren lassen.
»Ich sehe nirgends einen Computer oder dergleichen«, stellte Nicandra etwas verwundert fest.
Moronthor deutete auf einen Abdruck in der Staubschicht die sich dem Schreibtisch im Laufe der Zeit gebildet hatte. Er entsprach genau den Ausmaßen eines handelsüblichen Rechners. »De Bressacs Computer scheint entfernt worden zu sein. Fragt sich nur, ob die Polizei das zu verantworten hat…«
»Wer sonst?«, unterbrach ihn Nicandra. »Du denkst doch nicht etwa an diese Lemuren…?«
»Spricht irgendetwas dagegen?«, fragte Moronthor zurück. »Wir wissen weder, mit welchem genauen Auftrag sie hierherkamen, noch, ob es sich um unzivilisierte Bestien oder hoch intelligente Killer handelt.«
Vielleicht auch eine Mischung aus beidem, überlegte Moronthor.
Der Bildschirm fand sich wenig später. Er war zusammen mit der Tastatur achtlos in eine Ecke geworfen worden.
Ähnlich wie in den anderen Räumen des Obergeschosses waren die Wände mit Kratzspuren nur so übersät. Zahllose, teils sicher sehr wertvolle Bücher waren aus ihren Regalen gerissen und so mancher Einband regelrecht zerfetzt worden. Moronthor fiel ein Teppich auf, der ein paar dunkelgrüne Flecken aufwies.
Grün - das war der Überlieferung nach das Blut jener Kreaturen der Nacht, die der dunkle Bruder des Affengottes um sich gescharrt hatte.
Moronthor berührte unwillkürlich das handtellergroße Amulett, das er an einer Halskette vor der Brust trug.
Merlins Stern schlug an.
Er erwärmte sich leicht.
Die magische Kraft dieser Lemuren ist noch anwesend, erkannte Moronthor. Das war kein Wunder. Schließlich hatten sie etwas sehr Wesentliches zurückgelassen.
Ihr Blut…
»Sehen wir uns noch ein bisschen um«, schlug Nicandra vor. »Irgendetwas Brauchbares, das uns vielleicht doch noch etwas weiterbringt, müssten wir doch in diesem Gemäuer noch auftreiben können…«
»Leider sind wir wohl - nach den Lemuren Heng Sons und der Polizei - die Letzten in der Reihe, die hier herumstöbern«, erwiderte Moronthor ziemlich resigniert.
Ein Geräusch ließ ihn und Nicandra jäh zusammenzucken. Draußen auf dem Korridor hatte es geknarrt. Natürlich kam es in einem derart alten Haus immer wieder vor, dass sich Fußbodenbretter verzogen und dadurch unerklärliche, beinahe geisterhafte Laute entstanden, die manchmal einem menschlichen Aufstöhnen oder Seufzen ähnelten.
Aber daran glaubte Moronthor in diesem Augenblick nicht.
Er zog den E-Blaster unter seiner Jacke hervor, wo er diese ausgesprochen wirkungsvolle und auch gegen Dämonen und dämonenähnliche Wesen einsetzbare Waffe verborgen trug. Sie haftete dort an einer Magnetplatte, die am Gürtel seiner Hose befestigt war.
Die Wirkung des Blasters ließ sich regulieren. Normalerweise hatten die mit dieser Pistole abgefeuerten Strahlen eine verheerende und in der Regel auch für jedes gewöhnliche Lebewesen tödliche Wirkung. Aber der E-Blaster ließ sich auch auf Betäubung umschalten.
Moronthor legte den Finger auf seinen Mund, während draußen vom Korridor her jetzt eindeutig Schritte zu hören waren.
Moronthor und Nicandra postierten sich links und rechts der ins Schloss gefallenen Tür. Knarrend öffnete sie sich.
Eine junge Frau trat ein. Das brünette Haar fiel ihr lang und offen über die Schultern.
In der Rechten hielt sie einen kurzläufigen, sehr zierlich wirkenden Revolver. Moronthor schätzte, dass es sich um eine Waffe vom Kaliber 22 handelte.
Die junge Frau wirbelte herum.
Mit einer entschlossenen Bewegung schlug Nicandra ihr auf das Handgelenk, sodass sie die Waffe fallen ließ.
»Ganz ruhig«, sagte Moronthor. »Sie haben nichts zu befürchten.«
Die junge Frau blickte von Nicandra zu Moronthor, der seinen E-Blaster wieder wegsteckte - eine Waffe, die für die junge Frau wie aus einer anderen Welt wirken musste.
Was sie ja auch war.
»Wer sind Sie?«, fragte Moronthor.
Die junge Frau verschränkte ihre Arme vor der Brust. »Dasselbe könnte ich Sie mit sehr viel mehr Recht fragen!«, erwiderte sie.
»Ich bin Professor Moronthor und meine Partnerin heißt Nicandra Darrell. Wir versuchen Licht in das Dunkel um Monsieur de Bressacs Tod zu bringen«, trat Moronthor sogleich die Flucht nach vorn an.
Die junge Frau hob die Augebrauen.
»Dann sind Sie von der Polizei?« Sie machte einen Schritt zurück und hob abwehrend die Hände. »Nein, das kann nicht sein!«, schüttelte sie entschieden den Kopf. »Der Beamte, der zur Bewachung des Anwesens abgestellt wurde, hätte mich dann für kein Geld der Welt hierher gelassen.«
»Sie haben ihn bestochen?«, fragte Moronthor.
»Ja - aber was Sie mit ihm gemacht haben, um ihn auszuschalten, wage ich mir gar nicht vorzustellen!«
Moronthor lächelte mild.
»Ich glaube, Sie schätzen uns wirklich vollkommen falsch ein. Pierre de Bressac beschäftigte sich mit höchst eigenartigen Studien. Was er machte, dürfte nicht nur einfach mit der Archäologie des alten Khmer-Reichs zu tun gehabt haben.«
Sie hob die Augenbrauen.
»Sondern?«
»Sein wahres Interesse galt wohl der Erforschung gewisser übernatürlicher Mächte, die ihm wohl letztlich auch zum Verhängnis wurden.«
»Was reden Sie da nur für einen Unfug zusammen!«, erwiderte die junge Frau und strich sich dabei eine Strähne aus ihrem Gesicht.
»Jedenfalls wird die Polizei kaum in der Lage sein, die Hintergründe von Pierre de Bressacs Tod wirklich aufzuklären«, mischte sich Nicandra in das Gespräch ein.
Die junge Frau atmete tief durch. »Was wissen Sie darüber?«, drängte sie.
»Bevor wir dazu auch nur eine Silbe sagen, möchten wir schon ganz gerne wissen, mit wem wir es zu tun haben,«, erwiderte Nicandra kühl.
Die junge Frau zögerte noch einen Moment. Ihre Züge machten einen nachdenklichen Eindruck.
Sie schien noch abzuwägen, inwieweit sie Moronthor und seiner Begleiterin vertrauen könnte. Schließlich überwand sie aber ihre Zweifel und begann zu sprechen.
»Mein Name ist Valerie Cordonnier - und obgleich ich nicht denselben Namen trage, bin ich doch die Tochter von Pierre de Bressac. Seine einzige lebende Verwandte und damit Erbin seines gesamten Nachlasses, wenn Sie verstehen, was ich meine…«
»Sicher verstehe ich das«, gab Moronthor zurück.
»Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin Monsieur de Bressacs Alleinerbin. Ich befinde mich also gewissermaßen auf meinem eigenen Besitz - auch wenn diese Bürokraten von der Justiz mir den Zugang zu meinem rechtmäßig Eigentum bislang einfach nicht gewähren wollten.«
Moronthor hörte Valerie schon gar nicht mehr wirklich zu. Seine Aufmerksamkeit galt etwas anderem. Das Gefühl der Anwesenheit einer schwarzmagischen Kraft war innerhalb der letzten Minuten beständig stärker geworden, und jetzt begriff Moronthor auch, was die Quelle dieser Kraft war.
Das dunkelgrüne, getrocknete Lemurenblut auf dem Teppich!
Die Flecken gewannen plötzlich auf unheimliche Weise an Substanz. Sie wuchsen innerhalb von Sekunden zu grünlich schimmernden, unförmigen Klumpen heran, in deren Mitte sich Paare von rot glühenden Augen bildeten. Arme, Beine, siebenfingrige Hände und lederhäutige Schwingen formten sich. Aus den knöchernen Verdickungen an den Schwanzenden wuchsen dolchartige Stacheln heraus.
Drohende Knurrlaute gingen von diesen Wesen aus.
In de Bressacs Arbeitszimmer gab es Dutzende von kleinen Flecken mit grünem Lemurenblut. Offenbar hatte sich der Wissenschaftler nach Kräften gewehrt, bevor ihn diese Kreaturen der Finsternis schließlich im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen hatten.
Aus jedem dieser Flecken wuchs nun ein geflügelter Affe hervor. Manche von ihnen waren winzig. Kaum größer als eine Hand oder ein Finger.
Ihre Größe schien von der jeweils zur Verfügung stehenden Menge an Lemurenblut abhängig zu sein.
Ein gutes Dutzend dieser Nachtkreaturen setzten im selben Moment zum Angriff an und sprang mit weit geöffneten Mäulern und ausgestreckten Krallenhänden auf Moronthor, Nicandra und Valerie zu.
Moronthor verschob eine der Hieroglyphen auf Merlins Stern.
Das handtellergroße Amulett erhitzte sich.
Blitze zuckten daraus hervor und vernichteten eine Schattenkreatur nach der anderen.
Ein sehr kleiner Lemure, kaum größer als ein Daumennagel, sprang Valerie an, krabbelte über ihren Arm höher und höher, bis er schließlich ihren Hals erreichte.
Die junge Frau schrie. Sie schlug mit den Händen um sich und schüttelte den winzigen geflügelten Affen wie ein lästiges Insekt von sich. Im hohen Bogen flog er durch die Luft. Einer der aus dem Amulett herausschießenden magischen Blitze erfasste ihn und verdampfte ihn zu Staub.
Moronthor stellte sich vor Nicandra und Valerie. Das grünlich schimmernde Schutzfeld, das durch das Amulett jetzt aktiviert wurde, hüllte sie alle drei ein.
Nur wenige Augenblicke dauerte Moronthors Kampf gegen diese aus Dämonenblut geborenen Kreaturen.
Dann waren sie sämtlich vernichtet. Zwei oder drei von ihnen entkamen durch das nur notdürftig mit Folie verklebte Fenster und gelangten ins Freie.
Die anderen wurden unter dem Beschuss der Blitze, die aus Moronthors Amulett herausschossen, zu Staub.
Ein eigenartiger Geruch verbreitete sich in Pierre de Bressacs ehemaligem Arbeitszimmer. Es war eine Mischung aus verbranntem Fleisch und Fäulnis. Der faulige Atem der Hölle selbst, so kam es Moronthor für einen Moment vor.
»Gehen wir besser«, schlug Nicandra vor.
Valerie hingegen war unfähig, auch nur ein einziges Wort herauszubringen. Sie würgte und rang nach Luft. Ihr Gesicht war so bleich wie die Wand geworden.
Niemand außer ihr bemerkte die kleine Wunde an der Innenfläche ihrer linken Hand, die bei dem Angriff des winzigen Lemuren entstanden war.
»Ich hoffe, mit Ihnen ist alles in Ordnung«, meinte Moronthor.
»Mit mir ist alles okay«, antwortete Valerie. »Zumindest ist nichts passiert, was der Rede wert gewesen wäre.«
Aber das war ein Irrtum.
***
Ein schwerer Geruch von Fäulnis und Moder hing in dem hohen, von flackernden Fackeln erhellten Saal.
Düstere, in Kutten gehüllte Gestalten hatten sich in einem Halbkreis um einen Thron versammelt. Die Kapuzen dieser Kuttenträger waren tief ins Gesicht gezogen, sodass von ihren Gesichtern nichts zu sehen war. Auch der Schein der Flammen konnte die Finsternis darunter nicht erhellen.
Der Thron, um den sich die etwa fünfzig Kuttenträger gruppiert hatten, war aus versteinerten Schädeln errichtet worden. Schädel von Menschen waren ebenso darunter wie tierisch wirkende, durch lange Reißzähne gekennzeichnete Totenköpfe anderer Arten.
Unter anderem zählten dazu wohl die geflügelten, rotäugigen Affen, die sich zu Hunderten und in nahezu jeglicher Größe im Saal befanden. Viele von ihnen kauerten dicht gedrängt in Gruppen beieinander. Den Blick ihrer funkelnden Dämonenaugen hielten sie dabei gesenkt. So als wollten sie es vermeiden, mit jener Kreatur direkten Blickkontakt aufzunehmen, die sich auf dem Knochenthron niedergelassen hatte…
Das Glühen ihrer Augen pulsierte sehr viel schneller, als man es beobachten konnte, wenn man sie andernorts antraf.
Manche der kleineren Lemuren, von denen viele nur die Größe menschlicher Hände oder Finger aufwiesen, manche sogar an Insekten erinnerten, flogen und kletterten an der gewölbten Decke dieses unheimlichen Thronsaals herum, von der Primatenschädel jeglicher Art an hauchdünnen, aber sehr haltbaren Fäden herabhingen. Bei dem geringsten Aufkommen von Zugluft geriet dieses groteske Mobile des Grauens in Bewegung. Hin und wieder klammerten sich kleinere Exemplare unter den Lemuren an diese Fäden oder an die daran befestigten Schädel und schwangen damit hin und her. Besonders winzige unter den geflügelten Affen machten sich offenbar einen Spaß daraus, durch die leeren Augen- und Mundhöhlen der Schädel hindurch zu fliegen.
Aber auch sie schienen allergrößten Respekt vor jenem Wesen zu haben, das auf dem Thron saß und von dem sie wussten, dass es ihr Herr war.
Ein Herr, der absolute Unterwerfung forderte und jeden Hauch von Ungehorsam grausam bestrafte.
Es reichte schon ein leises Knurren, um die in dem eigenartigen Schädel-Mobile herumturnenden Kleiniemuren augenblicklich zur Räson zu bringen und in eine andächtige Erstarrung zu versetzen, in der sie dann aufmerksam den Anweisungen ihres Herrn und Meisters lauschten.
Eines Herrn und Meisters, den keiner von ihnen je gesehen hatte, obwohl er doch vor ihnen auf dem Schädelthron saß und niemand seine Anwesenheit ernsthaft bestreiten konnte.
Ein Schattenfeld umgab Heng Son, den dunklen Bruder des geliebten Affengottes Hanuman, von dessen Existenz die meisten Sterblichen nichts ahnten. Und diejenigen, die von seiner Existenz wussten, versuchten ihn so schnell wie möglich zu vergessen, damit er sie nicht bis in ihre Albträume hinein verfolgte. Denn auch das war Heng Son - der Herr der Albträume.
Der Umriss des Schattenfeldes hatte keine eindeutigen Konturen. Es ging kaum merklich in das Halbdunkel über, das in dem Thronsaal herrschte. Kein Lichtstrahl vermochte es, in dieses Dunkelfeld einzudringen und es zu erhellen.
Viele Geschichten rankten sich um Heng Son. Sowohl unter den Sterblichen, als auch unter den Lemuren erzählte man sich, dass sich der dunkle Bruder des Affengottes in den Zeitaltern seiner Herrschaft über das vergessene Land und die vergessene Stadt Sarangkôr sehr stark verändert hätte.
Aber wer hätte dies schon bezeugen können, da ihn seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen hatte?
Und Herrschaft war Heng Sons Ansicht nach auch das völlig falsche Wort, um seine gegenwärtige Existenz zu charakterisieren. Ein Herrscher war er nur für seine Untertanen und willigen Knechte, die er mithilfe seiner schwarzmagischen Fähigkeiten und Kräfte in seinen Bann zu ziehen vermochte.
Er selbst sah sich anders.
Ich bin ein Verbannterl, dachte er. Einer,; dem man die Wiederkehr auf ewig versagen wollte - aber diese Zeit nähert sich dem Ende. Die Macht der alten Götter ist im Schwinden begriffen und meine nimmt zu. Ich werde sehr bald schon mächtiger auf die Erde zurückkehren, als ich sie seinerzeit unter Zwang verlassen musste…
Niemand konnte sehen, wie sich unter dem Schattenfeld knöcherne, siebenfingrige Hände zu Fäusten ballten. Da war so viel Zorn, so viel Hass, so viel Lust an namenloser Grausamkeit, die sich in all den Jahrhunderten aufgestaut hatte. Wie oft hatte er davon geträumt, seine Herrschaft des Schreckens und der Finsternis zu etablieren. Niemanden, der ihm auch nur im Entferntesten hätte gefährlich werden können, würde er verschonen. Diesmal nicht!, schwor er sich. Diesmal soll es anders kommen, als damals.
Ich hatte die Gelegenheit, meinen Bruder und seine Helfershelfer zu vernichten, erinnerte er sich, aber ich habe diese einmalige Gelegenheit verstreichen lassen…
Wen willst du denn nun dafür verantwortlich machen, außer dich selbst?, meckerte in der hintersten Ecke seiner finsteren Seele eine kritische Stimme, die Heng Son am liebsten auch zum Schweigen gebracht hätte. Das erwies sich allerdings bisweilen als viel schwieriger als der Umgang mit seinen Gegnern, mit denen er kurzen Prozess zu machen pflegte. Es war dein eigenes Versagen, deine eigene Feigheit, die dich in deine jetzige Situation gebracht hat. Verbannt in ein Land, das nicht umsonst »das Vergessene« genannt wird. Du kannst von Glück reden, dass man dich in all diesen Jahren nicht auch vergessen hat…
Das Schlimme und Qualvolle für Heng Son war die Erkenntnis, dass diese unangenehme Stimme aus den Tiefen seiner Seele recht hatte. Es war tatsächlich sein Versagen, das zu dem Desaster geführt hatte.
Heng Son, der Meister der schwarzen Magie, hätte ein Ritual von ungeahnter Macht ausführen können, um seine damaligen Gegner auf alle Zeiten zu vernichten. Nie wieder hätte jemand ihm dann seine Herrschaft streitig machen können.
Aber Heng Son hatte gezögert.
Die Folgen, die die Beschwörung derart unkalkulierbarer Mächte nach sich ziehen konnte, hatten ihn zurückschrecken lassen. Dabei hatte er weniger an die Folgen für andere als an die gedacht, die ihn selbst treffen konnten.
Ich hätte es riskieren müssen, eventuell die Kontrolle über diese schwarzen Mächte zu verlieren und selbst vernichtet zu werden, überlegte er. Eine Erkenntnis, die um viele Jahrhunderte zu spät kam, das wusste er wohl. Und doch führte Heng Son sie sich immer und immer wieder vor Augen. Was wäre geschehen, wenn er sich damals, in seinem Kampf gegen die anderen Götter anders entschieden und alles auf eine Karte gesetzt hätte?
Nichts hätte schlimmer sein können, als die Situation, in der er sich so lange befunden hatte.
Seine Gegner von damals - allen voran der Affengott Hanuman selbst - hatten jenen Mut gehabt, der ihm gefehlt hatte. Sie hatten die eigene Vernichtung riskiert, als sie gegen Heng Son zu Felde gezogen waren und ihn schließlich in das vergessene Land verbannt hatten. Mitsamt seiner Stadt Sarangkôr.
Aus Fehlern wird man klug, dachte der Herr des Schädelthrons. Und ich werde denselben Fehler sicherlich kein zweites Mal machen…
Eher beiläufig registrierte Heng Son, dass sich die Kuttenträger vor ihm niederknieten. Sie stimmten einen murmelnden Gesang an, der hin und wieder durch ein schrilles Kreischen eines Lemuren unterbrochen wurde.
Heng Son erhob sich.
Für einen Betrachter war nur zu sehen, wie sich die Position und Ausdehnung der Schattenzone etwas veränderte.
»Erhebt euch, meine Diener!«, grollte eine tiefe, heisere Stimme aus dem Dunkel dieses Schattens heraus.
Die Kuttenträger gehorchten.
Sie standen in einem Halbkreis da und warteten ab, was nun geschah.
Ein Arm aus purer Dunkelheit wuchs aus der Schattenzone heraus, griff scheinbar wahllos nach einer der Gestalten, umschlang sie und zog sie zu sich heran, sodass sie innerhalb des Schattens mit einem unterdrückten Schrei verschwand.
Schmatzende Laute waren im nächsten Augenblick zu hören, dazu ein knackendes Geräusch.
Das Bersten von Knochen…
Anschließend stöhnte Heng Son wohlig auf.
Etwas wurde aus der Schattenzone hinausgeworfen und landete inmitten des Halbkreises.
Eine blutdurchtränkte Kutte.
Der Herr von Sarangkôr ließ sich wieder auf seinem Schädelthron nieder.
Blut rann die Stufen hinab, die hinauf zu dem quaderförmigen Podest führten, auf dem der Thron stand.
»Und jetzt erneuert eure Gefolgschaft zu mir!«, forderte Heng Son unmissverständlich.
Die Kuttenträger ließen ihre grob gewebten Gewänder einer nach dem anderen zu Boden gleiten. Die nackten Körper von starr dreinblickenden Männern und Frauen kamen zum Vorschein. Ihre Augen wirkten leer und seelenlos, die Mimik wie eingefroren.
Das flackernde Licht der Fackeln schimmerte auf ihrer nackten Haut und gab Kratzspuren siebenfingriger Krallenhände in den unterschiedlichsten Größen frei. Manche dieser Wundmale waren bereits vernarbt, andere frisch verkrustet.
Die geflügelten Affen wurden unruhig. Selbst jene, die bis dahin friedlich und eher angstvoll in den Ecken gekauert hatten, begannen jetzt, aktiver zu werden. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und starrten mit ihren leuchtenden Augen interessiert auf die Körper jener Sterblichen, die Heng Son zu seinen Dienern auserkoren hatte. Knurrende und schmatzende Laute waren zu hören. Die Lemurenwinzlinge an der Decke stellten ihre Flugmanöver durch die Öffnungen der Totenschädel ein. Sie verharrten ruhig in der Luft, bewegten dabei ihre Flügel mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von Kolibris und warteten anscheinend auf ein Signal ihres Herrn und Meisters.
Dieses kam in Form einer Folge von konsonantenreichen Silben, die aus einer längst vergessenen Sprache zu stammen schienen.
Kreischend stürzten sich die geflügelten Affen auf die ungeschützten Körper der Sterblichen.
***
»Vielleicht begreifen Sie jetzt, mit welchen Mächten Ihr Vater sich eingelassen hat«, sagte Moronthor ernst.
Valerie Cordonnier wirkte abwesend. Sie schien dem Meister des Übersinnlichen nicht richtig zuzuhören. Suchend ließ sie den Blick im Arbeitszimmer umherkreisen.
»Vermissen Sie irgendetwas?«, fragte Nicandra.
Valerie schüttelte den Kopf.
»Nein«, sagte sie beinahe tonlos.
Sie seufzte hörbar.
Dann musterte sie einen Augenblick lang Nicandra auf eine Weise, die Moronthor nicht richtig zu interpretieren wusste, und sagte schließlich: »Vielleicht war Ihr Vorschlag, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen ganz gut… äh… Mademoiselle oder Madame Darrell?«
»Nennen Sie mich Nicandra«, erwiderte Moronthors Lebensgefährtin.
Valerie zuckte die Achseln.
»Wie Sie wünschen.«
Sie wandte sich zur Tür.
Moronthor und Nicandra folgten ihr hinaus in den Korridor.
Wie ahnungslos war diese junge Frau wirklich?
»Wir hatten sehr gehofft, dass Sie uns weiterhelfen könnten, Valerie. Heng Son, der dunkle Bruder des Affengottes, hat es offenbar geschafft, nach sehr langer Zeit seine getreuen Diener wieder auf die Erde zu bringen, nachdem man ihn und sein Gezücht für gut tausend Jahre verbannt hatte!«, erläuterte der Professor so sachlich, wie ihm dies in dieser Situation möglich war. Den beschwörenden Tonfall, der ihm eigentlich auf der Zunge gelegen hätte, versuchte er so gut es ging zu unterdrücken. Schließlich wusste er, dass dies Valerie eher misstrauisch machen würde.
Moronthor nahm sie bei den Schultern und drehte sie zu sich herum. Sie ließ es geschehen, wich aber dem durchdringenden Blick seiner Augen aus.
In besonders seltenen Momenten hatte Moronthor die Gabe, Gedanken lesen zu können. Aber in diesem Augenblick war das nicht der Fall. Der Geist der jungen Frau öffnete sich ihm gegenüber nicht.
Nicht einmal ihr Blick!, rief sich der Meister des Übersinnlichen in Erinnerung.
»Ich habe keine Ahnung, wie ich Ihnen helfen könnte«, sagte Valerie schließlich, nachdem sie sich gefasst hatte. »Ansonsten bin ich Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie mich eben vor diesen…«, sie suchte nach dem passenden Wort, »… Kreaturen geschützt haben. Ich hätte nicht gewusst, wie ich mich gegen sie hätte verteidigen sollen.«
»Sie hätten nicht den Hauch einer Überlebenschance gehabt.«
»Ich weiß nicht, ob Sie gefunden haben, was Sie suchen, Professor Moronthor. Aber ich für mein Teil werde mich jetzt davonmachen. Nicht eine Sekunde länger als unbedingt nötig will ich in diesem Gemäuer bleiben.«
»So schnell wieder auf und davon?«, wunderte sich Nicandra. »Im Grunde genommen haben Sie uns noch nicht einmal gesagt, was Sie letztlich hier wollten.«
»Dafür muss ich mich auch wohl kaum rechtfertigen. Schließlich…«
»… sind Sie Pierre de Bressacs Erbin, ich weiß«, vollendete Nicandra den Satz an Valeries Stelle.
Die junge Frau verdrehte genervt die Augen.
Moronthor fragte sich, was es letztlich sein mochte, das ihr so auf den Wecker ging.
Jemand, der auf Grund seines ersten übernatürlichen Erlebnisses unter Schock stand, reagierte zweifellos anders, als es bei Valerie zu vermuten war. Moronthor hatte ungezählte Beispiele dafür erlebt. Es war nicht selbstverständlich zu akzeptieren, dass es Mächte im Universum gab, die weit über das hinausgingen, was menschliche Wissenschaft und menschliche Erkenntnis zu erklären vermochten. Für manchen brach zunächst einmal ein komplettes Weltbild zusammen, wenn er zum ersten Mal Nachtkreaturen wie einen geflügelten Lemuren oder anderen Alptraumgeschöpfen begegnete.
»Ich kann Ihnen nicht viel über meinen Vater und seine Studien sagen«, behauptete Valerie.
Danach hat doch noch keiner von uns gefragt, dachte Moronthor etwas erstaunt. »Immerhin scheint Sie das Auftauchen dieser lemurenhaften Ungeheuer nicht im mindesten in Ihrem Realitätsempfinden beeinträchtigt zu haben«, stellte er kühl fest.
Sie schluckte.
Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort: »Wie Sie ja bereits wissen, trage ich einen anderen Namen als mein Vater. Meine Mutter trennte sich früh von ihm, als sie erkannte, dass er sich mit Mächten einließ, die…« Sie musste schlucken, ehe sie schließlich fast tonlos weitersprach. »… Mächtèn, die böse sind - wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Das tue ich sehr wohl.«
»Bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu meinem Vater. Meine Mutter fürchtete immer, dass ich auch in den Bann dieser dunklen Mächte geraten könnte, sobald er die Gelegenheit hätte, mich zu beeinflussen. Aber irgendwann interessierte es mich einfach, wer mein Vater war und mit welch obskurem Forschungsgegenstand er sich beschäftigte.«
»Durchaus verständlich«, kommentierte Nicandra. »Sie nahmen also von sich aus Kontakt mit ihm auf?«
»Ja, genau so war es. Es war ja nicht schwer, ihn zu finden. Er machte im Laufe der Zeit immer wieder Schlagzeilen. Immer wieder waren seine Thesen Auslöser von Debatten - später galt er dann wohl nur noch als exzentrischer Spinner und Außenseiter, dessen Forschungen niemand mehr unter die Rubrik Wissenschaft subsumiert hätte.«
»Ja, Forschungen im Bereich des Übersinnlichen bekommen leider noch lange nicht die Anerkennung, die sie eigentlich verdienten«, konnte Professor Moronthor aus eigener leidvoller Erfahrung nur bestätigen.
»Sie können sich vorstellen, dass ich als Heranwachsende fasziniert von dem Gedanken war, einen Vater zu haben, der sich mit Schwarzer Magie beschäftigt. Übrigens starb meine Mutter, kurz nachdem ich wieder Kontakt zu meinem Vater aufgenommen hatte. Sie beging unter sehr mysteriösen Umständen Selbstmord, obwohl sie nie derartige Neigungen hatte.«
Valerie machte eine Pause und fuhr schließlich in gedämpftem Tonfall fort: »Ich wurde den Verdacht nicht los, dass mein Vater damit etwas zu tun hatte. Aber er hat das immer abgestritten. Jedenfalls ging ich auf Distanz zu ihm, studierte in London und Madrid… Dann erhielt ich die Nachricht von seinem Tod, und deshalb bin ich hier.«
»Wir sollten kooperieren«, schlug Moronthor vor. Er hatte das untrügliche Gefühl, dass sie ihm noch etwas Wichtiges verschwieg. Der Meister des Übersinnlichen war sich nahezu sicher, dass Valerie noch sehr viel mehr über die Forschungen ihres Vaters wusste, als sie bislang preiszugeben bereit gewesen war.
***
Moronthor und Nicandra folgten Valerie ins Freie. Sie nahmen dabei denselben Weg, auf dem sie auch gekommen waren, und verließen das graue Gemäuer durch die Hintertür.
»Auf Wiedersehen«, sagte Valerie und deutete auf die verwilderte Parklandschaft, die das Anwesen umgab. Jahrzehntelang hatte hier niemand etwas an den Gartenanlagen getan. Das Gras stand überall meistens kniehoch. Dazwischen wucherten wilde Dornbüsche und reckten die unterschiedlichsten Blumen ihre Blütenkelche in die Höhe.
In den völlig verwilderten Hecken nisteten Vögel, und so mancher der Obstbäume war längst morsch geworden und verströmte den modrigen Geruch feuchten Holzes.
»Sollen wir Sie irgendwohin mitnehmen?«, fragte Professor Moronthor.
Valerie schüttelte den Kopf.
»Nein, danke. Mein Wagen befindet sich auf der anderen Seite des Parks - wenn der Ausdruck für diesen Dschungel überhaupt passend sein sollte.«
»Wo können wir Sie erreichen, Valerie?«, wollte Nicandra geistesgegenwärtig wissen.
»Leben Sie wohl«, war ihre nichts sagende Antwort. »Ich werde Sie beide übrigens nicht wegen des von Ihnen begangenen Hausfriedensbruchs anzeigen, weil ich dann erklären müsste, was ich hier zu suchen hatte - in einem abgesperrten Tatort.«
Sie ging davon, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Moronthor blickte ihr nachdenklich hinterher.
Nach ein paar Augenblicken war sie hinter einer der verwilderten Hecken verschwunden.
»Die wollte uns so schnell wie möglich loswerden«, stellte Nicandra fest und verschränkte dabei die Arme unter der Brust.
Moronthor zuckte die Achseln.
»Was hätte ich tun sollen? Sie hypnotisieren?«
»Warum nicht, Chéri?«
»Ich nehme nicht an, dass uns das irgendwie weitergebracht hätte.«
Nicandra lehnte sich gegen Moronthors Schulter.
»Und wo setzen wir jetzt an?«
»Bei den noch lebenden Mitarbeitern, die Pierre de Bressac auf seine letzen Expeditionen begleiteten«, schlug Moronthor vor.
»Was ist der Grund dafür, dass Heng Sons Lemuren anscheinend dabei sind, einen nach dem anderen von ihnen umzubringen?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung, Nicandra«, gestand Moronthor. »Aber rein instinktmäßig würde ich vermuten, dass de Bressac irgendetwas damit zu tun hat, wie Heng Son in unsere Welt zurückkehrte…«
»Ein willfähriger Helfer, der ihm lästig wurde?«
»Wäre doch eine Erklärung, oder?«
»Ich glaube ehrlich gesagt, dass da noch mehr dahintersteckt, Chéri!«
»Dein Wort in Merlins Ohr, Nicandra!«
Sie gingen zurück in Richtung des BMW. Der wachhabende Polizist würde noch eine ganze Weile im hohen Gras vor sich hin schnarchen und sich hinterher an nichts erinnern.
Plötzlich blieb Moronthor stehen.
»Da ist etwas faul!«, stellte er fest.
»Wovon sprichst du jetzt?«, wunderte sich Nicandra.
»Ich meine Valerie! Hast du einen Motor starten hören?«
»Nein.«
Schnellen Schrittes lief Moronthor zu jener Stelle zurück, an der sie sich von Valerie getrennt hatten.
Sein Instinkt sagt ihm einfach, dass er etwas sehr Wichtiges übersehen hatte.
Nicandra folgte ihm.
Moronthor umrundete die Hecke, hinter der die junge Frau verschwunden war.
Es dauerte nicht lange und sie hatten einen Punkt erreicht, von dem aus man die gesamte Westseite jener Anhöhe überblicken konnte, auf der sich das Anwesen der Familie de Bressac befand.
Eine schmale Straße führte von dort aus in Richtung von Aiges-Mortes.
Aber es war weit und breit kein Wagen zu sehen.
Doch Valerie Cordonnier konnte unmöglich weggefahren sein, ohne dass Moronthor und Nicandra erstens die Geräusche mitbekommen und zweitens den Wagen auf dem weiteren Verlauf der Straße gesehen hätten.
»Scheint, als hätte unsere gute Valerie die Gabe, sich in Luft aufzulösen, oder irgendwelche anderen magischen Tricks auf Lager«, kommentierte Nicandra die neue Lage. »Kein Wunder, dass sie so relativ cool auf die Lemuren reagierte.«
»Ich hatte gleich den Eindruck, dass dies nicht ihre erste Begegnung mit Magie war«, bekannte Moronthor.
»Ganz meiner Meinung«, stimmte seine Freundin zu. »Ihr-Vater scheint sie weitaus tiefer in die Geheimnisse seines Wissens eingeführt zu haben, als sie das uns gegenüber zugeben wollte.«
Moronthor sah sich etwas um und wurde schließlich hinter einer weiteren Hecke in einem verwilderten Blumenbeet fündig.
»Vielleicht ist das hier ja des Rätsels Lösung!«, glaubte er und deutete auf eine Kolonie von Regenbogenblumen, deren mannshohle Kelche von dem Gestrüpp fast überwuchert wurden, sodass sie einem auf den ersten Blick gar nicht auffielen.
Die Blüten schimmerten in allen Farben des Regenbögens, je nachdem, aus welcher Perspektive und unter welcher Beleuchtung man sie betrachtete.
Wenn man eine intensive Vorstellung eines Ortes hatte, konnte man sich mit Hilfe von Regenbogenblumen dorthin versetzen, vorausgesetzt, dass sich am Zielpunkt ebenfalls Regenbogenblumen befanden.
Im Château Aranaque wuchsen einige dieser seltenen Pflanzen in einem Kellergewölbe unter einer frei schwebenden Mini-Sonne, von der niemand wusste, wer sie einst installiert hatte und wie. Bekannt war nur, wer vor einer kleinen Ewigkeit die Regenbogenblumen hier angepflanzt hatte: Die Unsichtbaren hatten diese Blumen anscheinend überall im Universum verteilt. Einige Standorte auf der Erde waren Moronthor auch bekannt - aber es waren gewiss nicht die einzigen.
Zudem hatte er sich selbst auch als »Gärtner« betätigt, indem er Ableger überall dort anpflanzte, wo es ihm nützlich erschien.
Jedenfalls war es für Moronthor und Nicandra im Augenblick unmöglich herauszufinden, wohin Valerie mit Hilfe der Regenbogenblume verschwunden war. Wahrscheinlich hatte sie sich an ihrem Ankunftsort bereits so weit von den Blumen entfernt, dass es nichts mehr nützte, sich auf sie als Transportziel zu konzentrieren.
»Falls du jetzt noch irgendetwas im Château vergessen hättest, könntest du schnell dorthin zurück!«, stellte Nicandra ironisch fest.
Moronthor deutete zum Herrenhaus.
»Wir werden uns wohl noch mal etwas gründlicher dort drinnen umsehen müssen«, meinte er.
»Wenn du meinst, dass uns das etwas bringt!«
»Ich wüsste nicht, wo wir sonst einen Anhaltspunkt herbekommen sollen, wohin Valerie verschwunden ist.«
Da mit Hilfe der Regenbogenblumen sogar Zeitreisen sowohl in die Vergangenheit, als auch in die Zukunft, möglich waren, eröffneten sich einfach zu viele Möglichkeiten.
***
Valerie materialisierte inmitten einer Kolonie mannshoher Regenbogenblumen.
Sie hatte im ersten Moment ein Gefühl, als ob ihr jemand mit der Faust vor den Kopf geschlagen hätte. Sie fühlte sich benommen, ihr war einige Augenblicke schwindelig. Der Temperaturunterschied zwischen Südfrankreich und ihrem jetzigen Aufenthaltsort betrug schätzungsweise fünfzehn Grad. Aber die Hitze war nicht das, was Valerie im ersten Moment so sehr zu schaffen machte, sondern die hohe Luftfeuchtigkeit, die nahe bei hundert Prozent liegen musste.
Es dauerte einige Augenblicke, bis die junge Frau sich einigermaßen erholt hatte und wieder klar denken konnte.
Sie blickte auf die kleine Kratzwunde an ihrem linken Handballen. Sieben Striemen von den sieben Krallenfingern jenes winzigen Lemuren, der es geschafft hatte, zu ihr vorzudringen, ehe Professor Moronthor für die Vernichtung der ganzen Brut gesorgt hatte.
Die vorläufige Vernichtung!, korrigierte sich Valerie. Dieser Moronthor ist ein seltsamer Narr… Gut möglich, dass er seine Neugier einst noch mit dem Leben bezahlen wird - oder mit einem noch viel höheren Preis!
Die Striemen an ihrer Hand wurden jetzt von rotbrauner Kruste überzogen.
Ein tiefes Unbehagen machte sich auf einmal in ihr breit. Sie konnte diese Empfindung nicht erklären und wusste nur, dass sie sich von ihrem Magen ausgehend in ihrem gesamten Körper verbreitete.
Valerie spürte auf einmal sehr deutlich, dass eine Veränderung stattgefunden hatte.
Eine Veränderung, von der sie einstweilen noch nicht sagen konnte, worin sie wirklich bestand oder wodurch sie verursacht worden war. Noch brachte sie diese nicht mit der läppischen Wunde an ihrer Hand in Verbindung.
Und doch - da war so etwas wie ein Zwang in ihr, immer wieder auf ihren linken Handballen zu starren.
Ganz tief in ihrem Inneren glaubte sie dann etwas zu spüren.
Da war etwas Kaltes, Fremdes. Etwas, das nicht Bestandteil ihrer selbst war, sich aber dennoch in ihr tiefstes Inneres hineingeschlichen hatte.
Es wächst.
Es breitet sich aus.
Sie schluckte, riss ihren Blick fast gewaltsam vom Anblick der sieben Striemen fort.
Du bildest dir etwas ein. Mach dich nicht komplett zur Närrin, sondern konzentriere dich auf die Aufgabe, die du dir selbst gestellt hast.
Valerie trat aus der Blumenkolonie, die inmitten dicht nebeneinander wachsender Sträucher emporragten und so gut getarnt waren, heraus. Schließlich erreichte sie einen Weg, der am Ufer eines Sees entlangführte.
Geräusche drangen zu ihr herüber. Hupende Autos, Menschenstimmen, Motorengeräusche… Aber das alles klang wie aus weiter Ferne.
Valerie lächelte verhalten.
Sie befand sich am Ufer des im Norden der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh gelegenen Boeng Kar-Sees. An dessen Westufer befanden sich der Amüsement Park Boeng Kak und das ehemalige, im Kolonialstil gehaltene Franzosenviertel mit der eindrucksvollen früheren Botschaft der Grande Nation.
Im Süden des Sees war der Verkehrsstrom auf dem Boulevard Confederation de la Russie zu sehen, der parallel zu einer Bahnlinie die Stadt in west-östlicher Richtung durchzog. Während der Boulevard Confederation de la Russie und die Hauptlinie der Bahn weiter nach Westen in Richtung des Pochentong Airports führten, zweigte ein Gleis der Bahnstrecke nach Norden ab und führte am Seeufer entlang. Die Kolonie der Regenbogenblumen fand sich in einem verwilderten Stück Natur zwischen Bahnlinie und Seeufer. Es muss sie schon immer gegeben haben, diese Blumen, so hatte sie die Worte ihres Vaters noch im Ohr, als er ihr gezeigt hatte, wie man mit ihrer Hilfe reisen konnte. Nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Für einen Forscher wie Pierre de Bressac hatte das natürlich faszinierende Möglichkeiten eröffnet. Möglichkeiten, von denen alle seine Kollegen und Konkurrenten nur zu träumen wagten.
Den Ursprung dieser Pflanzen schien niemand zu kennen, selbst ein Gelehrter wie de Bressac nicht. Vielleicht hatte sie irgendjemand vor langer Zeit ausgesät, aber de Bressac hatte es auch für möglich gehalten, dass sie auf natürlichem Weg entstanden waren und sich verbreitet hatten. Der Gedanke, dass es möglicherweise eine Rasse unvorstellbar mächtiger Wesen gab oder einst gegeben hatte, die in der Lage waren, Pflanzen mit derartig phantastischen Eigenschaften heranzuzüchten, hatte Valeries Vater nie wirklich gefallen. Eher war er bereit gewesen, die Regenbogenblumen als eine - wenn auch bizarre - Laune der Natur zu akzeptieren.
Valerie folgte zunächst dem Seeufer des Boeng Kar, überquerte dann die Bahnlinie und erreichte den Boulevard Confederatipn de la Russie, auf dem sich ein dichter Strom unterschiedlichster Fahrzeuge ins Innere der Stadt quälte. Fahrradrikschas, Motorradkarren, Lastwagen, ausgediente Militärfahrzeuge aus den Beständen der DDR-Volksarmee und Wagen, die aus unzähligen Ersatzteilen zusammengeflickt zu sein schienen. Daneben aber auch fabrikneue Fahrzeuge der Marken Mercedes und Toyota, die trotz allen Hupens, die von Sebu-Rindern oder mageren, kaum über einssechzig großen Männern gezogenen Karren nicht zu überholen vermochten. Der Geruch von Benzol mischte sich mit Schweiß, Rinderkot und einem Dutzend anderer Ingredienzien, über die Valerie lieber nichts Genaueres wissen wollte.
Sie war nicht zum ersten Mal auf diesem sehr zeitsparenden Weg nach Phnom Penh gelangt. Insgesamt dreimal hatte sie ihren Vater hierhin begleitet, und so kannte sie sich einigermaßen aus.
Sie verzichtete darauf, irgendeines der im Verkehr steckenden Taxis anzuhalten und zuzusteigen, was in Phnom Penh durchaus üblich war.
Stattdessen überquerte sie nach einiger Mühe und nachdem sie beinahe von einer Motor verstärkten Fahrradrikscha ohne ausreichende Bremsen über den Haufen gefahren worden wäre, den Boulevard Confederation de la Russie und bog von dort in den Boulevard Tchecoslovaquie ein, auf dem weitaus weniger Betrieb herrschte.
Wie Valerie aus Erfahrung wusste, waren die Verkehrsverhältnisse für Phnom Penh im Moment eigentlich ganz annehmbar. Wirklich schwierig konnte es in der Regenzeit werden, wenn die Flüsse und Seen des Landes über die Ufer traten und vielerorts Straßen knietief unter Wasser standen. Die Hauptstadt bildete da keine Ausnahme.
Valerie wusste, dass sie noch einen ziemlich langen Weg vor sich hatte.
Ihr Ziel lag auf der anderen - südlichen - Seite der Stadt.
Und sie fühlte sich so schwach…
Anfangs hatte sie diese Schwäche auf das Klima geschoben, aber inzwischen war sie sich in dem Punkt nicht mehr sicher.
Sie begann trotz der Hitze von weit über dreißig Grad im Schatten plötzlich vor Kälte zu zittern. Eine Gänsehaut überzog ihren gesamten Körper. Es fühlte sich beinahe wie Schüttelfrost an, und sie befürchtete schon, sich irgendeine Krankheit eingefangen zu haben.
Da ist es wieder… dieses absolut Kalte im Innern deiner Seele. Es wächst. Und es hat nichts mit Malaria oder Schüttelfrost oder all den anderen Dingen zu tun, die man sich vielleicht in so heißen, sumpfigen Gegenden holen kann…
Sie versuchte ihre Gedanken hinwegzuscheuchen.
Ein einziger Wirrwarr an Empfindungen und flüchtigen Geistesblitzen herrschte in ihr.
Es fiel ihr schwer, überhaupt noch einen klaren Gedanken zu fassen.
Sie lehnte sich an eine Haus wand.
Eine Fahrradrikscha hielt. Der Fahrer bot ihr seine Dienste als Taxi an und sprach dabei ein einigermaßen verständliches Französisch.
Valerie konnte nicht antworten. Ein dicker Kloß saß ihr im Hals. Sie nickte nur stumm und stieg zu dem Kambodschaner auf die Rikscha. Dort sank sie förmlich in sich zusammen.
Auf dem Dach eines dreistöckigen Hauses erblickte Valerie dann im nächsten Moment einen langschwänzigen Affen, der auf irgendetwas herumkaute.
Namenloses Entsetzen durchzuckte sie und riss sie aus der Apathie, die sie befallen hatte.
Eine Sekunde noch redete sie sich verzweifelt ein, dass es sich vielleicht um einen ganz gewöhnlichen Affen handelte, die einen heiligen Status genossen und deswegen nicht gejagt werden durften. Mancherorts waren sie in Südasien deswegen zur Plage geworden.
Aber in diesem Augenblick entfaltete das Wesen auf dem Dach seine Flügel. Jeder Zweifel war ausgeschlossen.
Dies war ein Lemure.
Ein Diener Heng Sons.
Nein!, schrie es in ihr. Wenn sie hier schon auf dich warten, dann ist es vielleicht schon zu spät… oh, Vater, was hast du nur getan!
»Mademoiselle? Wohin soll ich Sie bringen?«
Die Stimme des Rikschafahrers drang wie aus sehr weiter Ferne in ihr Bewusstsein.
Wie in Trance murmelten ihre Lippen eine Adresse.
»Bringen Sie mich zu Monsieur François Lon, 321 Boulevard Mao Tse Toung.«
»Kein Problem. Nummer 321 müsste in der Nähe vom Toul Tom Pon Market sein!«, gab der Rikschafahrer zurück.
Aber davon bekam Valerie schon nichts mehr mit.
Alles drehte sich vor ihren Augen.
Dunkelheit senkte sich wie ein Leichentuch über ihren Geist, und sie verlor das Bewusstsein.
***
Moronthor und Nicandra waren in das Herrenhaus Pierre de Bressacs zurückgekehrt und stöberten dort nach etwas, was ihnen einen Hinweis darauf geben konnte, wohin Valerie verschwunden war.