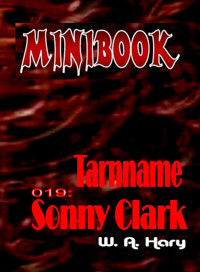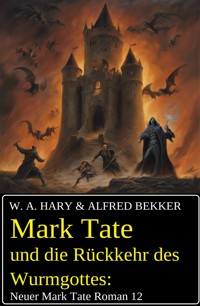Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält folgende Romane: (499) W.A.Hary: Mark Tate und die Voodoo-Hexte W.A.Hary: Mark Tate und das Erbe des Grauens W.A.Hary: Der Druden-Chirurg W.A.Hary: Trau keinem Geist um Mitternacht W.A.Hary: Hexagramm gefällig? Alfred Bekker: Dämonenmeister von Maskatan James Melvoin: Moronthor und der Tod über der Tunguska Mark Tate ist der Geister-Detektiv. Mit seinem magischen Amulett, dem Schavall, nimmter es mit den Mächten der Finsternis auf und folgt ihnen in andere Welten und wenn es sein muss, bis in die Hölle. Ihm zur Seite steht May Harris, die weiße Hexe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 890
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
7 Dämonische Gruselkrimis Mai 2024
Inhaltsverzeichnis
7 Dämonische Gruselkrimis Mai 2024
Copyright
Mark Tate und die Voodoo-Hexe
Mark Tate und das Erbe des Grauens
Der Druden-Chirurg
Trau keinem Geist um Mitternacht
Hexagramm gefällig?
Dämonenmeister von Maskatan
Moronthor und der Tod über der Tunguska
7 Dämonische Gruselkrimis Mai 2024
W.A.Hary, Alfred Bekker, James Melvoin
Dieses Buch enthält folgende Romane:
W.A.Hary: Mark Tate und die Voodoo-Hexte
W.A.Hary: Mark Tate und das Erbe des Grauens
W.A.Hary: Der Druden-Chirurg
W.A.Hary: Trau keinem Geist um Mitternacht
W.A.Hary: Hexagramm gefällig?
Alfred Bekker: Dämonenmeister von Maskatan
James Melvoin: Moronthor und der Tod über der Tunguska
Mark Tate ist der Geister-Detektiv. Mit seinem magischen Amulett, dem Schavall, nimmter es mit den Mächten der Finsternis auf und folgt ihnen in andere Welten und wenn es sein muss, bis in die Hölle. Ihm zur Seite steht May Harris, die weiße Hexe.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Mark Tate und die Voodoo-Hexe
W.A.Hary
Vorwort
Der Tote, den man vor Jahren verscharrt hatte, sah gräßlich aus. Jetzt schlug er die Augen auf. Anstelle normaler Augäpfel waren zwei taubeneigroße, glutrote Steine zu sehen - jedenfalls wirkte es so.
Die Hexe unterbrach das Voodoo-Ritual. Es hatte Erfolg gezeitigt. Sie verbeugte sich vor der aufgebahrten Leiche und murmelte voller Ergebenheit: »Willkommen im Reich der Lebenden, Meister!«
1
Der Tote richtete sich grollend auf. Sein zerfressener Körper begann sich zu regenerieren. Doch bekam er kein frisches Aussehen, sondern die Farbe, die in Spiritus konserviertes Fleisch besaß.
»Lange Zeit war mein Geist im Zwischenreich der Dämonen. Du, Hexe, hast mir ermöglicht, über meinen Körper, der schon fast vermodert ist, Kontakt mit dem Dasein zu bekommen. Meine einstige Macht ist gewachsen.« Die Worte strengten ihn sichtlich an, wenngleich er sehr schnell wieder zu Kräften kam. Schon nach Minuten konnte er sich ohne Hilfe von der Bahre erheben und die ersten tapsigen Schritte machen. Er ballte die bleichen, kalten Hände zu Fäusten. »Einst starb ich einen gewaltsamen Tod. Ich wittere die Spur der Mörderin. Sie hat ihren Kult verraten und ging mit einem Ungläubigen zusammen, der ihr gegen mich half. Nichts habe ich vergessen, und meine Rache wird furchtbar sein.«
»Ich habe recherchiert und bin auf dich gestoßen, großer Meister«, berichtete die Hexe mit gebeugtem Haupt. »Es ist in der Zwischenzeit viel geschehen.«
Der Tote antwortete nicht. Dann verwandelte er sich vor den Augen der Hexe endgültig in das, was er inzwischen war: ein Dämon. Der Körper behinderte ihn nicht mehr.
Sofort macht er sich mit der Hexe auf den Weg. Die Spur führte nach England, zum Schloß Pannymoore. Dort endete sie abrupt. Es gab keine Möglichkeit für die beiden gräßlichen Wesen, hier einzudringen.
Sie forschten weiter und gelangten nach London.
Es gab Menschen, die mit den Dingen um Schloß Pannymoore in enger Beziehung standen. Auf dem Schloß selbst stießen die Furchtbaren auf erbitterten Widerstand. Deshalb hielten sie sich an den Londoner Privatdetektiv Mark Tate und sagten ihm und seinen Freunden den Kampf an - nachdem sie sich einen Helfer beschafft hatten...
2
Ich verließ das Apartmenthaus in Bayswater, in dem ich unter dem Namen Mark Tate mit meiner Freundin May Harris wohnte, und schritt zu meinem Mietwagen. Meine Bewegungen waren mechanisch. Etwas stimmte nicht, obwohl es mir nicht bewußt wurde. Ich klemmte mich hinter das Steuer, um ins Zentrum zu fahren. Dort wollte ich dringende Besorgungen machen, während May die Koffer packte. Früh am nächsten Morgen wollten wir los. Lord Frank Burgess, der Herr von Schloß Pannymoore, hatte vor Tagen einen Hilferuf in Form eines Telegramms an Don Cooper geschickt. Durch die turbulenten Ereignisse der vergangenen Zeit kamen wir erst jetzt dazu, dem Ruf zu folgen.
Ich knallte den Wagenschlag zu, und im nächsten Augenblick hatte ich alles vergessen - hatte ich noch nicht einmal Angst vor dem Kommenden, obwohl ich allen Grund dazu gehabt hätte.
3
May Harris schloß gerade die voluminöse Reisetasche ihres Freundes und wollte sich ihren eigenen Sachen zuwenden. Es war noch eine Menge zu packen. Da schrillte das Telefon. Sie hob den Kopf und schaute erstaunt zu dem Apparat hinüber. Wer mochte das sein? Don Cooper? Achselzuckend ging sie hin und hob den Hörer ab.
»Hier bei Mark Tate«, meldete sie sich.
»Wer ist dort?« kam es stark näselnd zurück.
»May Harris. Ich bin in der Wohnung von Mark Tate und gerade beim Packen. Mark ist seit ein paar Minuten abwesend. Ich weiß nicht, wann er zurückkommt.«
May wurde nicht bewußt, was sie da redete, daß sie einem praktisch wildfremden Menschen offen alles sagte, was den im Moment interessieren könnte.
Der Anrufer kicherte verhalten. Als er wieder sprach, wurde sein französischer Akzent deutlicher.
»Nein, meine Liebe, das war es nicht, was mich interessierte. Ich weiß besser als Sie, wo sich Ihr Mark Tate befindet.«
»Ja? Dann bin ich ja beruhigt«, erklärte May widersinnig.
»Sind Sie allein in der Wohnung?«
»Ja, es wird auch niemand erwartet. Don Cooper stößt erst morgen früh zu uns. Wir fahren mit seinem Wagen nach Schloß Pannymoore. Das sind rund hundert Meilen, meines Wissens. Den Mietwagen lassen wir schon heute abend abholen. Wir brauchen ihn nicht mehr.«
Der Anrufer lachte heiser.
»Dann ist alles in bester Butter, meine Liebe. Ich werde Sie jetzt besuchen kommen.«
May zeigte sich erfreut.
»Oh, das wollen Sie wirklich tun, Meister? Ich freue mich darauf.«
»Tun Sie das, meine Liebe, und machen Sie Ihren herrlichen Hals frei. Vielleicht überkommt es mich und ich schlage meine Zähne hinein.«
»Ich kann es kaum erwarten. Kommen Sie schnell, Meister! Fünfter Stock hier im Apartmenthaus. Ich öffne jetzt schon die Tür.«
Ein schauriges Lachen kam aus dem Hörer. May erschrak darüber nicht. Mit einem verklärten Gesichtsausdruck schritt sie zur Tür und öffnete. In der Füllung blieb sie stehen und harrte aus.
Ihre Geduld wurde auf keine große Probe gestellt. Bald schon summte der Aufzug. Die Kabine blieb im fünften Stockwerk stehen. Leise zischend öffnete sich die Tür.
Im gleichen Augenblick schien jemand dichte Gardinen vor das wandhohe Fenster im Treppenhaus gezogen zu haben. Es wurde düster. Das immer brennende Licht des Fahrstuhles funktionierte nicht mehr. Die hohe Gestalt, die darin lauerte, war nur ein Schatten. In Augenhöhe glühte es, als befänden sich dort zwei Kohlestücke.
Dann stieß sich der Schatten an der Rückwand des Liftes ab und trat in das Treppenhaus.
Mit einem verzückten Lächeln breitete May Harris die Arme aus.
Sie wollte der Gestalt entgegengehen, doch übermannte sie das Glück dermaßen, daß sie nicht fähig war, auch nur einen Schritt vorwärts zu machen.
»Meister, du bist wirklich gekommen!«
»Ja, meine Liebe. Bist du bereit?« fragte die nasal klingende Stimme mit dem französischen Akzent. Irgendwie klang sie verzerrt, als komme sie gar nicht aus dieser Welt, sondern entstamme einem Grab.
»Allzeit für dich, mein Meister!« versicherte May Harris.
Die hochgewachsene Gestalt glitt lautlos auf sie zu. Sie brachte eisige Kälte mit, Kälte, die an den Tod erinnerte.
4
Auch Don Cooper packte seinen Koffer. Er war mittleren Alters, hatte einen schlanken, sportlich gestählten Körper, ein energisches Kinn und eisgraue Augen. Der schmale Oberlippenbart, den er sich erst seit kurzem wachsen ließ, kleidete ihn gut.
Es war warm an diesem Tag, weshalb Don Cooper in seiner Wohnung nur ein Unterhemd anhatte. Die Muskeln des Oberarms spielten unter der sonnengebräunten Haut, als er den Rest der Sachen, die er unterwegs benötigte, im Koffer verstaute. Er war schnell fertig geworden. Don Cooper verreiste nicht das erste Mal: Es gab kaum ein Fleckchen Erde, an dem er noch nicht gewesen war - ein reicher Abenteurer, den es nie lange an einem Ort hielt. Trotzdem kam er immer gern nach London, seiner Heimatstadt, zurück. Den Reichtum hatte er in erster Linie seinem Vater zu verdanken. Dieser war vor einigen Jahren verstorben und hatte Don Cooper und dessen Bruder das gesamte Vermögen vererbt. Don kam allerdings nur häppchenweise an sein Erbe heran. Das hatte seinen guten Grund: Der ungeheure Fleiß und die Strebsamkeit, die zum Reichtum seines Vaters geführt hatten, gingen ihm völlig ab. Don war ein Mann, der gern lebte, der das Leben in vollen Zügen genoß. Wenn er Geld hatte, gab er es mit beiden Händen aus, besaß er keines, war er genügsam und fand rasch einen legalen Weg, zu Geld zu kommen. Seine Feinde sprachen in diesem Zusammenhang von einer Art sechsten Sinn für Geschäfte. Don lachte darüber. Tatsache war, daß er auf das geerbte Vermögen letztlich nicht angewiesen war. Er hätte durchaus auch allein für seinen Unterhalt sorgen können.
Sein Bruder war von dem alten Herrn im Testament besser bedacht worden. Er ähnelte dem Vater am meisten und war ein reiner Buisnessman, wenngleich ihm die ungeheure Dynamik des Alten fehlte. Dons Bruder war ein Mensch mit Beständigkeit. Unter seiner Führung gab es für den Konzern weder Höhen noch Tiefen. Don und er hatten vielleicht auf Grund ihrer Verschiedenheit nicht viel füreinander übrig, obwohl Don auf seinen Reisen, die ihn überallhin führten, oft genug für wichtige Geschäftsverbindungen gesorgt hatte. Trotz allem nämlich fühlte er sich mit dem Konzern innerlich verbunden.
Don Coopers Gedanken verließen das Thema und wandten sich anderen Dingen zu. Er dachte an morgen früh, an Schloß Pannymoore und Lord Frank Burgess.
»Wäre Mark Tate nicht gewesen, wäre auf dem Schloß alles anders gekommen«, murmelte er halblaut vor sich hin.
In der Tat war Don Cooper vor Wochen an mich herangetreten und erzählte mir die Geschichte eines gräßlichen Fluches, der über dem Schloß hing. Er selber wäre beinahe ebenfalls Opfer davon geworden. Die dämonischen Kräfte des Schlosses hatten ihm immer noch zugesetzt, obwohl wir uns damals weit vom Schloß entfernt befunden hatten und zwar auf einem Schiff, das sich auf dem Weg nach Indien befand. Ich erfuhr von ihm, daß für das erneute Auftreten des Fluches des Schloßherrn Gattin verantwortlich zu machen sei. Ihre Herkunft sei ungewiß und bestimmt nicht adelig. Das schien auslösender Faktor gewesen zu sein. Die dämonischen Kräfte wurden ihr zum Verhängnis. Im Kindbett verstarb sie und geisterte nun als Wesen des Schattenreiches durch das Haus. Alles wies darauf hin, daß Lady Ann, die Frau des Lords, vor ihrem Ableben selber magische Fähigkeiten besessen hatte. Und wirklich gelang mir die Kontaktaufnahme. Mit Hilfe des Schavalls konnte ich den Fluch bannen.
Daran mußte Don Cooper im Moment denken - auch an den Umstand, daß Lady Ann zugegeben hatte, mit dem Voodoo-Glauben verbunden gewesen zu sein.
Don Cooper gab sich einen Ruck und schloß den Koffer. Er wollte sich dem Schrank zuwenden, als es an der Tür klingelte.
»Nanu«, überlegte er laut, »wer mag das sein?«
Stirnrunzelnd ging er hin. Da war ein eigenartiges Gefühl in seiner Brust - ein Gefühl, das ihn warnte. Trotzdem öffnete er.
5
Don Cooper wohnte in einem Apartmenthaus, ähnlich dem, in dem ich selber eine Wohnung hatte. Allerdings nannte Don Cooper das Penthouse sein Eigentum.
Vor der Wohnungstür lag ein schmaler Flur, an dessen Ende die Fahrstuhltür offenstand.
Allerdings hatte Don für dieses Detail im Moment kein Auge. Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit vielmehr auf den Besucher. Es handelte sich um einen breitschultrigen Mulatten, der fast die ganze Tür ausfüllte. Auffallender noch an dem Mann waren jedoch die Augen. Sie wirkten gebrochen wie die eines Toten.
Don zeigte sich irritiert.
»Sie wünschen?« erkundigte er sich.
»Sie sind Don Cooper?« drang es dumpf aus der mächtigen Brust des Mulatten.
Don bejahte das.
Der Mulatte hob die Arme.
»Ich will zu Ihnen. Der Meister schickt mich.«
Don Cooper reagierte blitzschnell. Er warf die Tür zu und verriegelte sie. Keine Sekunde zu früh. Etwas prallte mit großer Wucht gegen das Holz.
Gehetzt blickte sich Don um. Irgendwo hatte er eine geladene Waffe. Instinktiv hatte er erkannt, was ihm blühte. War der Mulatte allein? Wenn ja, besaß Don noch eine Chance.
Wieder krachte etwas gegen die Tür. Diesmal hielt diese dem Ansturm nicht mehr stand. Sie flog auf und traf mit einem donnernden Laut gegen die Wand. Wie ein mächtiger Rachegott stand der Mulatte in der Öffnung. Mit stierem Blick suchte er nach Don Cooper. Als er diesen erblickte, tapste er herein. Er wirkte dabei wie ein Roboter, und Don wurde in Weiterführung dieser Formulierung klar, daß es sich um einen Kampfroboter handelte.
Er sah nicht ein, daß er sich mit dem Mulatten in einen Zweikampf einlassen sollte, obwohl er sich berechtigte Chancen gab, einen solchen Kampf zu gewinnen. Don flüchtete ins Schlafzimmer zurück, denn endlich war ihm eingefallen, wo er seine Waffe hatte.
Obwohl er eine ganze Sammlung dieser Dinge besaß, in einem eigenen Raum, war nur die belgische Browning in der Nachttischschublade stets schußbereit. Er nahm sie an sich. Im gleichen Augenblick betrat der Mulatte das Schlafzimmer.
»Halt, stehenbleiben!« bellte Don Cooper.
Der Mulatte ließ sich nicht beirren. Seine Augen waren unnatürlich geweitet. Das Weiße dominierte. Mit staksigen Schritten kam er näher. Die mächtigen Hände öffneten und schlossen sich, als könnte er es kaum erwarten, Don Cooper zu packen und zu zerquetschen.
Don wich bis zur Wand zurück. Er scheute sich davor, auf einen Unbewaffneten zu schießen.
Dann war es zu spät zu weiteren Überlegungen in dieser Richtung. Der Riese hatte ihn erreicht und packte zu. Gottlob waren die Bewegungen des Mulatten langsam genug, um Don eine Ausweichmöglichkeit zu lassen. Der hochgewachsene, sportliche Mann duckte sich unter dem Griff und unterlief seinen Gegner. Ein mächtiger Uppercut ließ den Farbigen zwei Schritte zurücktaumeln. Das war aber auch die einzige Wirkung, die Don erzielte. Mit ungebrochener Angriffslust stürzte sich der Mulatte abermals auf ihn.
Diesmal sah Don Cooper keine Alternative. Er zog den Abzug durch. Die Browning, Kaliber 7,65, krachte los. Der Schall brach sich ohrenbetäubend an den Wänden. Trotzdem würde ihn kaum jemand außerhalb des Penthouse hören. Don hatte für ausreichende Isolierung gesorgt. Er konnte es sich leisten.
Die Kugel traf den Mulatten ins Bein. Deutlich stanzte sie ein Loch in den Stoff der Hose: Don hatte absichtlich so gezielt. Er wollte den Mulatten nicht umbringen, sondern lediglich kampfunfähig machen.
Weit gefehlt. Der Riese ließ sich nicht beeindrucken. Erschrocken registrierte Don, daß nicht ein einziger Tropfen Blut aus der Wunde kam. In seiner aufkeimenden Panik drückte Don erneut ab.
Diesmal bohrte sich das Geschoß in die linke Brustseite des Mulatten. Er reagierte darauf, wenn auch nicht so, wie es Don hätte erwarten können. Der Mulatte stutzte für einen Augenblick und unterbrach seinen Angriff. Don nutzte die Gelegenheit und setzte über das Bett hinweg. Er wollte zur Tür. Da kam in den Gegner wieder Bewegung. Es zeigte sich, daß der Riese behender war als angenommen. Er versperrte Don den Weg.
Das war der Zeitpunkt, an dem Don ein drittes Mal schoß. Irgendwo in seinem Gehirn war der Gedanke entstanden, der Mulatte hätte kugelsichere Kleidung unter dem Anzug. Das wäre eine Möglichkeit gewesen.
Die dritte Kugel klatschte dem Mann direkt in die Nasenwurzel. Es entstand ein gräßliches Loch, aus dem es gelblich-grün sickerte. Der Mulatte grunzte unwillig.
Don Cooper schrie. Er war ein Mann, der schon eine Menge erlebt hatte und den so schnell nichts erschüttern konnte, aber jetzt übermannte ihn das Grauen, und er brüllte sich alles aus dem Leib, was er empfand.
Zurückweichend leerte er das ganze Magazin gegen den Mulatten, und er betätigte auch noch den Abzug, als die Pistole nur noch ein häßliches Klicken von sich gab. Bis ihm der Riese die Waffe mit einem ärgerlichen Knurren entwand und in eine Ecke warf.
Jetzt konnte Don Cooper nicht mehr ausweichen.
Noch einmal nahm er all seine Kraft zusammen. Seine Hände krallten sich ineinander. Er riß sie hoch. Wuchtig trafen sie den Mulatten an der Kinnspitze. Doch das stachelte dessen Angriffslust nur noch mehr an. Er packte Don Cooper an den Schultern und warf ihn spielend leicht wie eine Puppe quer durch den Raum auf das Bett.
Als er näher tappte, grollte er: »Ich bin gekommen, um dich zu töten, Don Cooper!«
»Aber warum?« begehrte Don verzweifelt auf.
»Der Meister hat es befohlen, der Meister, der mich aus dem Reich der Toten zu sich gerufen hat. Er sagte mir, ich solle auf deine Stimme achten. Du sprachst mich an, und ich habe erkannt, daß du der Richtige bist. Der Meister schickt mich, und er will, daß ich keinen Fehler mache.«
Wie Schuppen fiel es Don von den Augen. Er begriff, daß der Mulatte kein lebendes Wesen war. Es handelte sich um einen sogenannten Untoten.
Dons erster Eindruck war richtig gewesen. Sein Gegner war eine Art Roboter, ein Kampfroboter, beseelt von den schwarzen Mächten des Jenseitigen.
Nein, mit einer Pistole konnte man keinen Menschen töten, der längst nicht mehr unter den Lebenden weilte.
6
Ich startete den Motor und fuhr an. Es gab kein bestimmtes Ziel, noch nicht, doch achtete ich nicht darauf. Etwas in mir war stärker. Es schaltete meinen Willen nicht völlig aus, sondern beherrschte mich mit suggestiver Kraft. Ich würde später noch Gelegenheit haben, mich mit dieser eigenartigen und ungewöhnlichen Einflußnahme auseinanderzusetzen. Jetzt war ich ihr Sklave. Ich glaubte, frei zu sein, und in Wahrheit wurden meine Gedanken alle unmerklich in eine bestimmte Richtung gelenkt.
Daher wußte ich kein Ziel. Dafür war ich noch nicht reif genug. Die Abhängigkeit von der unbekannten Macht wurde immer stärker, wuchs mit der Zeit.
Ursprünglich hatte ich Besorgungen machen wollen. Das war Hauptantriebsfeder geblieben. Nur suchte ich nicht nach einem bestimmten Geschäft. Ich ließ den Wagen langsam rollen, kam zu einer Ampel, mußte halten. Keiner der vorbeihastenden Menschen ahnte, was mit mir war. Kein Wunder, denn mir erging es genauso. Die Verkehrsampel sprang auf Grün. Ich legte den Gang ein und betätigte gedankenverloren den Blinker. Wie von einer Schnur gezogen bog ich ab. Unmerklich senkte sich mein Fuß auf das Gaspedal, so, als wäre er ein selbständiges Wesen und als fürchte er, daß ich auf sein Tun aufmerksam werde. Die Geschwindigkeit erhöhte sich, erreichte die zugelassene Höchstgrenze, überschritt sie.
Ich lächelte. Die Fahrt machte mir Spaß. Ich öffnete das Fenster, weil mir heiß war. Daß diese Hitze von dem wie verrückt glühenden Schavall auf meiner Brust stammte, ignorierte ich. Kühle Luft kam herein, zauste meine Haare. Ich legte den Kopf zurück und lachte. Mein Fuß verlor die scheinbare Scheu und trat kräftiger zu. Der Mietwagen machte einen Satz nach vorn. Er gehörte nicht zu den PS-starken, war nur ein Fahrzeug der unteren Mittelklasse. Trotzdem konnte er schnell genug fahren.
Immer schneller wurde der Wagen. Weit und breit war kein Bobby zu sehen. Mein Glück oder mein Pech. Jedenfalls wären mir innerhalb kürzester Zeit ein paar Streifenwagen auf dem Hals gewesen.
Links tauchten die ersten Ausläufer eines Parkes auf. War es Regents Park in St. Maryleborne? Es interessierte mich nicht. Die Tachonadel erreichte zitternd die Siebzig-Meilen-Marke, und sie blieb nicht stehen, sondern wanderte weiter. Der Motor gab einen infernalischen Lärm von sich. Autofahrer wichen erschrocken aus. Einige stoppten sogar ihr Fahrzeug. Mehrere Fußgänger schüttelten drohend die Fäuste. Ich kicherte nur. Die fremde Macht hatte mich vollends in den Klauen. Es gab kein Entrinnen mehr.
7
Bäume säumten die Straße. Parkgelände öffnete sich. Höchstgeschwindigkeit. Weiß traten meine Knöchel hervor. So fest umklammerte ich den Lenker. Gegenverkehr. Es störte mich wenig. Ich suchte mir die dicksten Bäume aus. Ich wollte das Steuer herumreißen und darauf zuhalten.
Es schien, als ahnte man mein Vorhaben. Fußgänger suchten Deckung. Nur der Lastwagenfahrer, der mit seinem schweren Brummer entgegenkam, achtete nicht auf mich. Ich steuerte erst auf die rechte Gegenfahrbahn, als wollte ich Anlauf nehmen.
Der Lastwagen entzog sich völlig meiner Achtsamkeit. Ich hatte nur Augen für die dicken Bäume, die mich zu locken schienen.
Gelächter gellte mir in den Ohren. Es erreichte mich nicht auf natürlichem Wege. Scheinbar klang es direkt in meinem Kopf auf.
Ich fiel in dieses Gelächter ein. Mein Gesicht war zur Fratze geworden.
Der Lastwagenfahrer hupte wie verrückt und stieg dann voll auf die Bremse.
Das rettete mir vorläufig das Leben. Ich raste auf ihn zu und riß nur wenige Yards vor ihm das Steuer herum.
Die Reifen protestierten kreischend. Das Heck brach aus. Schleudernd überquerte ich die linke Fahrbahn. Die Bäume sausten auf mich zu. Ich sah es wie in Zeitlupe. Wie Felsen standen sie da. Der Wagen, der bei dieser Geschwindigkeit wie ein Geschoß wirken mußte, würde sie nur ankratzen. Von ihm selbst und von mir würde nicht mehr viel übrigbleiben.
8
May Harris rührte sich nicht vom Fleck. Sie erwartete den entsetzlichen Tod - und das voller Verzücken. Der hohe Schatten des Unheimlichen glitt lautlos auf sie zu. Es schien sich um einen Geist zu handeln, denn es waren nicht einmal Atemgeräusche zu hören - etwa das gierige Schnaufen des Monsters, das sich seinem hilflosen Opfer näherte. Schaute man genauer hin, gewann man fast den Eindruck, das Wesen schwebe. Die glühenden Punkte in Augenhöhe wurden scheinbar von einem Teufel geschürt. Das unheimliche Glühen verstärkt sich. Strahlenbahnen lösten sich, erfaßten die wartende Gestalt Mays, tauchten sie in unwirkliches Licht.
May Harris schloß die Augen.
Nur noch zwei Schritte.
Noch einer und...
Der Unheimliche gab einen dumpfen Laut von sich und griff sich an die Brust. Sein linker Arm streckte sich zitternd der Frau entgegen, die ihre Augen wieder aufriß. Als hätte er an eine stromführende Leitung gefaßt, zog der Unheimliche seinen Arm schleunigst zurück. Er taumelte zwei Schritte von May Harris weg. Ein Grollen brach aus seiner Brust. Schatten huschten wie Nebelfetzen durch das Treppenhaus. Die diffuse Beleuchtung pulsierte. Das Grollen wurde zu einem qualvollen Stöhnen, als sich der Unheimliche zusammenkrümmte.
Schlagartig kam May Harris zu sich.
Glasklar stand die Erinnerung vor ihr. Sie begriff, was mit ihr passiert war, wie dicht sie am Tode vorbeigegangen war. Was sie nicht verstand, war das eigenartige Benehmen des Wesens vor ihr, dieser Ausgeburt der Hölle.
»Bleib hier!« grollte der Unmenschliche. Vergeblich versuchte May, Einzelheiten des Gesichtes zu erkennen, doch sie erkannte nur einen verwaschenen Fleck. Der Unheimliche schien das Licht zu schlucken, denn er wirkte immer noch wie ein dunkler Schatten.
»Bleib hier!« wiederholte er.
Und May Harris war so verwirrt, daß sie gehorchte.
Der Schatten richtete sich auf, hob beide Arme und kam auf sie zu. May vermochte es nicht, auszuweichen. Ein Teil der Macht nahm wieder von ihr Besitz. Sie kämpfte dagegen an und - gewann den Kampf. Und dann beherrschte sie nur noch das Grauen.
9
Der Unheimliche erreichte die Türöffnung. Er zuckte zusammen wie unter Stromstößen, als er nach ihr greifen wollte. Im nächsten Augenblick wurde er mehrere Yards frei durch die Luft geworfen, wie von einer unsichtbaren Faust getroffen. Direkt vor der offenen Fahrstuhltür blieb er liegen. Der Angriff aus dem Unsichtbaren hatte ihm so schwer zugesetzt, daß er es nicht mehr vermochte, die Maske aufrechtzuhalten. Für wenige Sekunden sah May Harris die gekrümmte Rückenpartie eines Mannes, der in Tücher gehüllt war wie ein altertümlicher Priester. Vom Gesicht erkannte sie nichts.
Plötzlich wandte er den Kopf. Die Haare wirkten wie emporzüngelnde Flammen, die jedoch nicht rot, sondern schwarz waren. Anstelle des Antlitzes immer noch der verwaschene Fleck mit den dämonisch glühenden Augen.
Im nächsten Moment war der alte Zustand wiederhergestellt. Das Treppenhaus verdunkelte sich, das Licht im Fahrstuhl erlosch.
May Harris beschloß endlich, die Tür ins Schloß zu werfen. Sie wußte nicht, was ihr geholfen hatte, aber es mußte mit der Wohnung zusammenhängen. Sie war vollgepfropft mit Dämonenbannern aller Art.
May kam nicht dazu, ihren Entschluß in die Tat umzusetzen. Schritte näherten sich über die Treppe. Sie blickte hinüber. Jemand schleppte sich mühsam hinauf. May Harris erkannte sofort, wer dieser Jemand war. Ihr stockte der Atem: Mark Tate!
»Mark!« murmelte sie verstört.
Er war blutbesudelt von oben bis unten und konnte sich kaum noch aufrecht halten.
»May!« flüsterte er ersterbend und taumelte auf sie zu.
May wollte ihn vor dem Unheimlichen warnen, doch dieser war auf einmal nicht mehr zu sehen. Sie dachte sich nichts dabei, verlor ihre Vorsicht, wollte nur noch ihrem Freund helfen und verließ die Wohnung. Sie lief Mark Tate entgegen, erreichte ihn, streckte ihm hilfreich die Hände hin.
Im selben Moment verwandelte sich der vermeintliche Freund. Er wurde zu dem Schattenwesen, das May kurz zuvor noch attackiert hatte.
Sie war einem Trugbild zum Opfer gefallen: Dem Unheimlichen war es doch gelungen, sie aus der schützenden Sphäre der Wohnung zu locken.
Wie ein Schlag traf sie die Erkenntnis. Nein, das Gesicht des Fremden war nicht nur ein verwaschener Fleck. Jetzt waren deutlich überlange Reißzähne zu sehen, das Gebiß eines Monsters, das nach ihrer Lebensenergie lechzte.
»Nein!« schrie sie verzweifelt. Ihr Schrei hallte von unsichtbaren Wänden wider. Der Unheimliche hatte mit einem magischen Schutzschild verhindert, daß es Zeugen für sein furchtbares Vorhaben gab.
Krallenhände zerfetzten Mays Kleid vor der Brust. Ihr zweiter Schrei verebbte.
10
Die Hände des Untoten waren eiskalt. Ihr Griff war so fest, daß Don Cooper dem nichts entgegensetzen konnte. Der Untote zwang seine Arme auf den Rücken.
»Verdammt, warum will dein Meister meinen Tod?« keuchte Don Cooper.
»Die Wege des Allmächtigen sind unergründlich«, orakelte der Mulatte monoton.
Don Cooper stieß ein heiseres Lachen aus.
»Aha, ein Größenwahnsinniger also, wenn er sich selber als allmächtig bezeichnet.«
»Der Meister ist der Mächtigste unter der Sonne und unter dem Mond. Die Schwarze Magie ist sein Werkzeug und der Tod sein Verbündeter.«
»Welchen Sinn hat mein Ableben?« begehrte Don Cooper auf. Verdammt, dachte er, ich hänge an diesem verrückten Leben! Ein grausiges Etwas stieg in ihm auf, schnürte ihm die Kehle zu. Es war die Angst.
»Der Meister will euch vernichten. Nur so kann er seine Rache durchführen. Ihr seid ihm im Weg. Er beschloß euren Tod, um zu bestrafen.«
»Kannst du dich nicht deutlicher ausdrücken?« Don Cooper schöpfte neue Hoffnungen. Der Untote preßte ihn auf das Bett, daß er meinte, das Kreuz breche ihm und er Schwierigkeiten mit dem Atem bekam. Trotzdem ließ er ihn noch am Leben. Es gab einen kleinen Aufschub, dessen Grund Don nicht kannte; gleichwohl klammerte er sich an die paar Minuten, in denen er länger leben sollte. So lange wie möglich wollte er sie hinauszögern.
»Nach dem ungeschriebenen Gesetz wird jeder Abtrünnige bestraft. Der Meister hat lange gebraucht, aber jetzt ist sein Bemühen von Erfolg gekrönt. Die Abtrünnige versteht sich zu widersetzen. Deshalb muß er erst die Verbündeten von ihr aus dem Weg räumen.«
Auf einmal ging Don Cooper ein Licht auf. War nicht Lady Ann eine ehemalige Voodoo-Hexe gewesen? Sie war nicht mehr am Leben, und ihr Geist, der auf Schloß Pannymoore umherirrte, war vernichtet worden, als Mark Tate mit seinem Schavall den Fluch brach. Und jetzt kamen die Anhänger der Voodoo-Sekte, der Lady Ann angehörte, um sich an ihr zu rächen. Wie durch ein Wunder war es ihnen geglückt, ihn, Don Cooper, ausfindig zu machen.
Wie durch ein Wunder?
Unterschätzte er bei diesem Gedanken nicht die Möglichkeiten der Voodoo-Anhänger?
Erschrocken kam Don Cooper zu Bewußtsein, daß der Untote in der Mehrzahl gesprochen hatte. War er, Don, nicht das einzige Opfer? Nahm man sich auch Mark Tates und May Harris' an?
»Du bist ein Zombie!« stieß er hervor.
Der Mulatte, den eine unheimliche Macht beseelte, ging nicht darauf ein. Er beugte sich tiefer zu Don hinab. Sein fauliger Atem, der von der Kälte des Todes durchdrungen war, streifte das Genick des Mannes.
»Sage mir, wo sich die Hexe befindet, die ihre Brüder und Schwestern verraten hat! Sage es mir!«
Das war also der Grund, warum der Zombie Don nicht sofort erledigt hatte. Kein Wunder, daß die Voodoo-Anhänger Lady Ann nicht finden konnten. Möglicherweise hatten sie sich um Schloß Pannymoore gekümmert, aber bei allem, was sich dort ereignet hatte, war natürlich jegliche Spur verwischt, und die Resteinflüsse der Magie, die in dem Gemäuer steckten, erschwerten Nachforschungen.
In diesem Zusammenhang dachte Don an seinen alten Freund Lord Frank Burgess. Er glaubte nun den Grund für dessen Hilferuf zu wissen.
Was sollte er dem Zombie sagen?
Der untote Mulatte verstärkte seinen Druck. Don schrie schmerzerfüllt auf.
»Laß das! Ich werde dir alles sagen, was ich weiß!«
Der Zombie ging darauf ein.
»Logisch, daß ihr Lady Ann nicht findet«, beeilte sich Don Cooper zu sagen. »Sie hat große Macht und versteht sich abzuschirmen. Du mußt mich am Leben lassen. Mir vertraut sie. Ihr kommt nur an sie heran durch mich.«
Der Zombie zögerte. Don entging es nicht. Hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen? Die magischen Fähigkeiten der verstorbenen Lady Ann waren unzweifelhaft vorhanden gewesen, aber waren sie so umfangreich, daß man seinen Worten Glauben schenken konnte?
Sie waren! Der Zombie entließ Don Cooper aus seinem Griff.
11
Es dauerte eine Weile, bis der hochgewachsene, sportliche Mann das begriff. So lange blieb er noch regungslos auf dem Bett liegen. Dann kam Bewegung in ihn. Im nächsten Augenblick stöhnte er laut. Er hatte den Eindruck, daß ihm der Untote sämtliche Knochen gebrochen hatte. Alle Glieder schmerzten. Als Don aber seinen Körper durchcheckte, erkannte er, daß es nicht so schlimm war. Er sah auf.
Die gebrochenen Augen des Untoten fixierten ihn. Der Mulatte roch süßlich. Don rümpfte unwillkürlich die Nase. Wenn er bedachte, daß er mit diesem Schattenwesen gerungen hatte, wurde ihm nachträglich noch speiübel.
»Was hast du nun vor?« erkundigte er sich vorsichtig.
»Abwarten!« war die lapidare Antwort.
»Auf was warten wir?«
»Auf das Kommen des Meisters. Er weiß für alles Rat und gab mir entsprechende Order. Er wird endgültig über dein Schicksal entscheiden.«
Und mich umbringen lassen, wenn ich mich als nicht nützlich erweise, ergänzte Don in Gedanken bitter.
Er zermarterte sein Gehirn nach einem Ausweg aus der Misere. Er sah keinen.
Dann dachte er an seine Freunde, an Mark Tate, an May Harris und - nicht zuletzt - an Lord Frank Burgess. Letzterer tat ihm ehrlich leid. Was der Lord bereits hatte erleben müssen im Umgang mit den Mächten der Finsternis, war zuviel für einen einzelnen Menschen. Und jetzt sollte er das Opfer des Voodoo geworden sein?
Don Cooper kramte zusammen, was er über den Sektenglauben in der Karibik wußte. Dabei erkannte er, daß es nicht sehr viel war. Überhaupt wurden in einschlägigen Schriften über Voodoo mitunter recht unterschiedliche Ansichten vertreten. Es kam dabei auch darauf an, wie sehr der Schreiber mit dem Okkulten und der Mystik verwachsen war. Generell steht nur fest, daß Voodoo ein Kult ist, der entstand, als die afrikanischen Negersklaven, behaftet mit dem heidnischen Glauben ihrer Heimat, in der Karibik mit dem Christentum zusammentrafen. Ihre Götter behielten sie, das Christentum wurde in ihre Vorstellungswelt sozusagen integriert. Kein Wunder, daß bei diesem Durcheinander nicht einmal mehr Experten durchblickten.
Eines stand für Don Cooper von Stund an fest: Es war keine Scharlatanerie. Seine Anhänger vermochten es sogar, Tote zu wecken. Das Beispiel dafür saß vor ihm - in der Gestalt eines sogenannten Zombies.
»Was habt ihr Schweine mit meinen Freunden gemacht?« knurrte Don Cooper.
Aus dem untoten Mulatten war keine Information mehr herauszuholen.
Es blieb Don Cooper nichts anderes übrig, als mit ihm der Dinge zu harren, die da noch kommen würden.
12
Der Schmerz auf meiner Brust wurde unerträglich. Es war, als bohre sich ein glühender Eisenstab in meinem Körper. Ich stöhnte gequält auf und verlor vorübergehend die Herrschaft über das Steuer. Der Wagen schleuderte wild hin und her. Ich hatte offenbar einen besonders guten Schutzengel. Um Haaresbreite verfehlte ich die Bäume. Das Fahrzeug raste wieder auf die Straße zu, überquerte diese und kam den Häusern auf der anderen Seite bedrohlich nahe. Für Sekundenbruchteile, wie Momentaufnahmen, sah ich schreckverzerrte Gesichter vor der Windschutzscheibe auftauchen und wieder verschwinden - Menschen, die ich nur knapp verfehlte.
Ich rang verzweifelt nach Luft. Der Schmerz hatte ein Stadium absoluter Unerträglichkeit erreicht. Instinktiv löste ich meine Rechte vom Lenkrad und griff nach dem Ding, das mich so folterte.
Schlagartig war alles vorbei. Der Schavall, der mir die Qualen bereitet hatte, fühlte sich in der Hand nur mäßig warm an. Seine Hitze war magischer Natur gewesen. Sie hatte den Bann gelöst, und ich wußte, was geschehen war.
Allerdings hatte ich im Moment keine Zeit, darüber erschrocken zu sein, denn der Wagen schlitterte wieder quer über die Fahrbahn und erreichte fast die Baumreihe, die beinahe doch noch mein Schicksal besiegelt hätte.
Es zeigte sich, daß ich mich auf meine Fahrkünste verlassen konnte, denn es gelang mir endlich, das Fahrzeug unter Kontrolle zu kriegen. Sofort verließ ich die Straße an einer Abzweigung. Erst als mehrere Häuserblocks zwischen mir und dem Ort der Ereignisse lagen, wagte ich zu stoppen. In der Ferne klang das Schrillen der Alarmglocken auf. Also war die Polizei bereits unterwegs. Ich hoffte nur, daß sich keiner das Kennzeichen des Wagens gemerkt hatte. Gottlob war kein Mensch zu Schaden gekommen, was leicht hätte passieren können.
So blieb nur noch ein einziger Wunsch: Ich wollte nicht der Polizei endlos lange schwierige Fragen beantworten müssen.
Erst als der Wagen parkte, machten sich die Nachwirkungen der Geschehnisse bemerkbar. Ich hielt den Schavall fest in beiden Händen. Er hatte unzweifelhaft mein Leben gerettet - obwohl er sich dazu hätte einer anderen Methode bedienen können, dachte ich in einem Anflug von Bitterkeit. Aber konnte ich dem Dämonenauge wirklich Schuld geben? Normalerweise sprach es sofort an, wenn sich ein negatives magisches Feld aufbaute. Es reagierte darauf mit magischer Erhitzung. Ja, eigentlich war nicht mehr geschehen. Die Warnung war nicht mit Absicht so schmerzhaft gewesen. Der Schavall hatte sich benommen wie ein Instrument mit bestimmten Eigenschaften. Zu wundern brauchte ich mich darüber nicht. Bei dem Schavall hatte ich das ohnedies längst aufgegeben. Das Ding war absolut unberechenbar und blieb das auch. Oft genug hatte es echtes Eigenleben bewiesen. Ich dachte an die Worte der alten Hexe in Indien, die mir den Schavall geschenkt hatte, weil sie sich mir gegenüber zur Dankbarkeit verpflichtet gefühlt hatte. Über den Schavall gab es praktisch keine erreichbaren Informationen. Ich hatte da schon alle möglichen Schritte unternommen - ohne Erfolg.
Vor Jahren, im Rahmen von Recherchen in einem Fall, in dem es um Teufelsanbeter ging, war ich zum erstenmal auf den Begriff »Goriten« gestoßen. Ich erfuhr, daß es sich dabei um die Bezeichnung eines Stammes handelte, der zu unbekannter Zeit an einem unbekannten Ort bestanden habe. Es war ein künstlicher Stamm, ein Zusammenschluß von Zauberern, Medizinmännern, Priestern und Magiern aus verschiedenen Völkern. Die Männer und Frauen hatten ihr Leben der Magie gewidmet.
Seltsamerweise gibt es über ihr Wirken keine Unterlagen. Sie sind verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Das einzige, was ich über sie bis zu jenem Sommer 1977 gefunden hatte, waren Spurenfragmente. Eines davon war der Schavall. Die Hexe hatte mir versichert, er stamme aus der Werkstatt der Goriten. Leider hatte sie mir nicht mehr verraten können, auch nicht, wie sie zu dem Dämonenauge gekommen war, denn wenig später wurde sie das Opfer einer Rivalin. Ein bedauerlicher Verlust, wie ich fand, denn die indische Hexe war keine reine Vertreterin der Schwarzen Künste gewesen. Sie hatte ihre Fähigkeiten oft genug für gute Zwecke verwandt.
Noch immer war ich auf der Suche nach dem Geheimnis der Goriten. Oftmals glaubte ich, eine echte Spur gefunden zu haben, doch nie gelang es mir, sie bis zum Ende zu verfolgen.
Der Schavall hätte mir mehr sagen können, allein, er entzog sich meiner Einflußnahme. Angeblich war Schavall ein mächtiger Geist gewesen, der in den seltsamen Stein eingeschlossen wurde und dem Schmuckstück seinen Namen gab. Ich hatte einmal versucht, dem Stein durch chemische Analyse hinter die Schliche zu kommen. Dabei jedoch flog mir das halbe Labor um die Ohren. Glücklicherweise kam ich mit heiler Haut davon. Von diesem Zeitpunkt an ging ich vorsichtiger mit dem Ding um. Bestand der Stein aus reiner magischer Energie?
Ich schreckte aus meinen Gedanken und atmete tief durch. Meine Knie fühlten sich so weich an wie Pudding. Trotzdem konnte ich hier nicht ewig stehenbleiben. Ich mußte weiter - vor allem zu meiner Wohnung zurück. Die Besorgungen würde ich auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Ich machte mir ehrlich Sorgen um May Harris. Was war unterdessen mit ihr geschehen? Wurde auch sie von den geheimnisvollen Mächten attackierte, die mich beinahe das Leben gekostet hätten.
Ich griff nach dem Zündschlüssel, um den Motor zu starten. Inzwischen hatten mehrere Streifenwagen meinen Standort passiert. Niemand achtete auf mich. In der Aufregung war es anscheinend niemandem eingefallen, sich mein Kennzeichen zu merken. Ich bedauerte die Umstände sehr, aber es hätte keinen Sinn gehabt, wenn ich mich der Polizei gestellt hätte. Für die Vorfälle konnte ich nichts. Ein anderer war dafür verantwortlich, und diesen anderen wollte ich finden.
Die Maschine heulte auf. Ich legte den ersten Gang ein, dabei immer wieder voller Sorge an May denkend. Ob ihr etwas geschehen war? Ich hatte eine Art sechsten Sinn für Geschehnisse. Bis jetzt konnte ich mich fast immer darauf verlassen. Und im Moment sagte er mir, daß es brenzlig war.
Ich wollte losfahren, kam jedoch nicht dazu. Ein wütendes Knurren ließ mich wie zur Salzsäule erstarren. Ich brauchte ein paar Sekunden, um meine Fassung wiederzuerlangen. Mein Kopf ruckte herum.
Es saß jemand im Fond des Wagens. Keine Ahnung, wie er dahin gekommen war.
Ich betrachtete das Wesen genauer. Dabei rieselte es mir eiskalt über den Rücken.
13
May Harris war wie gelähmt gewesen. Plötzlich konnte sie sich wieder bewegen. Fassungslos blickte sie an sich herab. Da waren ihre nackten Brüste.
Das Schattenwesen war vor ihr wieder zurückgeschreckt. Es fauchte enttäuscht.
May erkannte, welchem Umstand das zu verdanken war. Mark Tate hatte ihr eine sogenannte gnostische Gemme um den Hals gehängt, ein Dämonenbanner also. Als der Unheimliche ihr Kleid zerrissen hatte, war das Ding zum Vorschein gekommen.
Die Gemme erwärmte sich merklich und begann sich zu verformen. Ein untrügliches Zeichen, daß sie dem Schattenwesen auf die Dauer keinen Widerstand entgegensetzen konnte.
May Harris durfte keine Zeit verlieren. Sie warf sich herum und ergriff die Flucht. Der Unheimliche setzte ihr sofort nach, doch erreichte May vor ihm die schützende Sphäre der Wohnung. Kein Dämon konnte ihr ins Innere folgen. Sie warf die Tür hinter sich ins Schloß und lehnte sich schweratmend dagegen.
Ein Erdbeben ließ das Gebäude erzittern. Der Unheimliche draußen raste. Er konnte es anscheinend nicht verkraften, daß ihm sein Opfer so knapp entronnen war.
May Harris hörte seine Stimme. Der französische Akzent war deutlicher als je zuvor: »Ich bin der Meister. Freue dich nicht zu früh, May Harris! Du gehörst mir. Meine Rache wird furchtbar sein. Tausend Qualen wirst du erleiden und dich nach dem Tode sehnen, solltest du jemals wieder dieses Apartment verlassen!«
14
May Harris lauschte zitternd, aber draußen blieb nach der schrecklichen Drohung alles ruhig. Hatte sich der Unheimliche zurückgezogen? Sie mochte es nicht glauben.
May überlegte. Die ungezählten Dämonenbanner hier schützten sie. Wieso war es dem Unheimlichen dennoch gelungen, sie während des Telefonates in seine geistige Gewalt zu bekommen? Auf diese Frage fand sie keine Antwort.
Zum ersten Mal blickte sie sich in dem Apartment genauer um.
Es war das Eigentum Mark Tates. Hier wohnte er immer, wenn er sich in London befand. Im Laufe der Jahre hatte er viele Dinge zusammengetragen.
Die Wohnung befand sich in einem Apartmenthaus im fünften Stockwerk. Das Gebäude stand im Ortsteil Bayswater, der zur City of Westminster gehört. Ganz in der Nähe gab es einen U-Bahnhof, die Bayswaterstation. In jedem Stockwerk waren zu jener Zeit zehn Apartments. Mark hatte eines der kleinsten - ungefähr dreißig Quadratyards.
Die Einrichtung der Wohnung war nicht gerade luxuriös zu nennen. Links neben dem Fenster stand eine Schrankwand. Sie beherbergte nicht nur ein ausklappbares Bett, sondern auch Kleider. Davor stand ein niedriger, kreisrunder Tisch, der Schrank und Sesselgruppe voneinander trennte. In der Ecke war die Kochnische mit Elektroplatten, Kühlschrank, Dunstabzugshaube und schmalen Schränkchen zur Aufnahme des Geschirrs. Auch ein tragbarer Fernseher, Eßzimmertisch und Stühle fehlten nicht.
Direkt neben dem Eingang ging es rechts zum Badezimmer. Es war winzig, hatte nur Platz für eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette, bei deren Benutzung korpulente Menschen ihre Schwierigkeiten hätten.
An den Wänden hingen Bilder mit schaurigen Szenen. Diese Bilder entsprachen nicht gerade dem Geschmack des Besitzers, waren aber recht nützlich, was ihre abwehrende magische Wirkung anbetraf. Der Boden war mit einem Perserteppich ausgelegt, der den Eindruck machte, bereits Jahrtausende ohne großen Schaden überstanden zu haben. Dieser Eindruck trog nicht. Der Teppich war von besonderer Art - ebenso wie die kleinen Figuren, die teilweise auf Wandbrettchen, einfach auf dem Boden und auch im Schrank hinter Glas standen.
Der absolute Höhepunkt befand sich direkt an der Eingangstür. In Schulterhöhe hing dort eine Teufelsmaske. Sie wirkte wie die Präparierung des Gesichtes des Leibhaftigen. Ein Kunstwerk. Die Augen waren herausgearbeitet. Sie schienen zu leben. In den senkrechten Schlitzpupillen irrlichterte es deutlich.
In May Harris hallten die Worte ihres Freundes nach: »Die wirkungsvollste Waffe gegen Dämonen sind Nachbildungen von ihnen. Allerdings soll das kein Pauschalurteil sein. Es kommt weniger auf die Abbildungen an als auf die Umstände, bei denen sie entstanden sind. Es ist ähnlich wie bei den sogenannten Aktionskünstlern. Ihre Kunstwerke sind läppische Utensilien ohne eigentlichen Wert. Ihr Wert besteht nur darin, daß sie bei einer bestimmten Aktion die Hauptrolle spielten. Sie wurden dadurch gewissermaßen zu statischen Symbolen eines längst abgeschlossenen Handlungsablaufes.
Es ist tatsächlich so, daß sich magische Handlungen in Gegenständen manifestieren können. Diese Teufelsmaske hier zum Beispiel ist das Ergebnis einer Satansbeschwörung, die schon Jahrtausende zurückliegt. Einzelheiten weiß ich darüber nicht. Aber schau dir das Ergebnis an. Sie scheint nicht gealtert zu sein, wirkt lebendig und wie gerade erst entstanden. Das ist ein Hinweis darauf, daß sie unter entsetzlichen Umständen entstand. Doch stellt sie in sich einen Triumph über das Böse dar, obwohl sie selbst wie die Personifizierung des Bösen erscheint.«
May Harris überlief es noch nachträglich eiskalt. Sie hatte sich nie Gedanken darüber gemacht. Das war verständlich. Eine Frau konnte sich in einer solchen Umgebung kaum wohlfühlen, wenn sie es nicht verstand, all diese Dinge zu ignorieren.
Und da lag sozusagen der Hase im Pfeffer. Es war ihr die Ignorierung so perfekt gelungen, daß der Schutz an Wirksamkeit verloren hatte. Nur so konnte es dem Unheimlichen gelingen, sie vorübergehend in seine geistige Gewalt zu bekommen. Jedoch war es ihm unmöglich gewesen, die Sphäre der Weißen Magie zu betreten. Im Gegenteil, sie hatte ihm so sehr zugesetzt, daß er May aus seinem Bann hatte entlassen müssen.
May Harris betrachtete die Teufelsmaske. Die Augen schienen jede ihrer Bewegungen zu belauern.
Schaudernd wich sie zurück, bis sie mit den Kniekehlen gegen etwas stieß. Es war eine Sessellehne. Sie ließ sich einfach in das Sitzmöbel sinken und vergrub das Gesicht in den Händen. Sie ertrug ihre Umgebung nicht mehr. Ja, es war ihr nicht schwergefallen, dies alles über einen bestimmten Zeitraum von ihrem Bewußtsein fernzuhalten. Ohne diese Fähigkeit hätte sie es auch nicht mit gesundem Verstand überstanden, fünfzehn Jahre mit einem Teufelsdiener als dessen Gefangene zu verbringen. Ihr Mann hatte sich mehr und mehr in einen Dämon verwandelt. Erst Mark Tate hatte den entscheidenden Anstoß zu seiner Vernichtung gegeben.
May war bei Mark geblieben - nicht allein aus Dankbarkeit, sondern weil sie den Mann liebte.
Als May an ihren Freund dachte, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ließ ihnen freien Lauf.
15
Erst hatte ich den Eindruck, ein Kind vor mir zu haben. Der Körper stimmte. Es war der eines kleinen Mädchens. Nur der Kopf sprach dem extrem entgegen. Ein runzeliges, häßliches Gesicht, schüttere, stark ergraute Haare. Eine Mulattin. Als ich ihr in die Augen blickte, erkannte ich die Hexe.
Sie verzog den Mund zu einem gemeinen Grinsen. Dabei kamen faule Zahnstummel zum Vorschein. Ein widerlicher Geruch ging von dem Wesen aus, das kein gewöhnlicher Mensch war.
»Sterben sollst du, qualvoll verrecken!« keifte sie in einem Französisch, das nur an einem Ort der Welt gesprochen wird: auf Haiti. »Der Meister hat deinen Tod beschlossen. Ich bin gern sein ausführendes Organ.«
Sie kicherte irr und rollte mit den Augen.
Damit erschien sie wie eine Irre, die nicht angsteinflößend, sondern eher lächerlich, wirkte. Ich wußte es besser. Deutlich spürte ich die dämonische Ausstrahlung und tastete nach meinem Schavall.
Als sie das gewahrte, fauchte sie wie eine Wildkatze. Sie zog sich in den hintersten Winkel des Wagenfonds zurück. Hilflos gab sie sich, und ich ahnte, daß sie sich auf einen Angriff vorbereitete. Grimmig wartete ich darauf, hoffend, daß mich der Schavall nicht im Stich ließ. Allerdings vermißte ich eine Reaktion des Dämonenauges. Es erwärmte sich nicht.
»Du warst es, der mich in den Tod führen wollte?« fragte ich gepreßt. »Wie hast du es geschafft - trotz der Dämonenbanner, die ich immer bei mir trage?«
Sie lachte heiser.
»Du darfst mich nicht unterschätzen.«
Daß sie damit recht hatte, bewies sie mir sofort. Ihre Konturen begannen zu verschwimmen. Innerhalb von Sekunden verwandelte sich das häßliche Geschöpf in eine vollbusige Blondine. Das Abendkleid war so tief ausgeschnitten wie die Sünde. Sie lächelte verführerisch.
»Das ist mein wahres Gesicht«, säuselte das Wesen. »Gefalle ich dir, Mark Tate? Ich bin für dich da. Warum sollen wir uns bekämpfen? Der Meister ist beschäftigt. Er weiß nicht, was hier geschieht.« Provozierend reckte sie sich. Ihre Stimme schmeichelte: »Ich mag Männer wie dich. Vergiß, was geschehen ist. Mir tut es selber leid. Vergiß meine abstoßende Maske, für die der Meister verantwortlich ist. Werde mein Liebhaber. Der Meister braucht mich. Er wird auf meine Wünsche eingehen und dich verschonen. Das verspreche ich dir.«
Ich konnte es nicht verhindern, daß mir schwindelte.
Mit lasziven Gesten raffte sie langsam das Abendkleid. Makellose Schenkel kamen zum Vorschein. Die ungewöhnlich schöne Frau bot sich mir an, und schon spürte ich brennendes Verlangen in mir emporsteigen. Der Schavall blieb kalt und leblos wie ein gewöhnliches Schmuckstück. Hieß das, daß keine Gefahr drohte?
Schon löste ich meine Hand davon. Das Bedürfnis, das zarte Geschöpf, die Inkarnation der Weiblichkeit, in die Arme zu nehmen, wurde übermächtig.
In meinem Kopf schrillte eine Alarmglocke. Etwas sickerte in mein Bewußtsein: die Erinnerung an die von Homer beschriebenen Sirenen, die vielen tapferen Männern zum Verhängnis geworden waren.
Blitzschnell handelte ich. Noch war es nicht zu spät. Noch war ich der Hexe nicht verfallen.
Ich griff in die Innentasche meines Jacketts und brachte einen Drudenfuß zum Vorschein. Er hatte einen Durchmesser von einem Zoll und war aus Silber. Dieses Ding hielt ich der Hexe hin.
Das wunderschöne Gesicht verzerrte sich.
Ich ging noch einen Schritt weiter, indem ich der Hexe den Drudenfuß gegen die Stirn preßte.
Qualm stieg auf. Es roch nach verbranntem Fleisch. Die Arme der Hexe ruckten hoch. Sie machte eine abwehrende Geste, die jedoch viel zu schwach war.
Die Rückverwandlung begann. Da saß wieder das häßliche Geschöpf.
Kaum war die Metamorphose abgeschlossen, als der Drudenfuß in meiner Hand butterweich wurde. Er erhitzte sich so sehr, daß ich ihn nicht mehr halten konnte. Als formloser Klumpen fiel er in den Spalt zwischen Vorder- und Hintersitze.
Ich war beeindruckt. Die Demonstration der Macht war der Hexe überzeugend gelungen.
16
Ehe ich mich von meiner Betroffenheit erholen konnte, richtete sie ihre Augen auf mich. Sie schienen immer größer zu werden, bis sie fast mein gesamtes Gesichtsfeld ausfüllten. Mit einem erstickten Laut klammerte ich mich an den Schavall.
Noch immer reagierte das Dämonenauge nicht. Ich verfluchte seine Unzulänglichkeit und versuchte, aus dem Bann der Hexe zu kommen. Es gelang mir nicht. Die magischen Fähigkeiten des Wesens waren zu umfangreich. Dicke Schweißperlen erschienen auf meiner Stirn, während ich mich wehrte. Mit letzter Kraft gelang es mir, ein weiteres Dämonenbanner aus der Tasche zu ziehen, ein sechszackiges Hexagramm, in der Form zweier verdreht übereinander angeordneter Dreiecke gearbeitet.
Mein Arm schien Zentner zu wiegen, als ich ihn hob.
Die Hexe zeigte sich durch das Banner unbeeindruckt. Auch das Hexagramm wurde zu einem kleinen Metallklümpchen und somit unbrauchbar.
Die Hexe lachte hämisch.
»Deine Bemühungen sind vergeblich, und das Ding da an deiner Brust läßt dich diesmal im Stich. Jetzt werde ich dich töten. Nein, keine Angst, ich werde mir damit Zeit lassen. Du sollst es genießen. Das bin ich dir schuldig.«
Ich wollte etwas sagen, aber die Stimme versagte mir den Dienst.
Mir wurde ermöglicht, den Blick zu wenden. Außerhalb des Wagens wallten diffuse Nebel. Ich wußte, daß der Wagen im Moment von außen unsichtbar war. Die Hexe hatte ihn in eine eigene Sphäre entführt.
Noch immer fragte ich mich verzweifelt, was mit dem Schavall los war. Hingegen, es war nicht das erste Mal, daß er mich so schmählich im Stich ließ. Es hatte keinen Sinn, darüber zu jammern. Das änderte gar nichts. Das Ding war und blieb unberechenbar.
Die Hexe begann mit ihren Attacken. Sie bereiteten ihr satanische Freude.
Eine Schmerzwelle durchraste meinen Körper. Das Innere des Wagens bekam die Temperatur eines Backofens. Und ich vermeinte, in einem Stahlkorsett zu stecken, das jeden Versuch, mich zu bewegen, im Keim erstickte.
»Hör auf!« keuchte ich.
Sie griente über ihr ganzes häßliches Gesicht.
»Warum denn? Der Spaß hat doch erst begonnen!«
17
Ich versuchte ein letztes Mittel zur Gegenwehr, indem ich anfing zu beten.
»Vater unser, der du bist im Himmel...«
Sie brach in schallendes Gelächter aus. Es war ihr ein leichtes, mir den Mund zu schließen. Kein Wort mehr kam über meine Lippen.
Plötzlich hatte sie eine lange, glühende Nadel in der Hand.
»Wie gefällt dir die, Mark Tate? Oder findest du, sie ist deiner nicht würdig?«
Die Nadel verwandelte sich in eine zischende Schlange, die nach mir stieß. Im nächsten Moment löste sie sich in einen dünnen Rauchfaden auf, der sich allmählich verflüchtigte.
»Nein, das ist alles nichts«, beschloß die Hexe. »Es gibt etwas viel Besseres. Du bist ein Mann, Mark Tate, und das wirst du jetzt verfluchen.«
Sie verwandelte sich in die betörende Blondine und näherte sich mir. Auf einmal war die Rückenlehne des Fahrersitzes nicht mehr da. Die Blondine küßte mich auf den Mund. Es brannte wie Feuer. Da war der Druck ihrer vollen Brüste.
Mein Gott, dachte ich. Wahrscheinlich sagte ich diese Worte auch laut, denn die Hexe lächelte amüsiert. Mir schwindelte. Ich konnte kaum noch zwischen Wirklichkeit und Alptraum unterscheiden. Mein Gott, was hat sie mit mir vor?
»Zeitvertreib«, versicherte sie schmunzelnd, »reiner Zeitvertreib, nicht wahr, Liebling?«
Ich verlor meine Erinnerung. Vergeblich grübelte ich darüber nach, woher ich die Blondine kannte.
Sie tat erstaunt.
»Du tust so entgeistert, Mark«, schmollte sie. »Es sieht so aus, als würdest du deinen Liebling nicht mehr kennen.«
Ich lachte etwas gekünstelt und nahm sie in die Arme.
»Unsinn, Honey, wer denkt denn so was?«
Verdammt, wie heißt sie nur? Ich marterte mein Gehirn. Vergeblich.
»Wirst du die kleine Babsie auch nie vergessen?« säuselte sie.
Ich wollte schon erfreut auf diesen Namen eingehen, hielt mich aber zurück.
Ich kenne doch die Frauen, dachte ich. Die sind zu allem fähig. Denken sich einfach einen Namen aus, und am Ende heißen sie gar nicht so.
Mir wurde die Verworrenheit meiner eigenen Gedanken bewußt. »Babsie« lenkte mich ab.
»Wir sind ganz allein, weißt du das?« Das war Aufforderung genug. Ich konnte nichts gegen die aufkeimende Leidenschaft tun und entledigte mich meiner Kleider. Die Blondine kuschelte sich an mich. Ihr Gesicht war ganz nahe.
Ihre Haare! durchzuckte es mich. Um Gottes willen, was sind denn das für Haare?
Erst jetzt erkannte ich, daß es sich dabei um dünne Würmer handelte, die sich wanden. Nein, keine Würmer, korrigierte ich mich: Schlangen! Die Biester öffneten ihre Rachen. Deutlich die Giftzähne.
Strahlenförmig gingen die Haare vom Kopf der Blondine ab.
Medusa! fiel mir ein: Das Haupt der Medusa.
»Darling, was hast du denn? Verkrampfe dich nicht so!«
Es raschelte. Nackt hielt sie mich fest. Ihre Kleider landeten in einer Ecke des Wagens, der viel kleiner erschien. Und jetzt sah ich, daß er sich immer weiter verengte. Etwas stieß in meinen Rücken. Es war das Armaturenbrett. Es drängte mich über die Medusa.
»Liebst du mich?«
»Ja«, hauchte ich gegen meinen Willen. Meine Leidenschaft ließ sich nicht zügeln. Eine dämonische Macht hatte sie entzündet. Es verzehrte mich schier. Ich spürte den berauschenden Körper.
»Ja, Babsie, natürlich liebe ich dich!« behauptete ich.
»Dann beweise es mir! Küß mich!«
Sie öffnete leicht den Mund. Ich sah die Zunge und schreckte zurück: Auf der Zunge befand sich ein übergroßer Daumennagel, festgewachsen, dazugehörig.
Ich schreckte vor dem Kuß zurück. Die Blondine, jetzt wieder mit normalem Haar, lachte. Auch die Zunge erschien so, wie sie sein sollte. Ich wollte diese Schönheit besitzen, um jeden Preis der Welt. Fest umschlang ich sie.
Da geschah es. Ihr Körper fühlte sich an wie aus Pappe. Und tatsächlich zerriß diese unter meinem Griff.
Babsie verzog das Gesicht.
»Aber was tust du denn, Mark, du kleiner, unbeholfener Liebhaber?« Sie zerbröckelte unter meinen Händen, bis nur noch das Gesicht übrig war.
Ich stierte darauf und wußte, daß ich wahnsinnig gewordenwar.
Plötzlich veränderte sich die Szene. Ich fand mich auf dem Fahrersitz wieder. Auf dem Rücksitz kauerte die Hexe. Wütend keifte sie: »Verdammt, warum ausgerechnet jetzt?« Ich verstand, daß sie in ihrem schändlichen Tun gestört worden war. Von was oder von wem?
Ich erfuhr es auf der Stelle, und es gab für mich keinen Grund, über die Unterbrechung zu frohlocken. Im Gegenteil. Mein Grauen mehrte sich.
18
In einer verzweifelten Situation kann nur ein Verzweiflungsplan den ersehnten Erfolg bringen, sagte sich Don Cooper. Er hatte einen solchen Plan. Die Wahrscheinlichkeit des Gelingens war gering - so gering, daß Don gar nicht darüber nachdenken mochte.
Er saß auf der Bettkante. Der Zombie verbaute mit seiner mächtigen Gestalt die Tür, belauerte jede seiner Bewegungen. Inzwischen war der Geruch des Todes unerträglich geworden.
Don Cooper erhob sich vorsichtig. Sofort spannte sich der Körper des Untoten.
»Ich - ich wollte nur öffnen.« Don deutete mit einer hilflos anmutenden Geste zum Fenster. »Ein Lebender braucht frische Luft.«
Der Mulatte ignorierte die Anspielung. Wie ein Fels stand er da. Seine Rechte hob sich leicht und zeigte auf das Bett.
»Setz dich, Don Cooper! Wir müssen warten, bis der Meister kommt.«
»Sei doch nicht so kleinlich, verdammt«, schimpfte Don Cooper, kam aber der Aufforderung nach. »Was gibt mir das schon für eine Fluchtchance, wenn ich das Fenster öffne? Vergiß nicht, daß wir uns hier in einem Penthouse befinden, zehn Stockwerke über der Straße. Glaubst du wirklich, ich könnte von hier aus fliehen? Es gibt nur einen Weg, und dieser beginnt draußen auf dem kurzen Flur und heißt Fahrstuhl.«
»Zwei Wege!« korrigierte der Untote grollend. »Der Meister setzte mich ins Bild, und ich habe die Stahltür neben dem Fahrstuhl nicht übersehen. Eine schmale Nottreppe führt hinunter.«
Don Cooper atmete einmal tief durch. Das steigerte seine Übelkeit nur noch.
»Du sagst, wir müssen auf den Meister warten? Wenn es noch lange dauert, bin ich nicht mehr am Leben. Dann muß sich dein Meister etwas einfallen lassen. Vielleicht macht er mich ebenfalls zum Zombie? Dann werden wir sozusagen Kollegen, wie?«
Der Untote ignorierte die Ironie in Dons Stimme.
»Ich hätte dich gleich getötet, aber der Meister wies mich an, dich vorerst nur einzuschüchtern, damit du redest. Es ist nicht gelungen. Du bist stärker als geahnt. Als Zombie nützt du dem Meister nicht mehr. Bei deinem Tod verläßt die Seele den Körper, und bei der Wiedererweckung kehrt nur ein kleiner Teil dieser Seele zurück. Du bist nicht mehr du. Der Meister ist dein Herr. Der führt dich aus dem Dunkel der Erinnerungslosigkeit und sagt, was du zu tun hast.«
Also doch ein Roboter, konstatierte Don Cooper bei sich. Er betrachtete den Zombie und stand ein zweites Mal auf.
»Wie ist das nun mit dem Fenster? Du hast selbst gesehen, daß es außer der Treppe und dem Fahrstuhl keinen Weg nach unten gibt. Draußen ist die Dachterrasse. Ich kann nicht fliegen, ehrlich. Einen Hubschrauber habe ich auch nicht parat.«
Der Zombie antwortete nicht. Aber er hatte auch nichts mehr dagegen, als Don Cooper beide Fensterflügel aufschwingen ließ. Tief atmete der Mann die frische Luft ein, die von draußen kam. Sie war zwar mit Staub und Abgasen durchsetzt, wie das bei einer Millionenstadt wie London üblich ist, doch eine reinste Köstlichkeit gegenüber dem Mief, der das Schlafzimmer beherrschte.
Don Cooper wartete, bis er sich einigermaßen erholt hatte. Ein Blick über die Schulter. Der Zombie hatte den Platz an der Tür nicht verlassen.
Blitzschnell schwang sich Don Cooper hinaus. Sein Atem ging keuchend. Alles hing jetzt von der Reaktion des Untoten ab. Das Penthouse war von einer Terrasse umgeben, die von einer hohen Brüstung umschlossen wurde. Nein, man konnte sie nicht verlassen, aber das hatte Don Cooper auch gar nicht vor. Seine Überlegungen waren andere. Es gab den Raum mit der Waffensammlung. Don mußte es gelingen, von außen dort einzudringen. Das gab ihm eine echte Chance, denn er wußte, wie man einem Zombie beikommen konnte. Ein geweihtes Schwert mußte er benutzen. Damit mußte er den Kopf vom Rumpf des Monsters trennen.
Ein Untoter der üblichen Art wäre damit erledigt gewesen, nicht so ein Zombie. Die Kraft des Voodoo war stärker. Das Köpfen des Geschöpfes der Schwarzen Künste führte lediglich zu einem Aufschub - der hoffentlich groß genug war, Don den zweiten Schritt tun zu lassen.
Dem untoten Leib mußte das Herz entnommen und durchspießt werden. Das war die sicherste Form. Natürlich gab es noch einen Weg, der bei Wesen, die dem Jenseitigen untergeordnet waren, immer half: Feuer! Für Don Cooper schied dieses Kampfmittel aus.
Es ergab sich, daß für ihn alles entfiel, denn sein Plan blieb im Ansatz stecken.
Kaum war er draußen auf der Terrasse, als eine mächtige Faust aus dem Fenster hinter ihm schnellte und ihn am Hemd erwischte. Das Kleidungsstück zerriß, doch eine zweite Faust faßte nach. Mit unwiderstehlicher Gewalt wurde Don Cooper zurückgezogen, obwohl er sich verzweifelt wehrte. Nein, den Kräften des untoten Riesen hatte er nichts entgegenzusetzen.
Der Zombie knurrte böse und zeigte dabei eine Reihe fauliger Zähne. Sein Gesicht kam Don ganz nahe, und zum ersten Mal erkannte dieser, daß das Fleisch der belebten Leiche schwammig und aufgedunsen war.
Der Zombie hob Don hoch über den Kopf und schleuderte ihn quer durch den Raum.
Don Cooper landete an der gegenüberliegenden Wand. Ein greller Schmerz durchzuckte seine Wirbelsäule. Es war ihm für Sekunden unmöglich, sich zu erheben. Der Untote stampfte auf ihn zu.
»Ich werde das dem Meister berichten. Deine Lage hat sich verschlimmert. Furchtbar wird es sein, was der Meister mit dir anstellt.«
Don Cooper glaubte ihm aufs Wort.
Das Geschöpf der Finsternis blieb breitbeinig vor ihm stehen.
Endlich konnte sich Don wieder bewegen. Er riß sich zusammen und ignorierte den Schmerz. Langsam kam er auf die Beine und lehnte sich gegen die Wand. Der Zombie lauerte nur zwei Schritte von ihm entfernt, die aufgedunsenen Hände zu Fäusten geballt.
19
Don Cooper hatte von seinem Freund Mark Tate einiges über Magie gelernt. Darin sah er seine letzte Chance. Er breitete die Arme aus und fixierte den Zombie. Worte einer längst vergessenen Sprache gingen ihm durch den Sinn. Ihre Bedeutung war heute nicht mehr hundertprozentig klar, nur ihre Wirkung.
Waren diese Worte der Sprache der geheimnisvollen Goriten entliehen, auf deren Spuren Mark Tate vergeblich wandelte? Er hatte diese Vermutung geäußert, doch fehlten ihm schlüssige Beweise.
Don Cooper entschied sich für eine wirkungsvolle Beschwörung. Der Zombie glotzte ihn an. Wenn er begriff, was Don vor hatte, würde es dem Weltenbummler schlechtgehen. Daran bestand kein Zweifel. Noch aber war es nicht soweit.
»Homan, Santus, Est!« rief Don laut. Seine Hände kreisten leicht. Don Cooper fühlte sich wie in Trance. Das hatten die drei Begriffe der Schwarzen Heiligkeiten bewirkt.
Plötzlich schlugen seine Hände mit einem klatschenden Geräusch zusammen. Wörter sprudelten aus Dons Mund, wie ein Wasserfall. Er konnte sie nicht zurückhalten, selbst wenn er es gewollt hätte. Die Beschwörung hatte ihn selber in ihrer Gewalt. Er war gezwungen, sie bis zum Ende durchzuführen.
Dreimal klatschte er in die Hände, was begleitet war von einer wahren Wortkaskade.
Nach dem dritten Mal riß er die Arme hoch und rief abermals: »Homan, Santus, Est!« Das löste den Bann über sich selbst. Es war vollbracht, der Zombie gebändigt - falls es fruchtete.
Die Reaktion des Untoten war anders als erwartet. Er begann zu lachen. Es war dies ein gräßliches Gelächter, wie man es zu hören glaubte, wenn man bei Nacht und Sturm einen einsamen Friedhof überquerte.
In Don Cooper zerbrach etwas.
»Narr!« grollte der Zombie. »Glaubtest du wirklich, mir damit beikommen zu können? Der Meister wird sich freuen. Dein Sterben wird endlos sein. Was glaubst du, warum er mich zu dir geschickt hat - ausgerechnet mich? Er kümmert sich selber um May Harris, und eine seiner Dienerinnen, die beste, die Hexe, die ihn geweckt hat und die sich selber Barbara oder Babsie nennt, schickt Mark Tate in den Tod. Ich bin hier, und ich bin ein Produkt der Schwarzen Magie. Wie also willst du mir mit Formeln der Schwarzen Kunst beikommen? Sie prallen an mir ab oder mehren meine Kraft, der ich dieses Leben verdanke.«
Don Cooper zitterte wie Espenlaub. Er sah keinen Ausweg mehr. Verdammt, dachte er, eher will ich gleich sterben, als diesem Meister zu begegnen. Ich kann nichts mehr verlieren.
Die nächste Tat konnte seine Lage kaum verschlechtern. Das war der Grund, warum er nicht davor zurückschreckte.
Abermals breitete er die Arme aus. Der Untote hatte behauptet, ihm könnte Schwarze Magie nichts anhaben, da er selber ein Produkt der Schwarzen Magie sei. Also mußte Don die Sache von der anderen Seite anpacken!
Die nächsten Worte, die er ausstieß, waren lateinisch!
Der Zombie zuckte zusammen. Er wollte nach Don greifen, zögerte jedoch zu lange. Don Cooper führte die Hände zusammen und machte das Segnungszeichen: »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.«
Ein langgezogener Klagelaut entrang sich der untoten Kehle. Er wollte gar nicht mehr abreißen, als brauchte das Schattenwesen keine Luft zu holen...
20
Don war sich im klaren darüber, daß die Kampfunfähigkeit des Gegners nur von kurzer Dauer war. Er würde sich schnell erholen, zu schnell, um Don einen ausreichenden Vorsprung zu geben. Aber vielleicht würde es ihm gelingen, an die Waffensammlung heranzukommen?
Es zahlte sich nun aus, daß Don stets Sport trieb. Er hetzte an dem Zombie vorbei, der mit tapsigen Bewegungen nach ihm greifen wollte und ihn knapp verfehlte. Mit einem Satz ging Don Cooper durch das Fenster. Behende fing er sich draußen wieder.
Nicht einen einzigen Blick warf er zurück, um nicht unnötig Zeit zu verlieren.
Mit fliegendem Atem rannte er am Penthouse vorbei. Da war das Fenster zur Waffensammlung. Es war natürlich geschlossen. Don holte mit dem Fuß aus und trat dagegen. Ein feines Netzwerk von Rissen überzog die Scheibe. Es war Isolierglas. In das Zwischenvakuum, das die beiden Gläser voneinander trennte, drang zischend Luft. Die Teile klebten aneinander.
Wieder und wieder trat Don Cooper zu. Aus dem Schlafzimmer drang wütendes Knurren. Der Zombie hatte sich bereits erholt. Nur Sekunden waren inzwischen vergangen. Don kam es wie Ewigkeiten vor, bis er endlich in den Raum eindringen konnte. Trotz der Eile bemühte er sich, sich nicht an den Scherben zu verletzen.
Ein Blick über die Geräte. Da war ein Beidhänder. In den Griff war ein Kreuz eingearbeitet, aus kostbaren Edelsteinen, die im vergehenden Tageslicht funkelten und glitzerten. Das Schwert war dem Kreuzzug geweiht. Don riß es aus der Halterung und schwang es über den Kopf.
Keine Sekunde zu früh. Trotz seiner Körpermasse konnte sich der Untote mit der Geschmeidigkeit einer Katze bewegen. Er hechtete durch das geborstene Fenster. Dabei schlitzte er sich an mehreren Stellen mit den Scherben das Fleisch auf. Die Wunden schlossen sich sofort wieder.
Der Beidhänder zischte durch die Luft. Die Klinge brach das Licht der untergehenden Sonne. Der Untote duckte sich ab, aber Don Cooper war kampferprobt und hatte nicht zum ersten Mal ein Schwert in der Hand. Es gab nicht mehr viele Kampfsituationen, die er in seinem unruhigen Leben noch nicht durchgespielt hatte. Absichtlich setzte er den Hieb viel zu tief an. Damit wurde die Ausweichbewegung des Untoten kompensiert. Das Schwert traf die Schulter. Eine tiefe Wunde entstand.
Don biß sich auf die Zähne. Er hatte nicht genau getroffen, trotz allem.
Der Untote stöhnte auf und griff sich an die Wunde, die grünlichen Schleim absonderte. Sie schloß sich nicht so schnell wie die anderen. Das war darauf zurückzuführen, daß die Waffe der Weißen Magie geweiht war.
Der Zombie hatte seinen Angriff unterbrochen. Don beschloß, ihm nicht Gelegenheit zu geben, sich von dem Hieb zu erholen. Er holte kurz aus und schlug zu. Wie Butter drang die scharfe Waffe in den Hals des Zombies. Der Kopf wurde vom Rumpf getrennt und kullerte davon. Der Mund öffnete sich dabei und gab grausige Schreie von sich. Aus dem Halsstumpf tropfte es ätzend.
Der geköpfte Körper hatte das Interesse an Don Cooper verloren. Die Arme tasteten umher, während der Kopf schrie. Es war klar, daß der Zombie seinen Schädel suchte.
Don wußte, daß er auf diese Weise den Untoten nicht töten konnte - diesen jedenfalls nicht. Da stand eine Macht dahinter, die stärker war als alles andere, die es Untoten sogar ermöglichte, bei hellichtem Tag ihr Unwesen zu treiben.
Don Cooper wußte, daß Voodoo Zombies entstehen lassen konnte, die äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden waren, die sich nicht vor der Sonne zu schützen brauchten. Wie viele gab es in der Karibik, die nach außen hin das Leben von normalen Menschen führten und in Wirklichkeit Wesen der Finsternis waren, zu vernichten nur mit bestimmten Methoden?
Don Cooper hatte keine Zeit, weiter über dieses Problem nachzudenken. Er mußte handeln, denn der kopflose Körper tapste genau auf den Schädel zu, der mit rollenden Augäpfeln und schreiend in der Ecke lag. Er würde ihn mit untrüglichem Instinkt finden.
Wie lange würde die Regenerierung dauern? Wann war der Zombie wieder voll kampffähig?
Don umrundete den Leichnam, der sein Ziel fast erreicht hatte und sich bereits anschickte, sich zu bücken, um den Kopf an sich zu nehmen. Der Dolch zuckte vor und traf.
Der Zombie schien von Stromstößen getroffen zu werden. Seine Arme ruderten hilflos.