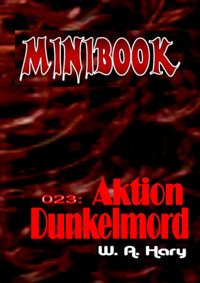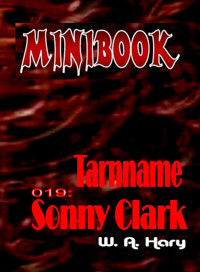4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Bekker und Silke Bekker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Venedig, um das Jahr 1400... /449) Ein zufälliges Treffen von Catrina und Ricardo, dem Straßenjungen, in Venedig ist schnell vergessen. Sie treffen nach Jahren wieder aufeinander, und die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Nun muss Ricardo im Auftrag des Dogen einen Serienmörder suchen. Catrina will ihm trotz ihrer Blindheit helfen. Die Ming-Dynastie geht ihrem Ende entgegen. Im Jahr 1644 gehen Rebellen und Mandschuren gegen den Kaiser und seine Truppen vor, aber noch wird Peking gehalten. Mitten in diesen Wirren ist ein Liebespaar, die schöne junge Chen und der holländische Händler John van Aarden, auf der Flucht. Als John gefangen genommen wird, muss er den Rebellen helfen, um sein Leben zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alfred Bekker
Zwei historische Romane: Jenseits der Großen Mauer/Die venezianische Seherin
Inhaltsverzeichnis
Zwei historische Romane: Jenseits der Großen Mauer/Die venezianische Seherin
Copyright
Die venezianische Seherin Gesamtband Teil 1-3
Catrina und Ricardo: Die venezianische Seherin 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Die blinde Nonne: Die venezianische Seherin 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Micheles dunkler Fluch: Die venezianische Seherin 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Epilog
Jenseits der Großen Mauer: Gesamtband, Teil 1-3
Die schöne Tochter
Der neue Kaiser
Zeit der Irrwege
Zwei historische Romane: Jenseits der Großen Mauer/Die venezianische Seherin
W.A.Hary, Alfred Bekker
Venedig, um das Jahr 1400...
Ein zufälliges Treffen von Catrina und Ricardo, dem Straßenjungen, in Venedig ist schnell vergessen. Sie treffen nach Jahren wieder aufeinander, und die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Nun muss Ricardo im Auftrag des Dogen einen Serienmörder suchen. Catrina will ihm trotz ihrer Blindheit helfen.
Die Ming-Dynastie geht ihrem Ende entgegen. Im Jahr 1644 gehen Rebellen und Mandschuren gegen den Kaiser und seine Truppen vor, aber noch wird Peking gehalten. Mitten in diesen Wirren ist ein Liebespaar, die schöne junge Chen und der holländische Händler John van Aarden, auf der Flucht. Als John gefangen genommen wird, muss er den Rebellen helfen, um sein Leben zu retten.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Die venezianische Seherin Gesamtband Teil 1-3
W.A.Hary, Alfred Bekker
Die venezianische Seherin Gesamtband Teil 1-3
von W.A.Hary, Alfred Bekker
Über diesen Band:
Dieser Band enthält folgende Einzeltitel:
Catrina und Ricardo
Die blinde Nonne
Micheles dunkler Fluch
––––––––
Venedig, um das Jahr 1400...
Ein zufälliges Treffen von Catrina und Ricardo, dem Straßenjungen, in Venedig ist schnell vergessen. Sie treffen nach Jahren wieder aufeinander, und die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Nun muss Ricardo im Auftrag des Dogen einen Serienmörder suchen. Catrina will ihm trotz ihrer Blindheit helfen.
Catrina und Ricardo: Die venezianische Seherin 1
W.A.Hary, Alfred Bekker
von Wilfried A. Hary & Alfred Bekker
nach einem Exposé von Alfred Bekker
––––––––
Venedig, um das Jahr 1400...
Ein zufälliges Treffen von Catrina und Ricardo, dem Straßenjungen, in Venedig ist schnell vergessen. Sie treffen nach Jahren wieder aufeinander, und die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Nun muss Ricardo im Auftrag des Dogen einen Serienmörder suchen. Catrina will ihm trotz ihrer Blindheit helfen.
1
Es gibt Dinge in Leben eines Menschen, die sich in sein Gedächtnis einbrennen wie mit sprichwörtlicher Säure. Dinge, die man niemals mehr vergessen kann. Dinge, die einen für das ganze Leben prägen, ob bewusst oder unbewusst. Und dies sind nicht nur die schlimmsten Dinge. Nicht unbedingt jedenfalls. Auch nicht die schönsten. Es sind vor allem Dinge, Begebenheiten und Ereignisse, die sich erst viel später vielleicht als von besonderer Bedeutung erweisen.
Wie ihre erste Begegnung mit Ricardo.
Man muss vorausschicken, dass beide damals wirklich wahre Welten trennten. Sie als die zwölfjährige Tochter aus dem angesehenen Haus des zwar kleinen aber dennoch feinen Wollhändlers – und Ricardo, der Straßenjunge, der alles tun musste, um einfach nur zu überleben. Eben auch Dinge tun, die man nicht tun sollte. Wie beispielsweise Diebstahl. Und dann noch als Opfer ausgerechnet den angesehenen und einflussreichen Glasbrenner Giuseppe D‘Andrea auszuwählen. Um möglicherweise Folgen heraufzubeschwören, die unabsehbar waren. Um auch als Kind vielleicht mit schlimmster Strafe rechnen zu müssen, falls man dabei erwischt wurde im Jahre des Herrn 1387 in der nicht nur für Venezianer heiligen Lagunenstadt Venetia, auch Venedig genannt ...
Gewisse Gleichaltrige nannten die zwölfjährige Catrina gern auch „dürre Ziege“. Was sie allerdings persönlich eher als Kompliment empfand. Zeigte es doch auch, dass man deutlich wahrgenommen wurde. In diesem schwierigen Alter sicherlich nicht ganz so unbedeutend.
Zumal Catrina wusste, dass Gleichaltrige nur dann permanent mit so etwas geärgert wurden, wenn sie sich daraufhin empfindlich zeigten, also darauf eingingen. Das galt auch schon im Jahre des Herrn 1387 so. Wenn man jedoch darüber lachte, so wie Catrina, wiederholte sich das meist nicht mehr so oft. Dann wurde „die dürre Ziege“ in Ruhe gelassen, und man ärgerte dafür andere. Wobei es ja nun wirklich keinen Menschen gab und gibt, den man nicht mit irgendetwas zu ärgern versuchte. Die einen, weil sie angeblich zu dürr, so wie Catrina, andere gar, weil sie angeblich zu dick, zu groß, zu klein, zu spitznasig, zu wuschelköpfig waren und dergleichen mehr. Man musste es einfach nur tapfer ignorieren oder eben sogar darüber lachen.
An diesem Tag trotzdem schon wieder. Natürlich von jener kleinen Gruppe, die so tat, als würde sie aus angehenden Königinnen bestehen. Die selbsternannte Oberprinzessin drangsalierte dabei besonders gern Gleichaltrige, tatkräftig unterstützt von ihren wenigen Anhängerinnen, die wie Anhängsel von ihr wirkten, weil sie diese stets und ständig im Schlepptau hatte. Zumindest drangsalierte sie jene, mit denen sie es tun konnte. Und jetzt hatte sie es doch tatsächlich bei Catrina erneut versucht, obwohl sie eigentlich hätte wissen müssen, dass es nutzlos war.
Jedenfalls weitgehend nutzlos, denn ausgerechnet diesmal änderte Catrina einfach einmal spontan ihre Taktik, um solchen Unbilden zu begegnen. Anstatt zu lachen nämlich wie über einen lustigen Scherz, stolzierte sie als genau jene „dürre Ziege“ an ihnen vorbei, so hochnäsig es gerade noch ging, um nicht über die eigenen Füße zu stolpern.
Es war ja die falsche Richtung. Aber Catrina konnte sich halt diese Gelegenheit nicht verkneifen. Sie musste es ihnen sozusagen zeigen. Was für sie als Zwölfjährige tatsächlich von annähernd fundamentaler Bedeutung sein mochte.
So geschah es eben, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes vom Weg abkam und in jenen Grenzbereich geriet, vor dem ihr besorgter Vater sie mindestens einmal pro Tag eindringlich warnte. Denn hier verkehrten jene, denen es nicht ganz so gut ging wie ihr. Hier herrschten andere Verhältnisse, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wagten sich die Ärmsten der Armen hin, um zu betteln und auch um zu rauben. Wenn nicht Schlimmeres geschah, was Catrina in diesem Alter noch längst nicht wissen durfte.
Kein Wunder also, wenn sie sich täglich diese Warnungen anhören musste. Woran sie sich für gewöhnlich auch gern hielt. Außer eben diesmal, wo sie sich nun wirklich diese Gelegenheit für einen besonders provokanten Auftritt nicht entgehen lassen durfte.
Mit vollem Erfolg, denn die kleine Schar gaffte sich schier die Augen aus. Sie konnten wohl nicht glauben, dass jemand es wagen würde, sich ihrer Übermacht zu stellen und doch tatsächlich sich ganz deutlich über sie zu erheben.
Zumindest so lange Catrina in Sichtweite blieb. Aber sobald der Abstand groß genug war, begann sie dennoch zu rennen. Sie waren trotzdem die Übermacht, und aus Erfahrung wusste Catrina, dass sie nicht nur so tun konnten wie verwöhnte Prinzessinnen, sondern leider auch wie übelster Abschaum. Falls die Wut und der Zorn sie übermannten. Und damit war ja nun in diesem Fall wirklich zu rechnen.
Deckung fand Catrina in einer schmalen Seitengasse, in der es auch am hellsten Tag dunkel genug blieb, um nicht sogleich gesehen werden zu können.
Und sie hatte sich nicht geirrt: Ihre Verfolgerinnen kamen zornbebend herbeigerannt, vermuteten jedoch, sie sei längst weiter gelaufen und verloren keine unnötige Zeit, um vielleicht auch noch in dieser schmalen, unbedeutenden Seitengasse nachzusehen, in der es dermaßen nach Schmutz und Unrat stank, dass es Catrina schier den Atem raubte.
Sie blieb tapfer. Sie hielt es aus. Wenigstens bis sie sicher sein konnte, dass ihre Verfolgerinnen nicht zurückkamen, um hier nachzusehen. Immerhin kannten sie ja ebenfalls die immer wieder angemahnten Gefahren, denen man hier begegnen konnte, und waren sicherlich längst wieder auf dem Weg in ihren Bereich, wo sie sich sicherer fühlen durften.
Erst dann wagte Catrina es, ins Freie zu treten, zurück in das Licht.
Aber da kam noch jemand herbei gerannt. Nicht minder schnell als sie vorhin. Ein Junge, ungefähr in ihrem Alter, wie es schien. Ziemlich abgerissen wirkend. Also einer dieser berüchtigten Straßenjungen. Einer von denen, die vom Betteln lebte. Und falls das nicht reichte ...
Catrina jedenfalls verstand schon, bevor sie sah, dass er immer wieder gehetzt einen Blick zurückwarf: Er wurde verfolgt. Er war also eindeutig einer dieser kleinen Diebe, die nicht zum Spaß stahlen, sondern weil sie keine andere Wahl hatten. Und er hatte sich diesmal erwischen lassen, war auf der Flucht vor seinen Häschern und kam dabei ausgerechnet direkt auf sie zu, ohne sie zunächst bewusst wahrzunehmen.
Catrina fiel ihm erst auf, als er nur noch wenige Schritte von ihr entfernt war. Es erschreckte ihn dermaßen, dass er seine Flucht abbrach, um sie nicht über den Haufen zu rempeln, und knapp vor ihr zum Stehen kam.
Catrina sah in seine weit aufgerissenen, panikerfüllten Augen – und fühlte so etwas wie Mitleid mit ihm. Anders konnte es nicht sein. Sonst hätte sie ihn nicht gepackt und in diese dunkle Seitengasse hineingestoßen. In Sicherheit nämlich, anstatt ihn festzuhalten und seinen Häschern zu überlassen, wie sie es als wohlerzogene Tochter eines Wollhändlers gelernt hatte, der ebenfalls immer wieder von solchen kleinen Dieben behelligt wurde.
Er ließ es verdutzt mit sich geschehen. Wohl weil er immer noch unter einer Art Schock stand. Und vor allem kam er nicht sofort wieder aus der Gasse hervorgestürmt, um weiter zu fliehen. Das wäre ihm auch schlecht bekommen, denn seine Verfolger hatten bereits aufgeholt. Immerhin zwei ausgewachsene Männer in der Uniform der Stadtwachen, und sie machten nicht gerade den Eindruck, als wären sie gut gelaunt, mit ihren Knüppeln in den Händen.
Jetzt wurden sie Catrinas ansichtig und stutzten, denn allein schon an ihrer Kleidung erkannten sie, dass sie nicht in dieses Viertel gehörte. Und dann weinte sie auch noch so herzzerreißend los, dass sie kurz sogar vergaßen, den fliehenden Jungen weiter zu verfolgen.
„Bitte, so helfe mir doch jemand!“
„Was ist denn los, Kleine?“, fragte einer der beiden keuchend und blieb gemeinsam mit dem anderen stehen.
„Ich – ich habe mich verlaufen!“, behauptete sie. „Ich – ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Könntet Ihr mich denn nicht ...?“
„Keine Zeit für so etwas, Kleine. Tut mir leid.“
Und schon wollten sie weiterlaufen. Der eine äugte allerdings noch misstrauisch in Richtung dunkler Seitengasse. Anscheinend formte sich in seinem Kopf bereits die Idee, der Flüchtige könnte sich womöglich dort versteckt halten.
Und schon hörte Catrina die dazu passende Frage: „Ist da soeben ein Straßenjunge an dir vorbeigelaufen, etwa in deinem Alter?“
Catrina tat überrascht und vergaß vorübergehend sogar, weiter zu weinen, obwohl immer noch dicke Tränen über ihre Wangen kullerten.
„Nein, da war niemand. Es hat keiner mein Flehen erhört. Bitte, ihr werten Herrn, ich bin Catrina, die Tochter des Wollhändlers. Ich glaube, es ist nicht weit von hier, aber ich habe solche Angst und weiß nicht mehr, in welche Richtung ich gehen muss.“
Der eine vergaß wieder, dass er in der Gasse nachsehen wollte. Stirnrunzelnd sah er das Mädchen an.
„Es gibt hier in der Nähe nur einen einzigen Wollhändler. Und das ist dein Vater?“
„So ist es!“, bestätigte sie eifrig.
„Dann bist du hier tatsächlich falsch. Du musst hier einfach nur zurück und über die nächste Brücke gleich links abbiegen. Dann bist du schon fast da. Sicherlich findest du dich dort besser zurecht.“
„Oh, vielen Dank, ihr werten Herrn!“, rief sie erleichtert. „Und wenn ich den bösen Jungen sehe, den ihr verfolgt, schreie ich ganz laut um Hilfe. Ja, das werde ich tun!“
„Äh, gut so, Kleine!“, meinte der Wachmann irritiert, winkte seinem Kollegen zu, und schon rannten sie weiter.
Erst als sie nicht mehr zu sehen waren, ging Catrina in die Gasse zurück. Aber der Junge war nicht mehr zu sehen. Sie konnte ihn jedenfalls nicht finden. Also wandte sie sich ab und wollte sich jetzt endlich auf den Weg zurück machen, bevor ihre Eltern sich noch unnötig Sorgen machten ob ihrer Verspätung.
Doch da zupfte sie jemand am Ärmel. Sie wandte sich erschrocken herum und sah den Jungen wieder. Die Panik war aus seinen Augen verschwunden.
„Danke!“, sagte er.
„Nichts zu danken, aber an deiner Stelle würde ich jetzt tatsächlich weiterrennen, allerdings in eine andere Richtung.“
„Wollte ich ja, aber die Gasse endet dort hinten. Dort komme ich nicht weiter. Denn die Mauer ist viel zu hoch und zu glatt, um daran emporzuklettern.“
„Na, die beiden Wachmänner sind ja jetzt nicht mehr da. Ich gehe zurück in Richtung Elternhaus. Vielleicht wäre das auch die richtige Richtung für dich?“
„Nein, wäre es nicht. Man kann ihnen am besten entwischen, wenn man hinter ihnen bleibt.“
„Also, du willst sie jetzt deinerseits verfolgen?“, vergewisserte sie sich ungläubig.
Er lächelte listig.
„Das ist ja der Trick: Sie suchen vor sich, nicht hinter sich.“
Catrina musste darüber unwillkürlich lachen.
„Aber sage mal, wie heißt du denn eigentlich?“
„Ich bin Ricardo.“
„Hast du denn kein Zuhause?“
„Nein, habe ich nicht. Ich hatte noch nie Eltern. Jedenfalls keine, an die ich mich erinnern könnte.“
„Aber du weißt zu überleben, wie ich sehe.“
„Weil ich keine Wahl habe. Und noch einmal danke für deine Hilfe, Catrina.“
„Du weißt, wie ich heiße?“
„Nun, du hast denen ja deinen Namen verraten. Das habe ich gehört.“
Abermals musste sie lachen.
Er blinzelte sie schelmisch an und rannte weiter. Tatsächlich in dieselbe Richtung, in der seine Verfolger verschwunden waren.
So recht konnte Catrina immer noch nicht glauben, dass dies wirklich die richtige Strategie sein sollte. Kopfschüttelnd wandte sie sich ab und hatte die Begegnung mit Ricardo schon eine halbe Stunde später wieder vergessen.
Glaubte sie zumindest. Wie hätte sie denn auch nur ahnen können ... Aber niemand kennt wirklich die Zukunft. Catrina jedenfalls nicht. Obwohl das Schicksal schon längst bestimmt hatte, dass ausgerechnet Ricardo dereinst eine besondere Rolle in ihrem zukünftigen Leben spielen würde.
Noch war es aber längst nicht so weit. Sie war zu diesem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt und lebte noch in sehr behüteten Verhältnissen. Ganz anders als der arme Straßenjunge Ricardo. Ohne auch nur zu ahnen, dass ihr eigenes Glück nicht mehr von allzu langer Dauer sein würde ...
2
Ricardo war zwei Jahre älter als Catrina, obwohl beide ungefähr gleich alt aussahen. Aber das wussten zu diesem Zeitpunkt beide nicht. Und es wäre ihnen auch egal gewesen. Weil jeder in seine eigene Welt zurückkehrte nach dieser kurzen und doch so bedeutsamen Begegnung. Das hieß, eigentlich blieb Ricardo einfach in seiner eigenen, in der es jeden Tag um das Überleben für einen weiteren Tag ging. Und er hatte in seinen noch so jungen Jahren bereits weitreichende Erfahrungen mit dem Überleben sammeln müssen, sonst hätte es ihn längst schon nicht mehr gegeben. Also war er auch durchaus berechtigt zuversichtlich, so völlig überzeugt von seiner Strategie, dass er seinen Verfolgern entrinnen konnte.
Allerdings gab es auch noch mehr Menschen auf den Straßen von Venedig als nur Ricardo, seine Verfolger und auch Catrina. Vor allem einen, der beiden gar nicht aufgefallen war, weil er für sie keine Bedeutung zu haben schien. Eben auch für Ricardo nicht, der tatsächlich der Illusion erlag, es wieder einmal geschafft zu haben, als er seine Häscher nicht mehr zu Gesicht bekam. Als hätten sie sich selbst regelrecht in Luft aufgelöst.
Eine Illusion, die allerdings nicht allzu lange anhielt. Nur so lange, bis ihm jemand von hinten mit einem Knüppel auf die Schulter klopfte. Ein Knüppel, wie er typisch war für einen der Stadtwache.
Erschrocken fuhr Ricardo herum. Und es war tatsächlich ein Stadtwächter. Schlimmer noch: Es war einer seiner Häscher, während der andere bereits hinzutrat, um ihm den weiteren Fluchtweg abzuschneiden.
„Da hat dich also die Kleine tatsächlich gedeckt. Ich hatte gleich so einen Verdacht, dass sie uns nur etwas vormacht“, meinte der mit dem Knüppel.
Er hob ihn von Ricardos Schulter, der erschrocken zusammenzuckte, weil er erwartete, damit geschlagen zu werden. Doch nichts dergleichen geschah.
Ein weiterer Mann trat hinzu. Hochgewachsen schien er nicht mehr der Jüngste zu sein. Er hatte einen stattlichen Schnurrbart auf der Oberlippe, den er wohl sehr liebte, sonst hätte er nicht so gepflegt gewirkt. Auf seinem Kopf thronte ein Zylinder. Aber auch die übrige Kleidung verriet einen sehr wohlhabenden Herrn aus einflussreichen Kreisen.
„Oh, verzage nicht“, meinte er überaus freundlich zu Ricardo, „aber die beiden hättest du tatsächlich mit deinem Trick überlisten können. Die Verfolger verfolgen, weil sie natürlich dann immer in der falschen Richtung suchen? Ich halte das für genial, allerdings nicht für genial genug, um nicht von mir durchschaut werden zu können. Jedenfalls konnte ich die beiden davon überzeugen, sich hier ihrerseits auf die Lauer zu legen. Gemeinsam mit mir.“
Ricardo sah den Fremden mit geweiteten Augen an und fürchtete längst das Allerschlimmste. Nicht nur, weil er keine Ahnung hatte, um wen es sich bei diesem handelte.
Da deutete dieser tatsächlich eine höfliche Verbeugung an und schlug dabei sogar die Hacken zusammen.
„Gestatten, mein Name ist Giuseppe D‘Andrea!“
„Der berühmte Glasbrenner?“, entfuhr es Ricardo voller Panik.
Der so Bezeichnete nickte lächelnd.
„Genau der nämlich, den du bestohlen hast!“ Er schürzte abschätzig die Lippen. „Dabei habe ich mich allerdings gefragt, wieso ein verwahrloster, abgerissener Straßenjunge wie du ausgerechnet in eine Glasbrennerei einbrechen sollte.“
„Ich bin gar nicht eingebrochen. Ich ging einfach so hinein. Am helllichten Tag. Niemand hat mich aufgehalten.“
„Aber wieso bist du dort überhaupt hinein? Als Straßenjunge, wohlgemerkt. Was will denn jemand wie du ausgerechnet in einer Glasbrennerei stehlen? Vielleicht die Geheimnisse der Glasbrennerei gar?“
„Ihr wisst gar nicht, was ich entwendet habe, glaubt sogar, ich könnte ein Spion sein?“, wunderte sich jetzt Ricardo ehrlich.
Er sah die beiden Stadtwachen an. Diese erwiderten nur grimmig seinen forschenden Blick.
„Nein“, gab der Glasbrenner zu, „das weiß ich nicht. Was du gestohlen hast. Noch nicht jedenfalls. Vielleicht ja tatsächlich Geheimnisse, die nicht für dich bestimmt sind? Sage du es mir also!“
„Könnte ich wirklich Eure Geheimnisse herausgefunden haben in dieser kurzen Zeit in Eurer Brennerei?“
Der Glasbrenner musste nicht lange überlegen.
„Nein, das wäre in der Tat eher unwahrscheinlich. Aber sprich endlich: Was sonst gäbe es für einen wie dich in einer Glasbrennerei zu stehlen?“
„Ihr vermisst also in der Tat überhaupt nichts? Wieso sonst würdet Ihr mich danach fragen? Aber warum wolltet Ihr mich dennoch so unbedingt fangen lassen? Wenn nichts fehlt, habe ich ja gar nichts verbrochen. Oder will man mich nur deshalb in den Kerker werfen, weil ich es gewagt habe, ohne Aufforderung die Glasbrennerei zu betreten? Als handele es sich um heiligen Boden oder so?“
Der Glasbrenner lachte herzhaft.
„Du scheinst mir ein ziemlich gewitzter Bursche zu sein. Aber so einfach kommst du mir nicht davon. Natürlich weiß ich, dass du gestohlen hast. Was denn sonst bei deinesgleichen? Nur ist mir immer noch nicht ganz klar, was dies denn sein könnte. Geheimnisse schließe ich jetzt einmal aus, weil diese zu sicher verwahrt sind. Bei uns kann man außerdem noch nicht einmal Essen stehlen, auch nicht unbedingt Wertvolles. Außer vielleicht Glasarbeiten, aber die wären zu empfindlich, um damit eine Flucht Hals über Kopf zu riskieren. Und die hast du ja ganz offensichtlich riskiert.
Also, sage mir endlich, Bursche: Was war es? Oder muss ich die beiden erst bitten, dich gründlich zu durchsuchen? Ich fürchte allerdings, das wird ziemlich unangenehm für dich.“
Trotzig entgegnete Ricardo: „Nein, ich habe überhaupt nichts gestohlen. Sollen die mich doch durchsuchen. Mir doch egal.“
„Und wieso bist du dann überhaupt geflohen, wenn du doch nichts getan hast?“
Jetzt lachte Ricardo frech: „Was glaubt Ihr wohl, was ein Straßenjunge tun muss, wenn ihm Stadtwachen begegnen? Für die sind wir doch alle bloß Übeltäter. Am liebsten würden sie uns gleich totprügeln mit ihren Knüppeln.“
„Und deshalb bist du vor ihnen geflohen? Weil du ein abgerissener Straßenjunge bist, der Angst hat vor den Prügeln durch die Stadtwachen?“
Mit jedem Wort drückte der Glasbrennerei mehr aus, wie wenig er den Worten Ricardos glaubte.
Er war größer als Ricardo. Hochaufgeschossen eben, während der Junge noch ziemlich kindlich wirkte für sein Alter. Jetzt beugte sich Giuseppe D‘Andrea leicht hinab, als wollte er damit sicherstellen, dass Ricardo jedes einzelne weitere Wort auch wirklich deutlich genug verstehen konnte.
„Ich weiß definitiv, dass du mich bestohlen hast, aber deshalb waren die beiden letztlich gar nicht hinter dir her. Das taten sie nur, weil ich sie ausdrücklich darum gebeten habe, als ich dich in meiner Glasbrennerei erwischte.“
„Nur deshalb haben die mich verfolgt?“, vergewisserte sich Ricardo argwöhnisch.
„Ja! Und ganz egal, was ist, was du mir entwendet hast: Darum geht es mir überhaupt nicht. Also ganz egal, ob es nun mir gehört hat, kannst du es auf jeden Fall behalten. Es geht mir lediglich um das Was und das Warum. Es waren immerhin weder Geld noch irgendwelche Wertgegenstände, und sonst gab es ja wohl nichts für dich in einer Glasbrennerei zu stehlen.“
„Ach, Gegenstände, die für Euch von Wert sind, haben mich sowieso nicht interessiert. Weil Ihr das alles viel zu gut weggeschlossen habt. Fast so gut wie Eure Geheimnisse. Außerdem, in der Glasbrennerei arbeiten zu viele Leute, die einen derart erfolgreichen Diebstahl wohl unmöglich gemacht hätten.“
„Und was könnte es ansonsten gewesen sein?“, beharrte der Glasbrenner nachdrücklich.
Ricardo lächelte ihn an. Dann griff er in seine Taschen und zog etwas hervor, das er Giuseppe D‘Andrea direkt unter die Nase hielt. Ohne ein Wort des Kommentars.
Der hagere Mann starrte darauf und schien seinen Augen nicht trauen zu wollen. Dann richtete er sich ruckartig auf und ächzte: „Schreibwerkzeug?“
„Ja, Schreibwerkzeug!“, bestätigte der Junge ungerührt. „In Eurem Kontor arbeiten so viele Schreiberlinge, um Euren Reichtum zu verwalten, dass sie dabei jede Menge Tinte, Federkiele und für mich unbezahlbares Papier verwenden. Macht es da wirklich einen so großen Unterschied, wenn ich mir davon etwas ausborge? Bei diesem Überfluss? Wo Ihr noch nicht einmal bemerkt habt, dass überhaupt etwas dergleichen fehlt?“
Fassungslos schüttelte der hagere Mann den Kopf.
„Deshalb ließ ich dich einfangen. Weil ich mir einfach keinen Reim darauf machen konnte. Aber wirklich nur Schreibwerkzeug? Und dafür bist du ein solches Risiko eingegangen? Bursche, du kannst doch damit überhaupt gar nichts anfangen. Oder willst du es etwa gewinnbringend verkaufen? An wen denn?“
„Nein, nein, ich will es natürlich nicht verkaufen. Es gibt ja auch niemanden, der mir dafür Geld geben würde. Ich benötige das allein nur für mich selbst.“
„Obwohl du weder lesen noch schreiben kannst?“
„Wer sagt denn so etwas?“
„Aber keiner von euch Straßenjungen kann lesen und schreiben. Woher denn?“
„Ich kann es jedenfalls, und deshalb benötige ich das hier.“
Ricardo deutete mit dem Kinn auf das Tintenfässchen in seiner Linken und auf die beiden gestohlenen Federkiele und die wenigen Blätter Papier in der rechten Hand. Das Papier war schon übel zerknüllt, weil er es einfach schnell in die Tasche hatte stopfen müssen. Um es zu benutzen, musste es zuerst wieder sorgfältig geglättet werden.
„Du kannst lesen und schreiben?“, vergewisserte sich der Glasbrenner ungläubig.
„Ja. Ich habe es gelernt von einem alten Mann. Er erzählte uns, dass er selber einmal wohlhabend gewesen sei. Aber er hatte alles verloren, hatte sogar untertauchen müssen wegen seiner immensen Schulden. Deshalb wurde er zum Bettler. Niemand wollte von ihm etwas lernen. Ich aber schon. Nur leider hat er dann nicht mehr so lange gelebt.“
„Und jetzt stiehlst du solche Dinge, um sozusagen in Übung zu bleiben?“
„So ist es!“
„Und was hast du bei ihm noch alles gelernt?“
„Er hat mir die Sterne erklärt und viele Dinge, die für alle anderen so fremd klingen, dass sie nichts davon hören wollten.“
„Dann war er gar so etwas wie ein Gelehrter?“
„Das war er ganz gewiss!“, bestätigte Ricardo überzeugt.
„Und du warst mithin sein Schüler?“
„Eben leider für nicht allzu lange“, bedauerte Ricardo erneut.
Da packte ihn der Hagere so plötzlich vor der Brust, dass Ricardo erschrocken alles fallenließ, was er in den Händen hielt. Das Tintenfässchen war aus Glas und zersprang in viele Teile, dabei seinen für Ricardo so kostbaren Inhalt über das Pflaster vergießend.
Doch Ricardo hatte keine Gelegenheit, sich darüber aufzuregen. Das Gesicht des Hageren kam ihm ganz nah. Der Schnurrbart beeindruckte aus dieser Nähe nicht nur, sondern er wirkte sogar ziemlich bedrohlich. Noch bedrohlicher eigentlich als die Knüppel in den Händen der beiden Stadtwachen, die die ganze Zeit über aufpassten, dass Ricardo nicht doch wieder entwischte.
Ricardo hatte keine Chance, sich aus dem eisernen Griff zu befreien. Umso überraschter war er, als Giuseppe D‘Andrea mit einer Stimme zu ihm sprach, die keineswegs bedrohlich wirkte, sondern so, wie Ricardo das überhaupt nicht einordnen konnte.
„Mein lieber Junge, jetzt weiß ich, warum es mir so wichtig erschien, deiner habhaft zu werden. Ursprünglich hielt ich es nur für ein dummes Gefühl. Jetzt ist mir klar, dass du etwas ganz Besonderes bist. Jedenfalls jemand, der es nicht verdient hat, im Dreck und im Elend zu bleiben.“
Jetzt erst schien er die Panik in den Augen des Jungen zu erkennen und erschrak selber. Er ließ Ricardo sogleich los und fuhr sogar zurück.
„Verzeihung, mein Junge, ich wollte dir keine Angst einjagen. Ganz im Gegenteil. Ja, verzeih mir, dass ich mich von der Erkenntnis habe überwältigen lassen. Aber du musst wissen, ich bin seit Jahren ein unglücklicher Witwer, dem schon zu Lebzeiten meiner über alles geliebten Gattin keine Kinder vergönnt gewesen waren. Niemals mehr wollte ich nach diesem überaus schmerzlichen Verlust eine andere Frau zu meinem Weib nehmen. Also habe ich mich längst damit abgefunden, ohne einen Sohn oder eine Tochter zu bleiben. Und dann du ...“
Er schluckte bewegt und fuhr, mühsam Tränen unterdrückend und mit halb erstickter Stimme, fort: „Als ich dann dich sah, habe ich gespürt, dass du kein normaler Straßenjunge bist. Ich habe keine Ahnung, welches grausame Schicksal dich zu diesem unwürdigen Dasein verdammt hat. Ja, es war auf jeden Fall ein überaus grausames Schicksal. Soviel steht augenscheinlich fest.“
Er hielt inne, ungläubig beobachtet von Ricardo, der das Ganze irgendwie nicht so richtig einordnen konnte. Weil er so etwas noch nie zuvor erlebt hatte. Wie denn auch?
Was ging da eigentlich vor?
Wie aus weiter Ferne hörte er weiter die Stimme des hageren Mannes vor ihm: „Und wie würde es dir gefallen, weit mehr zu erlernen als nur das Lesen und Schreiben? Mit genügend Schreibzeug für alle Zeiten? Mit sauberen Kleidern und einem wohlbehüteten Zuhause? Du musst nichts dafür tun. Gar nichts. Du musst einfach nur einverstanden sein.“
„Einverstanden womit?“, erkundigte sich Ricardo misstrauisch, der dem Frieden immer noch nicht trauen mochte. Weil so etwas wie Güte und bedingungslose Zuwendung in seiner Welt ein wahres Ding der Unmöglichkeit geblieben war. Bis heute jedenfalls.
„Einverstanden damit, mein Junge, mein angenommener Sohn zu werden!“, behauptete der hagere Mann mit dem eindrucksvollen Schnurrbart und der feinen Kleidung, die ihn als reichen und vor allem einflussreichen Bürger dieser Stadt auswiesen.
Ja, Ricardo mochte es nicht glauben. Er vermutete eher eine Art Hinterlist. Aber als er zu Boden sah auf die vergossene Tinte, neben dem gänzlich unbrauchbar gewordenen Papier, während sein Magen vor Hunger beständig knurrte wie ein gereiztes Tier, kam ihm tatsächlich die Idee, es doch vielleicht einmal versuchen zu müssen. Bevor ihn die Wachmänner doch noch in einen Kerker warfen, wo er dann verrottete beispielsweise. Und falls es ihm nicht behagen sollte bei diesem seltsamen Fremden, der vorgeblich gern eine Art Vater werden wollte für ihn, konnte er ja immer noch fliehen.
Es sei denn ...
„Und ich werde nicht Euer Gefangener sein?“
„Aber nein, keineswegs, mein Junge!“, beteuerte Giuseppe D‘Andrea erschrocken.
Und dann beugte er sich wieder vor. „Wie heißt du denn eigentlich?“
„Ricardo!“, verkündete der Junge nicht ohne Stolz.
„In Zukunft sollst du Ricardo D‘Andrea sein!“, versprach der Glasbrenner, und Ricardo war tatsächlich ein wenig geneigt, ihm endlich zu glauben. Obwohl es ihm zu märchenhaft erschien, um wirklich wahr sein zu können.
Er sah sich nach den beiden Wachmännern um, sah deren freundliches Lächeln. Wobei er niemals auch nur vermutet hätte, dass ausgerechnet Wachmänner dazu überhaupt fähig sein könnten.
Immerhin: Ein freundliches Lächeln, geschenkt von zwei Stadtwachen ausgerechnet einem verlausten und verwahrlosten Straßenjungen wie ihm?
„Ich hoffe allerdings“, meinte der Glasbrenner zögernd, als befürchtete er, damit Ricardo doch wieder in die Flucht zu jagen, „dass du nichts gegen die Entlausung, ein ausgiebiges Bad und frische Kleider haben wirst?“
Ricardo lachte verlegen. „Nein, das gewiss nicht!“, versprach er.
Dann ging er mit den drei Männern mit.
3
Seit Mitte des vierzehnten Jahrhunderts wurde Venedig immer wieder von der Pest heimgesucht, vom Schwarzen Tod. Gerade eine Stadt wie Venedig, die vom Handel lebte, vom Warenumschlag im großen Stil, und wo es regelrecht wimmelte von Besuchern aus aller Welt, wurde dadurch auch immer wieder zum Zentrum für die Pest, von dem aus sich die Seuche nahezu ungehindert über ganz Europa ausbreitete.
Die Menschen waren verzweifelt, weil sie nicht nur Angehörige, Freunde und Bekannte verloren, sondern auch nicht selten auch ihr Hab und Gut. Sie konnten einfach nicht verstehen, wieso Gott sie immer wieder dermaßen bestrafte, trotz ihrer sprichwörtlichen Frömmigkeit und Bußfertigkeit. Sie sahen, wie um sie herum andere wie die sprichwörtlichen Fliegen starben, und konnten sich über ihr eigenes Überleben angesichts der Folgen gar nicht mehr so recht freuen.
Im Jahre des Herrn 1390, gerade drei Jahre nach ihrer kurzen Begegnung mit dem jungen Ricardo, hatte Catrina keine bewusste Erinnerung mehr an diese Begegnung, obwohl sie andererseits unauslöschlich geblieben war. Es waren weitere behütete Jahre für sie gewesen. Umso härter traf sie der erneute Ausbruch der Pest, bei der diesmal auch ihre Familie ganz unmittelbar betroffen wurde. In aller Heftigkeit und Gnadenlosigkeit.
Niemand in ihrer Familie wurde verschont. Ihre Eltern starben genauso wie all ihre Geschwister den Schwarzen Tod. Und sie selbst erkrankte und rang schier endlos lange mit diesem Tod, meist vor lauter Schwäche ohne Bewusstsein und in den Wachphasen blind vor Schmerzen und vor Trauer.
Da sie die Pest als einzige in der ganzen Familie überlebt hatte, kam sie in die Obhut von barmherzigen Schwestern, die selbst von der Seuche nicht betroffen waren. Weil Gott es so wollte? Aber wie konnte Gott denn so grausam sein und einer gerade mal Fünfzehnjährigen wie Catrina wirklich alles nehmen? Nicht nur ihre Eltern und ihre Geschwister, sondern auch ihre Existenzgrundlage, denn mit dem Tod von allen gab es auch das Geschäft des Wollhändlers nicht mehr. Die Waise Catrina wurde vollkommen mittellos.
War es durch die hingebungsvolle Pflege durch die barmherzigen Schwestern oder gar dem Willen Gottes höchst selbst entsprechend, aber Catrina überlebte nicht nur die Pest, sie wurde sogar wieder gesund.
Die Schwestern jedenfalls sahen darin ein ganz großes Wunder, denn ihnen war nicht bekannt, dass jemand jemals so schwer an der Pest erkrankt gewesen wäre und am Ende diese furchtbare Krankheit tatsächlich sogar dermaßen besiegt hätte, um danach wieder so gesund zu werden wie zuvor.
Allerdings mit einer Einschränkung, denn dieses Wunder forderte ganz offensichtlich ein grausames Tribut: Catrina verlor ihr Augenlicht! Sie erblindete vollständig.
Noch als sie total bettlägerig gewesen war, um sich von der Krankheit erst einmal ein wenig zu erholen, die sie auf so wundersame Weise überlebt hatte, war ihr klar geworden, dass dies keineswegs nur eine vorübergehende Blindheit war, sondern eine zusätzliche Bürde für den ganzen Rest ihres Lebens.
Sie spürte beim Gedanken daran eine Verzweiflung, die beinahe ihre Trauer um den Tod ihrer Eltern und Geschwister noch übertraf. Konnte sie angesichts dessen denn wirklich Gott dankbar sein, dass er ihr dieses Schicksal aufgebürdet hatte? War es denn angesichts dessen überhaupt noch von Vorteil, den Tod durch die Pest überwunden zu haben?
Das Verzagen, dem sie anheimfiel, war zu groß, um von den barmherzigen Schwestern schön geredet werden zu können. Catrina verfiel in tiefste Lethargie und weigerte sich gar, ihr Bett zu verlassen, um endlich die Beschwerlichkeit ihres neuen Lebensweges anzunehmen.
Allerdings war auch dies nicht von Dauer, denn sie begann allmählich zu vermuten, dass ihr Überleben vielleicht doch irgendwie einen höheren Sinn haben könnte. Sie war doch erst fünfzehn Jahre alt und hatte eigentlich noch ihre ganze Zukunft vor sich. Aber ohne ein behütendes Elternhaus? Ohne die Liebe ihrer Eltern und ihrer Geschwister? Und dann auch noch vollkommen erblindet?
Dennoch: Was auch immer dieses Wunder des Überlebens bewirkt hatte, durfte es nicht ganz umsonst gewesen sein!
Solcher Art Gedanken schafften es tatsächlich, neuen Mut in ihr zu wecken. Auch wenn sie die Augen weit aufriss und dabei trotzdem nur vollkommene Finsternis erblickte, musste sie lernen, sich in dieser grausamen Finsternis zurechtzufinden.
Catrina verließ zum ersten Mal ihr Bett in einem Moment, an dem sie ganz allein war in dem Zimmer, das die Schwestern ihr zugewiesen hatten. Eher eine kleine Kammer, in der kaum Platz war für eine wacklige Kommode neben dem Bett. Es gab nicht einmal einen Stuhl oder einen Tisch.
Gleich neben der Kommode musste das Fenster sein, denn wenn sie sich recht erinnerte, zog es aus dieser Richtung, wenn das Fenster geöffnet war und draußen der Wind über die Mauern des Klosterbaus streifte.
Catrina tastete sich zum Fenster hin, fand den Mechanismus, um zu öffnen und sog tief die frische Luft ein, die von draußen hereinwehte. Sie hielt die Augen dabei fest geschlossen, was für sie ja keinen Unterschied mehr machte.
Und dann hörte sie, wie sich hinter ihr die Tür öffnete, und wollte sich danach umdrehen.
Es war der Augenblick, in dem etwas geschah, was alle Wunder sogar noch übertraf. Ja, sogar das Wunder ihres Überlebens. Denn es war der Augenblick, in dem sie sich selbst sehen konnte. Von hinten. Sie sah auf sich selbst, während sie sich den Rücken zukehrte.
Ein ächzender Laut entrang sich ihrer Kehle. Sie musste sich am engen Fensterrahmen festhalten, um nicht den Halt zu verlieren. Das Bild vor ihr war so deutlich, wie es deutlicher gar nicht hätte sein können.
Konnte sie denn auf einmal wieder sehen? Aber wieso sah sie denn dann nicht aus dem Fenster hinaus, dem sie sich zugewandt hatte, sondern sich selbst von hinten?
Eine Stimme hinter ihr: „Catrina, was tust du denn da?“
Es war zweifellos eine der Schwestern, die sie die ganze Zeit über gepflegt hatten. Sie machte sich natürlich Sorgen um Catrina, die nicht wieder hatte aufstehen wollen, trotz aller Mühe, die man ihr hatte zuteilwerden lassen. Und wollte sie sich denn jetzt gar aus dem Fenster stürzen vor lauter Verzweiflung über ihre familiären Verluste und über ihre Blindheit?
Die Nonne stürmte vor und packte Catrina hart an den Schultern, um sie zurückzureißen. Um sie zu retten, wie sie meinte.
Catrina verlor das Bild vor ihren Augen, das ihr im Nachhinein vorkam wie ein Traumbild. Aber seit wann träumte sie mit wachen Augen? War es denn wegen ihrer Blindheit, weil diese Augen sowieso nichts mehr sehen konnten? War das denn sogar normal?
Wie hätte sie das wissen sollen? Sie hatte niemals Gelegenheit gehabt in ihren jungen Jahren, mit einem Blinden etwa Erfahrungen auszutauschen. Es war für sie völlig neu. Eine Erfahrung gar, auf die sie liebend gern für immer verzichtet hätte.
Willenlos ließ sie es geschehen, als die Nonne, die es ja nur gut mir ihr meinte, sie ziemlich derb auf das Bett zurückwarf.
Mit geschlossenen Augen blieb Catrina liegen und starrte in diese vollkommene Finsternis hinein, die ihr wie ihr ärgster Feind vorkam.
Um auf einmal wieder etwas sehen zu können. Ein weiteres Traumbild? Was denn sonst? Wieso hätte sie sich selbst auf dem Bett liegen sehen sollen? So deutlich eben, als würde sie nicht auf dem Bett liegen, sondern daneben stehen und genau dorthin starren.
So wie die Nonne, die sie gerade auf das Bett zurückgeworfen hatte?
Eisiger Schreck packte mit seinen kalten Klauen nach ihrem bebenden Herz und brachte es vorübergehend sogar zum Stehen. Stocksteif lag Catrina jetzt auf dem Bett und konnte wiederum nur noch die totale Finsternis sehen mit ihren wieder weit aufgerissenen Augen. So weit aufgerissen, als würde sie den Teufel selbst damit sehen. Und genauso war auch ihr Gesichtsausdruck dabei.
Das steigerte noch die Sorgen der Nonne, weshalb sie halbwegs verzweifelt um Hilfe rief.
Catrina blieb liegen, immer noch stocksteif vor Entsetzen, weil sie jetzt wusste, was das für Bilder waren, die so unmöglich erschienen, dass es unmöglicher gar nicht mehr hätte sein können:
Sie hatte durch die Augen der Nonne gesehen!
Aber wieso ließ Gott denn solches zu? Nicht nur, dass Gott sie hatte erblinden lassen, konnte sie jetzt auch noch die Augen anderer Menschen missbrauchen, um zu sehen? Das kam ihr eher wie teuflischer Frevel vor als eine Gabe Gottes. Zumal die Nonne davon selbst überhaupt nichts mitbekommen hatte. Sonst hätte sie doch wohl entsprechend reagiert?
Die Hilfe kam und lenkte Catrina von ihren düsteren Gedanken ab. Und gegen ihren eigenen Willen sah sie jetzt abwechselnd durch die Augen der anwesenden Nonnen. Diese waren zu dritt. Und zum ersten Mal wusste Catrina, wie sie überhaupt aussahen. Hatte sie doch zuvor immer nur ihre Stimmen gehört. Zunächst als Todkranke. Später dann mit fortschreitender Genesung, als sie sich selbst hatte eingestehen müssen, für immer blind geworden zu sein.
Sie fürchtete sich auf einmal vor dieser Gabe und wollte nicht mehr durch die Augen anderer sehen, die sich offensichtlich nicht dagegen zur Wehr setzen konnten. Das konnte doch nur etwas sein, was man als große Sünde bezeichnen musste. Missbrauchte sie denn nicht regelrecht die Augen jener, ohne deren Erlaubnis, machte sie jene denn damit nicht sogar zu einer Art Opfer?
Andererseits allerdings: Es tat ihnen ja nicht weh. Weil sie es noch nicht einmal bemerkten. Und sie schenkten ihr damit sogar etwas, nämlich so etwas wie ein Augenlicht aus zweiter Hand.
Oder sollte man es nicht Geschenk, sondern Diebstahl nennen? Sie stahl ihnen das Augenlicht, um es selbst zu benutzen?
Die Gedanken Catrinas verwirrten sich, denn eigentlich stahl sie ja nicht wirklich den Nonnen ihr Augenlicht. Sie behielten es ja weiterhin für sich selbst. Das hieß, sie konnten weiterhin sehen, was sie selber wollten. Catrina konnte sie nicht dazu zwingen, dorthin zu blicken, wohin sie wollte. Sie musste mit dem vorlieb nehmen, was deren Augen ihr zeigten.
Also eher so eine Art großzügige Leihgabe?
Catrina ballte die zierlichen Hände zu Fäusten. So fest, dass sie zitterten. Am liebsten hätte sie damit auf ihren eigenen Kopf eingedroschen, um diese Bilder zu vertreiben, die sich einfach nicht wieder abschalten lassen wollten. Denn alle Bemühungen nutzten nichts: Sie konnte weiterhin durch ihre Augen sehen. Abwechselnd, nicht gleichzeitig. Nicht so, wie sie es wollte, sondern irgendwie rein zufällig.
Drei Augenpaare, die jetzt nur noch auf ein gemeinsames Bild gerichtet waren: Das Bild, wie Catrina auf ihrem Bett lag, rücklings, mit geballten, zitternden Händen, entsetzt geweiteten, wenngleich blinden Augen, und mit dem Ausdruck namenlosen Schreckens in ihrer Miene.
Die Nonne, die der Meinung war, Catrina gerettet zu haben, schloss wieder das Fenster. Dabei erhaschte Catrina einen Blick nach draußen. Das brachte ihr allerdings nicht viel, denn sie wusste dennoch nicht, wo genau sie sich hier überhaupt befand, denn dieses Kloster hatte sie vordem noch nie besucht. Ja, sie hatte davon noch nicht einmal etwas gewusst.
Sie schloss die Augen wieder und hoffte, dass es etwas nutzte, dass dadurch diese Bilder endlich verschwinden würden.
Es gelang immer noch nicht. Zumindest jedoch schaffte Catrina es, sich wieder halbwegs zu beruhigen.
„Es ist alles gut!“, behauptete sie mit leiser Stimme, wenngleich mit einem leichten Zittern darin.
Die Nonnen glaubten ihr daher kein Wort. Sie sahen sich gegenseitig an – und Catrina sah mit.
„Bitte“, flehte Catrina, „niemand muss sich meinetwegen noch Sorgen machen. Ich wollte mich doch gar nicht aus dem Fenster stürzen. Das war ein Missverständnis. Ich habe nur beinahe den Halt verloren, als ich da stand. Sicher, weil ich total erschöpft bin wegen viel zu langer Bettlägerigkeit. Ich muss einfach nur wieder zu Kräften kommen. Und ich verspreche hoch und heilig, dass ich mich fügen werde. Ich will wieder auf die Beine kommen. Mehr noch: Ich will euch für alles danken, was ihr für mich getan habt.“
„Das brauchst du nicht“, sagte die eine mit sanfter Stimme und streichelte ihr sogar beruhigend über den Kopf. „Wir haben es gern für dich getan. Du bist doch unser Wunder. Alle sehen das so, denn nur Gott allein kann ein solches Wunder vollbringen. Und wir schätzen uns glücklich, dass wir persönlich Anteil daran haben durften.“
„Und immer noch dürfen!“, betonte die zweite, während die dritte Catrinas Hand nahm und fest drückte.
„Jedenfalls sind wir jetzt froh, dass du wieder neuen Mut gefasst hast. Bald wirst du wieder vollends auf den Beinen sein.“
„Und was dann?“, erkundigte sich Catrina auf einmal bang. „Wo soll ich denn dann hin?“
„Du kannst so lange bei uns bleiben, wie du willst. Unsere Äbtissin hat das längst entschieden. Du stehst in keiner Schuld bei uns.“
„Als ein Wunder Gottes!“, bekräftigte die erste Nonne.
Catrina zögerte nur kurz: „Gut, ich werde wohl bleiben. Aber nicht einfach so.“
„Was meinst du damit?“
„Wäre es denn möglich, gleich euch dem Herrn zu dienen, dem Glauben nicht nur, sondern mich auch verdingen der Hilfe am Nächsten? Obwohl ich blind bin?“
„Ach, komm doch erst einmal zu Kräften. Dann wird sich alles Weitere ergeben“, riet die erste Nonne.
Die zweite allerdings war da offenbar nicht ganz der gleichen Meinung: „Sobald du wieder bei Kräften bist, kann dir unsere Äbtissin sicherlich einen Vorschlag machen. Als Novizin nämlich. Ohne dauerhafte Verpflichtung.“
„Gewissermaßen zur Probe?“, erkundigte sich Catrina gespannt.
„Ja, gewissermaßen. Eben zunächst einmal ein Gelübde auf Zeit. Aber ruhe dich jetzt erst noch aus. Es eilt dies ja nicht. Gott hat alle Ewigkeit – und du sicherlich noch ein langes Leben, so gesund du wieder bist.“
Das klang alles sehr zuversichtlich, und es bestärkte Catrina auch tatsächlich in ihrem neuen Mut.
Als die drei Nonnen sie wieder verließen, damit sie endgültig zur Ruhe kommen konnte, lag sie noch lange grübelnd auf ihrem Bett. Indem die drei sie verlassen hatten, war die totale Finsternis wieder zur Vollkommenheit gereift, alle Bilder erloschen, die sie aus den Blickwinkeln der Nonnen erhascht hatte.
Catrina hatte nichts darüber gewagt zu sagen. Sie würde auch noch weiter Stillschweigen darüber üben. Zumindest solange, nahm sie sich vor, bis sie sicher sein konnte, dass es nicht etwa eine Gabe des Teufels war.
Denn was, wenn nicht Gott sie hatte gesunden lassen, sondern sein ärgster Widersacher? Der Catrina zudem auch noch mit einer solchen Gabe geißelte?
4
Nach kurzem und wenig erholsamem Schlaf, auch noch gepeinigt von schrecklichen Albträumen, erwachte Catrina wieder. Sie starrte zur Decke, ohne etwas zu sehen, und die Erinnerung an das Erlebnis mit den Nonnen kehrte wieder zurück. Damit auch erneute Zweifel.
Ja, war es nun eine Gabe Gottes oder eine Gabe des Teufels? Wie hätte sie das denn überhaupt unterscheiden können?
Aber wenn sie sich dankbar Gott gegenüber erwies und in seinem Namen diente, um Gutes zu tun, zunächst zur Probe als Novizin und pflegende Schwester, hatte doch der Teufel keinerlei Macht über sie? Warum also hätte er ihr dann eine Gabe aufbürden sollen, von der er selber nicht im Geringsten profitierte?
Es war genau die Art von Logik, wie sie in diese Zeit passte, in der alles Leben abhängig zu sein schien vom Wohlwollen Gottes in Konkurrenz zu seinem mächtigen Gegenspieler. Als wäre es nur nötig, alles zu tun, um Gott zu gefallen, um damit den Einfluss des Bösen zu schmälern oder gar ganz zu verhindern.
Obwohl dem gegenüber all das Schreckliche stand, was nicht nur Menschen von niederem Stand widerfuhr, sondern auch denen, die sich zur Elite ihrer Zeit zählen wollten. Denn die Pest machte da kaum einen Unterschied. Sie raffte eben nicht nur die Ärmsten der Armen dahin, sondern ereilte auch manche Reiche und bestrafte jene, die irgendwo dazwischen lagen. Wie Catrina als Tochter eines kleinen Wollhändlers, der es in ihrem bisherigen Leben nicht wirklich an etwas gefehlt hatte, obwohl sie niemals zu den wahrhaft Wohlhabenden sich hätte zählen dürfen.
Und jetzt hatte sie zwar überlebt, aber war bettelarm geworden. Allerdings mit der Chance, ihr Überleben nutzbringend einbringen zu können. Eben im Angesicht Gottes. War es da denn nicht wirklich noch völlig ohne Belang, wem sie dieses Wunder letztlich zu verdanken hatte, das ihr widerfahren war? Im Dienste des Herrn nämlich konnte es letztlich doch nur noch das Wunder des Herrn höchstselbst genannt werden!
Das beruhigte sie einerseits ungemein, andererseits wagte sie es immer noch nicht, jemandem von jenen Bildern zu erzählen, Visionen gleich und dennoch dermaßen real: Weil sie es doch tatsächlich vermochte, durch die Augen anderer zu sehen.
Oder war das nur etwas Vorübergehendes gewesen, was sich nicht auf Dauer wiederholen ließ?
Einerseits hätte sie inzwischen den Verlust dieser Gabe sogar bedauert, obwohl sie darin zunächst eher eine Art Fluch gesehen hatte. Denn sie war nun einmal völlig blind, und wenn sie durch die Augen anderer sah, war das immerhin eine nicht zu unterschätzende Erleichterung für sie. Zwar nicht vergleichbar mit dem eigenen Augenlicht, aber dennoch etwas, wofür sie sich als Blinde eher als über alle Maßen dankbar erweisen sollte. Immerhin würde dies natürlich auch ihren Dienst im Namen des Herrn erheblich erleichtern helfen, um damit mehr als nur dem schieren Eigennutz zu dienen.
All diese Gedanken bestärkten sie noch mehr, endlich das neue Leben anzunehmen, all diese Trauer zu überwinden und nicht länger im Selbstmitleid zu versinken ob des Verlustes ihres Augenlichts.
Selbst wenn ihre neue Gabe jetzt wieder erloschen sein sollte, wohlgemerkt!
Sie konnte sogar wieder lächeln. Und sie lächelte in die Finsternis hinein, die dunkler war als nur dunkel, denn es war die totale Abwesenheit von jeglichem Licht.
Die Erhellung kam erst, als sich zaghaft die Tür öffnete: Prompt konnte Catrina wieder sehen, und sie sah sich selbst auf dem Bett liegen, während diejenige, durch deren Augen sie sehen konnte, auf leisen Sohlen näher kam.
Catrina wandte sich ihr zu, ohne sie mit ihren eigenen Augen zu sehen. Sie sah dabei vielmehr in diese eigenen blinden Augen hinein.
Wer war das nur, der jetzt an ihrem Bett stand?
Das erfuhr sie erst beim Klang der Stimme.
„Oh, du bist wieder wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt?“
Die Äbtissin des Klosters. Mithin jene Frau, der sie zusätzlich ihr Leben verdankte, denn ohne die von ihr angeordnete Pflege der Schwestern hätte sie sich trotzdem nicht mehr von dieser schrecklichen Krankheit erholen können. Sie war zwar nicht daran gestorben, aber so geschwächt wie sie gewesen war, hätte sie trotzdem nicht mehr lange gelebt. Und inzwischen haderte Catrina nicht mehr damit, sondern war tatsächlich überaus dankbar darum.
Sie lächelte die Äbtissin an und sah dabei ihr eigenes Lächeln mittels deren Augen.
„Es ist ein Geschenk Gottes, dass ich weiterleben darf“, bekannte sie. „Und ich bin jetzt bereit, dieses Geschenk dankbar anzunehmen.“
„Man hat es mir bereits zugetragen“, verriet ihr die Äbtissin. „Gott hat Wohlgefallen an dir, sonst hätte er dich nicht gerettet. Also hat er noch Besonderes mit dir vor.“
„Und ich will dem voll und ganz genügen! Mein vorheriges Leben lang sah es so aus, als hätte Gott etwas ganz anderes mit mir im Sinn. Das hat sich auf drastische Weise geändert. Ich habe alles verloren, was in meinem vorherigen Leben so immens wichtig gewesen war für mich, und dafür habe ich jetzt die Chance zu diesem anderen Leben ganz im Dienste des Herrn. Es ist das einzige, worum ich jetzt noch bitten will: Mir die Möglichkeit dazu zu gewähren.“
„Mach dir darüber keine Gedanken, mein Kind. Du bist nicht nur für uns das lebende Wunder. Es gibt viele Menschen inzwischen in Venedig, die davon gehört haben. Sie verehren dich wie eine Heilige.“
„Ist das so? Davon ahnte ich ja gar nichts“, bekannte Catrina überrascht.
„Nein, natürlich nicht, weil es dir bisher niemand erzählt hat. Wir wollten dich damit nicht überfordern, aber jetzt, da du dein Schicksal ohne Einschränkungen anzunehmen bereit bist, ist es an der Zeit, dich darüber aufzuklären. Mit diesem Ruf kannst du viel Gutes bewirken. Und glaube mir, diese Stadt hat es bitter nötig nach all dem Schrecken, dem sie bereits ausgesetzt war. Noch immer wüten Krankheiten nicht nur in den Elendsvierteln, weil die Pest natürlich die Versorgung nachhaltig gestört hat. Wir haben alle Hände voll zu tun, um die größte Not lindern zu helfen.“
„Dann werde ich meinerseits alles tun, um euch zu unterstützen!“, rief Catrina voller Tatendrang und erhob sich vom Bett.
„Langsam, langsam“, bremste die gute Äbtissin sie. „Du bist noch nicht kräftig genug.“
„Aber kann ich es denn nicht einfach schon versuchen?“, schlug Catrina vor.
Sie bettelte regelrecht.
„Bitte, ich will es tun. Jetzt! Soweit ich kann. Soweit es meine Kräfte erlauben. Ich bin noch sehr jung, und ich werde mich schnell erholen. Viel schneller, wenn ich aktiv dem Herrn dienen kann, als würde ich nur hier auf dem Bett liegen.“
Die Äbtissin zeigte sich skeptisch, was Catrina natürlich nicht sehen konnte, aber sie spürte es regelrecht. Was sie wirklich sehen konnte, war nach wie vor sie selbst. Und deshalb fiel es ihr leicht, ihre Schwäche nach so langer Bettlägerigkeit zu kaschieren und erholter zu erscheinen als sie in Wahrheit war.
Sie wollte wirklich tapfer die Zähne zusammenbeißen und es endlich anpacken. Allein schon deshalb, um sich selbst von etwaigen düsteren Gedanken abzulenken.
Die Äbtissin nickte endlich und war bereit, es zuzulassen.
5
Anfangs erwies es sich als sehr schwierig, die Gabe zu nutzen, um sich einigermaßen koordiniert zu bewegen. Es war, als würde sie sich selbst in einer Art Spiegel sehen, und nur anhand dessen, was sie da sah, versuchte sie gezielte Bewegungen durchzuführen. Wenn sie beispielsweise nach etwas griff, das sie halt nur indirekt sehen konnte, durch die Augen von jemand anderem.
Es war viel Übung nötig, um dies immer besser zu schaffen. Jedenfalls wurde sie erst im Laufe der Zeit für andere so erstaunlich sicher, trotz ihrer Blindheit. Es musste nur immer jemand nah genug sein, um durch dessen Augen sehen zu können. Und mit der Zeit lernte sie sogar, das insofern bewusst zu steuern, dass sie selber bestimmen konnte, wessen Augen sie jeweils benutzte.
Obwohl das ziemlich verwirrend sein konnte, wenn sie beispielsweise einfach nur quer durch den Raum ging und dabei aus wechselnder Sicht sich selbst beobachtete, um nirgendwo anzustoßen oder über etwas zu stolpern, was im Weg lag.
Und die Äbtissin behielt recht: Die Kranken und Verletzten, die im Kloster um Hilfe ersuchten, verehrten sie wie eine Heilige. Mit dem gebührenden Respekt und auch mit einer gewissen Zuneigung. Nicht so, dass Catrina es gar als erdrückend hätte empfinden können, sondern es blieb eher angenehm für sie. So wurde sie jedenfalls von allen geliebt und geschätzt. Obwohl niemand sie ob ihrer Blindheit wirklich ernst nahm. Noch nicht einmal die Äbtissin selbst, von der sie ansonsten dennoch in allem bestärkt und unterstützt wurde, was sie anstrebte.
Catrina blieb allerdings bescheiden in ihren Ansprüchen. Sie hatte sich selbst zur heiligen Aufgabe gesetzt, den Menschen zu helfen, und das tat sie nach Kräften und wie man es ihr als blinder junger Frau gerade noch zugestand.
Dabei musste sie bloß immer vorsichtig bleiben, damit niemand Verdacht schöpfte ob ihrer Gabe, denn nach wie vor hielt sie diese geheim. Selbst nicht so recht wissend, wieso sie daraus ein solches Geheimnis machte. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich vor den Reaktionen der betroffenen Menschen fürchtete?
Immerhin, wenn sie erfuhren, dass eine Blinde doch tatsächlich leihweise durch ihre Augen sehen konnte, ohne dass sie etwas dagegen zu tun vermochten ...
Die Zeit verging, und längst zweifelte Catrina nicht mehr daran, dass ihr Überleben und auch ihre besondere Gabe Geschenke Gottes waren.
Doch vielleicht nicht persönlich von Gott verliehen?
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie die Idee erlangte, dass vielleicht der Heilige Markus damit etwas zu tun haben könnte. Der Legende nach sollten ja die Gebeine des Apostels von Alexandria nach Venedig gebracht worden sein, um sie in der Kapelle gegenüber dem Dogenpalast beizusetzen. Viele Menschen in jener Zeit glaubten fest an die heilenden Kräfte dieser Gebeine, und sie verehrten sogar den nach dem Apostel benannten Markusplatz als Quelle heiliger Macht, um Krankheit und vielleicht sogar den Tod zu überwinden.
Es war also kein Zufall, dass Catrina sozusagen auf den Apostel kam und immer häufiger zum Markusplatz pilgerte, sofern es ihre knapp bemessene Zeit erlaubte, um in der Kapelle während ihrer Gebete dem Apostel Markus nicht nur für ihr Überleben zu danken, sondern auch für diese Gabe, die sich für sie als blinder Frau tatsächlich als eine arge Erleichterung bewährt hatte. Zwar nicht so, als könnte sie nach wie vor mit ihren eigenen Augen sehen, aber das Sehen mittels der Augen anderer hatte sich längst als ein wahrer Segen erwiesen. Zumal sie gelernt hatte, damit virtuos umzugehen, ohne allzu auffällig dabei zu werden.
Als Catrina der Äbtissin schließlich den Wunsch vortrug, sich mit Nachnamen di San Marco nennen zu dürfen, hatte diese absolut gar nichts dagegen. Ja, sie unterstützte dieses Ansinnen sogar nach Kräften, und so wurde aus Catrina, Novizin des Ordens und vormals Tochter des Wollhändlers, Catrina di San Marco. Was verbunden war mit einem Gelübde auf Zeit als Nonne, nicht mehr als Novizin. Denn nur dadurch durfte sie sich einen Namen zulegen im Dienste des Herrn. Wie jede Nonne.
Schwester Catrina di San Marco eben!
Ein Name, den sie fürderhin voller Stolz trug, und auch ein Name, der bald in Venedig durchaus seinen eigenen Klang bekam: Catrina di San Marco, die Barmherzige. Was sie sich redlich verdiente durch ihre aufopfernde Hilfe am Nächsten. Nicht nur als Überlebende der Pest.
6
Es kam das Jahr 1400, das ein weiteres Mal den Schwarzen Tod im Gepäck hatte. Diesmal mit nie gekannter Grausamkeit. Das hieß, es übertraf alles, was Venedig bisher hatte erleiden müssen.
Die Menschen waren dementsprechend noch verzweifelter denn je. Sie kannten die Ursache des Schwarzen Todes nicht und konnten nicht verstehen, dass es diesmal trotz ihrer verstärkten Zuwendung zur Frömmigkeit und Bußfertigkeit immer noch hatte schlimmer werden können. Mehr denn je starben sie wie die sprichwörtlichen Fliegen; ein Ausmaß des Schmerzes, der Trauer und auch der Wut über die eigene Hilflosigkeit erzeugend, das ebenfalls alles Bisherige übertraf, während über der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes der Pesthauch des Todes lag, so schwer, dass nicht einmal ein Sturm vermocht hätte, ihn zu vertreiben.
Seit nunmehr fünfzig Jahren war die Seuche immer wieder nach Venedig gekommen, um zunächst hier zu wüten und sich von hier aus über Europa auszubreiten. Es war kein Wunder, dass angesichts dessen viele Menschen endgültig von ihrem Glauben an Gott abfielen und sich mehr und mehr heidnischen Vorstellungen hingaben, auch der finstersten Art.
Die Kirche verlor ihre schiere Allmacht und bemühte sich vergeblich um Eindämmung. Denn die Frage, wieso Gott all diese Schrecken denn überhaupt zulassen konnte, war auch von den Männern im schwarzen Talar nicht glaubwürdig zu beantworten. Was sollten die Menschen denn jetzt noch alles tun, um ihre Frömmigkeit und Bußfertigkeit unter Beweis zu stellen, während Gott ihre Bemühungen nicht nur total ignorierte, sondern nach Ansicht viel zu vieler Menschen in jener allzu schweren Zeit sogar auch noch bestrafte?
Inmitten des Chaos, das sich bemühte, nicht nur die Bewohner von Venedig nachhaltig zu dezimieren, sondern auch ihren Wohlstand und ihre Rolle als wichtigste Handelsstadt nicht nur der Region, fiel die Serie von Frauenmorden nicht sonderlich auf. Zumal die Opfer ausschließlich unter Dirnen und Bettlerinnen, oder aber Diebinnen zu finden waren. Was für die sich anständig dünkenden Bürger beinahe ein und dasselbe war. Schließlich hatte ein jeder mit sich selbst zu tun, mit dem eigenen Überleben, aber auch mit der Trauer über persönliche Verluste und dem Bemühen, außer dem nackten Leben auch noch den letzten Rest von Wohlstand zu schützen. Es interessierte nicht, dass die Opfer grausam verstümmelt waren. Dass man ihnen das Herz herausgeschnitten und die Zunge entfernt hatte.
Das Morden ging weiter, während nach wie vor weit mehr Opfer noch von der Pest dahingerafft wurden. Es erschien fast so, als hätte die Pest diesmal ihren kleinen Bruder mitgebracht, der sich ebenfalls bemühte, Venedig zu Fall zu bringen mit seinen Morden. Wobei er im Gegensatz zur Pest selbst eher gezielt vorging, was die Auswahl seiner Opfer betraf.
Bis es eines Tages auch einmal eine junge Frau aus bestem Hause traf! Die Umstände waren nicht ganz klar, denn was hatte diese junge Frau, obzwar aus bestem Hause stammend, ausgerechnet dort zu suchen, wo man eher die typischen Opfer des Serienmörders vermutete, nämlich bei Dirnen, Bettlerinnen und Diebinnen? Letztlich spielte jedoch allein der Umstand die Hauptrolle, dass ihre Familie nachdrücklich nach Aufklärung verlangte.
Dem konnte auch der Doge von Venedig nicht mehr länger entgehen. Er konnte nicht mehr so tun, als sei dieses Problem nicht doch von größerer Bedeutung, während immer noch auch viel schlimmere Probleme die Stadt heimsuchten, die in der Regel mit der Pest zu tun hatten.
Da er persönlich natürlich nicht wirklich etwas tun konnte, musste er jemanden damit beauftragen, dem er durchaus zutrauen konnte, Licht in das Dunkel dieser Angelegenheit zu bringen, bevor noch weitere Töchter aus gutem bis bestem Hause betroffen wurden. Er ließ Ricardo D‘Andrea zu sich kommen!
Ricardo war inzwischen längst ein studierter Mann geworden, doch die Wurzeln seiner Kindheit, mit denen er nach wie vor über seine Kindheitserinnerungen mit dem verbunden war, was man Gosse nannte, hatten ihn zusätzlich prädestiniert, in die Dienste des Dogen zu treten. Obwohl sein Ziehvater, der Glasbrenner Giuseppe D‘Andrea, es anders mit ihm beabsichtigt hatte.
Die Glasbrennerei war in jener Zeit in Venedig eine wahrlich hohe Kunst geworden, deren Geheimnisse nach wie vor fast so gehütet wurden wie das Geheimnis um den Kriegshafen Venedigs, jene Anlagen, durch die sogar eine Lagunenstadt schier unangreifbar geworden war.
Gegen menschliche Feinde zumindest, nicht etwa gegen Seuchen wie die Pest, wie es sich schmerzlich erwiesen hatte. Und natürlich auch nicht gegen Feinde im Innern, als solchen der Doge inzwischen jenen Frauenmörder endlich begriffen hatte.
Jedenfalls hatte die erfolgreiche Geheimniskrämerei den Glasbrenner Giuseppe D‘Andrea zu einem der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer der Stadt gemacht. Wenngleich nicht einflussreich genug, um zu verhindern, dass der Doge persönlich „seinen“ Ricardo regelrecht abgeworben hatte. Was allerdings Ricardo selbst ganz und gar nicht bedauerte. Und so lange Giuseppe, sein Ziehvater, die Geschäfte noch selbst leiten konnte, war es nicht zum Schaden für die Glasbrennerei, wenn er unterdessen die Aufträge des Dogen erledigte.
Zu einer Zeit, während die Pest dermaßen wütete, hatte er allerdings schon anderweitig alle Hände voll zu tun. Deshalb kam ihm diesmal der persönliche Auftrag des Dogen, dem Serienmörder auf die Spur zu kommen, ganz und gar nicht gelegen. Schließlich ging es für ihn sowieso schon um etwas sehr Bedeutsames: Es schien so, als würden im großen Stil die Laken und Kleider von Pestkranken nach deren Tod weiterverkauft werden, obwohl sie zwingend hätten verbrannt werden müssen.
Eine kriminelle Organisation schien sich an solcherlei Widerlichkeiten zu bereichern, denn es konnte sich unmöglich um Einzeltäter handeln, wie Ricardo bereits in Erfahrung hatte bringen können.
Und jetzt sollte er all seine Erkenntnisse weitergeben an andere Ermittler und durfte nicht mehr weiter in dieser Sache ermitteln?
Der Doge persönlich begründete es mit den Worten:
„Bedenkt, Ricardo D‘Andrea, dass solchermaßen der venezianische Stadtstaat in seinen Grundfesten erschüttert werden könnte. Weil niemand dem Einhalt geboten hat, weitete der Mörder offensichtlich sein Betätigungsfeld aus und wird auch die vornehmen Töchter nicht länger verschonen. Jedenfalls deuten die Umstände unmissverständlich darauf hin. Seid Ihr Euch denn darüber überhaupt im Klaren, wie dringlich dies nach einer Aufklärung schreit?“
Ricardo war sich darüber im Klaren. Natürlich. Und zähneknirschend willigte er schließlich ein. Nicht nur, weil ihm sowieso keine andere Wahl blieb, denn was hätte es genutzt, ausgerechnet dem Dogen widerstehen zu wollen und gar seinen ausdrücklichen Befehl zu missachten?
Sein Anfangsverdacht war auf Grund seiner bisherigen Erfahrungen dann wohl auch nicht ganz von der Hand zu weisen: Er vermutete, dass dahinter in Wahrheit ein besonderer Kult stand, dessen Spur er auch schon im Rahmen der Ermittlungen mit den verseuchten Hinterlassenschaften der Pestkranken verfolgt hatte. So würde er ja möglicherweise seine bisherigen Erfolge in dieser Angelegenheit doch nicht so ganz vergessen müssen. Denn wenn es da wirklich einen Zusammenhang geben sollte, gab es für ihn beste Voraussetzungen, tatsächlich zum Erfolg zu kommen.
Allerdings fiel es schwer, die einzelnen Toten tatsächlich mit dem Diebstahl jener Laken und Kleidungsstücke in Verbindung zu bringen. Das alles passte weder zeitlich noch räumlich so recht zusammen. So vergingen Tage, in denen das Morden weiterging, ohne dass es Ricardo gelang, auch nur einen Zollbreit weiter zu kommen in seinen Ermittlungen.
Bis eines der nächsten Opfer den Anschlag auf sein Leben tatsächlich überstand! Der Täter war von angeblich zufälligen Passanten überrascht worden. Anscheinend war er mit der Zeit immer leichtsinniger geworden und hatte zu wenig darauf geachtet, ungestört zu bleiben. Zwar hatte er fliehen können, doch das Opfer war dennoch am Kopf verletzt und ohne Bewusstsein am Tatort zurückgeblieben.
Dadurch wurde Ricardo klar, dass der oder die Täter ihre Opfer niederschlugen, ehe sie ihnen Herz und Zunge herausschnitten, was wohl letztlich erst zur Todesursache wurde. Aber wie konnte er denn jetzt auch wirklich sichergehen, dass es sich um genau den oder die Täter handelte, nach denen er sowieso schon ermittelt hatte? So lange eben nicht Herz oder Zunge oder gar beides entfernt waren, gab es dafür nicht wirklich einen eindeutigen Beweis. Oder?
Was, wenn es sich um einen ganz anderen Täter handelte, der die Gelegenheit hatte nutzen wollen, sein Opfer niederzuschlagen, um es anschließend brutal zu vergewaltigen? Dann wäre er, Ricardo, letztlich ja noch nicht einmal zuständig für diesen Fall?
Man hatte, wie Ricardo erfuhr, die Arme in ein nahes Kloster gebracht, in dem die barmherzigen Schwestern sich ganz der aufopfernden Hilfe von Kranken und Verletzten verschrieben hatten, die sich solcherart Zuwendung aus eigenen Mitteln nicht leisten konnten. Um mehr zu erfahren, musste er also dorthin.
Ohne zu wissen, dass er nach all den Jahren dort auf jemanden treffen würde, den er längst vergessen geglaubt hatte. Jemanden, der ihm einst aus der Patsche hatte helfen wollen, uneigennützig sogar.
Obwohl er den Vorgang an sich natürlich niemals vergessen würde. Er hatte nur nicht mehr bewusst daran gedacht.
Bis er vor ihr stand und den Namen hörte: „Schwester Catrina di San Marco!“