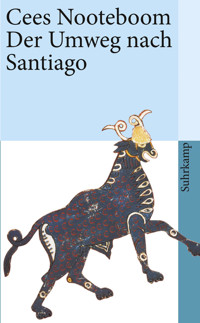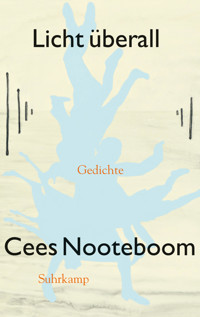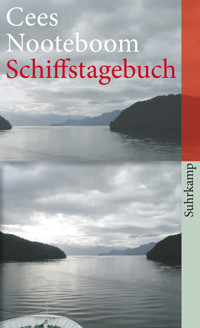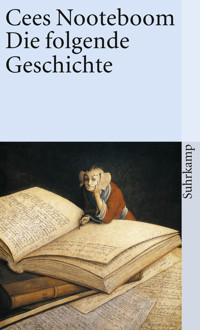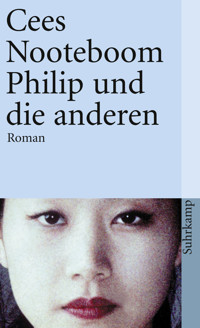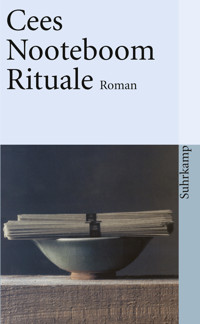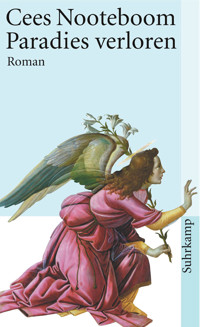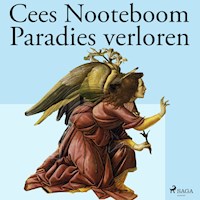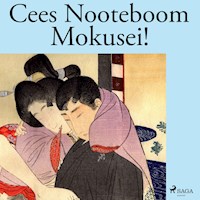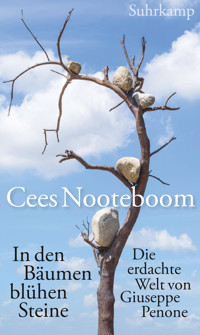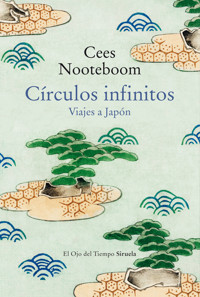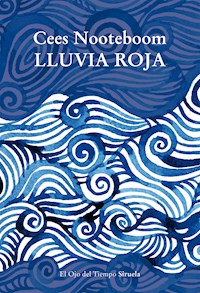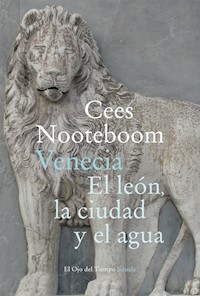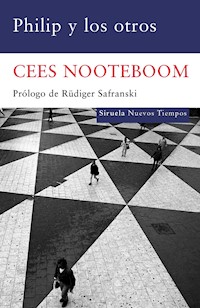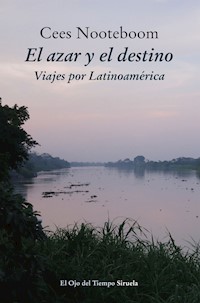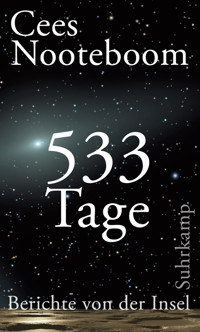
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, eine Insel, das All: Wenn der Kosmopolit Cees Nooteboom auf Menorca ist – längst nicht mehr nur seine »Sommerinsel« –, dann steht er mit beiden Beinen fest auf dem fruchtbaren Boden, umgeben von Palmen, störrischen Schildkröten und den geliebten Büchern im Gartenstudio. Sein Blick reicht jedoch weit über die Horizontlinie hinaus, wach und neugierig. Mit Skepsis blickt Nooteboom auf ein Europa, das auseinanderzubrechen droht; mit Staunen betrachtet er das Gesamtkunstwerk David Bowie. Seine Begeisterung aber gilt dem Weltall, von seinem Schutzheiligen, dem Sternbild Orion, bis zu den beiden Voyager-Raumsonden mit ihren Grußbotschaften an fremde Zivilisationen im Gepäck, seit fast 40 Jahren im All unterwegs und von allen vergessen (»außer von der NASA und mir«). Nur eine Handvoll betagter Techniker weiß die veraltete Software noch zu bedienen – die Rentner der Raumfahrt.
533 Tage im Leben eines großen Autors, der die Sorge um seinen Garten und den leidenden Hibiskus darin elegant und meisterlich zu vereinen weiß mit dem Griff nach den Sternen: ein berückender Band, garantiert nicht nur für Inselliebhaber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ein Mann, eine Insel, das All: Wenn der Kosmopolit Cees Nooteboom auf Menorca ist – längst nicht mehr nur seine »Sommerinsel« –, dann steht er mit beiden Beinen fest auf dem fruchtbaren Boden, umgeben von Palmen, störrischen Schildkröten und den geliebten Büchern im Gartenstudio. Sein Blick reicht jedoch weit über die Horizontlinie hinaus, wach und neugierig. Mit Skepsis blickt Nooteboom auf ein Europa, das auseinanderzubrechen droht; mit Staunen betrachtet er das Gesamtkunstwerk David Bowie. Seine Begeisterung aber gilt dem Weltall, von seinem Schutzheiligen, dem Sternbild Orion, bis zu den beiden Voyager-Raumsonden mit ihren Grußbotschaften an fremde Zivilisationen im Gepäck, seit fast 40 Jahren im All unterwegs und von allen vergessen (»außer von der NASA und mir«). Nur eine Handvoll betagter Techniker weiß die veraltete Software noch zu bedienen – die Rentner der Raumfahrt.
533 Tage im Leben eines großen Autors, der die Sorge um seinen Garten und den leidenden Hibiskus darin elegant und meisterlich zu vereinen weiß mit dem Griff nach den Sternen: ein berückender Band, garantiert nicht nur für Inselliebhaber.
Cees Nooteboom, geboren 1933 in Den Haag, lebt in Amsterdam und auf Menorca. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Prijs der Nederlandse Letteren. Mit dem Helden seines Bestsellers Die folgende Geschichte teilt er die Faszination für die Voyager-Mission. Zuletzt erschienen: Briefe an Poseidon (2012) und der Gedichtband Licht überall (2013).
Helga van Beuningen gilt als die deutsche Stimme von Cees Nooteboom. Für ihre langjährige Arbeit als Übersetzerin aus dem Niederländischen wurde sie mit zahlreichen Preisen, darunter dem Martinus-Nijhoff-Preis, dem Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein, dem Helmut-M.-Braem-Preis und dem Else-Otten-Preis ausgezeichnet.
Cees Nooteboom533 Tage
Berichte von der Insel
Aus dem Niederländischenvon Helga van Beuningen
Die niederländische Ausgabe erschien 2016 unter dem Titel 533. Een dagenboek bei Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam.
Sämtliche Fotos in diesem Band sind von Simone Sassen, mit Ausnahme der Abb. 6 (Éditions Phébus, Paris, 1999) und der Abb. 14 (Matthias Horn, Berlin).
Der Abdruck des Zitats auf S. 59ff. (aus: Héctor Abad: Brief an einen Schatten. Eine Geschichte aus Kolumbien.Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg. Berlin 2009, S. 183-185) erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Berenberg Verlags.Die Seiten 246ff. beziehen sich auf das Radiofeature »Die Raumfahrt-Rentner der Voyager-Mission« von Guido Meyer für SWR2 Wissen (Erstsendung: 14. 9. 2015).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.
Erste Auflage 2016
© Cees Nooteboom 2016
© der deutschen Übersetzung Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildung: © NASA, ESA, Adolf Schaller/SPL/Agentur Focus
eISBN 978-3-518-74765-0
www.suhrkamp.de
533 Tage
1.
Die Blüten der Kakteen lassen sich mit anderen Blüten nicht vergleichen. Sie sehen aus, als hätten sie einen Sieg errungen und, so seltsam das auch klingen mag, als würden sie am liebsten noch heute heiraten, wen, ist allerdings nicht klar. Mein ältester Kaktus, er war schon hier, als ich vor vierzig Jahren kam, besteht aus Gegensätzen, man könnte meinen, seine einzelnen Teile wären von unterschiedlichem Alter. Er hat diese großen Blätter, die natürlich nicht Blätter heißen, es sind eher mächtige ausgestreckte Hände ohne Finger, ovale Formen, grün und massiv, voll kleiner Stacheln, das Klischee eines Kaktus in einer mexikanischen Landschaft. Ich verstehe nichts von Kakteen. Sie waren hier die ursprünglichen Bewohner, der Eindringling bin ich. Sie stehen an verschiedenen Stellen, es gibt einen verwahrlosten Teil des Gartens hinter meinem Studio, in dem sie die Alleinherrscher sind. An einer anderen Stelle steht der Kaktus der Gegensätze. Am Ende dessen, was später eine Frucht sein wird, hier chumba geheißen, in Frankreich figue de barbarie, sitzt jetzt, im Sommer, eine gelbe Blüte. Einige seiner Blätter, ich bleibe jetzt mal bei dieser Bezeichnung, sind aus vertrocknetem Leder, doch manchmal hat er auch kleine Hände von einem lichten, lebendigen Grün, wenn man die Stacheln herauszieht, kann man sie kleinschneiden und essen. Seine großen toten Hände lässt er fallen, sie sind erstaunlich schwer. Wenn ich im Garten arbeite, alles zusammenharke, was bei einem Sturm von den Bäumen geweht worden ist, hebe ich sie vorsichtig auf, tunlichst mit Handschuhen. Dann werfe ich etwas Totes weg, aber wenn ich näher an den Kaktus herangehe, sehe ich, dass er, ein Mann, der mich weit überragt und nach unten hin scheinbar zu Holz geworden ist, tot, trocken und schwer, an dieser abgestorbenen Materie neue kleine Hände bekommt. Das meine ich mit Gegensätzen, so als bestünde ich zum Teil bereits aus toter Materie und bekäme gleichzeitig neue Gliedmaßen, wenngleich ich nicht weiß, wie ich mir das im Detail vorstellen soll. Was wäre das Äquivalent zu dieser gelben Blüte?
Letztes Jahr, nach einer Reise durch die Atacama im Norden Chiles, beschloss ich, einige Kakteen in meinem spanischen Garten zu pflanzen. Auf der anderen Seite der Insel gibt es ein Gartenzentrum. Als ich dort nach Kakteen fragte, deutete jemand auf eine riesige phallische, haarige Pflanze, die mich ein ganzes Stück überragte. Unmöglich, sie in mein Auto zu verfrachten, doch in ihrer Nähe gab es ein kleines oder eigentlich gar nicht einmal so kleines Heer von Gewächsen, die von den Verkäufern ebenfalls als Kakteen bezeichnet wurden, Offiziere und Soldaten in sehr unterschiedlichen Uniformen. Jedes Mal, wenn ich bei einer völlig anderen Form nach dem Namen fragte, lautete die Antwort unvermeidlich Kaktus, und so stehen jetzt sechs davon in meinem Garten oder was dafür durchgehen muss. Bis auf einen haben sie den Winter überlebt; sie zu beschreiben, ist äußerst schwierig. In seinem Zibaldone sagt Leopardi, der Dichter müsse nicht nur die Natur imitieren und perfekt beschreiben, sondern er müsse das auch auf natürliche Weise tun. Leicht gesagt! Sie ähneln den Kakteen, die hier bereits waren, den Ureinwohnern, eigentlich in nichts. In den zwischenzeitlich gekauften Kakteenbüchern werde ich versuchen, ihre Namen zu finden, aber das ist nicht einfach. Einer ist eine meergrüne, pflanzenähnliche kleine Säule, die mir bis zu den Knien geht. Ein anderer teilt sich nach einem knappen Meter in viele Seitenäste und setzt danach seinen Weg einfach nach oben fort. Doch warum sage ich Äste? Am ehesten gleichen sie einem Teil des Stamms, der einen Seitenweg eingeschlagen hat. Und Stamm ist möglicherweise ebenfalls nicht das richtige Wort. Ein Kaktus, der sich auch zur Seite hin fortsetzt. Xec, der genauso wenig weiß, wie die Pflanze heißt, behauptet, sie könne sehr groß werden. Ich meine, diese Form schon mal in einer Tequilawerbung gesehen zu haben. Aber vielleicht war es nur das Etikett auf einer Flasche, und der Alkoholnebel hat meinen Blick verschleiert. Dann gibt es noch eine knollenförmige, ziemlich plumpe, in Segmente aufgeteilte Kanonenkugel aus dem Ersten Weltkrieg, mit unendlich vielen Stacheln, so dass die Schildkröten einen Bogen um sie machen. In Segmente aufgeteilt, ist das der richtige Ausdruck? Wie hat Humboldt das gemacht, wie beschreibt man ein Objekt, das grün ist, durch ungefähr vierzehn scharfe Einschnitte seine euklidische Kugelform verloren hat, gefährlich und mächtig dasteht und weiß der Himmel was dadurch klarzumachen versucht, dass die Stacheln, die es überall hat, an seiner Oberseite von tiefkarminroter Farbe sind? Aber, Lektion eins, Stacheln darf ich nicht sagen, so gemein geschliffen sie auch aussehen und so lang sie auch sind. Ein Kaktus hat Dornen. Humboldt achtete natürlich auf Merkmale, Geschlecht, Fortpflanzungsmöglichkeiten, Verwandtschaften. Dafür fehlt mir das Instrumentarium, alles, was ich habe, ist meine prima vista und die Armut meiner Sprache. Denn wenn ich grün sage, was meine ich damit? Wie viele Grüntöne gibt es? Indem ich allein schon meine sechs neuen Kakteen betrachte und ihre Farben benennen will, werde ich zum Meister des Adjektivs.
Wie dem auch sei, ich habe eine kleine Enklave für sie angelegt, die auf der einen Seite von einer uralten Mauer aus aufeinandergeschichteten Steinen begrenzt wird, einer pared seca, und auf der anderen von Steinen derselben Art wie die der Mauer, auf der braunen Erde zur durchlässigen Grenze geformt, die jedoch von den Schildkröten missachtet wird. Sie kommen natürlich nur an die untersten Blätter heran, aber die Wunden, die ihre Bisse verursachen, sind ebenso bizarr wie die Gestalt mancher Pflanzen. Rund um die Kakteen habe ich andere Sukkulenten gepflanzt, die wir im Niederländischen Fettpflanzen nennen, eine von ihnen, Angehörige einer der vielen Aeonium-Arten, hat tiefschwarze, glänzende Blätter, die so wunderbar um einen Mittelpunkt herum angeordnet sind, dass man automatisch an Symmetrie und Harmonie als Sinn und Zweck zu glauben beginnt. Das Schwarz der Blätter ist so intensiv und eigentlich schon wollüstig, dass diese Pflanze der denkbar passendste Schmuck auf dem Grab einer jung verstorbenen Dichterin wäre. Und obwohl ich meine Schildkröten liebe – heute Morgen sah ich, wie das älteste Exemplar, der Patriarch, der schon seit unendlich vielen Jahren die Winter ohne mich überlebt, versuchte, mit seinen Altmännerzähnen die Harmonie dieser mathematischen Symmetrie zu durchbrechen, indem er mit aller Kraft hineinbiss, pervers, eine Entweihung.
Doch wie bestraft man eine Schildkröte, die hier viel ältere Rechte hat als ich? Schildkröten besitzen meines Wissens keine Jahresringe, ich habe also keine Ahnung, wie alt diese ist, und auf Ermahnungen hört sie nicht. Was ich am liebsten täte: mich aus ihrer Perspektive zu betrachten, um zu wissen, wie das aussieht. Eine Art beeindruckend hoher, sich bewegender Turm, der, wenn man ihn nur deutlich genug auffordert, für Wasser sorgen kann. Während der größten Sommerhitze kommt sie manchmal auf die Terrasse und stupst meinen Fuß an. Dann sprühe ich Wasser auf die Steine, und sie leckt sie gemächlich und gründlich ab. Die Steine, die ich im letzten Jahr rund um die Pflanzen gelegt habe, um die unteren Blätter gegen ihre Angriffe zu schützen, hat sie wie ein lebender Bulldozer Millimeter um Millimeter beiseitegeschoben.
Nicht nur über Kakteen, auch über Schildkröten weiß ich wenig, finde aber, dass beide einiges gemeinsam haben, die Widerborstigkeit, den Eigensinn, vielleicht sogar das Material, aus dem sie gemacht sind, alles ist hart und zäh. Schilde und Dornen sind Abwehrmittel, das Bein einer Schildkröte fühlt sich genauso an wie die Haut mancher Kakteen, und meine Schildkröten legen ihre Eier in die Erde, als glaubten sie selbst, Pflanzen zu sein. Sie halten es lange ohne Wasser aus, wissen mich allerdings zu finden, wenn sie doch Durst bekommen. Vielleicht denken sie ja, ich sei Wasser. Das Geheimnis von Kakteen und Wasser muss ich noch lösen, ein Mysterium von zu viel oder zu wenig. Ich war bis Oktober hier und dann wieder, kurz, im Dezember. Jabi, der Nachbar, sagt, es habe viel geregnet in diesem Winter. Doch in den Wüsten, aus denen die Kakteen stammen, regnet es kaum oder nie. Bei uns hat es heute Nacht, nach einem Unwetter mit Blitz und Donner, schwer geschüttet. Dem Ficus und dem Feigenbaum hat das, wie es aussieht, durchaus behagt, ihre Blätter glänzen. Die Kakteen äußern sich nicht dazu, jedenfalls nicht so, dass ich es verstehe.
Dafür zeigen sie die Eigenartigkeit ihrer Form, als sei das ihre Pflicht, was natürlich auch so ist. Sie gehorchen ihrer DNA, wie ihre Vorfahren das eine Ewigkeit lang getan haben, ein Gesetzbuch, einst für sie geschrieben und von ihnen peinlichst befolgt, Paragraph für Paragraph. Oder haben sie es in einer Zeit vor der Erinnerung selbst geschrieben und in endlosen Prozessen und Rechtsprechungsreformen angepasst? Derlei Fragen beantworten sie mit unerbittlicher Schweigsamkeit. Bäume rauschen, Sträucher beugen sich, Wind braust, doch an solchen Unterhaltungen beteiligen sich Kakteen nicht. Es sind Mönche, ihr Wachstum ist unhörbar, falls sie Geräusche von sich geben, sind meine Ohren nicht so beschaffen, dass ich sie vernehmen kann, ihre Form ist ihr Zweck, das wusste schon Aristoteles. Dass ich sie sehen kann, ist ihnen vermutlich egal.
Abb. 1 Chumba: Die Frucht des Feigenkaktus
2.
Am Tag meiner Ankunft erschien nach ein paar Stunden Xec mit einem Buch über den Tod. Der Postbote hatte es draußen hingelegt, dem Regen ausgesetzt. Xec hatte das Buch gerettet. Danach besprachen wir seine Arbeit. Er ist ein Negativbildhauer, er verändert die Formen der Bäume, damit der Garten mehr Licht bekommt. Vor einem halben Leben habe ich Palmen gepflanzt, sie reichten mir bis zu den Knien. Jahrelang habe ich die abgestorbenen Palmwedel selbst abgesägt, bis ich das nicht mehr schaffte. Der Baum – es sind zwei – zu hoch und ich zu alt. Palmwedel, sie gehören zu Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, zu Jesu Einzug in Jerusalem, die Menschen am Straßenrand winken damit. An Palmsonntag wurden die Zweige geweiht, man durfte einen kleinen nach Hause mitnehmen, eine Miniausgabe, die nicht aussah wie ein richtiger Wedel, denn ihr Ansatz am Baum, der Teil, den man absägen muss, steckt voller Dolche, an denen man sich böse verletzen kann. Im Winter schaut Xec nach dem Garten, ein merkwürdiges Amalgam eigensinniger Bewohner, die mich erwarteten, als ich vor über vierzig Jahren herkam. Ein Teil dieser Bevölkerung ist in der Zwischenzeit ausgestorben, hier herrscht kein mildes Klima, und ein Garten ohne Gärtner hat es schwer auf einer Insel, auf der der Wind ein strenger Herrscher ist, der manchmal von Norden herantost und vom Meer Salz mitbringt. Xec ist jung und stark, an besagtem Tag meiner Ankunft kam er mit seiner kleinen Tochter, und wegen des Buches, das er mitbrachte, assoziierte ich ihn mit dem Tod. Es ist ein Buch von Canetti, der nicht sterben wollte, was für sich genommen zugegebenermaßen nicht ausreicht, um einen Gärtner mit dem Tod zu assoziieren. Der Grund war ein anderer. Ich fragte ihn, warum er die Lilien nicht herausgerissen habe, die sich ständig herrschsüchtig zwischen die Aeonia zu drängen versuchen. Das hatten wir so abgesprochen. Diese Lilien, ich nenne sie so, weil ich nicht weiß, wie sie wirklich heißen, scheinen während meiner Abwesenheit zu blühen, das allein schon ist ein Grund, sie nicht leiden zu können. Doch wie beschreibt man diese Abneigung? Dann muss man bei den Aeonia selbst beginnen, Sukkulenten, die einer kleinen Armee gleich gegenüber der Terrasse angetreten sind, dem Haus zugewandt, das Erste, was ich sehe, wenn der Tag beginnt. Es ist ein schlichtes Volk. Hellgrüne Blätter, schön mathematisch im Kreis angeordnet, feste Substanz, sie haben sich ihr Existenzrecht dadurch verdient, dass sie während dieser ganzen Zeit, meist in Einsamkeit, einfach stehen geblieben sind. Die Lilien sind Eindringlinge, lange, dünne, in die Höhe strebende Blätter an hartnäckigen, verbissenen Knollen, die man fast nicht herausbekommt, ohne die Hälfte der Aeonia mit auszureißen, was mich meinen halben Rücken gekostet hat. Xec hatte versprochen, sie herauszunehmen, wenn der Boden etwas nachgiebiger wäre und ich am anderen Ende der Welt umhergondelte.
Als Antwort auf meine Frage hob Xec seinen Fuß. An der Sohle war ein großer schwarzer Fleck, der aussah wie etwas Verderbliches, ein Unheilszeichen. Und das war es auch, er sei, erzählte er, an diesem Fuß wegen Hautkrebs operiert worden. Der schwarze Fleck, die Lilien, das Buch von Canetti mit dem hoffnungslosen Titel – so hatte sich der Gedanke an den Tod zwischen Kakteen und Schildkröten eingeschlichen. Ich dachte an Canettis letzte Ruhestätte, die ich einmal in Zürich besucht hatte, er liegt nicht weit von James Joyce entfernt. Zweimal war ich dort, beim ersten Mal hatte er, wie Brodsky in Venedig, noch ein katholisches Kreuz, das später durch eine Platte ohne Kreuz ersetzt wurde, ohne dass es dadurch ein jüdisches Grab geworden wäre. Zwar lagen auf beiden Gräbern einzelne kleine Steine, wie ich sie auch bei Celan und Joseph Roth in Paris gesehen hatte, doch am auffallendsten an den in Zürich so nahe beieinander gelegenen Grabstätten war ihr unterschiedlicher Charakter. Joyce saß sorglos da, die Beine locker übereinandergeschlagen, ein Herr am Sonntagmorgen, der genauso gut eine Zigarette hätte rauchen können. In der Regel sitzen Tote nicht, und rauchen tun sie schon gar nicht, das kommt natürlich noch hinzu. Jemand, der sitzt, kann auch aufstehen, wohingegen beim Tod von Auferstehung vorläufig noch nicht die Rede ist. Die erfolgt, falls überhaupt, erst am Ende aller Zeiten. Bei Canetti bestand der einzige Schmuck aus seiner Unterschrift, die etwas Wütendes und Verbissenes hatte, das Ende eines zornigen Briefes an einen allzu dummen Widersacher, danach sah es noch am ehesten aus. Als ich sein Buch aufschlage, lese ich: »Die Auferstandenen klagen plötzlich in allen Sprachen Gott an: das wahre Jüngste Gericht.« Auch in diesem Satz Empörung. Das Leben als ein von Gott ersonnenes Komplott gegen die Menschen, ein Geschenk mit beigefügter Todesstrafe. An einer früheren Stelle im Buch besucht er den Platz, an dem er später liegen wird, eine Stelle, die er selbst ausgesucht hat. Das hat dann fast den Anschein des Gegenteils, lässt auf Sehnsucht schließen. Er fragt sich, was Joyce wohl dazu sagen wird, wenn er in dessen Nähe zu liegen kommt. Aber da Canetti ein Mensch ist, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, fragt er sich auch, ob ihm das selbst angenehm sein wird, hat er doch immerhin einmal über Joyce geschrieben: »Wenn ich ganz aufrichtig zu mir wäre, müsste ich sagen, dass ich alles, wofür Joyce stand, zerstören möchte. Ich bin gegen die Eitelkeit des Dadaismus in der Literatur, die sich über die Worte erhebt. Ich vergöttere die intakten Worte.« Hier spricht jemand vom Volke des Buchs, das ist unverkennbar, als er fortfährt: »Der eigentlichste Teil der Sprache für mich sind die Namen. Ich kann Namen angreifen und herunterholen, ich kann sie nicht zerstückeln. Das gilt sogar für den Namen dessen, den ich am meisten hasse, den Erfinder und Bewahrer des Todes: Gott.« Joyce und der Dadaismus, auf diesen Gedanken war ich noch nicht gekommen, aber jemanden zu hassen, der nicht existiert, könnte auch eine Form von Dadaismus sein.
Der Zufall will es (doch für Leser gibt es keinen Zufall), dass ich gleichzeitig ein älteres Buch von Philip Roth lese, Sabbaths Theater, in dem die Hauptfigur, Mickey Sabbath, sich wie Canetti auf die Suche nach dem Ort begibt, an dem er beerdigt werden will. Zwei Juden auf der Suche nach ihrem Grab, und auch Sabbath hat diese Todesobsession, das Buch ist eine Wahnsinnsarie von Eros und Thanatos bis hin zu seinem wiederholten Masturbieren auf dem Grab der ehebrecherischen Frau, mit der er eine erotomanische Beziehung hatte, die von Roth auch noch sehr explizit mit einer Überfülle an Details geschildert wird, was beim Leser hin und wieder zu stellvertretender Erschöpfung führt, als müsste er bei schwülem Wetter einen endlos langen Bergweg hinaufsteigen, bis er nicht mehr kann – für den Leser, der ich bin, das Gegenteil der Erotik bei Nabokov, die zwar ebenso extrem sein kann, allerdings durch Suggestionen, nicht durch eine Aufzählung wilder Aberrationen und realistischer Details in endlosem Überfluss. Sabbath ist also kein Humbert Humbert, aber in all seiner grotesken Besessenheit doch auch eine unvergessliche Figur, und diese Figur treibt sich nun verloren auf einem verwahrlosten Provinzfriedhof herum und verhandelt mit dem Friedhofswärter über den Platz und vor allem auch den Preis seines Grabes, einen Betrag, den er an Ort und Stelle entrichtet. Ob Canetti darin etwas wiedererkannt hätte, weiß ich nicht, wenngleich er den skandalösen Text, den Sabbath auf seinem Grabstein haben möchte und den er zusammen mit dem Geld für die Beisetzung und die Kosten für den Rabbiner dem Bestattungsunternehmer in einem versiegelten Umschlag überreicht, ekelhaft gefunden hätte. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass es Sabbath in Wirklichkeit nicht gegeben hat. Nicht existierende Personen brauchen nun einmal mehr Worte, während Canetti sich mit seiner Unterschrift und den Namen seiner ersten und seiner zweiten Frau begnügen konnte, Veza und Hera.
3.
Wann ist etwas ein Ereignis? Ein Zugunglück, ein völlig unerwarteter Besuch, ein Blitzschlag. Letzteres geschieht im Sommer auf dieser Insel regelmäßig, ein Himmel, voll von elektrischem Menetekel, und plötzlich ein tödlicher Schlag. Das steht dann tags darauf in der Lokalzeitung, ein Ereignis. Doch wie nennt man es, wenn etwas stattfindet, das für die Welt niemals als Ereignis zählen würde, für einen selbst aber durchaus? Früher Morgen, die esteras, eine Art Vorhang aus geflochtenem Schilf, noch nicht heruntergelassen. Ich sitze auf der Terrasse, und auf einmal landet neben mir ein Wiedehopf mit unnachahmlicher Effekthascherei. Er hat mich nicht gesehen, sonst wäre er schon auf und davon. Der Upupa epops ist sehr scheu. Doch hier sitzt er, auf der trockenen braunen Erde, vor dem frisch gepflanzten Hibiskus, der nicht wachsen will. Wenn es einen Vogel gibt, der einer Blume gleicht, dann ihn. Auf Spanisch heißt er abubilla, hier auf der Insel puput. Ob er weiß, dass er schön ist? Er hat einen hohen Kamm aus senkrecht stehenden Federn, die zimtfarben beginnen und nach oben hin schwarz und weiß auslaufen. Sein langer gebogener Schnabel ist graubraun, die Beine sind schiefergrau, der Schwanz läuft in einem dünnen weißen Streifen und dahinter einem breiteren schwarzen Band aus. Ich bleibe mucksmäuschenstill sitzen, als ich nach einer Weile ganz kurz die Hand bewege, ist er, schwupp, fort, ich sehe ihn, eindeutig ein Männchen, mit seinem merkwürdig niedrigen, wellenförmigen Flug über das Feld der Nachbarn entschwinden. Ein Nest von ihm habe ich nie zu Gesicht bekommen, es soll sehr unordentlich sein, aber das kommt bei schönen Menschen zuweilen ebenfalls vor. Ist es ein Ereignis, wenn der Tag danach anders ist?
4.
»Il faut cultiver notre jardin«, sagt Voltaire am Ende von Candide. Doch was, wenn es anders wäre, oder umgekehrt? Ich bin keine Pflanze, aber wenn es nun der Garten wäre, der mich kultiviert? Der mir unerwartete Formen von Achtsamkeit beibringt? Über das Rot der Surfinia habe ich bisher noch nie nachgedacht. Vielleicht nicht einmal über Rot an sich, oder wie es sein kann, dass man manche Rottöne am liebsten als schwarz bezeichnen würde. Die Stunden des Tages, die An- oder Abwesenheit von Wolken bringen ihre eigenen Formen von Malerei mit sich. Und von Theater. Keine Wolken, Mittagshitze, die Surfinia wird blutrot, das Rot eines Mordes aus Leidenschaft, bösartig, das schwarze Rot im Sand der Arena, wenn der Stier hinausgeschleppt wird.
Ein anderer Wind, Tramontana, drohendes Gewitter, aschgrauer Himmel, die Surfinia plötzlich eine Schauspielerin, Meisterin begnadeter Mimikry, ins Rot kriecht bleifarbenes Schwarz, Unheil naht, ich bin gewarnt.
5.
Literarische Politik (so etwas gibt es: Hegemonien, Einflüsse, Triumvirate, Vermächtnisse) und der Tod. Elias Canetti (»Der Prophet Elias hat den Todesengel bezwungen. Immer unheimlicher wird mir mein Name.«) über Thomas Bernhard. Er nimmt ihn für sich in Anspruch, fürchtet aber, ihn an Beckett abtreten zu müssen. »(…) ich erhebe ihn zu meinem Schüler und natürlich ist er's, in einem viel tieferen Sinn als etwa die Iris Murdoch [seine Ex-Geliebte. Anm. CN], die alles ins Angenehme und Leichte wendet und im Grunde zu einer gescheiten und amüsanten Unterhaltungsschriftstellerin geworden ist. Sie ist schon darum keine wirkliche Schülerin von mir, weil sie vom Geschlecht besessen ist. Thomas Bernhard ist aber wie ich vom Tod besessen.
Allerdings ist er in den letzten Jahren einem Einfluss unterlegen, der meinen verdeckt, nämlich dem von Beckett. Die Hypochondrie Bernhards macht ihn anfällig für Beckett. Er gibt wie dieser dem Tod nach, er stellt sich nicht gegen ihn. (…)
So meine ich, dass es jetzt, dank der Stärkung durch Beckett, etwas wie eine Überschätzung Bernhards gibt, aber eine Überschätzung von oben her: Die Deutschen finden ihren eigenen Beckett in ihm.«
Ein Schüler abserviert, dient einem anderen Meister, hat Wasser in den Wein des Todes getan. Strafe. Das war 1970. Bernhard reagiert rasend in Die Zeit, sechs (!) Jahre später, Canetti antwortet mit einem Brief, den er nicht abschickt. »Ich habe Sie hart kritisiert, und Sie schlagen nun besinnungslos um sich.« Letzter, nicht abgeschickter Satz: »Sie haben niemand, der Ihnen die Wahrheit sagt, ist sie Ihnen gleichgültig geworden?« Für Canetti war der Tod ein Erzfeind, der wie ein lebender Gegner bekämpft werden musste. Paktierer hasste er, sein Hass war nicht abstrakt. Besinnungslos um mich schlagen, das täte ich auch gern. Woran mangelt es mir?
6.
Einst, vor gut fünfzig Jahren, schrieb ich ein Buch, Der Ritter ist gestorben. Der Laut eines Nachtvogels erinnert mich daran. Das Buch spielt auf einer Mittelmeerinsel, nicht dieser, eher näher an Afrika. Auch hier höre ich diesen Vogel. Damals beschrieb ich den sich stets wiederholenden Laut als gluck, Stille, dann wieder gluck. Ich habe mir die Passage nicht noch einmal angesehen, erkenne aber die Faszination des Lauts, weil er sich, wie von einem Metronom vorgegeben, ständig wiederholt, die Intervalle sind immer gleich lang, man kann mitzählen. Der Vogelführer gibt den Ruf der Zwergohreule mit Djü wieder. Dieser Auslaut ohne scharfen Konsonanten trifft es ganz gut, aber eigentlich wäre Puh die beste Nachbildung. Es ist ein sehr geheimnisvoller Laut, und wenn man aufmerksam lauscht, hört man die gleich klingende Antwort, nur leiser, ein Geräusch, das zur Nacht gehört und zur Jagd, ein Ruf, der den Tod von Käfern, anderen Kerbtieren und Spinnen ankündigt. Er ruft, sie antwortet, ich werde in eine unsichtbare Intimität einbezogen, verborgen im Dunkel der mediterranen Nacht.
7.
Zwischen der Welt des Hauses und der Außenwelt habe ich ein menorquinisches Gatter, gebaut aus dem Holz der wilden Olive, das erst getrocknet, dann in Wasser gelegt und in eine bestimmte Form gezwungen wird, sechs oder sieben quer verlaufende verkümmerte, leicht gebogene Äste, unbehandelt und lang, und als Abschluss ein einzelner, schräg von oben nach unten durch sie hindurch geführter Ast, der alles zusammenhält. Die Männer, die diese barreras machen, heißen araders, früher zogen sie von lloc zu lloc, den Bauernhöfen, auf denen es immer etwas instand zu setzen gab. Sie sind die Letzten, genauso wie die Mauerbauer. Auf dem Land sieht man ihre Gatter noch, wenngleich sie immer häufiger hohen, gestrichenen Toren weichen müssen, durch die man nicht mehr hindurchschauen kann. Oft stehen dahinter Häuser von Leuten, die nicht von der Insel stammen, die Höhe der Tore und die Unsichtbarkeit des Lebens dahinter zeugen sowohl von Besitz als von der Angst, ihn zu verlieren. Mein Tor ist eine barrera, es hat kein Schloss und folglich auch keinen Schlüssel, man schließt es, indem man einen langen Metallhaken in einen Ring einhängt, was wir aber meist nicht tun, und man öffnet es, indem man am obersten der gebogenen Äste zieht, doch als ich das diese Woche tun wollte, saß dort eine Motte von der Größe einer Kinderhand. Ohne Zweifel ein ausgesucht schönes Tier, ein Design der Wiener Schule, effizient, schlicht, mönchisch, auf moderne Weise streng. Die Farbe war die des getrockneten Holzes, eine perfekte Tarnfarbe. Er oder sie saß da nicht einfach herum, und welchen Geschlechts das Tier auch war, lange blieb es nicht allein. Jetzt waren sie zu zweit, ein befreundetes Ehepaar. Ich war glücklich, weil sie mein Gatter gewählt hatten. Ich brauchte sie nicht zu beschützen, für die Geckos, die hier ebenfalls wohnen, waren sie zu groß, Ratten klettern nicht auf Zäune, und Falken, Eulen und Bussarde kommen nicht so nah. Ihr schlimmster Feind war ich, doch das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Abb. 2 Oruga barrenadora de las palmeras
Von diesem ersten, überraschenden Augenblick an sah ich sie fast jeden Tag. Meist flogen sie kurz auf, wenn ich durch das Tor wollte, waren aber offenbar so zahm, dass Simone in aller Ruhe eines fotografieren konnte. Mit dem Foto in der Hand durchsuchte ich mein Schmetterlingsbuch, denn Motten gehören zu den Faltern, zumindest in dem spanischen Buch, das ich hier habe. Finden konnte ich sie allerdings nicht. Ich sah die merkwürdigsten Entwürfe, Gucci, Armani, samt und sonders Modelle von großer Schönheit, ich verstehe, dass manche Menschen lieber an Gott glauben als an den Big Bang und das darauf folgende, ewigwährende große Von-Selbst. Ich lebe nun mal in einer Welt von Designern und Künstlern, und irgendwo muss doch immer ein Namenszeichen stehen, wenngleich wir das von Gott auch nie gesehen haben, es sei denn, es wäre nun gerade diese Motte. Doch Motte oder Falter, das ist hier die Frage. Motten haben stabförmige Antennen ohne Verdickung am Ende, das hatte ich bereits gelernt, und die elegante Erscheinung auf unserem Foto war folglich eindeutig eine Motte, nur welche? Hatte sie keinen Namen? Warum stand sie nicht in dem Buch? Heute kam die Auflösung und damit die Ernüchterung. Unter einem Stapel alter Zeitungen fanden wir plötzlich einen Panikbrief des Inselrats, der hier noch vom Vorjahr liegen geblieben war. ¡¡ALERTA!! Lebensgefahr für Ihre Palmen! Ich erinnerte mich, dass Xec uns erzählt hatte, er habe irgendein Zeug in die Palmen injiziert, weil gerade sie von einem Tier bedroht würden, so wie wir vor einigen Jahren die Prozessionsraupenplage hatten bekämpfen müssen, indem wir etwas in die Pinien hängten. Jetzt war es also die Oruga barrenadora de las palmeras, die bekämpft werden musste. Nun verstand ich auch, warum ich sie nicht im Schmetterlingsführer gefunden hatte, mein Buch war von 1985, und die Motte war ein Späteinwanderer, ein räuberischer, aus Uruguay und Argentinien stammender Eindringling, der es auf unsere Palmen abgesehen hatte. Erst jetzt konnte ich ihn richtig sehen, auf unserem Foto hatte er nämlich die beiden Schöße seines Mantels sorgfältig über dem Teil seines Kleides zusammengelegt, an dem ich ihn hätte erkennen können. Auf dem Foto des Faltblatts hatte er seine Flügel weit ausgebreitet, so dass sein Unterkleid zu sehen war, und genau dieses Unterkleid verriet ihn, eine Komposition aus Schwarz und Orange mit heftig hineingetupften weißen Flecken in der Mitte, Luxus unter der Mönchskutte, ein gefährlicher Heiliger. Ich sah mir das Foto noch einmal genau an. Wie die einzelnen Teile eines Schmetterlings technisch korrekt heißen, weiß ich nicht. Kopf ist Kopf, das ist klar, doch was ich als Unterkleid bezeichne, heißt vielleicht Hinterflügel. Simone hatte ihn von oben fotografiert. Zwei Fühler, die also eigentlich Antennen sind, ein Rückenschild, zwei seitliche Gliedmaßen. Der Rückenschild gab ihm die Ausstrahlung eines Straßenkämpfers. Er lief leicht frivol aus und hatte links und rechts etwas Haariges. Die Flügel, auf dem Foto noch immer nach unten gestreckt, waren braun und hellbraun in verschiedenen Abstufungen, zur Mitte hin etwas heller, mit zwei kleinen weißen, zur Zier schräg hineingesetzten Querbändern, eine Art Offiziersabzeichen. Der Leib war zur Hälfte sichtbar, er hatte schwarze Ringe oder Bänder und bestand aus einem unschönen Material, das wie bei vielen Insekten an den gruselig bewaffneten Feind aus einem Science-Fiction-Film erinnerte. Es gibt Formen von Schönheit, die, vergrößert, Teil des Arsenals eines Albtraums sein können. Und außerdem war er jetzt plötzlich zu einem Feind geworden, doch wie tötet man einen Falter? Die Palmen habe ich vor über dreißig Jahren gepflanzt, sie sind enge Familienangehörige. Die Schönheit der Motte ist ihr heute zum Verhängnis geworden. Wir hatten sie bildhübsch gefunden und uns an sie gewöhnt wie an ein unerwartetes Geschenk, das zu uns gehörte. Ein neuer Hausfreund, nie hätten wir ihn weggejagt. Und die Liebe beruhte auf Gegenseitigkeit. Darum saß er mit ihr – oder mit ihm? – immer auf dem Gatter. Jetzt nicht mehr.
Wir haben ihn gefangen und ertränkt. Er schlug noch ein wenig mit den Flügeln, aber ich musste mich zwischen zwei Formen des Verrats für die geringere entscheiden. In dem Faltblatt des Inselrats (Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça [= Jagd]) hatte ich ähnliche Fotos gesehen wie auf Zigarettenpackungen in Amerika, dort angefressene Lungen mit ekelerregenden Geschwulsten, hier gelbes, geschundenes Palmenholz mit scheußlichen Löchern und trauernd herabhängenden Wedeln. Paysandisia archon heißt die Motte in der Wissenschaft (Burmeister, 1880). Meinem altgriechischen Wörterbuch zufolge ist ein archos ein Führer, Anführer, Befehlshaber. Archon wäre davon der Akkusativ, in meiner Sprache lijdend voorwerp, das leidende Objekt. Heute traf das zu. Der einzige Trost dabei ist, dass Schmetterlinge in der Regel nicht lange leben, bei den meisten Arten bemisst sich die Zeit nach Tagen, manchmal Wochen, länger jedoch nie. Über die Rätselhaftigkeit von Zeit und Dauer, so habe ich gelernt, lässt sich wenig sagen. Jetzt, da ich wusste, wie das Tier heißt, konnte ich mich ins Internet begeben, und dort gerät man immer auf Seitenpfade und Umwege. Wie heutzutage üblich, war er wahrscheinlich eine Sie, die Weibchen der Familie Castniidae sind meist größer als die Männchen. Flügelspannweite bis 110 Millimeter. Die Larve ist weiß und ähnelt einer Made, sie frisst an den Wurzeln und Stämmen von Palmen. Der Tod war in meinen Garten geflogen in Form eines Schmuckstücks. Auf einem der vielen Seitenpfade stieß ich auf eine weitere Märchenfigur, das Ei des C-Falters, der ebenfalls nicht unter den zweitausend Arten in meinem spanischen Schmetterlingsbuch vorkommt. Ich bin ein Entdeckungsreisender auf Irrwegen und finde nur Fremdlinge. Wie stark das Foto vergrößert ist, weiß ich nicht. »Das linke Ei ist bereits verlassen, das rechte noch nicht«, steht darunter. Wie kommt es nun, dass dieses rechte Ei einer der Kakteen ähnelt, die ich letztes Jahr gepflanzt habe? Ein kugelförmiges großes grünes Ei, in seiner Form so regelmäßig wie ein Sonett, aber bespickt mit bösartigen Dornen.
Für Leser gibt es keinen Zufall, das habe ich bereits gesagt. Heute erhielt ich ein Buch von einem befreundeten Südtiroler Lyriker zugeschickt, Oswald Egger. Es heißt Euer Lenz und hat nichts mit Schmetterlingseiern oder Kakteen zu tun, und trotzdem glaube ich, dass es eine Verbindung gibt, wenngleich ich, um das beweisen zu können, noch ein Jahr lang in dem Buch werde forschen müssen – das denke ich, weil ich Egger vor einigen Monaten daraus habe lesen hören und weil ich mir zuerst die Illustrationen angesehen und die Bildunterschriften gelesen habe. Unter dem blassen Foto von etwas, das aussieht wie ein in Wachs geritztes Relief, steht: »Wie die Rinde der berindeten, dünnästigen Birken birst, bin ich – Bostrichus Typographus.« Ob es richtig ist, weiß ich nicht, ich übersetze die Zeile in meine Sprache, »Zoals de bast van de omschorste duntakkige berk barst, ben ik«