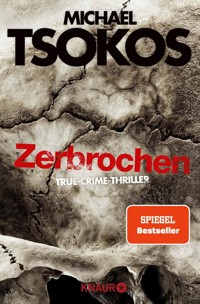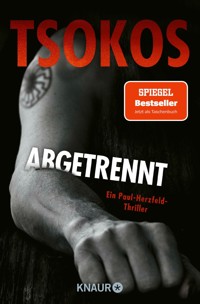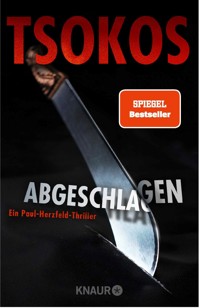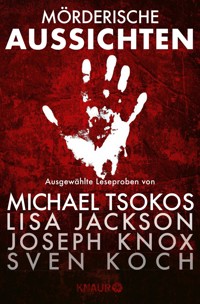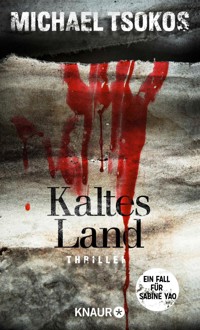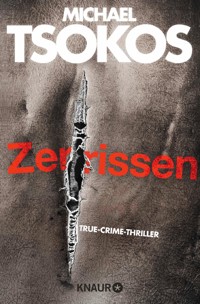9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Paul Herzfeld-Reihe
- Sprache: Deutsch
Echte Fälle, authentische Ermittlungen: True Crime von Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Tsokos Rechtsmediziner Paul Herzfeld steckt sein letzter Fall noch in den Knochen, weshalb er vorübergehend von Kiel nach Itzehoe auf eine vermeintlich ruhigere Stelle in der Pathologie versetzt wird. Doch statt der erhofften Ruhe erwartet ihn dort eine ausgebrannte Ruine des Klinikumarchivs, in der nicht nur unzählige Akten und Gewebeproben verbrannten, sondern auch ein Pathologe sein Leben verlor. Ein Todesfall mit zu vielen Ungereimtheiten, wie Herzfeld findet. Und je weiter er nachforscht, desto klarer wird, dass er einem Skandal ungeheuren Ausmaßes auf der Spur ist. Die Gesundheit der Bevölkerung Norddeutschlands ist ernsthaft bedroht. Seine Ermittlungen auf eigene Faust bleiben nicht lange unentdeckt, denn bald verfolgt ihn eine eiskalte Killerin auf Schritt und Tritt. Ihr Mordwerkzeug: eine Drohne. Ihr Lieblingsspielzeug: Feuer. Während immer mehr Leichen auf Paul Herzfelds Sektionstisch landen, bringen seine Nachforschungen den Rechtsmediziner erneut in akute Lebensgefahr. Ein brandneuer Fall für Rechtsmediziner Paul Herzfeld – ein Wettlauf gegen eine eiskalte Killerin und die Flammen der Zerstörung. »Abgefackelt« ist der 2. Band der True-Crime-Thriller-Reihe um Paul Herzfeld, Band 1 der Trilogie ist unter dem Titel »Abgeschlagen« erschienen. Die Thriller-Reihe erzählt die Vorgeschichte des Rechtsmediziners Herzfeld aus dem Thriller »Abgeschnitten« von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Tsokos mit Alexander Pohl
ABGEFACKELT
Ein Paul-Herzfeld-Thriller
Knaur e-books
Über dieses Buch
Rechtsmediziner Paul Herzfeld steckt sein letzter Fall noch in den Knochen, weshalb er vorübergehend von Kiel nach Itzehoe auf eine vermeintlich ruhigere Stelle in der Pathologie versetzt wird. Doch die dortige Ruine des Klinikumarchivs zeugt von einem Flammenmeer, in dem nicht nur tausende Akten und Gewebeproben dem Feuer zum Opfer fielen, sondern auch Herzfelds Vorgänger in der Pathologie den Tod fand. Ein Todesfall mit zu vielen Ungereimtheiten, wie Herzfeld findet. Und je weiter er nachforscht, desto klarer wird, dass er einem Skandal ungeheuren Ausmaßes auf der Spur ist. Die Gesundheit der Bevölkerung Norddeutschlands ist ernsthaft bedroht. Seine Ermittlungen auf eigene Faust bleiben nicht lange unentdeckt, denn bald verfolgt ihn eine eiskalte Killerin auf Schritt und Tritt. Ihr Mordwerkzeug: eine Drohne. Ihr Lieblingsspielzeug: Feuer.
Inhaltsübersicht
Die Handlung dieses Buches beginnt nur wenige Tage nach den Ereignissen in »Abgeschlagen«. Paul Herzfeld ist sechsunddreißig Jahre alt und Assistenzarzt am Institut für Rechtsmedizin in Kiel.
Prolog
Der hagere Mann in dem dunkelbraunen Sakko stieß die Fahrertür des silbernen Mercedes auf, kaum dass dieser ausgerollt war. Sie hatten alles durchwühlt, die Akten waren verschwunden und der Laptop natürlich auch. Er hatte keine Zeit gehabt zu prüfen, was sie sonst noch mitgenommen hatten, aber er vermutete, dass sie gründlich gewesen waren. Das hier war seine letzte Chance zu retten, woran er jahrelang gearbeitet hatte und was der Grund dafür war, warum er in den letzten Wochen nachts kaum noch ein Auge zugemacht hatte. Die einzige Möglichkeit, ihnen noch zuvorzukommen. Aber nur, wenn er sich jetzt beeilte.
Das fahle Licht der Straßenlaternen zeichnete harte Schatten auf das kantige Gesicht des Mannes, als er hastig aus dem Wagen stieg. Sofort wurde er von dem eisigen Regen in Empfang genommen, der seit dem Nachmittag ununterbrochen auf Schleswig-Holstein niedergegangen war und jetzt in den Nachtstunden an Intensität sogar noch zugenommen hatte.
Vom Schwung seiner allzu eifrigen Bewegung mitgetragen, rutschte er im losen Schotter der nassen Einfahrt aus und strauchelte, doch er konnte sein Gleichgewicht im letzten Moment noch wiederfinden.
Er eilte in großen Schritten um den Wagen herum, dessen Motor immer noch lief. Er hatte sich nicht damit aufgehalten, ihn auszuschalten. Jetzt zählte jeder Augenblick. Der Mann öffnete den Kofferraum und entnahm zwei große, dunkle Sporttaschen. Auf dem Weg zum Eingang des dunkelroten Backsteingebäudes, eines Flachdachbaus aus den 1950er-Jahren, zerrte er eine Keycard aus der Innentasche seines für die nächtlichen Wintertemperaturen viel zu dünnen Sakkos, das schon nach wenigen Augenblicken von den Regenmassen völlig durchnässt war.
Im Licht der Scheinwerferkegel probierte er mehrfach vergeblich, die Keycard in die richtige Position vor das elektronische Türschloss zu bringen, bis sich endlich mit einem metallischen Klacken die Verriegelung des Schlosses öffnete. Der Mann drückte mit seinem ganzen Körpergewicht gegen die schwere Metalltür. Als er im Haus war und sich umdrehte, um die schwergängige Tür wieder zu schließen, glaubte er für einen Moment einen Schatten zu sehen, hinter den flachen Büschen, dort, wo ein Weg zum zweiten Gebäudeflügel der Klinik führte. Sind sie etwa schon hier?
Er sah noch einmal genau hin.
Nein. Da ist niemand. Niemand weiß, was ich vorhabe. Oder? Sind sie mir gefolgt? Habe ich sie schon wieder unterschätzt?, ging es ihm panisch durch den Kopf. Ich muss mich beeilen, die Unterlagen und die Gewebeproben …
Eilig drückte er die Tür von innen ins Schloss und betätigte den Lichtschalter neben dem Türrahmen. Die Neonröhren an der Decke des einzigen Raumes in dem eingeschossigen Gebäude erwachten summend nacheinander zum Leben und verbreiteten ihr unangenehm flackerndes, bleiches Licht in den Gängen zwischen Hunderten von offenen Metallregalen. Zielstrebig ging der Mann an den bis knapp unter die Decke reichenden Regalen entlang, vorbei an endlosen Reihen von Aktenordnern voller Patientendaten, Untersuchungsbefunden und weiterem Archivmaterial, weiter zu seinem eigentlichen Ziel, den großen Metallschränken am Stirnende des Raumes. Auch diese schritt er mit schnellen Schritten ab, bis er schließlich vor dem richtigen Schrank angekommen war, der wie die übrigen aus aufeinandergetürmten Stahlblechboxen bestand. Hier waren allerdings keine Akten verstaut, sondern Pappmappen mit hauchdünnen Schnitten menschlicher Organe, aufgezogen auf gläserne Objektträger, sowie Hunderte von menschlichen Gewebeproben, eingegossen in kleine Paraffinblöcke und damit haltbar gemacht für die Ewigkeit und bestimmt für die Untersuchung durch den Pathologen am Mikroskop.
Gehetzt wischte sich der Mann die vom Regen klatschnassen Haare aus der Stirn und riss die metallenen Schubfächer auf, wobei er sich systematisch von unten nach oben vorarbeitete, bis er schließlich fand, was er suchte. Er warf einen prüfenden Blick auf die Beschriftung der Gewebeproben. Jeder Paraffinblock enthielt eine sechsstellige Ziffernfolge sowie eine Jahreszahl, was ihn einer bestimmten Krankenakte und somit einem Patienten zuordnete.
Mit geübten Griffen zog der Mann hastig Objektträger und Paraffinblöcke heraus und stopfte sie in die beiden Sporttaschen, bis diese zum Bersten gefüllt waren.
Er packte die Tragegriffe der Taschen, die er nun kaum noch vom Boden hochheben konnte, und schleifte seine Beute gerade zurück in Richtung Eingangstür, als es mit einem Schlag dunkel wurde. Alle Neonleuchten in dem fensterlosen Gebäude hatten gleichzeitig, mit einem letzten bedrohlichen Summen, ihren Geist aufgegeben.
Das passierte nicht zum ersten Mal, einige der altersschwachen Deckenlampen in diesem Gebäude fielen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder aus – allerdings hatte er einen solchen kompletten Stromausfall hier im Archivgebäude bisher noch nie erlebt.
Die Taschen im Schlepptau, stolperte der Mann die letzten Meter durch die Dunkelheit, bemüht, sich nicht an einem der Regale zu stoßen.
Er hatte Glück. Schon nach wenigen Schritten bemerkte er am Ende des Gangs einen Lichtschimmer am Boden. Ein schwacher Lichtschein, der von draußen unter dem Türschlitz hindurchfiel und von den eingeschalteten Scheinwerfern seines Wagens stammen musste, der immer noch mit laufendem Motor vor dem Archivgebäude stand.
Der Mann stellte die Taschen schnaufend neben sich ab und tastete in der Dunkelheit nach der Türklinke. Irritiert stellte er fest, dass sein Schritt ein leise platschendes Geräusch verursachte.
Eine Pfütze. Verdammter Regen. Vermutlich steht das Wasser draußen inzwischen derart hoch, dass es schon über die Türschwelle ins Gebäude eindringt. Auch hier ist mal wieder am falschen Ende gespart worden, dachte er bitter. Und jetzt nichts wie raus.
Er drückte die Klinke herunter, doch die schwere Metalltür ließ sich nicht öffnen.
Er drückte die Klinke noch einmal.
Nichts.
Da diese Tür den einzigen Fluchtweg aus dem Gebäude darstellte, hätte sie sich eigentlich problemlos von innen öffnen lassen sollen. Aus diesem Grund gab es hier am Ausgang auch kein Lesegerät für die Magnetkarte, die das elektronische Türschloss öffnete.
Der Mann rüttelte erneut an der Türklinke und drückte von innen gegen die Tür, aber sie ließ sich keinen Millimeter weit bewegen.
Verdammter, beschissener Stromausfall!
Ärgerlich stemmte er sich jetzt mit seinem ganzen Körpergewicht dagegen, aber es war nichts zu machen. Die massive Stahltür blieb verschlossen. Einen weiteren Fluch unterdrückend, überlegte der Mann fieberhaft, wie er sich aus seinem Gefängnis befreien konnte.
Ich muss raus hier, sofort!
Die Panik brach über ihm zusammen wie die Brandung über einem unglücklichen Schwimmer. Seine Gedanken begannen hektisch zu kreisen, während er von der Metalltür zurücktaumelte und an einem Hindernis hängen blieb, das er zu spät als eine seiner beiden Sporttaschen erkannte. Er ruderte mit den Armen in der Luft, suchte verzweifelt nach Halt, fand ihn für einen Moment zu seiner Rechten – dann riss er ein paar Aktenordner aus dem Regal direkt neben ihm mit sich zu Boden. Er versuchte, den Sturz mit den Händen abzufedern, doch vergeblich. Seine rechte Hand rutschte in der Flüssigkeit weg, und er schlug hart auf. Fluchend rieb er sich sein schmerzendes Gesäß, bis er die Feuchtigkeit bemerkte, die jetzt den Stoff seiner Hose durchnässte. Kein Wunder, er war direkt in die verdammte Pfütze gefallen.
Verfluchter Mist!
Aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr. Er musste erst einmal hier rauskommen. Das vor allem anderen.
Da nahm er den Geruch wahr. Er roch an seiner Hand. Ein beißender, irgendwie chemischer Geruch, der ihn an die kleine Jolle seines Vaters denken ließ und an das gleichmäßige Tuckern des Außenbordmotors, in dessen Nähe er immer am liebsten gesessen hatte, wenn sie gemeinsam auf Bootstour gegangen waren. Der Geruch kam ihm mit jedem Atemzug intensiver vor.
Das hier ist kein Regenwasser. Verdammt, es ist …
Während sein Gehirn mühsam versuchte, die Eindrücke in die richtige Beziehung zueinander zu setzen, sah er eine Bewegung in dem schmalen Lichtspalt unter der Tür. Ein Schatten, Schritte.
Da ist jemand auf der anderen Seite der Tür!
»Hallo?«, rief der immer noch in der Pfütze am Boden sitzende Mann und ärgerte sich darüber, wie schwach und brüchig seine Stimme plötzlich klang. Wie seine Angst förmlich darin mitschwang. Er versuchte es noch einmal, lauter. »Hallo? Hören Sie mich? Ich bin hier eingesperrt. Sehen Sie das Schloss? Neben der Tür, ein Metallkasten. Sie müssen …«
Er brach ab und starrte auf den Lichtspalt unter der Tür.
Der Schatten bewegte sich für einen kurzen Moment erneut, dann nicht mehr. Wer immer da draußen ist, er hätte mich hören müssen. Er hätte …
Seine Gedanken kehrten zurück zu dem Geruch. Der ganze Raum war jetzt davon erfüllt. Seine Lunge schmerzte, als er die Luft mit dem nächsten Atemzug tief einsog.
Und dann wurde es ihm schlagartig klar.
Benzin!
Draußen bewegte sich der Schatten wieder.
»Hallo!«, schrie der Mann, und diesmal lag echte Verzweiflung in seiner Stimme. »Hallo! Hier ist überall Benzin! Ich brauche Hilfe! Hilfe!«
Von draußen erklang ein metallisches Klacken, dann ein Knistern. Das elektronische Türschloss, dachte der Mann, erhob sich und hämmerte gegen das massive Metall, doch die Tür blieb verschlossen. Die Benzindämpfe waren jetzt überall. Seine Augen begannen zu tränen, sein Hals brannte, seine Schläfen hämmerten.
Er schnappte nach Luft und saugte dabei noch mehr giftige Dämpfe in seine brennenden Lungen. Von einem Hustenanfall geschüttelt, sank er verzweifelt an der Tür hinab, während die Welt vor seinen Augen in einen rasenden Taumel geriet.
Ich muss aufstehen. Ich muss mich in Sicherheit bringen, zur anderen Seite des Raumes gelangen. Ich muss …
Bevor er den Gedanken beenden konnte, schoss eine gewaltige Stichflamme unter der Tür hindurch und tauchte alles in gleißendes Licht und brüllende Hitze. Als die Flammenzunge die benzindurchtränkte Hose des Mannes und fast augenblicklich auch den Rest seines Körpers erfasste, gab er markerschütternde Schreie von sich, die nichts Menschliches mehr an sich hatten. Das Letzte, was er sah, war das gleißende Licht seiner brennenden Hand. Er war zu einer lebenden Fackel geworden.
1
24. Januar, 9.29 UhrKiel. Institut für Rechtsmedizin der Universität
Paul Herzfeld knotete die durchsichtige Plastikschürze, die seine blaue Sektionssaalkleidung vor Durchfeuchtung durch Blutspritzer und andere Körperflüssigkeiten am Sektionstisch schützen würde, hinter seinem Rücken zusammen. Dann streifte er sich die blauen Latexhandschuhe über, die der Sektionsassistent Heinrich von Waldstamm zusammen mit dem Diktafon neben der Organwaage auf einem Sideboard für ihn bereitgelegt hatte. Am Nebentisch stand Doktor Andreas Fleischer, der Herzfeld beim Betreten des Sektionssaals mit einem fröhlichen »Guten Morgen« und einem freundlichen Zwinkern durch seine Nickelbrille begrüßt hatte. Er war bereits seit etwa einer Stunde mit der Obduktion eines jungen Mannes beschäftigt. Doktor Fleischer war mittlerweile dreiundsechzig Jahre alt und nur noch wenige Tage pro Woche im Institut, da er seit einigen Monaten in einem Altersteilzeitmodell arbeitete.
Herzfeld kannte zwar die Umstände des Falles nicht, aber der Tote vor Fleischer hatte offensichtlich direkt vor seinem Ableben ein massives Polytrauma erlitten – so zumindest Herzfelds erste Blickdiagnose, als er bei der Erwiderung von Fleischers Gruß kurz auf die zahlreichen dunkelroten und feucht glänzenden Rippen- und Extremitätenfrakturen schaute. Fleischers Sektionsassistentin Annette Bartels präparierte diese gerade frei, indem sie die um die Frakturenden gelegene Muskulatur mit einem stabilen Sektionsmesser von den Knochen des Leichnams herunterschälte.
Herzfeld hatte sich nach seiner Ankunft im Institut vor einer halben Stunde in seinem Büro kurz mit dem Inhalt der polizeilichen Ermittlungsakte des Falles vertraut gemacht, der ihn an diesem Tag im Sektionssaal erwartete, und warf jetzt einen ersten Blick auf den unbekleideten Toten auf dem blanken Stahl des Sektionstisches vor ihm. Der aus Flensburg stammende und dort auch noch polizeilich gemeldete zweiundzwanzig Jahre alt gewordene Sven Theissen war erst vor wenigen Wochen nach Kiel gezogen, weil er hier bei einer Reinigungsfirma einen Job bekommen hatte. Er war am Abend seines Todes im Kieler Hauptbahnhof zur Säuberung der Oberlichter in der Bahnhofshalle eingesetzt gewesen. Um die in zehn Metern Höhe im Dach der Bahnhofshalle eingelassenen Fenster zu erreichen, hatte sich Theissen einer Teleskopstange aus leichtem Aluminiumrohr bedient, die ihm von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt worden war. An ihrem Ende war ein überdimensionierter Wischmopp befestigt, den er über seinem Kopf balanciert hatte, um so die Oberlichter zu erreichen. Nur wenige Minuten nach Beginn der Reinigung hatten im Hauptbahnhof anwesende Zeugen gehört, wie der junge Mann plötzlich einen markerschütternden Schrei ausstieß, dann beobachtet, dass er »kurz wie erstarrt« erschien, »den Rücken gerade durchgestreckt«, und anschließend zusammengebrochen war. Ein zufällig im Bahnhof anwesender Arzt hatte sofort mit der Reanimation des bewusstlosen Theissen begonnen und war schon nach wenigen Minuten von einem Notarzt und einem Rettungsassistenten abgelöst worden. Allerdings waren alle Bemühungen, den jungen Mann ins Leben zurückzuholen, vergeblich gewesen.
Nach Kenntnis der bisherigen Ermittlungsergebnisse aus der Akte war Herzfelds derzeitige Arbeitshypothese, dass Theissen möglicherweise an einer von ihm selbst und seinem persönlichen Umfeld zuvor unbemerkten schweren inneren Erkrankung gelitten haben könnte – vielleicht einer Herzmuskelentzündung oder einer pathologischen Gefäßwandaussackung der Brustschlagader, die bei der anstrengenden Reinigung der Oberlichter plötzlich dekompensiert war. Davon ging Herzfeld aus, weil sich weder Hinweise auf ein Unfallgeschehen, eine Einwirkung von fremder Hand noch Drogenkonsum in den Ermittlungsunterlagen fanden.
Nun ergriff er das Diktafon und begann mit der äußeren Leichenschau. Er bedeutete dem korpulenten Sektionsassistenten von Waldstamm mit einem stummen Nicken, den Körper anzudrehen, damit er die Körperrückseite des Toten in Augenschein nehmen konnte.
»An der Körperrückseite auf kräftigen Fingerdruck hin eben noch zur Abblassung zu bringende Totenflecken, hellviolett, ausgespart im Bereich der Aufliegeflächen«, sprach Herzfeld in das kleine Mikrofon.
Mit einem weiteren Nicken wies er von Waldstamm an, den toten Theissen wieder in seine ursprüngliche Position auf dem Sektionstisch zu bringen.
»Die Totenstarre in allen großen und kleinen Gelenken noch kräftig vorhanden«, fuhr Herzfeld fort, während er die Streckung und Beugung in den Extremitätengelenken überprüfte. Dann wandte er sich den Händen des Toten zu. Hände, die tägliche körperliche Arbeit gewohnt waren, wie der Rechtsmediziner anhand der Hornhautschwielen feststellte. »Die Fingernagelränder beider Hände kurz, die Nagelränder die Fingerkuppen gerade erreichend, nicht abgebrochen. An der Innenseite der rechten Hand, direkt mittig …«
Herzfeld stockte. Er fühlte, wie augenblicklich aus jeder Pore seiner Stirn Schweiß austrat und sein Mund schlagartig trocken wurde.
Er schaltete das Diktafon kurz aus, räusperte sich mehrfach und fuhr dann mit der äußeren Leichenschau fort: »… in Verlängerung des Strahls des Zeigefingers und unter Einbeziehung der Haut des Daumenballens …«
Ihm wurde schwindelig.
Das, was er vor sich sah, weckte furchtbare Erinnerungen an die gerade erst zehn Tage zurückliegende Untersuchung einer Toten in einem Schuppen. Dort hatte er unter den einfachsten Bedingungen die Todesursache einer Frau feststellen müssen, während Petra, seine Verlobte, in höchster Lebensgefahr schwebte, und sein Vorgesetzter, Professor Volker Schneider, mit einer Pistole auf ihn zielte.
Herzfeld versuchte, sich zusammenzureißen und sich wieder auf die vor ihm liegende Aufgabe zu konzentrieren, aber das gelang ihm nur bedingt. Die Hautveränderungen an der Innenseite der rechten Hand von Sven Theissen und den Fingerendgliedern von Daumen und Zeigefinger der toten Frau im Schuppen waren zwar nicht identisch, aber die Ähnlichkeit war frappierend.
Herzfeld erkannte nur allzu deutlich, woran der Tote auf dem Sektionstisch gestorben war, als er – unter merklichem Zittern – die vier teils porzellanartig schimmernden, teils im Randbereich schwärzlich verfärbten länglichen Hautblasen an Theissens Hohlhand einem erneuten prüfenden Blick unterzog.
Theissen war an einem Stromschlag gestorben.
Irgendwo musste er auf Höhe der Oberlichter mit der metallenen Teleskopstange mit einem stromführenden Gegenstand in Berührung gekommen sein, denn die etwa zwei Zentimeter breite und vier Zentimeter lange blasige Strommarke korrespondierte gut mit der Kontur eines länglichen Gegenstandes – der unter Strom gesetzten Teleskopstange.
Herzfeld warf das Diktafon auf das Sideboard neben sich, wo es mit einem lauten Knall aufschlug. Der nur wenige Meter entfernt stehende von Waldstamm zuckte erschrocken zusammen und zog ängstlich den Kopf ein. Herzfeld konnte sich gerade noch am Sektionstisch abstützen – seine Knie schienen urplötzlich eine gummiartige Konsistenz zu haben –, und er begann, bedrohlich zu schwanken.
Der Schweiß rann immer heftiger über seine Stirn und lief in seine Augen, die jetzt anfingen zu brennen. Sein Atem ging stakkatoartig und keuchend.
Von Waldstamm sagte irgendetwas zu ihm, aber Herzfeld konnte den Sektionsassistenten nicht verstehen, er hörte nur noch das Blut in seinen Ohren rauschen. Statt einer Erwiderung schüttelte er stumm den Kopf.
Als er sich einigermaßen sicher war, dass er sein Gleichgewicht und seinen sicheren Stand zurückerlangt hatte, riss er sich die Plastikschürze herunter und warf sie zusammen mit den Handschuhen in den nächstgelegenen Abfallbehälter.
Die Polizei muss verständigt werden, und die Techniker der Deutschen Bahn müssen sich umgehend im Kieler Hauptbahnhof umsehen, wo sich eine unbekannte, nicht gesicherte Stromquelle befindet … bevor … der nächste Fensterreiniger … Er konnte den Gedanken nicht zu Ende bringen.
Ohne den Toten oder von Waldstamm noch eines weiteren Blickes zu würdigen, hastete er aus dem Sektionssaal, in den er an diesem Tag auch nicht wieder zurückkehren würde.
2
25. Januar, 10.01 UhrKiel. Institut für Rechtsmedizin der Universität
Was war da gestern nur mit mir los?, fragte sich Herzfeld zum x-ten Mal an diesem Mittwochmorgen, während er in dem wuchtigen Ledersessel gegenüber dem ausladenden Eichentisch im Büro des Institutsdirektors Professor Doktor Schwan zu versinken drohte. Er war am Morgen nach seiner Ankunft im Institut von Schwans Sekretärin informiert worden, dass er für diesen Tag nicht im Sektionssaal eingeteilt war, sondern der Direktor ihn um zehn Uhr in seinem Büro sehen wollte. Der Raum, den der kurz vor seiner Emeritierung stehende Schwan mit antiken Stücken aus seinem eigenen Besitz möbliert hatte, war in ein schummriges Halbdunkel getaucht, das Herzfelds Netzhäute als ausgesprochen wohltuend empfanden. Es wurde nur von dem diffusen Lichtkegel der Messinglampe mit dem grünen Glasschirm auf dem Schreibtisch des Direktors unterbrochen.
Herzfeld gab sich dennoch Mühe, nicht in die Richtung des Lichts zu schauen, weil er befürchtete, dass dann der stechende Schmerz in seinen Schläfen, der ihn trotz mehrerer Paracetamol-Tabletten die ganze Nacht geplagt und vom Schlaf abgehalten hatte und der erst in den frühen Morgenstunden etwas abgeklungen war, wieder zurückkehren würde. Inzwischen hatte sich Herzfelds Nase auch einigermaßen mit dem Geruch von Schwans unvermeidlichem altmodischen Aftershave arrangiert, in dem der Direktor allmorgendlich zu baden schien.
Nach einer Weile drehte sich der untersetzte, knapp sechsundsechzigjährige Mann, wie immer ein Bild an Würde und Ernsthaftigkeit, zu ihm um, reichte ihm ein gefülltes Wasserglas und nahm ihm gegenüber in einem Sessel hinter seinem Schreibtisch Platz. Als sich der Direktor setzte, hörte Herzfeld seine Knie deutlich knacken – die Kniegelenksarthrose, unter der der ältere Mann seit geraumer Zeit litt und die ihn mittlerweile daran hinderte, noch selbst stundenlang im Sektionssaal zu stehen. Herzfeld nippte an dem Wasser.
»Kein Wunder, dass Sie am Ende sind, Kollege Herzfeld«, sagte Schwan. Der eindringliche Blick seiner wachen Augen, die sein körperliches Alter in keiner Weise widerspiegelten, ruhte auf Herzfeld.
»Was meinen Sie? Dass ich als erfahrener Rechtsmediziner während einer Obduktion schlappgemacht habe?«, fragte Herzfeld und stieß ein humorloses Lachen aus. Er wusste, dass der Direktor immer bestens informiert war über alles, was innerhalb der Institutsmauern vor sich ging, und zudem über jeden, der auch nur einen Fuß ins Gebäude setzte – auch wenn seine Mitarbeiter ihn manchmal tagelang nicht zu Gesicht bekamen.
»Nein«, antwortete Schwan, »das meine ich nicht. Sie haben in den letzten Wochen Außergewöhnliches durchmachen müssen. Sie haben schreckliche Dinge erlebt und in Abgründe geschaut. Sie haben bei all dem, was sich ereignet hat, eine Grenze überschreiten müssen, die keiner von uns jemals überschreiten sollte.«
»Worauf wollen Sie hinaus? Welche Grenze meinen Sie?«, fragte Herzfeld, obwohl er bereits ahnte, worauf Schwan anspielte.
»Man kann durchaus sagen, dass Lebensgefahr und Tod unsere täglichen Begleiter sind, Herr Kollege. Aber diesmal waren sie es nicht in der üblichen Form, mit der wir als Rechtsmediziner sonst damit in Berührung kommen. Wenn wir über die schriftlichen Vermerke in den Ermittlungsakten oder durch die mündlichen Berichte der Beamten der Mordkommission damit konfrontiert werden, können wir das Gräuel und die Gewalt für unser eigenes Leben eigentlich immer ohne Probleme ausklammern. Diesmal war Ihr persönliches Umfeld, Ihre Familie direkt betroffen. Das meine ich mit der Überschreitung einer Grenze. Es ist etwas geschehen, was uns als objektivem Betrachter des Todes in all seinen Facetten niemals passieren darf. Sie waren persönlich betroffen. Sie waren gezwungen, bis zum Äußersten zu gehen. Und …« – der Direktor sah Herzfeld intensiv in die Augen – »Sie waren bereit dazu. Sie haben Ihr gewohntes Terrain verlassen, und diese Grenze haben Sie ganz bewusst überschritten.«
»Was hat das mit meinem Zusammenbruch im Sektionssaal gestern Morgen zu tun?«
»Alles. Das, was Sie und Ihre Verlobte, Frau Schirmherr, erlebt haben, hat etwas mit Ihnen gemacht.«
Das traf den Nagel auf den Kopf. Professor Schwan hat es wieder mal mit einer scharfsinnigen Analyse auf den Punkt gebracht, dachte Herzfeld.
Unter vorgehaltener Waffe und vor den Augen des offensichtlich vollkommen wahnsinnig gewordenen Schneider, bis dahin Oberarzt und Schwans Stellvertreter am Kieler Institut für Rechtsmedizin, hatte Herzfeld die provisorische Obduktion einer in einem Schuppen aufgebahrten Frau mit einem Küchenmesser durchführen müssen, während seiner Verlobten Petra für den Fall, dass Herzfeld bei der Klärung der Todesursache der Frau versagte, ein grausamer Strangulationstod drohte.
Nach einer nervenaufreibenden Hetzjagd und nachdem er Herzfeld um ein Haar mit sich ins Verderben gerissen hätte, war Schneider schließlich aus über drei Metern Höhe in die eiskalten, schwarzen Wassermassen der Schlei gestürzt, um seiner Festnahme zu entgehen – Herzfeld war sich sicher, dass der Wahnsinnige das mit Absicht getan hatte. Ein Sprung aus dieser Höhe in ein Gewässer war durchaus etwas, das man überleben konnte, aber nicht angesichts der eisigen Kälte des Wassers – an jenem Tag hatte sich der Winter von seiner wahrhaft entfesselten Seite gezeigt. Den ganzen Tag über hatte ein furchtbarer Schneesturm gewütet, der die vergebliche Suche nach dem verrückten Schneider noch zusätzlich erschwerte.
Aber auch wenn er wusste, dass Schwan recht hatte, wollte Herzfeld es nicht hinnehmen, dass diese Erlebnisse Petras und sein Leben – und damit auch das Leben ihrer gemeinsamen Tochter Hannah – für immer verändert hatten. »Das mag ja alles sein«, räumte Herzfeld ein. »Aber was soll ich denn nun Ihrer Meinung nach tun, Chef? Mich verkriechen? Ich dachte, es ist das Beste, wenn ich so bald wie möglich wieder in der Normalität ankomme. Und dazu gehört unser Tagesgeschäft im Sektionssaal. Je eher ich wieder Routine habe, umso besser. Auch wenn Schneiders Leiche bisher nicht gefunden wurde und man sich deshalb in den wildesten Spekulationen ergehen könnte, versuche ich, mit diesem ganzen Irrsinn der letzten Wochen abzuschließen.« Herzfeld machte eine kurze Pause, ehe er hinzufügte: »Jedenfalls so mehr oder weniger.«
»Eben«, sagte Schwan. »Mehr oder weniger. Und genau da liegt das Problem, scheint mir.«
Herzfeld nickte. Er wusste, wann es keinen Sinn mehr hatte, Schwan zu widersprechen. Schließlich war der ältere Mann nicht von ungefähr seit über zweieinhalb Jahrzehnten Direktor des renommierten und traditionsreichen Kieler Instituts für Rechtsmedizin. Also erwiderte Herzfeld jetzt nichts und hörte, was sein Chef ihm zu sagen hatte.
»Ich glaube«, fuhr Schwan fort, »es würde Ihnen guttun, ein wenig Abstand zu gewinnen. Zu Ihrer Arbeit hier im Institut. Zu dem, was Sie täglich auf unseren Obduktionstischen vorfinden. Und besonders zu allem, was Sie möglicherweise in irgendeiner Form an diese betrüblichen Vorfälle an jenem Tag und an Schneider erinnert.«
»Und wie genau haben Sie sich diesen Abstand vorgestellt? Wollen Sie mich irgendwo hier auf dem Campusgelände zu einer Schreibtischtätigkeit verdonnern?« Herzfeld biss sich im selben Moment auf die Lippen, als diese Worte seinen Mund verlassen hatten, denn er hatte sie schärfer formuliert als beabsichtigt.
»Nun, offen gestanden schwebt mir tatsächlich eine – selbstverständlich nur temporäre – Unterbrechung Ihrer Arbeit hier am Institut vor. Nur für ein paar Wochen. Für diese Zeit kann ich Sie entbehren, wenn ich auch nicht glaube, Sie dauerhaft ersetzen zu können, seien Sie da unbesorgt. Frau Kollegin Westphal könnte die Leitung der Obduktionen vorläufig übernehmen. Und mit Doktor Fleischer habe ich auch gesprochen. Er sagt, er ist flexibel mit seinem Altersteilzeitmodell und kann uns für eine Weile auch drei oder sogar vier Tage die Woche im Saal unterstützen. Von Waldstamm ist ja mittlerweile auch schon einige Zeit hier und hat sich gut eingearbeitet, insofern kann er das gesamte Spektrum der Sektionsassistenz mit Frau Bartels zusammen abdecken. Und …« – über das Gesicht des Direktors huschte ein spitzbübisches Grinsen – »… ich bin ja auch noch da. Wenn es hart auf hart kommt, ziehe ich mir wieder die Gummistiefel und die Schürze an.«
Herzfeld starrte den Direktor an, in dem Bemühen herauszufinden, ob dieser sich mit seiner letzten Bemerkung einen Scherz erlaubt hatte oder es tatsächlich ernst meinte.
»Ich sehe Ihnen an, dass Sie mit dieser Idee nicht ganz glücklich sind, Herr Herzfeld«, sagte Schwan mit der Andeutung eines Lächelns.
»Die Kompetenz meiner Kollegen steht außer Frage«, sagte Herzfeld, »Aber …«
»Sehen Sie, dieses Aber sollten Sie meine Sorge sein lassen, immerhin bin ich der Direktor des Instituts, daher obliegt mir auch die Hoheit über Personalentscheidungen und die Verantwortung für meine Mitarbeiter.«
»Natürlich, aber …«
»Ja?«, fragte Schwan. Etwas Ungeduldiges hatte sich in seine Stimme geschlichen.
»Bei allem Respekt, Chef, aber Frau Westphal ist mit ihren derzeitigen Aufgaben doch schon mehr als ausgelastet. Und Kollege Fleischer – ich möchte unter keinen Umständen, dass er meinetwegen …«
»Wie gesagt, Herr Herzfeld, lassen Sie das bitte meine Sorge sein. Ein schlechtes Gewissen steht Ihnen in dieser Sache ja nun wirklich nicht an.«
»Na gut«, sagte Herzfeld. »Was schlagen Sie denn genau vor, was ich machen soll, während meine Kollegen in Arbeit ersticken?« Er versuchte, seiner Aussage einen scherzhaften Anstrich zu geben, obwohl er sich in der Situation alles andere als wohlfühlte. Den Kollegen so etwas aufzubürden, bloß weil er einen kleinen Schwächeanfall gehabt hatte, war einfach nicht sein Stil. Genau genommen widersprach es sogar allem, wofür Herzfeld stand.
»Sehen Sie, Herr Herzfeld, es gibt etwas, das ich mir wirklich nicht leisten kann, und das ist, Sie für einen längeren Zeitraum entbehren zu müssen. Oder Sie sogar ganz zu verlieren. Das, was Sie gestern erlebt haben, war ein Weckruf. Auch Sie haben eine Belastungsgrenze, und ich muss darauf bestehen, dass Sie diese respektieren. In unser aller Interesse. Und glauben Sie mir, ich verstehe Ihre Schwierigkeit, das einzusehen.«
»Sie beurlauben mich also?«, sprach Herzfeld das Offensichtliche aus, und Schwan nickte.
»Ordnen Sie Ihre Gedanken, ziehen Sie sich ein bisschen zurück aus alldem hier. Fahren Sie mit Ihrer Verlobten ein paar Tage oder auch Wochen weg, verbringen Sie Zeit mit Ihrer kleinen Tochter, und vor allem …« Schwan beugte sich auf seinem Sessel vor und deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger in Herzfelds Richtung, wie ein Lehrer, der seinen Schüler ermahnt. »Vor allem lassen Sie sich während dieser Zeit nicht im Institut blicken. Das ist eine Dienstanweisung!«
Die Aussicht darauf, etwas Zeit mit seiner Tochter Hannah verbringen zu können, stimmte Herzfeld versöhnlicher. Schwan hatte recht, sie sah ihren Vater tatsächlich viel zu selten. Sie aufwachsen zu sehen kam Herzfeld manchmal vor wie ein Film, der mit einer Zeitrafferkamera gedreht wurde. Eben noch ein Säugling, und jetzt schon fast in der Schule – wo war all die Zeit nur geblieben? Nun, am Obduktionstisch, an Leichenfundorten oder in Gerichtssälen hauptsächlich, das war in seinem Fall die einfache wie niederschmetternde Antwort, wie er sich selbst eingestehen musste.
Herzfeld nickte langsam. »Also gut. Einen Monat Auszeit. Aber bitte nicht länger.«
»Ausgezeichnet!«, freute sich Schwan und stand auf, um Herzfeld die Hand zu reichen. Beinahe, dachte Herzfeld, der sich jetzt ebenfalls aus dem geräumigen Sessel erhoben hatte, als besiegelten wir einen Pakt. »Dann erwarte ich Sie in vier Wochen wieder zur Arbeit, bestens ausgeruht und mit neuem Tatendrang.«
Herzfeld versprach es und wandte sich zum Gehen.
Sosehr sich Herzfeld auf die Zeit mit Hannah freute, so setzte dies jedoch zunächst voraus, dass seine Tochter von Petras Eltern, bei denen Petra sie nach ihren traumatischen Erlebnissen einquartiert hatte, wieder zurückkehrte.
Dazu würde er allerdings ein langes Gespräch mit Petra führen müssen, und das war eine Aussicht, der Herzfeld mit gemischten Gefühlen entgegensah.
3
25. Januar, 14.57 Uhr Kroatien. Eine Landstraße nahe Split
Branković blinzelte zum wiederholten Mal den Schweiß weg, der ihm in die Augen rann. Immer wieder lösten sich winzige Tröpfchen von seinen Augenbrauen. Seine Stirn sah aus, als habe er frisch geduscht, was er allerdings in Wahrheit das letzte Mal vor zwei Tagen getan hatte. Seitdem war der Mann mit dem buschigen Schnurrbart und der großen Brille in seinem Auto gefahren, praktisch ohne Unterlass, zunächst nur einem wilden Zickzackkurs folgend, über dessen Verlauf er erst Augenblicke vor der nächsten Kreuzung spontan entschieden hatte. Natürlich, um sie abzuhängen. Wie ein Hase, der Haken schlägt, um dem Wolf zu entkommen, der letztlich doch meistens schneller war als er – und viel gefräßiger.
Gut möglich, dass er sich das Ganze nur einbildete – oder zumindest einen Teil davon. Immerhin war er Ingenieur und somit ein Mann der Wissenschaft, und als solcher war ihm bewusst, dass drei Tage fast ohne Schlaf und mit lediglich Kaffee als Grundnahrungsmittel Verheerendes mit der Psyche eines Menschen anrichten konnten. Aber was, wenn er sich nicht irrte? Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, gingen ihm die berühmten Worte von Joseph Heller durch den Kopf.
War er paranoid?
Hatten sie ihn schon so weit, dass er sich vor seinem eigenen Schatten fürchtete? War da etwas in der Dunkelheit? Etwas Gieriges, Raubtierhaftes, das Zähne und Krallen nach ihm ausstreckte? Ein Schattenwolf?
»Sranje!«, fluchte er auf Kroatisch. »Scheiße!«
Mit dem schmutzigen Hemdsärmel wischte Branković den Schweiß von seiner Stirn, dabei war es in dem Auto alles andere als warm. Die Heizung des kleinen Lada Kombi hatte bereits vor Stunden den Geist aufgegeben, nachdem die Warnlampe der Anzeige mehrfach Überlastung signalisiert hatte. Vermutlich leicht zu reparieren, dachte er. Aber nicht jetzt. Beim nächsten Halt, vielleicht. An der nächsten Tankstelle.
Brankovićs Augen schmerzten. Von dem Schweiß, natürlich, aber auch von der Übermüdung. Selbst die Wirkung von Koffein hatte ihre Grenzen. Er warf einen Blick auf den Tacho, zwang sich, etwas vom Gas zu gehen. Die Aufmerksamkeit eines übereifrigen Dorfpolizisten, wenn auch unwahrscheinlich, war so ziemlich das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte. Seine Rechte zuckte nervös zu seinem Schnurrbart, der auf seiner Oberlippe zitterte, auch dieser war schweißfeucht. Er zupfte daran, eine alte Angewohnheit, wenn er nervös war.
»Reiß dich zusammen!«, schimpfte Branković in die Stille des Wageninneren. Als er nach der gigantischen 2,5-Liter-Thermoskanne im Fußraum des Beifahrerplatzes griff, fiel sein Blick auf den Prototyp auf dem Sitz neben ihm, den er in eine alte, hölzerne Munitionskiste gepackt hatte, davon hatten ja genug überall herumgelegen nach dem Jugoslawienkrieg. Und jetzt war er – ohne zu wissen, wie – abermals in einen Krieg geraten. Einen, in den keine UN-Blauhelme eingreifen würden und über den keine einzige Nachrichtenstation berichten würde. Ein stummer Krieg. Ein Schattenkrieg.
Branković wuchtete die Thermoskanne zwischen seine Knie auf den Sitz, öffnete den Deckel, der gleichzeitig als Becher diente, und platzierte ihn ebenfalls sorgsam zwischen seinen Beinen, ohne die Augen von der Fahrbahn vor ihm zu lassen. Nicht bei diesem Tempo. Nicht mit dem Prototyp neben sich, dem einzigen seiner Art. Er schraubte den Deckel ab, dann hob er die Kanne prüfend an. Ein Rest Kaffee war noch drin, vermutlich kalt. Egal. Schlimmstenfalls gäbe es ein paar neue Flecken auf seinem Hemd, das ohnehin inzwischen eher ein Fall für den Müll war statt für die Wäsche. Aber das spielte keine Rolle – nichts würde mehr eine Rolle spielen, wenn er den Prototyp nicht in Sicherheit brachte.
Branković setzte die Kanne gerade an, als er die Bewegung wahrnahm. Ein dunkler Fleck am Himmel, der vorbeihuschte, jetzt schon wieder aus seinem Sichtfeld verschwunden – oder war da doch gar nichts gewesen?
Er stellte die Kanne zurück in den Fußraum vor dem Beifahrersitz. Plötzlich war der Kaffee nicht mehr wichtig und Branković hellwach. Mit zusammengekniffenen Augen suchte er den Himmel vor sich ab. Seit einer Weile war ihm schon kein Fahrzeug mehr begegnet. Auch die Straßengräben und die Felder beiderseits der Straße lagen verlassen da.
Nichts, da ist nichts.
Branković drosselte das Tempo erneut, obwohl die Straße vor ihm schnurgerade war, der nächste Wald irgendwo hinter den Feldern auf der linken Seite.
Etwas huschte jetzt erneut durch sein Sichtfeld, diesmal im Rückspiegel! Er zuckte regelrecht zusammen. Er hatte etwas im Rückspiegel gesehen, über der Fahrbahn hinter ihm auf der Straße. Er drehte sich um, sah durch die Heckscheibe auf die Landstraße hinter sich – was immer es gewesen war, nun war es wieder fort.
Branković vermeinte ein Geräusch zu hören, ein Surren vielleicht oder ein Brummen, das vorher nicht da gewesen war. Der Motor? Hoffentlich nicht der Motor! Natürlich hatte er den Wagen nicht geschont, aber der Lada war zu Beginn der Fahrt gut in Schuss gewesen, er hatte ihn schließlich stets selbst gewartet. Das Summen verschwand, und Branković atmete auf.
Im nächsten Moment stieß das Ding vor ihm aus dem Himmel herab, und jetzt sah er es erstmals richtig. Eine fast futuristische Silhouette, die sich als schwarzes Etwas deutlich von dem Bleigrau des Himmels abhob. Eine Drohne!
All seine Fluchtmanöver waren vergeblich gewesen, all das Hakenschlagen umsonst. Das war es also, sie haben mich.
Intuitiv trat Branković aufs Gaspedal, der Motor heulte auf. Nun nahm er auch das Brummen wieder wahr, das diesmal eindeutig von der Drohne ausging. Und jetzt konnte er sehen, was genau ihn da verfolgte. Ein schwarzer Multicopter mit sechs oder acht in einer Ebene angeordneten Rotoren, so schnell konnte er das nicht erkennen. Das in mattem Schwarz lackierte Fluggerät hatte einen Durchmesser von eineinhalb bis zwei Meter, schätzte er. Auf jeden Fall war das Teil wendig und extrem schnell.
Und dann geschah alles gleichzeitig.
Als die Drohne in frontalem Kollisionskurs auf ihn zugeflogen kam, schrie Branković auf, verriss das Steuer reflexartig nach rechts, und einen Sekundenbruchteil später durchschlug der Lada die Leitplanke.
Mit einem entsetzlichen, kreischenden Geräusch wurde die linke Seite des Wagens von den verbliebenen Resten der Leitplanke aufgerissen wie eine Konservenbüchse. Messerscharfes Blech zerfetzte mühelos die dünne Polsterung der Tür und trennte das linke Bein des Ingenieurs ab, als wäre es das dürre Beinchen eines Insekts. Der Wagen verlor die Bodenhaftung und machte einen mächtigen Satz durch die Luft, bevor sich seine Front in den Boden eines abgeernteten Getreidefeldes grub. Vom Schwung des Aufpralls mitgerissen, bockte sich das Heck des Wagens auf wie ein störrisches Pferd, das nach hinten ausschlägt. Dann überschlug sich der Lada mehrfach und prallte dabei jedes Mal, mit abwechselnder Beteiligung von Front und Heck, hart auf den Untergrund auf, bis der Wagen selbst kaum noch als solcher zu erkennen war.
Als er schließlich zur Ruhe kam, auf dem zerbeulten Dach liegend wie ein unglücklicher Käfer, war sein Insasse längst tot, erschlagen und zerfetzt von Teilen des Fahrzeuginnenraums und der schweren Munitionskiste mit dem Prototyp, der so wichtigen Ladung des Wagens, die mit der Wucht eines Geschosses kreuz und quer geflogen war.
All das wurde, bar jeder Emotion, von einem kleinen gläsernen Auge aus der Luft beobachtet, dem rundlichen Kameraobjektiv an der Unterseite der Drohne. Benzin aus dem zerfetzten Tank tropfte auf den Boden. Als kleine Flammen aus dem Wagen zu schlagen begannen, hatte das gläserne Auge offenbar genug gesehen. Surrend und schwarz, kaum mehr als ein Schatten, erhob sich die Drohne in die Luft, um sich anderen Dingen zuzuwenden.
4
25. Januar, 17.34 UhrKiel. Wohnung Paul Herzfeld
»Ich könnte Hannah doch morgen nach Hause holen«, schlug Herzfeld vor.
Petra schüttelte energisch den Kopf. »Sie fühlt sich wohl bei meinen Eltern«, sagte sie. »Paul, im Moment will ich Hannah da auch nicht wegholen. Nicht nach Hause jedenfalls, zumindest noch nicht in den nächsten Tagen.«
»Wir könnten zu dritt in den Urlaub fahren«, schlug Herzfeld vor. »Und sei es nur für eine Woche.«
»Entschuldige, aber wie genau stellst du dir das vor? Willst du einen auf heile Welt machen? Soll ich unserer Tochter die fröhliche Mami vorspielen, als ob nichts gewesen wäre? Wollen wir probieren, ob sie bemerkt, dass ich immer noch jedes Mal panisch zusammenzucke, wenn es an der Tür klingelt oder ich irgendwo einen Koffer sehe? Dass ich jedes Mal Herzrasen und Atemnot bekomme, wenn irgendwo ein großer Mann mit hellblonden Haaren steht? Stellst du dir so vielleicht einen schönen Familienurlaub vor?«
»Nein«, seufzte Herzfeld. »Aber ich könnte mich doch um sie kümmern.«
»Du hast also mal ein paar Wochen frei, und da willst du plötzlich den Vater für sie spielen.«
»Warum denn nicht? Sie ist schließlich auch meine Tochter, Petra.«
»Ist ja schön, dass dir das auch mal auffällt, Paul. Aber vielleicht ist gerade das der Grund, warum ich glaube, Hannah sollte lieber noch ein bisschen bei meinen Eltern bleiben. Wo warst du denn die letzten Jahre? Im Institut, bei deinen Leichen! Und jetzt, denkst du, machst du vier Wochen einen auf heile Familie und drückst so den Reset-Knopf? Und wir machen ganz normal weiter?«
»Ich versteh dich manchmal einfach nicht«, sagte Herzfeld.
»Momentan kann ich das einfach nicht, Paul, und daran wird sich vermutlich auch in den nächsten Wochen nichts ändern. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass meine Eltern mir zumindest eine Sorge abnehmen. Ich habe immer noch viel zu viel mit mir selbst zu tun. Ich kann Hannah einfach nicht den ganzen Tag beschäftigen.«
Oder um dich haben, vervollständigte Herzfeld in Gedanken ihren Satz, obwohl er wusste, dass er Petra damit unrecht tat. Immerhin war sie es gewesen, die Hannah in den letzten Jahren umsorgt und großgezogen hatte, nicht er, der de facto eigentlich nie zu normalen Tageszeiten zu Hause gewesen war. »Das klingt, als redest du von einem Haustier und nicht von unserer Tochter«, sagte er. »Und ich verstehe immer noch nicht, wieso du glaubst, ich würde es nicht auch allein auf die Reihe bekommen, für sie da zu sein.«
Petra schwieg. Aber ihre Augen sprachen Bände stummer Vorwürfe. Weil du trotzdem die ganze Zeit in Gedanken bei deiner Arbeit wärst, schienen sie zu sagen. Und tief in seinem Inneren wusste Herzfeld, dass sie damit vermutlich recht hatte.
»Ich meine, da bin ich mal eine längere Zeit zu Hause«, sagte Herzfeld, »und dann soll Hannah ausgerechnet in dieser Zeit bei deinen Eltern bleiben? Wo sie doch in den nächsten Kita-Ferien sowieso wieder bei ihnen in Kronshagen ist? Ich kapiere wirklich nicht, was das soll.«
»Gut, dann muss ich es wohl aussprechen«, sagte Petra leise.
»Ich bitte darum«, sagte Herzfeld. Härter, als er es beabsichtigt hatte.
»Ich will sie jetzt nicht hier haben, okay? Nicht bei mir und …« Sie zögerte. »Und nicht in deiner Nähe.«
»Wie bitte?« Herzfeld starrte Petra verständnislos an. Hatte er sich diese Worte nur eingebildet oder waren sie tatsächlich gerade aus Petras Mund gekommen?
»Entschuldige«, lenkte Petra ein, »so war das nicht gemeint. Ich meine, sie soll nicht in der Nähe deiner Arbeit sein und … all dem anderen. Was dich so umgibt.«
»Zum Beispiel?«, fragte Herzfeld. »Es ist ja nicht so, dass ich vorhabe, sie während meiner freien Tage mit ins Institut zu schleppen und neben den Obduktionstisch zu stellen, damit sie ein bisschen zuschauen kann. Oder mir Arbeit mit nach Hause nehme und hier am Küchentisch mal eben ein paar Herzen und Nieren seziere …«
»Mach dich jetzt nicht darüber lustig, Paul!«, unterbrach Petra ihn energisch, und nun hatte sich ein Ton in ihre Stimme geschlichen, der sich nur als eisig bezeichnen ließ. »Das meine ich auch gar nicht.«
»Und was meinst du dann?«
»Ich meine, dass dein irrer Kollege mich entführt hat, während er dich unter vorgehaltener Waffe dazu zwang …«, Petras Stimme versagte.
»Aber wie hätte ich denn deiner Meinung nach reagieren sollen? Ich …«, begann Herzfeld, aber er kam nicht weit.
»Komm mir jetzt nicht so. Du weißt genau, worum es mir geht, Paul!«, rief Petra. Tränen hatten sich von den Lidern ihrer Augen gelöst und liefen ihr über die Wangen. »Wie kannst du erwarten, dass ich Hannah so großziehe? In der Gesellschaft von Leichen und Verrückten!«
»Schneider ist tot«, sagte Herzfeld. Vermutlich tot, korrigierte er sich im selben Moment, ohne es auszusprechen.
»Und was die Leichen betrifft …«
»Ja, Paul, lass uns über die Leichen reden. Die sind doch sowieso dein liebstes Gesprächsthema. Manchmal glaube ich, die interessieren dich sogar mehr als …« Petra hielt inne, als sie Herzfelds schockierten Gesichtsausdruck bemerkte. »Paul, ich …«, begann sie erneut, und ihre Tränen flossen nun noch heftiger. »So habe ich das nicht gemeint, Paul. Es ist nur …«
Herzfeld fühlte sich, als würde er zu Stein erstarren. Er wollte Petra in den Arm nehmen, aber er konnte es nicht.
Ich muss hier raus, dachte er, sofort!
Eine Weile standen sie nur so da und schauten sich an. Unfähig, dem, was sie fühlten, mit Worten Ausdruck zu verleihen.
»Ich muss noch mal los«, sagte er schließlich, und Petra nickte kurz, ohne ihn dabei anzusehen.
»Wir reden später weiter«, sagte er, während er seinen braunen Winterparka überzog. Petra wischte sich die Tränen fort und schenkte ihm den Versuch eines schmallippigen Lächelns. Herzfeld drehte sich um und verließ die Wohnung.
5
26. Januar, 8.34 Uhr Kiel. Institut für Rechtsmedizin der Universität
Es klopfte, und kurz darauf steckte Herzfeld den Kopf zur Tür herein.
»Guten Morgen, Kollege Herzfeld«, sagte Schwan und sah von den Papieren auf, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. »Kommen Sie nur herein.«