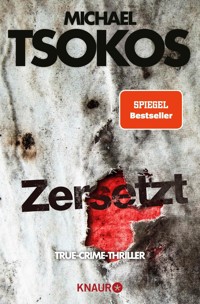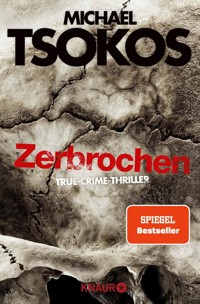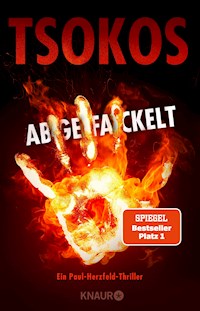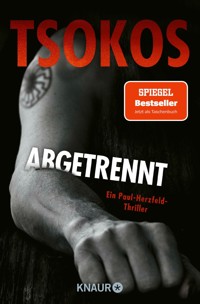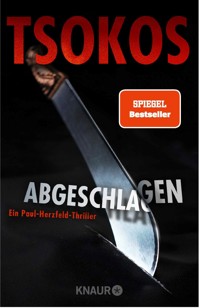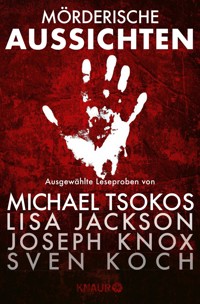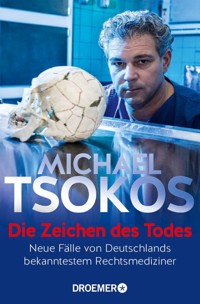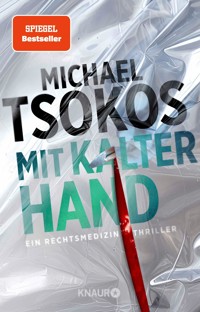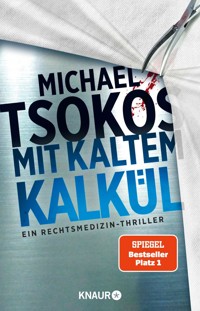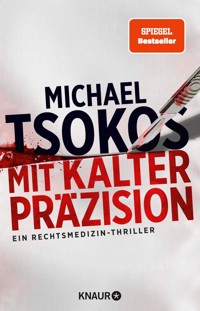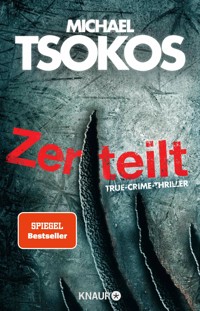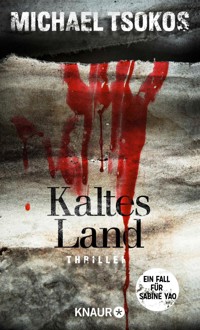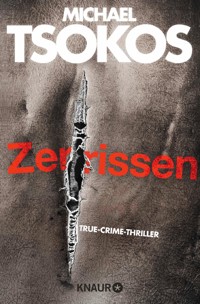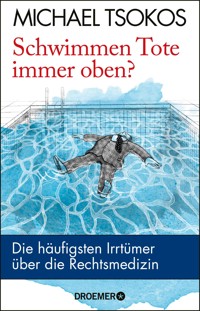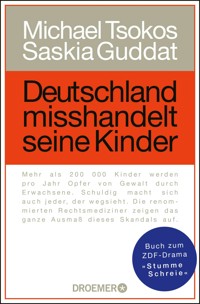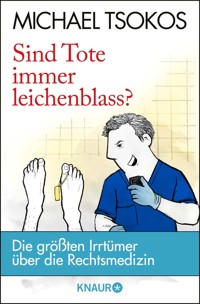
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mord, Leichenschau und bizarre Irrtümer - Die Realität hinter den Klischees der Rechtsmedizin In Sind Tote immer leichenblass? nimmt Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner, Professor Michael Tsokos, die gängigen Klischees und Irrtümer rund um die Arbeit im Sektionssaal aufs Korn. Mit seinem Sachbuch räumt er mit den oft bizarren Darstellungen der Rechtsmedizin in Krimis auf und zeigt, wie weit diese von der Realität entfernt sind. Spannend und realitätsnah informiert Tsokos über die tatsächlichen Mittel und Methoden der modernen Gerichtsmedizin. Werden Mordopfer tatsächlich von den Angehörigen in der Rechtsmedizin identifiziert? Sind Rechtsmediziner wirklich bei der Verhaftung eines Verdächtigen dabei? Nehmen sie gar an der Vernehmung von Zeugen teil? Szenen wie diese gehören zum Standardrepertoire von Fernsehkrimis. Doch mit der Realität haben sie nichts zu tun. Meist handelt es sich um Klischees von Vorgängen im Sektionssaal. Die tatsächlichen Abläufe und die Gründe erläutert Michael Tsokos in diesem Buch. Er entlarvt eingefahrene Klischeebilder und verzerrte Darstellungen der Vorgänge im Obduktionssaal und erteilt nebenbei einen Grundkurs in Rechtsmedizin. Das ist lehrreich und äußerst spannend. Ein Buch, das nicht nur für Fans von Sebastian Fitzek und True Crime Büchern fesselnd ist, sondern auch für alle, die sich für Kriminalistik, Forensik und die Aufklärung von Mordfällen interessieren. Sind Tote immer leichenblass? ist ein erzählendes Sachbuch, das zeigt: Nichts ist spannender als die Wirklichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prof. Dr. Michael Tsokos
Sind Tote immer leichenblass?
Die größten Irrtümer über die Rechtsmedizin
Illustriert von Christoph Kellner
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Werden Mordopfer tatsächlich von den Angehörigen in der Rechtsmedizin identifiziert? Sind Rechtsmediziner bei der Verhaftung eines Verdächtigen dabei? Nehmen sie an der Vernehmung von Zeugen teil? Und reiben sie sich vor der Obduktion Mentholpaste unter die Nasenlöcher, damit sie den Leichengeruch überhaupt ertragen können?
Szenen wie diese gehören zum Standardrepertoire von Fernsehkrimis. Doch mit der Realität haben sie nur selten etwas zu tun. Meist handelt es sich um Klischees von Vorgängen im Sektionssaal. Michael Tsokos, Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner und vielfacher Bestsellerautor, nimmt die bizarrsten Irrtümer aufs Korn. Er erläutert die teils groben Fehler und informiert unterhaltsam und spannend zugleich über die Mittel und Methoden der Rechtsmedizin.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Irrtum Nr. 1: Rechtsmediziner sind alles, nur keine richtigen Ärzte
Irrtum Nr. 2: Rechtsmediziner und Pathologen sind ein und dasselbe
Irrtum Nr. 3: Die Angehörigen identifizieren ihre Verstorbenen in der Rechtsmedizin
Irrtum Nr. 4: Rechtsmediziner untersuchen nur Tote
Irrtum Nr. 5: Serienkiller bestimmen den Arbeitsalltag des Rechtsmediziners
Irrtum Nr. 6: Tote sind immer leichenblass
Irrtum Nr. 7: Die grüne Farbe des altägyptischen Totengottes Osiris steht für Wiederauferstehung
Irrtum Nr. 8: Mann/Frau kann sich selbst erwürgen
Irrtum Nr. 9: Leichenfäulnis und -verwesung sind identische Vorgänge
Irrtum Nr. 10: Jeder hat zu jeder Zeit freien Zugang zu den Räumlichkeiten eines rechtsmedizinischen Instituts
Irrtum Nr. 11: »Gerichtsmediziner« und »Rechtsmediziner« können als Berufsbezeichnung synonym verwendet werden
Irrtum Nr. 12: Rechtsmediziner sind Trinker, denn ohne Alkohol ist dieser Job nicht auszuhalten
Irrtum Nr. 13: Todesursachen können immer aufgeklärt werden
Irrtum Nr. 14: Der Leichnam liegt nach der Obduktion noch tagelang, nur mit einem Laken bedeckt, auf dem Obduktionstisch
Irrtum Nr. 15: Ein Rechtsmediziner obduziert allein. Er löst auch seine Fälle immer allein, ohne fachliche Diskussionen mit Kollegen
Irrtum Nr. 16: Rechtsmediziner sind chronisch schlecht gelaunte Zyniker
Irrtum Nr. 17: Der Tod ist umsonst
Irrtum Nr. 18: »Es war Selbstmord.«
Irrtum Nr. 19: Rechtsmediziner hören klassische Musik bei der Arbeit
Irrtum Nr. 20: Rechtsmediziner sind postmortale Klugscheißer
Irrtum Nr. 21: Rechtsmediziner verbringen den ganzen Tag in gekachelten Sektionssälen und essen dort gerne mal ein Brötchen bei der Arbeit
Irrtum Nr. 22: Der Obduktionssaal ist im Keller eines rechtsmedizinischen Instituts gelegen
Irrtum Nr. 23: Rechtsmediziner gehen um 16 Uhr nach Hause, denn ihre »Patienten« können ja warten
Irrtum Nr. 24: Eine Obduktion erstreckt sich über mehrere Tage
Irrtum Nr. 25: Vor der Obduktion reiben sich Rechtsmediziner Mentholpaste unter die Nasenlöcher, damit sie den Leichengeruch besser ertragen können
Irrtum Nr. 26: Rechtsmediziner entwickeln neue kriminalistische Untersuchungsmethoden wie am Fließband
Irrtum Nr. 27: An den Gesichtszügen eines Verstorbenen lässt sich feststellen, ob ihn ein friedlicher oder qualvoller Tod ereilt hat
Irrtum Nr. 28: Rechtsmediziner ermitteln selbständig und sind der Polizei immer ein Stück voraus
Irrtum Nr. 29: Rechtsmediziner sind bei der Verhaftung Tatverdächtiger und der Vernehmung von Zeugen zugegen
Irrtum Nr. 30: Leichengift ist hochinfektiös
Irrtum Nr. 31: Nach dem Tod wachsen Nägel und Haare weiter
Irrtum Nr. 32: Rechtsmediziner besprechen ihre Fälle zu Hause mit der Familie, um mit ihrem Job klarzukommen
Irrtum Nr. 33: Tatort und Leichenfundort sind das Gleiche
Irrtum Nr. 34: Die Todeszeit bestimmt der Rechtsmediziner durch Handauflegen auf die noch vollständig bekleidete Leiche
Irrtum Nr. 35: Die Todeszeit bestimmt der Rechtsmediziner so ziemlich auf die Minute genau
Irrtum Nr. 36: Den Tod stellt der Kriminalkommissar durch Fühlen des (nicht vorhandenen) Pulsschlages der Halsschlagader fest
Irrtum Nr. 37: Die Todeszeit kann durch eine Mageninhaltsanalyse ermittelt werden
Irrtum Nr. 38: Die letzte Mahlzeit eines Toten lässt sich bei der Obduktion anhand der Untersuchung seines Mageninhalts feststellen
Irrtum Nr. 39: Rechtsmediziner leben gefährlich. Sie sind ein beliebtes Ziel von Vergeltungsaktionen durch rachsüchtige Kriminelle und deren Angehörige
Irrtum Nr. 40: Die Todesursache beim Erhängen ist ein Genickbruch
Nachwort und Danksagung
Vorwort
Vor mehr als 20 Jahren, als ich mich entschloss, Rechtsmediziner zu werden, führte mein Fachgebiet in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein absolutes Nischendasein. Aber auch für die meisten Ärzte war die Rechtsmedizin zu dieser Zeit noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der medizinischen Disziplinen. Mit Ausnahme von Wiederholungen der von 1976 bis 1983 produzierten Fernsehserie Quincy, bei der erstmals ein Rechtsmediziner Hauptfigur in einem Krimi war, gab es Mitte der 1990er Jahre noch keine Filme, in denen forensische Untersuchungsmethoden im Mittelpunkt standen. Auch in der Kriminalliteratur oder im Sachbuch hatten Forensiker noch nicht Einzug gehalten und Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Für die Rechtsmedizin interessierte sich damals eigentlich noch niemand. Die wenigen Leute, die sich damals Gedanken darüber machten, was sich wohl in rechtsmedizinischen Instituten abspielen könnte, gingen davon aus, dass dort in gekachelten und grell erleuchteten Sektionssälen den ganzen Tag tote Menschen aufgeschnitten werden. Abgesehen von dieser Vorstellung Einzelner war die Öffentlichkeit bis dahin ja auch völlig im Dunkeln gelassen worden, was hinter den verschlossenen Sektionssaal- und Labortüren eines rechtsmedizinischen Instituts vor sich gehen könnte. Das sollte sich aber schon ein paar Jahre später schlagartig ändern. Plötzlich wimmelte es von Rechtsmedizinern in Krimis und Fernsehfilmen; allerdings wurden dabei auch all die Bilder produziert, die sich offenbar hartnäckig im Bewusstsein der Menschen verankert hatten.
Zwei Dinge waren aber schon Mitte der 1990er Jahre für jeden meiner Kommilitonen oder auch die Ärzte, mit denen ich über meinen damals noch sehr ausgefallenen Berufswunsch sprach, nur zu sicher: Die Rechtsmedizin ist ein Schmuddeljob, und außerdem sind Rechtsmediziner hinsichtlich ihres Einkommens gegenüber allen anderen Medizinern benachteiligt – sie sind gewissermaßen ganz am Ende der ärztlichen Nahrungskette angesiedelt. Und eigentlich kann man auch gleich Gerichtsmediziner sagen, denn Gerichtsmediziner und Rechtsmediziner sind ja schließlich dasselbe. Und als Pathologen kann man sie auch bezeichnen, denn sie machen alle das Gleiche. Leider alles falsch. Hier geht es schon los mit den Irrtümern über die Rechtsmedizin.
Wir Rechtsmediziner beschränken uns nicht nur auf die Untersuchung Toter mittels äußerer Leichenschau und Obduktion. Im Gegenteil, die Untersuchung lebender Personen – beispielsweise Opfer von Straftaten, aber auch Tatverdächtige – hat einen festen Stellenwert und ist nahezu tägliche Praxis. Aber dazu später mehr. Und was das Pekuniäre anbelangt: Ein in der Rechtsmedizin tätiger Assistenz- und Oberarzt erhält aufgrund bundesweit ähnlicher tarifvertraglicher Regelungen im Gesundheitswesen ungefähr das gleiche Grundgehalt wie seine in der Klinik tätigen Kollegen.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2016. Nach meinem Medizinstudium an der Universität Kiel konnte ich meinen Berufswunsch verwirklichen und bin seit 1996 als Rechtsmediziner tätig. Die Zeiten haben sich seitdem erheblich geändert – auch was die öffentliche Wahrnehmung der Rechtsmedizin anbelangt und das »Wissen« über unser Tätigkeitsfeld. Das Schmuddelimage unserer Profession wurde abgelegt, und heutzutage meint jeder eigentlich nur zu genau zu wissen, was wir machen. Ganz wesentlich dazu beigetragen hat mein fiktiver Kollege, der kauzige und verschrobene Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne, verkörpert von Jan Josef Liefers. Als Münsteraner Rechtsmediziner in der sonntäglichen Serie Tatort ist er den Fernsehzuschauern seit 2002 ein Begriff. Boerne erzielt regelmäßig Einschaltquoten im zweistelligen Millionenbereich und ist aus dem Tatort nicht mehr wegzudenken. Aber auch die Serien Medical Detectives, Autopsie, CSI: Den Tätern auf der Spur, Bones – Die Knochenjägerin, Crossing Jordan, Der letzte Zeuge sowie Criminal Minds und viele andere haben seit Ende der 1990er Jahre ihren Teil dazu beigetragen, die bis dahin verschlossenen Sektionssaal- und Labortüren weit aufzustoßen und so Licht in das Dunkel der Arbeit der Forensiker zu bringen. Das Ausmaß, mit dem deutsche Fernsehzuschauer mit solchen Serien regelrecht bombardiert werden, ist beachtlich. In nur einer Kalenderwoche im Jahr 2016 zählte ich mehr als dreißig verschiedene Rechtsmedizin-Serien und Forensik-TV-Formate im Fernsehprogramm – die Wiederholungen nicht mitgezählt!
Ein Ende dieses Booms ist derzeit weder in der Kriminalliteratur und in Kino- und Fernsehfilmen noch in Wissenschaftsmagazinen absehbar. Unweigerlich haben sich bei so viel Präsenz der Rechtsmedizin in den Medien auch einige populäre Irrtümer bzw. Fehlannahmen über den Ablauf des Arbeitsalltags in der Rechtsmedizin verselbständigt. Immer wieder wird im Fernsehen das Bild des neben der Leiche Brötchen kauenden Rechtsmediziners bemüht, der zudem ewig schlecht gelaunt ist und mit seinen Mitmenschen nicht klarkommt. Ebenso sieht man in Filmen immer wieder ganze Familien durch den Obduktionssaal pilgern, um ihren verstorbenen Angehörigen zu identifizieren.
Da sich in den letzten 15 Jahren offenbar zahlreiche Klischees und verzerrte Darstellungen von uns Rechtsmedizinern und unserer Arbeit in der Öffentlichkeit verfestigt haben, scheint es mir nun an der Zeit, diese Bilder etwas geradezurücken und mit den größten Irrtümern über die Rechtsmedizin aufzuräumen.
Dieses Buch soll Sie, liebe Leserinnen und Leser, keinesfalls desillusionieren oder Ihnen den Spaß an der fiktionalen Darstellung unserer Arbeit nehmen. Mir ist klar, dass solche teils verqueren Szenen der Phantasie eines (Drehbuch-)Autors entspringen, dass solche Typisierungen die Dramaturgie des jeweiligen Falles stützen – und natürlich weiß ich auch, dass eine gute Story nur so funktionieren und den Zuschauer bzw. den Leser in Atem halten kann. Lassen Sie sich also nicht den Spaß an all diesen Serien, Filmen und Büchern nehmen. Das, was Sie hier lesen, holt Sie allenfalls ein kleines Stück in die Realität der Rechtsmedizin zurück und soll, wie die Fiktion auch, vor allem eines bewirken – Sie bestens unterhalten.
Michael Tsokos
Irrtum Nr. 1
Rechtsmediziner sind alles, nur keine richtigen Ärzte
Wann immer das Gespräch darauf kommt, was ich beruflich mache, wird mir auch heute noch manchmal die Frage gestellt, ob ich sowohl Medizin als auch Jura studiert hätte. Viele Menschen meinen offenbar, dass Rechtsmediziner im Prinzip so etwas wie Juristen seien oder zumindest den Rechtswissenschaften wesentlich näherstünden als der Medizin, was vielleicht auch ein bisschen an der Reihenfolge von »Recht« und »Medizin« im Wort »Rechtsmedizin« liegen mag.
Auch wenn in Deutschland der Facharzttitel für Rechtsmedizin neben anderen Anforderungen zwingend ein Medizinstudium erfordert, nicht aber das Studium der Rechtswissenschaften, ist diese Frage durchaus berechtigt. Zum einen gibt es Kollegen von mir, die durch ihren akademischen Titel »Prof. Dr. med. Dr. jur.« als doppelt promovierte Hochschullehrer hervorstechen, allerdings lassen die sich in Deutschland zur Zeit an einer Hand abzählen. Andererseits ist in angloamerikanischen Ländern der bei rechtsförmlichen Verfahren hinzugezogene Coroner, der bei unerwarteten, dubiosen oder gewaltsamen Todesfällen die Todesursache feststellt, nicht selten von Hause aus Jurist und fast nie Arzt. All dies zeigt, dass die eingangs erwähnte Frage durchaus ihre Berechtigung hat; trotzdem bedarf es in Deutschland für den Beruf des Rechtsmediziners keiner wie auch immer gearteten juristischen Vorbildung.
Völlig abwegig ist demgegenüber die Annahme, die Rechtsmedizin sei eine Art Ausbildungsberuf, den man – wie eine Schlosser- oder Maurerlehre – drei Jahre lang erlernt und dann, wie eine Gesellenprüfung, mit einer Prüfung zum Rechtsmediziner abschließt. Diese falsche Annahme geistert zumindest in einigen Berufsforen im Internet herum; dort tauschen sich zuweilen Halbinformierte, Unwissende und völlig Ahnungslose aus, bedienen bestimmte Klischees über die Rechtsmedizin und geben sich gegenseitig »Tipps«, wie man Rechtsmediziner wird.
Die Vorstellungen vom Beruf des Rechtsmediziners und das allgemeine Bild von uns in der Öffentlichkeit werden sehr von amerikanischen Fernsehserien bestimmt – und damit natürlich auch verzerrt. Die Protagonisten, oder besser »Helden«, in Serien wie CSI: Den Tätern auf der Spur, CSI: Miami oder Criminal Minds sind keine Rechtsmediziner. Bei ihren Pendants im wirklichen Leben handelt es sich in der Regel um hochrangige Kriminalermittler beziehungsweise Polizeioffiziere oder Bundesagenten mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung. Sie werden in diesen populären Serien häufig als Mordermittler und Kriminaltechniker mit dem entsprechenden naturwissenschaftlichen Know-how dargestellt. Diese Art der Kriminalermittlung hat mit der Realität nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern kaum etwas zu tun.
Um es klarzustellen: Wir Rechtsmediziner sind Naturwissenschaftler. Der »klassische« Rechtsmediziner, der im Sektionssaal, am Tatort und vor Gericht als Sachverständiger tätig ist, hat ein mindestens sechsjähriges Medizinstudium erfolgreich mit dem dritten Staatsexamen abgeschlossen. Danach darf man die Approbation als Arzt beim zuständigen Landesprüfungsamt beantragen. Wenn man dann für sich die Rechtsmedizin als Fachdisziplin gewählt hat – als den Job, zu dem man sich berufen fühlt –, kommt eine noch größere Hürde als der erfolgreiche Abschluss des Medizinstudiums auf den Berufsanfänger zu, nämlich eine Stelle als Weiterbildungsassistent in der Rechtsmedizin zu ergattern. Hat auch das geklappt, ist man zwar als Rechtsmediziner tätig, darf aber während der nächsten Jahre nur eingeschränkt eigenverantwortlich arbeiten. Alles, was der Weiterbildungsassistent in der Rechtsmedizin untersucht beziehungsweise begutachtet und was dann in schriftlicher Form als Gutachten vom Institut für Rechtsmedizin herausgegeben wird, muss von einem Facharzt für Rechtsmedizin (in der Regel einer der Oberärzte des Instituts) geprüft, für korrekt befunden und gegengezeichnet werden.
Die Facharztausbildung zum Rechtsmediziner dauert mindestens fünf Jahre und beinhaltet neben einer wenigstens vierjährigen Tätigkeit in einem Institut für Rechtsmedizin jeweils ein halbes Jahr praktischer ärztlicher Tätigkeit in der Pathologie und in der Psychiatrie. Wenn dann sämtliche Voraussetzungen von dem Anwärter – oder der Anwärterin – auf den Facharzttitel für Rechtsmedizin erfüllt sind (dazu gehört ein sogenannter Facharztkatalog, in dem ganz genau vorgeschrieben ist, welche Anzahl von Obduktionen, Leichenschauen, schriftlichen und mündlichen Gutachten für Gerichte, Beurteilungen von Knochenfunden, mikroskopische Untersuchungen und vieles mehr geleistet worden sein müssen), kann er (oder sie) sich zur Facharztprüfung anmelden. Diese mündliche Prüfung wird von zwei langjährigen und erfahrenen Fachärzten für Rechtsmedizin und einem Beisitzer, der ebenfalls Arzt ist, in der Ärztekammer des jeweiligen Bundeslandes durchgeführt.