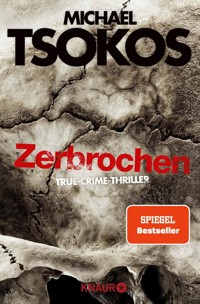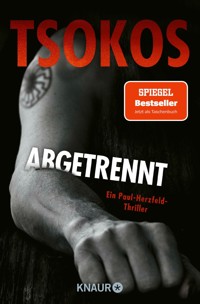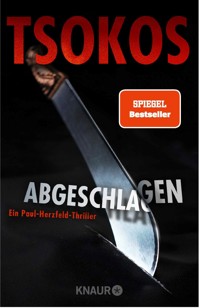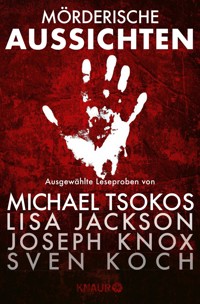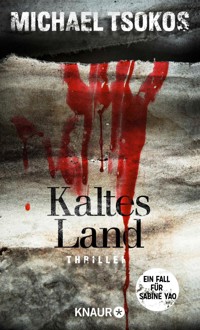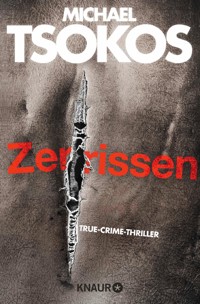9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fred Abel-Reihe
- Sprache: Deutsch
Teil 2 der True-Crime-Trilogie der SPIEGEL-Bestseller-Autoren Michael Tsokos und Andreas Gößling – basierend auf echten Fällen, authentischen Ermittlungen und der jahrelangen Erfahrung des bekanntesten deutschen Rechtsmediziners. BKA-Rechtsmediziner Dr. Fred Abel arbeitet unter Hochdruck an einem großen Fall: Ein winziger Einstich in der Kniekehle eines Toten verrät ihm, dass einer der gefährlichsten Killer der letzten Zeit weiterhin sein Unwesen treibt. Doch bevor Abel ihn stoppen kann, wird er in heikler Mission in den osteuropäischen Pseudostaat Transnistrien geschickt. Dort soll er zwei Mordopfer identifizieren, die in Kalkfässern gelagert wurden und fast vollständig zersetzt sind. Plötzlich steht Abel im Fadenkreuz eines politischen Komplotts. Während einer mörderischen Verfolgungsjagd durch das transnistrische Grenzland muss er seine ganz besonderen Fähigkeiten einsetzen. Und gleichzeitig kämpft in Deutschland das jüngste Opfer des Psychokillers in einem Keller um sein Leben ... "Ein spektakulärer Thriller." STERN Crime Die spannenden True-Crime-Thriller um Dr. Fred Abel sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Zerschunden (Michael Tsokos & Andreas Gößling) - Zersetzt (Michael Tsokos & Andreas Gößling) - Zerbrochen (Michael Tsokos & Andreas Gößling) - Zerrissen (Michael Tsokos) - Zerteilt (Michael Tsokos)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Michael Tsokos
mit Andreas Gößling
ZERSETZT
True-Crime-Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
BKA-Rechtsmediziner Dr. Fred Abel arbeitet unter Hochdruck an einem großen Fall: Ein winziger Einstich in der Kniekehle eines Toten verrät ihm, dass einer der gefährlichsten Killer der letzten Zeit weiterhin sein Unwesen treibt. Doch bevor Abel ihn stoppen kann, wird er in heikler Mission in den osteuropäischen Pseudostaat Transnistrien geschickt. Dort soll er zwei Mordopfer identifizieren, die in Kalkfässern gelagert wurden und fast vollständig zersetzt sind. Plötzlich steht Abel im Fadenkreuz eines politischen Komplotts. Während einer mörderischen Verfolgungsjagd durch das transnistrische Grenzland muss er seine ganz besonderen Fähigkeiten einsetzen. Und gleichzeitig kämpft in Deutschland das jüngste Opfer des Psychopathen in einem Keller um sein Leben …
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
Epilog
Danksagung
Michael Tsokos: Noch mehr True Crime, Thrill und wahre Begebenheiten
Andreas Gößling: Ein True-Crime-, Polit- und Psychothriller
Die Handlung in »Zersetzt«
spielt zehn Monate vor den Ereignissen
in »Zerschunden«.
Prolog
Die kleine Schlampe kapierte rein gar nichts. Jedenfalls tat sie so, als würde sie nur Bahnhof verstehen. Dabei hatte er es ihr in aller Ausführlichkeit erklärt, wieder und wieder. Aber sie glotzte ihn nur verständnislos an, und ihre veilchenblauen Augen tropften wie kaputte Wasserhähne.
»Ich soll meine Beine um Ihren Hals …?« Sie fing schon wieder an zu schluchzen. »Ich kann das nicht … ich will … ich versteh das nicht … Wieso lassen Sie mich nicht einfach gehen?«
Er musste tief Luft holen. »Wir sind per du«, erinnerte er sie. »Schon vergessen?« Er kniff sie in die linke Brustwarze. »Jana. So heißt du doch, oder?«
Sie nickte und schluchzte.
»Mich kannst du übrigens Barry nennen.«
Das war nicht gerade ein genialer Deckname, denn im wirklichen Leben wurde er Harry genannt. Aber darum ging es auch nicht. Harry war sein helles, Barry sein dunkles Ich. So wie bei Jekyll & Hyde. Er liebte diesen Vergleich.
Sie lag in dem uralten Bett mit der ausgeleierten Matratze, er kauerte neben ihr auf seinen Unterschenkeln. Sie waren nackt. Er hatte die Elektroheizung angestellt, es war kuschelig warm. Sie hatte also keinen Grund, sich zu beschweren. Obwohl sie vor kurzem noch geglaubt hatte, auf dem Weg in ihr kitschiges Single-Apartment am Stadtrand zu sein, wo niemand außer ihrer Plüschbären-Parade sie erwartete.
Jana mit den braunen Wuschelhaaren. Sportliche Figur, aber mit ansprechenden Rundungen. Es hatte ihm fast das Herz gebrochen, als er sie in den letzten Tagen beobachtet hatte. So jung, so hübsch und so allein. Da war es geradezu ein Akt der Nächstenliebe gewesen, sie im Gewerbegebiet an der einsam gelegenen Bushaltestelle einzusammeln und hierher mitzunehmen. Zu seinem Hobby-Hostel unter der Erde.
Die Einrichtung war karg, aber zweckmäßig. Ein Tisch mit zerplatztem Plastikfurnier, zwei knarrende Holzstühle, alles mindestens dreißig Jahre alt. In der einen Ecke eine Plastikdusche, daneben ein Chemieklo. In der anderen eine verschimmelte Spüle, kombiniert mit ultramoderner Mikrowelle und dem seit Ewigkeiten defekten Kühlschrank. Die Glühbirne an der Decke brannte, und alle fünf Minuten sprang mit leisem Surren die Belüftung an. Auf dem Tisch stapelten sich Fertiggerichtpackungen. Original Thai-Curry und Pichelsteiner Eintopf nach Großmutters Rezept, was wollte man mehr?
Na gut, neben der Stahltür standen noch zehn Sixpacks Mineralwasser in Plastikflaschen. Und der Arztkoffer, den Barry griffbereit neben seiner Bettseite plaziert hatte, enthielt alles andere, was man auf so einem Ausflug unter die Erde möglicherweise gebrauchen konnte. Zum Beispiel sechs Ampullen Laxophorin, direkt aus Moskau importiert, ein Fläschchen Liquid Ecstasy aus eigener Herstellung, mehrere Packungen Viagra, knapp einhundert Gramm Kokain in russischer Premiumqualität, jede Menge Einwegspritzen und Kanülen und außerdem natürlich das offizielle Notarztarsenal. Schließlich war er Mediziner mit eigener Praxis am Wandlitzsee bei Berlin.
»Gefällt es dir hier, Kleines?«
Keine Reaktion. Ihr monotones Schluchzen zählte nicht. Er wollte von ihr hören, dass es ihr gefiel. Und er wusste, dass sie früher oder später unter Tränen beteuern würde, wie großartig sie diesen Ort fand. Und ihn, Barry, ihren Lover.
Hey, deine neueste Eroberung ist ein waschechter Doktor! Nicht schlecht für eine abgebrochene Pädagogikstudentin, die beim Discounter in der Frühschicht malocht. Und dann auch noch gleich ein Bund fürs ganze Leben, du Schlampe, dachte Barry. Jedenfalls für deins.
Noch ließ sie es an Begeisterung fehlen, aber das würde schon noch kommen. An ihm sollte es nicht liegen. Er war nicht gerade als Langweiler bekannt.
»Allein schon das Bett ist ein Museumsstück«, pries er seinen Bunker an. »Andernorts muss man Eintritt bezahlen, um so etwas auch nur sehen zu dürfen.« Er legte ein Lächeln in seine Stimme, wie es die Radiomoderatoren machten. »Und wenn du im Museum versuchen würdest, dich ins Himmelbett der Prinzessin zu schummeln, würden sofort die Wärter angerannt kommen und weiß der Henker was mit dir anstellen.«
Ihr Schluchzen wurde immer hysterischer, aber Barry blieb auf Kurs. »Außerdem ist die Luft hier viel besser.« Er erklärte ihr, dass er mit eigenen Händen die elektronisch gesteuerte Umluftanlage installiert hatte, da es hier natürlich keine Fenster gab. »Denk doch mal nach, wir sind fast drei Meter unter der Erde.«
Er sah sie forschend an, bis sie den Rotz hochzog und halbherzig nickte.
Damit die Enden der Belüftungsrohre an der Erdoberfläche nicht auffielen, hatte er sie mit blickdichten Sträuchern getarnt. Aber das erwähnte er nicht, weil er fand, dass es defensiv klang. So als würde es ihn beunruhigen, dass irgendwer seinen Bunker unter der Erde entdecken könnte. Was natürlich nicht ganz falsch war, aber noch lange kein Grund, darauf herumzureiten.
Unangenehme Gedanken drückt man weg, alles andere ist mentale Masturbation. So sah Barry das jedenfalls.
1
Berlin, Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«, Besprechungsraum, Dienstag, 5. September, 07:30 Uhr
Sichtlich gut gelaunt eröffnete Professor Paul Herzfeld um Punkt halb acht die Frühbesprechung. Vor ihm lag ein Stapel mit Schnellheftern, auf dem sein Smartphone thronte, ein nagelneuer Blackberry von beeindruckenden Ausmaßen. Anders als gewöhnlich blieb Herzfeld neben seinem Stuhl am Kopfende des Konferenztischs stehen, als wollte er gleich eine Rede halten oder zu einem anderen Termin weitereilen.
Eher wohl Letzteres, dachte Dr. Fred Abel.
Dafür sprach auch, dass der Leiter der BKA-Einheit »Extremdelikte« im dunkelblauen Anzug mit Weste und Krawatte erschienen war. Den weißen Medizinerkittel hatte er offenbar nur der Form halber übergestreift und nicht einmal zugeknöpft. Als sein Stellvertreter war es Abel gewöhnt, bei Meetings genauso wie im Sektionssaal für seinen Chef einzuspringen. Herzfeld war ein weltweit renommierter Rechtsmediziner und entsprechend häufig zu Konferenzen oder Sondereinsätzen auf allen Kontinenten unterwegs.
»Spannende neue Fälle warten auf uns, meine Damen und Herren«, sagte Herzfeld. Seine Augen funkelten, seine tiefe, wohlklingende Stimme füllte den mausgrau möblierten Raum. Mit einer Körperlänge von gut einem Meter neunzig und der Physiognomie eines bekannten Hollywoodschauspielers war er eine imposante Erscheinung. Selbst der japanische Gastarzt Dr. Takahito Hayashi hing an seinen Lippen, obwohl er kaum Deutsch verstand.
»Verdacht auf Waterboarding im Regierungsviertel«, fuhr Herzfeld fort, »Dr. Horstmar von der Rechtsmedizin der Charité wird Sie gleich über die Faktenlage informieren.« Er nickte einem jungenhaft wirkenden Mann Mitte dreißig zu, der am hinteren Tischende saß und in einem blassrosa Schnellhefter blätterte. Abel meinte die Anspannung des Kollegen von der Charité förmlich spüren zu können.
Sie hatten sich in dem fensterlosen Besprechungsraum der Treptowers am Spreeufer versammelt, in dem die allmorgendliche Frühbesprechung mit allen Mitarbeitern ihrer Abteilung stattfand. Seinen Namen verdankte der Bürokomplex dem hundertfünfundzwanzig Meter hohen, glasummantelten Turm, der die ansonsten nüchtern-zweckmäßige Anlage im Südosten der deutschen Hauptstadt dominierte. Von der grandiosen Aussicht, die man von der Dachterrasse aus genießen konnte, hatten Abel und seine Kollegen allerdings wenig. Ihre rechtsmedizinische Sonderabteilung befand sich im zweiten Untergeschoss.
Obwohl es hier im Besprechungsraum eher kühl war, wies Horstmars hellblaues Hemd CD-große Schweißflecke unter den Achseln auf. Der Kollege ist voll auf Adrenalin, ging es Abel durch den Kopf. Horstmar schien seinen Blick zu spüren. Er blickte von seiner Akte auf und sah Abel durchdringend an.
Jagdfieber. Sein kriminalistischer Instinkt ist geweckt, dachte Abel und nickte ihm mit der Andeutung eines Lächelns zu. Er empfand spontane Sympathie für den rund zehn Jahre jüngeren Mann. Nur wenige Rechtsmediziner fühlten sich dazu berufen, als »Kommissar mit Knochensäge« aktiv an Ermittlungen teilzunehmen, und unter diesen Kollegen waren die raren Jobs in der BKA-Einheit »Extremdelikte« heiß begehrt. Abel selbst hatte vor vier Jahren Herzfelds Angebot angenommen und war rasch zu dessen Stellvertreter aufgestiegen, nachdem der vorherige Vize aus Altersgründen ausgeschieden war. Seit seinem ersten Tag in Herzfelds Abteilung war Abel überzeugt davon, seinen Traumjob gefunden zu haben.
»Und dann ist da noch ein weiterer mutmaßlicher Serienmörder.« Herzfeld hielt inne und überflog die erste Seite eines Schnellhefters, den er aus dem Stapel gezogen hatte.
»Eine aufmerksame junge Kollegin vom Brandenburgischen Landesinstitut«, fuhr er fort, »hat im Krematorium die gesetzlich vorgeschriebene Feuerbestattungs-Leichenschau bei einem angeblich an Leberversagen verstorbenen Mann vorgenommen und dabei eine sonderbare Entdeckung gemacht. Laut Totenschein litt der sechsundfünfzigjährige Immobilienmakler an Lebermetastasen bei unheilbarem Dickdarmkrebs. Die Kollegin wurde stutzig, als sie bei der äußeren Leichenschau keine gelbliche Verfärbung der Haut des Toten oder seiner Augenbindehäute feststellen konnte, wie wir es bei Lebermetastasen und der daraus resultierenden Gelbsucht erwarten würden. Im Gegenteil, seine Haut und seine Bindehäute waren lilienweiß, wie sich die Kollegin ausdrückt.«
Kurz sah er zu Dr. Murau hinüber, der die Lippen gespitzt hatte und anerkennend nickte. Murau war ein hervorragender Rechtsmediziner, aber fast noch eindrucksvoller war sein Repertoire an düsterer Poesie. Der Mittdreißiger mit dem dezenten Spitzbauch schien sämtliche Gedichte von Baudelaire und Gottfried Benn auswendig zu kennen. Da ihre Abteilung auf die Aufklärung besonders grausamer oder ungewöhnlicher Gewaltdelikte spezialisiert war, bekamen sie praktisch jeden Tag bizarr zugerichtete menschliche Überreste auf den Sektionstisch. Als typischer Wiener hatte Murau stets ein paar makabre Verse und eigene feinsinnige Bosheiten parat, die das vor ihnen ausgebreitete Schicksal auf den Punkt brachten.
»Dachte mir, dass Ihnen das Adjektiv gefällt«, kommentierte Herzfeld und ließ sein fanfarenartiges Lachen ertönen.
Er war in auffällig guter Stimmung. Abel versuchte, sich den zweifellos spektakulären Sonderauftrag vorzustellen, der Herzfeld in derart blendende Laune versetzte. Erst vor ein paar Tagen war Herzfeld ins Auswärtige Amt gerufen worden. Wie Abel am Rande mitbekommen hatte, waren bei dem eilends anberaumten Treffen neben dem Außenminister und dem Generalbundesanwalt auch die Bundesminister des Innern und der Verteidigung zugegen gewesen.
»Leider kann unsere Brandenburger Kollegin ihre Entdeckung nicht persönlich erläutern, da ihr ein anderer Termin dazwischengekommen ist«, fuhr Herzfeld fort. »Was vor allem, aber nicht ausschließlich aus fachlichen Gründen zu bedauern ist.«
Er ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, als hoffte er, die junge Rechtsmedizinerin doch noch unter den Anwesenden zu entdecken. Ähnlich wie sein Ebenbild in Hollywood galt er als Frauenschwarm und war gelegentlichen dezenten Flirts nicht abgeneigt. Allerdings war er seit Jahren in festen Händen und achtete ebenso wie Abel strikt darauf, Arbeits- und Liebesbeziehungen nicht zu vermischen. Das sonst drohende emotionale und hormonelle Gebräu war meist explosiv und nur mühsam wieder in seine Bestandteile aufzulösen.
»Stattdessen hat die Kollegin eine frische Einstichstelle in der linken Kniekehle des Toten entdeckt«, referierte Herzfeld weiter.
Abel verspürte gleichfalls einen Stich, allerdings nicht in der Kniekehle. Herzfelds Worte rührten etwas in seiner Erinnerung an.
»Der Einstich war im Randbereich dunkelrötlich unterblutet, muss dem Mann also kurz vor seinem Ableben zugefügt worden sein«, setzte Herzfeld hinzu. »Vor rund sechs Monaten hat es einen ähnlichen Fall gegeben, deshalb hat das BKA die Sache an sich gezogen und die Obduktion angeordnet. Bei dem ersten Toten handelt es sich um den Bauunternehmer Rainer Bunting. Im Rahmen der toxikologischen Untersuchung wurde ein Opioid russischer Herkunft im Blut des Toten gefunden. In beiden Fällen wurde der Totenschein von einem Internisten namens Dr. Harald Lenski ausgestellt. Lenski hat eine Praxis am Wandlitzsee im Norden Berlins. Laut unserer Datenbank ist er bislang weder straf- noch standesrechtlich auffällig geworden.«
Abel hatte Mühe, sich auf Herzfelds sonoren Redefluss zu konzentrieren. Der Name Lenski sagte ihm nichts. Aber er war sicher, dass er es irgendwann einmal mit einem Täter zu tun gehabt hatte, der seinem Opfer ein tödliches Gift in die Kniekehle injiziert hatte. Nur wer und wann das gewesen sein sollte, fiel ihm partout nicht ein.
»Einverstanden, Fred?«
Herzfeld legte dem neben ihm sitzenden Abel eine Hand auf die Schulter. Alle sahen ihn erwartungsvoll an.
»Sorry, ich war in Gedanken«, murmelte Abel. »Habe ich etwas verpasst?«
»Nichts Wesentliches«, versicherte ihm Herzfeld. »Ich habe dir nur gerade für heute Vormittag die Leitung der Abteilung übertragen, da ich direkt nach unserer Besprechung an einem weiteren Meeting im Auswärtigen Amt teilnehmen muss. Außerdem habe ich vorgeschlagen, dass du die Obduktion des mutmaßlichen Waterboarding-Opfers persönlich übernimmst. Der Fall könnte politisch hochbrisant werden.«
Abel nickte. »Sei unbesorgt, da bleibe ich dran«, sagte er absichtlich vage. Insgeheim hatte er bereits beschlossen, dass er den Toten mit dem mysteriösen Einstich in der Kniekehle sezieren würde. Doch das würde er seinem Chef unter vier Augen erklären, sobald er sich selbst über seine Beweggründe im Klaren war.
Um das mutmaßliche Waterboarding-Opfer konnte sich der altgediente Oberarzt Dr. Martin Scherz kümmern, der mit gewohnt griesgrämiger Miene zwischen Abel und der Assistenzärztin Dr. Sabine Yao saß, einer zierlichen Deutschchinesin mit dem Gesicht einer Porzellanpuppe. Allerdings musste Abel dann höllisch aufpassen, dass der grobschlächtige Oberarzt keine übereilten Schlussfolgerungen in sein Obduktionsprotokoll schrieb. Scherz war zwar einer der besten und erfahrensten Rechtsmediziner, mit denen Abel bisher zusammengearbeitet hatte, aber Menschenkenntnis schien der empathiefreie Eigenbrötler nur im Hinblick auf Tote zu besitzen. Was lebendige Individuen, ihre Motive und Handlungsweisen anging, neigte er zu haarsträubenden Fehleinschätzungen. Und Waterboarding war zweifellos ein brisantes Thema.
»Komm bitte gegen zwölf bei mir im Büro vorbei, Fred«, fügte Herzfeld hinzu. »Es geht um eine Kurzreise in den rauhen Osten unseres Kontinents, die wie für dich geschaffen ist.«
Wieder nickte Abel. »Bis zwölf dürften wir mit den Obduktionen durch sein.«
Er fing einen neidischen Blick von Horstmar auf. Doch mit seinen Gedanken war er immer noch auf der Suche nach dem ominösen Fall aus seiner Vergangenheit, bei dem ein in der Kniekehle versteckter Einstich eine Schlüsselrolle spielte.
»Dann erteile ich jetzt Dr. Horstmar das Wort.« Mit jovialem Lächeln wandte sich Herzfeld dem Rechtsmediziner von der Charité zu. »Bitte erklären Sie uns, was Sie zu der Hypothese veranlasst, dass es in einem Bundestagsgebäude zu Waterboarding mit tödlichem Ausgang gekommen sein könnte.«
2
Berlin, Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«, Besprechungsraum Dienstag, 5. September, 08:05 Uhr
Das ist Moah Aslewi«, sagte Horstmar, »ein kurdischer Türke, der als Putzmann im Berliner Abgeordnetenhaus gearbeitet hat.«
Hektisch klickte er auf der scheckkartengroßen Fernbedienung herum. Die Schweißflecke unter seinen Achseln hatten sich weiter ausgedehnt. Umso trockener war offenbar sein Mund. Vor Anspannung klang seine Stimme fast blechern.
Nach einigen Fehlversuchen beugte sich der Beamer seinem Willen, und auf der Leinwand erschien das Porträtfoto eines untersetzten Orientalen Anfang vierzig. Aslewi trug um den Hals ein Palästinensertuch und im Gesicht ein Lächeln, das in gewissem Widerspruch zu seinen zornig funkelnden Augen stand.
Horstmars Ehrgeiz ist noch größer, als ich dachte, sagte sich Abel. Anscheinend hatte der Kollege von der Charité den Inhalt der gesamten Fallakte als Powerpoint-Präsentation aufbereitet. Alle Achtung.
Die Kühlung des unter der Decke angebrachten Beamers gab allerdings ein nervtötendes Klappern von sich, so dass Horstmar nur mit Mühe zu verstehen war.
»Und so sah Aslewi aus, als ihn die Beamten vom Kriminaldauerdienst gefunden haben. In einem Kellerraum im Paul-Löbe-Haus, dem Abgeordnetenhaus im Regierungsviertel.« Horstmar drückte erneut auf die Fernbedienung. »Ich war mit der KT am Leichenfundort. Das hier sind Bilder von der noch unveränderten Auffindesituation des Toten.«
Auf der Leinwand war nun ein grell ausgeleuchteter Kellerraum zu sehen: verputzte Betonmauern, der Boden blanker Estrich, darauf Aslewi in Rückenlage mit freiem Oberkörper und einer blauen Arbeitshose. Er war schon längere Zeit tot, wie an den kräftig ausgeprägten Totenflecken unschwer zu erkennen war. Neben ihm lag ein zusammengeklappter Tapeziertisch, ansonsten war der Kellerraum leer. Aslewis Mund war weit geöffnet, als hätte er bis zum letzten Moment um Atemluft gekämpft.
In schneller Folge zeigte Horstmar weitere Fotos von Aslewis Armen, Beinen und Oberkörper in Übersichts- und Detailaufnahmen. Die rötlich bräunlichen Abschürfungen, die zirkulär um Hand- und Fußgelenke herumliefen, waren schon leicht mit Wundschorf verkrustet. Auch die halbkreisförmigen, rötlich dunkelvioletten Unterblutungen in der Haut seiner seitlichen Brustbereiche und der Flanken waren gut zu erkennen. Offenbar war er sitzend oder liegend gefesselt worden, mit einem Strick um den Oberkörper und zusätzlichen Fesseln um Hand- und Fußgelenke.
Die Nahaufnahmen seines Gesichts zeigten einen unauffälligen Mittvierziger mit dichtem, schwarzem Haar, ausgeprägten Augenbrauen und buschigem Schnauzbart. Umso auffälliger waren die rundlichen, rötlich violetten Hautverfärbungen im Kieferbereich, bei denen es sich zweifellos um Griffspuren von Fingerkuppen handelte. Anscheinend war Aslewis Mund gewaltsam offen gehalten worden. Befunde wie diesen kannte Abel von Fällen besonders brutaler Kindesmisshandlung, bei denen die Peiniger ihre Opfer zwangen, verdorbene oder viel zu scharfe Speisen und Flüssigkeiten zu essen.
Abel warf einen raschen Blick in die Runde. Die anwesenden Kollegen waren von Horstmars Ausführungen offenbar ebenso gebannt wie er selbst.
Nach einem weiteren Klick war Aslewis entkleideter Leichnam auf einem der Seziertische im Obduktionssaal der Charité zu sehen. Horstmar leckte sich die ausgedörrten Lippen und krächzte: »Der Verstorbene war mit zweiundvierzig Jahren noch relativ jung. Vorerkrankungen sind nicht bekannt, außerdem war die Tür des Kellers nicht verschlossen.«
Er griff erneut zur Fernbedienung. Auf der Leinwand erschienen, jeweils stark vergrößert, Fotografien des bereits sezierten Herzens und der Lunge.
»Ich habe gestern Abend die Sofortobduktion durchgeführt«, setzte Horstmar hinzu, »und dabei festgestellt, dass Aslewi nicht nur einen Herzinfarkt erlitten hat, wie Sie hier erkennen können.«
Er zeigte auf die großflächige Projektion, auf der sich der normalerweise gleichmäßig bräunliche Herzmuskel deutlich blasser als üblich und mit hellrötlichen Einblutungen darstellte.
»Der Mann hatte außerdem Wasser in der Lunge«, fuhr Horstmar fort. »Und ich rede hier nicht von Wasser, das wir bei einem herkömmlichen Lungenödem infolge von Herzversagen sehen. Es ist über die Luftröhre in die Lunge gelangt, wurde also von außen zugeführt, so als wäre er ertrunken. Und im Grunde ist er das wohl auch.«
Horstmar zeigte auf das Foto der beiden Lungenflügel, die in einer metallenen Schale separat auf dem Sektionstisch lagen. Sie waren unverkennbar klatschnass. Reichlich Flüssigkeit war aus den Bronchien herausgelaufen und hatte sich in der Schale angesammelt, so dass die Lungenflügel fast darin zu schwimmen schienen.
»Der Herzinfarkt war die Folge des Ertrinkens beziehungsweise einer massiven Stressreaktion des Körpers kurz vor seinem Tod«, fuhr Horstmar fort. »Aslewis Herz war bis dato völlig in Ordnung. Keine Koronarsklerose, nichts. Damit hätte er steinalt werden können. Herzinfarkt infolge Ertrinkens bei jemandem, der nicht aus dem Wasser geborgen wurde: Diese Kombination tritt, wie ich durch eigene Recherchen herausgefunden habe, häufig bei der Foltermethode auf, die als Waterboarding traurige Berühmtheit erlangt hat. Sie erinnern sich sicher an die Berichterstattung über den Abu-Ghureib-Folterskandal während der Besetzung des Irak durch die Vereinigten Staaten und an entsprechende Enthüllungen über die Behandlung der Gefangenen in Guantanamo Bay.«
Er zögerte einen Moment und gab sich dann sichtlich einen Ruck. »Die zuständigen Ermittler der Mordkommission haben außerdem herausgefunden, dass Aslewi in der Vergangenheit aktives Mitglied der kurdischen Hisbollah war«, fuhr er fort. »Aufgrund meines Obduktionsberichts hat Ihre Behörde die Ermittlungen an sich gezogen. Deshalb bin ich heute hier bei Ihnen. Soviel ich gehört habe, soll eine Sonderkommission gebildet werden, aber das ist hier im Haus sicherlich schon bekannt.«
Nach diesen Worten verstummte Horstmar und sah Herzfeld und Abel erwartungsvoll an. Sein Lampenfieber schien er überwunden zu haben, er wirkte nun stolz und selbstbewusst. Und begierig, von Herzfeld und Abel angemessen gewürdigt zu werden.
Eigene Recherchen, sieh an, dachte Abel. Der Kollege tat ihm leid, der arme Kerl verbrannte ja fast an seinem Ehrgeiz. Doch wenn er sich von ihnen mehr als ein lautstarkes Lob erhoffte, würden seine Wünsche zwangsläufig unerfüllt bleiben.
Herzfeld schien von den Ambitionen des Charité-Kollegen ohnehin nichts mitzubekommen. Er beendete eine E-Mail, die er nebenher auf seinem Smartphone geschrieben hatte, und nickte Horstmar mit zerstreutem Lächeln zu.
»Ausgezeichnete Arbeit, Herr Kollege«, lobte er. »Wir übernehmen also den Fall Aslewi hiermit offiziell von Ihnen. Dr. Abel wird den Toten nochmals obduzieren, um ganz sicherzugehen, dass Ihnen kein Irrtum unterlaufen ist. Herzlichen Dank. Sie haben uns mehr als genug von Ihrer kostbaren Zeit geopfert.«
Horstmars Gesicht wurde bei diesen Worten so grau wie die Blechschränke an der Wand hinter ihm.
Herzfeld blätterte in der Fallakte. »Hauptkommissarin Lubitz leitet die Ermittlungen«, verkündete er im Tonfall einer guten Nachricht. »Eine fähige und erfahrene Beamtin. Wenn etwas an dem Verdacht auf Waterboarding dran ist, wird sie es herausfinden.«
Er schob den Schnellhefter zu Abel hinüber und griff sich die nächste Akte vom Stapel. Horstmar sammelte seine Unterlagen ein und stopfte sie in seine Aktentasche.
»Mach doch mal einer den verdammten Apparat aus«, knurrte Scherz. Sein Doppelkinn unter dem grauen Fusselbart bebte vor Empörung, und auch Horstmars Hand bebte, als er ein letztes Mal nach der Fernbedienung griff. Er schaltete den Beamer aus, und das nervtötende Kühlungsgeräusch erstarb.
Mit gesenktem Kopf kam Horstmar um den Tisch herum und streckte Herzfeld die Hand hin. »Auf Wiedersehen, Herr Professor«, sagte er mit einer Stimme wie ein Verbannter. »Es war mir eine Ehre …«
»Ganz meinerseits. Und nochmals vielen Dank.«
Herzfeld erhob sich, Abel folgte seinem Beispiel. Mit seinen eins neunundachtzig Meter Körperlänge war auch er nicht gerade kleingewachsen, aber sein Vorgesetzter überragte ihn noch um mehrere Zentimeter. Sie schüttelten Horstmar die Hand. Der geradezu bettelnde Blick des Charité-Kollegen veranlasste Abel, ihn zur Tür zu bringen.
»Wenn in der Soko noch fachkundiger Beistand gebraucht wird …«, brachte Horstmar hervor.
»… werden wir an Sie denken«, versicherte ihm Abel so wahrheitsgemäß wie vieldeutig.
»Schließlich war ich es, der stichhaltige Beweise geliefert hat«, setzte Horstmar noch einen drauf.
Abel hörte ihm nur noch mit einem Ohr zu. Stichhaltig, dachte er, und seine Gedanken schweiften erneut zu dem Fall aus seiner Vergangenheit ab, in dem das Opfer durch Giftinjektion in die Kniekehle getötet worden war. Wann und wo hat sich das nur abgespielt?
In diesem Moment wurde an die Tür geklopft. Abel, der die Hand schon auf der Klinke hatte, öffnete, und die Sekretärin Renate Hübner erschien auf der Schwelle. Sie nickte Abel zu und marschierte mit den Bewegungen eines Roboters auf Herzfeld zu.
»Herr Direktor, das Auswärtige Amt.« Wie stets sprach sie so gleichförmig wie ein veraltetes Navigationsgerät. Auch ihr längliches Gesicht mit den ausgeprägten Schneidezähnen blieb reglos, während sie Herzfeld ein Mobiltelefon reichte.
Herzfeld schob das Smartphone in die rechte Innentasche seines maßgeschneiderten Jacketts. Mit der anderen Hand nahm er das Telefon von Frau Hübner in Empfang. »Guten Morgen, Frau Staatssekretärin. Bin schon unterwegs.«
3
Transnistrien, Dorfgasthaus in Piliptsche bei Tiraspol, vier Jahre zuvor
Dann sind wir uns also einig«, sagte Swirja und sah seinen Bruder durchdringend an.
Tjoma wollte seinem Blick ausweichen, aber Swirja zwang ihn, ihm in die Augen zu sehen. So war es immer schon gewesen, soweit Tjoma sich zurückerinnern konnte. Sein Bruder war gerade mal sechzehn Monate älter als er selbst, doch irgendwie war es Swirja gelungen, seine Vormachtstellung aus der Kindheit zu bewahren. Oder sogar noch auszubauen. Der große Swirja bestimmte, wo es langging. Und der kleine Tjoma gehorchte.
Dabei waren sie mittlerweile beide schon Anfang vierzig. Und sie besaßen rund fünfundzwanzig Millionen – Euro, wohlgemerkt, nicht etwa transnistrische Rubel. Doch auch wenn es um ihr gemeinsames Erbe ging, hatte Swirja die Zügel in der Hand.
»Okay?«, fragte er und warf Tjoma einen einschüchternden Blick zu.
Tjoma nickte widerwillig. Er traute diesem Vertrag nicht, den Swirja für sie beide aufgesetzt hatte. Aber noch weniger traute er sich, Zweifel zu äußern. Er war fast genauso groß gewachsen, breitschultrig und weizenblond wie sein Bruder. Aber wo auch immer sie sich zusammen blicken ließen, nahm sofort jeder an, dass Swirja der Chef war. Und Tjoma höchstens sein Vize.
Deshalb war es ursprünglich sogar Tjomas Idee gewesen, ihr Unternehmen aufzuteilen. Damit er nicht mehr ständig das Gefühl haben musste, von Swirja überrollt zu werden. Sein Bruder hatte den Plan allerdings so freudig aufgegriffen, dass es Tjoma unheimlich geworden war. Und Swirja war es auch, der vorgeschlagen hatte, sich wie Verschwörer hier im Gasthaus von Piliptsche zu treffen, einem entlegenen Dorf weit vor den Toren der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol. Ohne Augenzeugen und sogar ohne ihre Bodyguards, die ihnen sonst in der Öffentlichkeit nicht von der Seite wichen.
»Hier brauchen wir die Gorillas nicht«, hatte Swirja behauptet. »In Transnistrien haben wir keine Feinde mehr. Väterchen hat sie alle plattgemacht.«
Tjoma war sich da nicht so sicher. Dabei musste er zugeben, dass ihr »Väterchen« und sein genauso mächtiger Verbündeter Politik und Wirtschaft ihres Landes von allen erdenklichen Gegnern gesäubert hatten. Ganz zu schweigen von den diversen Verbrecherclans, die in den 1990er-Jahren praktisch die ganze Region unter ihrer Kontrolle hatten. Mittlerweile waren die Mitglieder dieser Syndikate entweder tot oder in alle Himmelsrichtungen zerstreut.
Trotzdem dürfen wir uns nicht zu sicher fühlen, dachte Tjoma.
Zu dieser frühen Nachmittagsstunde war außer ihnen niemand in der dämmrigen Schankstube – abgesehen von dem Wirt, einem krummbeinigen alten Mann, der mehr oder weniger taub war und starr wie eine Holzfigur hinter seinem Tresen saß. Draußen brannte die Augustsonne vom wolkenlosen Himmel, hier drinnen aber, unter der niedrigen Lehmdecke, war es so kühl, dass Tjoma fast fröstelte.
Swirja hob sein Glas und prostete ihm zu. Zögernd nahm auch Tjoma sein Glas auf und nippte von dem schweren Rotwein.
Sie hatten sich das Beste auftischen lassen, was die Küche der kleinen Landgaststätte hergab. Borschtsch mit Lammfleischstücken, dann geschmortes Kaninchen mit weißen und roten Bohnen, schließlich noch Turta dulce, den bessarabischen Kuchen aus Walnüssen, Honig und Mohn. Eigentlich waren es Tjomas Lieblingsspeisen, aber er hatte nur wenig gegessen und getrunken. Seit Monaten hatte er kaum mehr Appetit. Ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, der die Schüsseln und Platten fast im Alleingang geleert hatte.
»Dann fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir beide gleich unterschreiben werden«, sagte Swirja. »Nur damit es keine Missverständnisse gibt.«
Er blätterte in dem Vertrag, der in zwei Ausfertigungen vor ihm lag. Tjoma hätte sich nur ein wenig vorbeugen müssen, um eine Kopie des Schriftstücks auf dem schmierigen Holztisch zu sich herüberzuziehen. Aber sogar dafür fehlte es ihm an der nötigen Energie. So als hätte ihn seine Frau vor zwei Monaten nicht einfach nur verlassen, sondern auch noch alles mitgenommen, was er zum Weiterleben brauchte. Vor allem seine Selbstachtung und seinen Lebensmut. Von beidem hatte er sowieso nie allzu viel besessen, im Gegensatz zu Swirja, der seit jeher vor Selbstvertrauen strotzte.
»Wie wir beide wissen«, sagte Swirja, »will unser Väterchen unbedingt, dass wir das geerbte Kombinat zusammenhalten und gemeinsam leiten. Zwei Geschäftsführer, und keiner kann alleine irgendwas entscheiden. Aber ein Mischkonzern, der aus chemischer und optischer Industrie besteht, ergibt verdammt noch mal keinen Sinn. Außerdem geht es mir genauso wie dir auf den Sack, dass wir uns wegen jedem Scheiß abstimmen müssen. Das siehst du doch auch so, Tjoma?«
Wieder sah ihn Swirja drohend an, und wieder nickte Tjoma. Die wasserhellen Augen seines Bruders hatten seit jeher diese Macht über ihn. Manchmal dachte Tjoma, seine Rebellion müsste damit anfangen, dass er Swirja zwang, ihn mit seinem richtigen Namen anzureden. Als erwachsenen Mann eben, nicht als kleinen Jungen. »Tjoma« und »Swirja« waren kindliche Koseformen ihrer wirklichen Namen, auch das »Väterchen« war nicht ihr wirklicher Vater. Aber Swirja zu irgendetwas zwingen zu wollen, war ungefähr so aussichtsreich, wie wenn man versuchen würde, die Strömung des Dnestr umzukehren, dessen Flussbett sich von den Karpaten bis zum Schwarzen Meer erstreckte.
»Aus diesen Gründen haben wir beschlossen«, fuhr Swirja fort, »dass du ab sofort die Optiksparte leitest und ich die Kontrolle über den Chemiebereich übernehme. Nach außen bleibt alles, wie es ist; wir legen nur in unserem Vertrag fest, dass wir uns gegenseitig nicht in den Schampus pissen werden. Du wirst ab sofort alles gegenzeichnen, was ich dir aus meinem Bereich zur Unterschrift vorlege, und ich mache es umgekehrt genauso.«
Etwas störte Tjoma gewaltig an diesem Deal, und das waren bestimmt nicht nur die Flüche, mit denen Swirja jeden seiner Sätze würzte. Aber er hätte nicht sagen können, was an dem Vertrag oder ihrem Treffen hier faul war. Dem Anschein nach war die geplante Aufteilung fair und transparent. Swirja hatte ein Gutachten anfertigen lassen, aus dem hervorging, dass beide Unternehmensteile ungefähr gleich viel wert waren. Nach Einschätzung des renommierten Moskauer Sachverständigenbüros hatte die Optiksparte sogar die besseren Wachstumsperspektiven, so dass Tjoma aus der Aufteilung angeblich einen Vorteil ziehen würde.
»Wir unterschreiben also, ja?«, sagte Swirja und hielt schon seinen goldenen Füller in der Hand. Passend zu seiner Goldrolex und der goldenen Halskette.
Tjoma hätte es niemals über sich gebracht, so protzig wie Swirja aufzutreten, er trug immer nur Jeans, Polohemd und Sneakers. Sein Bruder aber hatte zu seinem maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug eine goldfarbene Krawatte umgebunden und eine daumenbreite, goldene Kette am linken Handgelenk. Er fuhr sogar einen goldfarbenen 7er-BMW, und jede seiner Exgeliebten bekam zum Abschied das gleiche Etui von ihm geschenkt, mit einem goldenen Ring darin und einer Halskette mit goldenem Medaillon. Er musste Unmengen dieser Etuis besitzen, denn sein Verschleiß an Geliebten war enorm. Es kam gar nicht so selten vor, dass Tjoma in einem der exklusiven Clubs in Tiraspol oder Moskau einer jungen Schönheit begegnete, die Swirjas Standardschmuck an der Hand und um den Hals trug. Einmal hatte ihm sein Bruder das Medaillon im Detail vorgeführt: ein kitschiges Herz, in dessen Innern ein stark geschöntes Porträtbild von Swirja unablösbar eingeklebt war.
Die Tinte glänzte noch feucht, als Swirja ihm die erste Vertragskopie mit seiner Unterschrift über den Tisch schob. »Hast wohl wieder nichts zu schreiben dabei?« Er grinste Tjoma an. »Warte, kriegst meinen.«
Er unterschrieb auch noch die zweite Ausfertigung, schob sie gleichfalls über den Tisch und legte mit großspuriger Geste seinen Füller obendrauf. »Ach, Tjoma, mein Kleiner, was wärst du ohne mich. Aber ab sofort musst du allein klarkommen.«
Sein selbstgefälliges Grinsen erstarb abrupt. Tjoma vollendete hastig seine Unterschrift, dann drehte er sich um und sah in die Richtung, in die Swirja mit finsterem Gesichtsausdruck starrte.
In der Tür stand ein bulliger Mann mit zurückgegeltem, schwarzem Haar. Er trug einen ausgebeulten grauen Anzug und hielt eine Glock-Automatikpistole in der Hand, die Mündung auf Swirjas Kopf gerichtet. Als er in die Gaststube trat, ächzten die durchgetretenen Dielen unter seinem Gewicht. Dichtauf folgten ihm zwei weitere Männer, beide mager wie Schakale, jeder mit einer AK-47 bewaffnet, besser bekannt als Kalaschnikow.
»Denkt nicht mal daran, in eure Taschen zu greifen!«, bellte der mit der Gelfrisur, offensichtlich der Anführer. »Seht zu, dass ihr eure Ärsche hochkriegt! Und ich will eure Pfoten sehen. Na, wird’s bald?«
Swirja und Tjoma wechselten einen Blick.
»Wenn die wüssten, wer wir sind, würden sie sich in die Hosen scheißen«, sagte Swirja leise.
Tjoma war sich da nicht so sicher, behielt aber seinen Einwand für sich. Der Anführer machte einem seiner Männer ein Zeichen. Der hängte sich die Kalaschnikow um, kam zu Swirja und Tjoma herüber und tastete sie blitzschnell ab.
»Die Ärsche sind sauber«, meldete er. Genau wie sein Kumpan, der seine Waffe weiter auf Tjoma und Swirja gerichtet hielt, trug er T-Shirt und Militärhose mit Camouflagemuster, dazu ausgelatschte Soldatenstiefel.
Vielleicht sind die beiden auch Brüder, ging es Tjoma durch den Kopf. Der Kerl, der sie abgetastet hatte, hatte ein schiefes Kinn, ansonsten sahen die beiden genau gleich aus. Mager, grauhäutig, mit schlechten Zähnen und schlammbraunen, dünnen Haaren, unter denen die Kopfhaut durchschimmerte.
»Schafft sie raus!«, befahl der Anführer. Mit einer barschen Geste zeigte er zur Küchentür weiter hinten im Schankraum. An seiner linken Hand blitzte ein breiter Silberring auf.
Jeder die Mündung einer AK-47 zwischen den Schulterblättern, wurden Swirja und Tjoma unsanft durch die Hintertür nach draußen bugsiert. Von dem Wirt war nichts mehr zu sehen, anscheinend hatte er sich auf seinen krummen Beinen davongestohlen.
Sie verstecken ihre Gesichter nicht vor uns, ging es Tjoma durch den Kopf. Entweder wissen sie wirklich nicht, wer wir sind, oder es ist ihnen egal. Weil sie den Auftrag haben, uns kaltzumachen.
Ein russischer Kleintransporter vom Typ GAZ-66 wartete mit laufendem Motor im Hof.
»Die wollen uns umbringen!«, flüsterte Tjoma seinem Bruder zu.
»Maul halten!«, bellte der Anführer. In seinem unförmigen grauen Anzug sah er wie ein x-beliebiger mittlerer Beamter der Russischen Föderation aus. Doch seine bullige Gestalt und der stählerne Blick strahlten brutale Entschlossenheit aus.
»Wir sind …«, stieß Tjoma hervor, weiter kam er nicht.
Der Kolben einer Kalaschnikow krachte ihm auf den Hinterkopf. Benommen stöhnte er auf und verstummte.
»Ich sag’s nicht zwei Mal«, fuhr sie der Anführer an. »Wir wissen, wer ihr seid. Wir haben den Auftrag, euch hier einzusammeln, und ihr habt keine Chance, uns daran zu hindern. Ihr könnt euch nur aussuchen, ob wir vorher die Scheiße aus euren Kadavern prügeln sollen oder ob ihr euren Bestimmungsort einigermaßen am Stück erreichen wollt.«
Der Typ mit dem schiefen Kinn stieß ein irres Gelächter aus, und sein Chef grinste ihn an. Ein Packen nachlässig zusammengefalteter Papiere lugte aus einer seiner Jacketttaschen hervor.
Tjoma überlegte unwillkürlich, ob es sein Vertrag mit Swirja war. Aber das ergab nicht den geringsten Sinn.
»Noch Fragen, ihr Arschgesichter?«
Swirja schüttelte den Kopf. »Ihr beschissenen Idioten seid schon tot«, sagte er, und seine Stimme klang wieder so fest und selbstbewusst wie gewöhnlich. »Ihr wisst es nur noch nicht.«
Einer der Männer trat dicht vor ihn und spuckte ihm ins Gesicht. Als Swirja reflexartig den Arm hob, schlug ihn der Mann mit dem Gewehrkolben seitlich gegen den Kopf. Swirja begann zu fluchen, verstummte aber gleich wieder. Mit ungläubiger Miene starrte er auf seine Hand, mit der er sich über die Schläfe getastet hatte. Sie war blutverschmiert.
Auch Tjoma fühlte sich noch benommen. Warum ist Swirja so fassungslos?, überlegte er dumpf. Er sieht aus, als könnte er einfach nicht begreifen, was hier mit uns passiert.
»Fesseln, na los!«, schnauzte der Anführer und riss die Hecktür des Militärtransporters auf. »Du übernimmst den da, Vadik, du den anderen, Vitali!«
Vitali, der Kerl mit dem geraden Kinn, zog zwei armlange Stücke Kabelbinder aus dem Laderaum. Vadik zerrte erst Swirja, dann Tjoma die Hände auf den Rücken, und Vitali schlang ihnen Kabelbinder um die Handgelenke und zurrte sie brutal zusammen. Tjomas Hände fühlten sich fast sofort taub an.
Sie stießen Swirja und Tjoma in den Laderaum. Dann folgten sie ihren Gefangenen und befahlen ihnen, sich auf eine der Seitenbänke zu setzen. Sie selbst ließen sich auf die Bank gegenüber fallen, wobei sie die Waffen weiter auf Swirja und Tjoma gerichtet hielten.
Der Anführer schlug die Hecktür zu. Tjoma hörte, wie vorn die Beifahrertür aufgerissen und wieder zugeknallt wurde. Sehen konnte er nicht, was draußen vorging, da der Transporter nur an den Seitenwänden weit oben über kleine Fenster verfügte.
»Los geht’s!«, brüllte der Anführer.
»Zu Befehl, Porutschik!« Der Fahrer legte krachend einen Gang ein, dann setzte sich der Transporter mit charakteristischem Motorbrüllen in Bewegung.
»Hilfe!«, schrie Tjoma, so laut er konnte. »Wir werden entführt!«
Er trampelte auf das Bodenblech des Transporters. Dabei war eigentlich klar, dass niemand da draußen ihn hören konnte. Die unverwüstlichen Kleinlastwagen vom Typ GAZ-66 wurden seit zwanzig Jahren nicht mehr hergestellt, waren im Straßenbild von Transnistrien jedoch nach wie vor allgegenwärtig. Auch Tjoma besaß so einen dunkelgrün lackierten Sechstonner mit einem verblassten roten Stern über der Windschutzscheibe. Manchmal fuhr er damit stundenlang durchs Gelände, um seinen Kopf frei zu bekommen. Die Maschine dröhnte und rasselte so ohrenbetäubend, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand.
Vadik und Vitali feixten. Tjoma schrie und stampfte unbeirrt weiter, auch als Swirja eine Handbewegung machte, als wollte er sagen: Jetzt komm mal runter, das kriegen wir schon hin.
Sehr viele Gelegenheiten zur Rebellion – gegen seinen Bruder oder wen auch immer – würde er nicht mehr bekommen, das war Tjoma absolut klar.
4
Transnistrien, heruntergekommenes Fabrikgebäude, vier Jahre zuvor
Der Fahrer stieg so brutal auf die Bremse, dass Tjoma gegen seinen Bruder geschleudert wurde.
»Hör endlich auf, rumzuschreien!«, fuhr Swirja ihn an.
Tjoma bekam es kaum mit. Er war längst heiser, seine Kehle brannte. Aber er schrie unermüdlich. »Hilfe! Ist da draußen jemand? Wir sind entführt worden! Holt uns hier raus!«
Wieder und wieder trampelte er mit beiden Füßen auf den Blechboden des Transporters. Vadik Schiefkinn und sein Kumpan Vitali schenkten ihm keine Beachtung. Der Einzige weit und breit, der auf Tjomas Geschrei zu reagieren schien, war Swirja.
Im Schneckentempo krochen sie nun über rissigen Untergrund, der mit Schlaglöchern gespickt war. Mit ihren auf dem Rücken gefesselten Händen konnten sich Swirja und Tjoma nirgendwo festhalten und hatten die größte Mühe, das Gleichgewicht zu bewahren. Der GAZ-66 schaukelte hin und her wie eine Jolle bei Windstärke 10.
Als der Fahrer erneut auf die Bremse trat und gleichzeitig das Steuer nach links herumriss, fiel Swirja von der Bank und knallte mit dem Gesicht voran auf den rostigen Blechboden. Er hob den Kopf und sah Tjoma an. Durch den Aufprall war seine Stirn aufgeplatzt, aus der etwa zwei Zentimeter langen Wunde quoll Blut. An der linken Schläfe hatte er eine gewaltige Beule, und bis zum Ohr hinab waren seine Haare blutverkrustet. Er sah grotesk aus, wie ein durchgedrehter Clown, der sich wahllos mit roter Farbe geschminkt hat.
Mehr als das viele Blut beunruhigte Tjoma aber Swirjas Gesichtsausdruck.
Swirja sieht immer noch aus, als könnte er einfach nicht kapieren, was hier abgeht. Aber er ist doch sonst nicht so begriffsstutzig, dachte Tjoma. Er hat geglaubt, dass niemand wagen würde, uns anzugreifen. Und da hat er offenkundig falschgelegen. Was ist daran so schwer zu verstehen?
Während sich Swirja stöhnend und fluchend aufzurappeln versuchte, wurde die Hecktür aufgerissen. Tjoma blinzelte in das helle Rechteck und erkannte den Anführer mit dem ausgebeulten grauen Anzug. Der breite Silberring an seiner linken Hand blitzte im Sonnenlicht. Vorhin hatte der Fahrer ihn Porutschik genannt, Leutnant. Tjoma fragte sich, ob es nur ein Spitzname oder tatsächlich sein Dienstrang war – bei der Armee oder wo auch immer.
Der bullige Porutschik beugte sich in den Laderaum, schnappte Swirja bei den Fußknöcheln und zerrte ihn mit dem Gesicht nach unten über das Bodenblech.
»Verdammte Scheiße, dafür reiß ich dir die Eier ab!« Swirjas Stimme klang brüchig und schmerzverzerrt.
Der Porutschik packte ihn bei den gefesselten Armen und zerrte ihn brutal nach draußen.
»Du verschissenes Arschloch!«, schrie Swirja. Er trat nach seinem Peiniger, aber der machte einen Schritt zur Seite. Swirja fiel zappelnd über die Ladekante und schlug auf dem Asphaltboden auf.
Vadik fuchtelte mit der Kalaschnikow. »Na los, nicht so schüchtern!«, fuhr er Tjoma an. »Raus mit dir. Jetzt geht die Party erst richtig los!«
Tjoma rappelte sich auf. Vadik Schiefkinn war allem Anschein nach ein irrer Sadist mit dem IQ einer Kanalratte. Als Tjoma vorgebeugt in der Hecktür stand, um nach draußen zu klettern, trat ihm Vadik mit voller Kraft in den Rücken, so dass er wie ein aufschnellendes Klappmesser nach draußen flog. Dabei knallte er mit dem Kopf gegen den Türrahmen, und stechender Schmerz durchbohrte ihm den Schädel. Mit der Schulter voran krachte er auf den Asphaltboden. Blut rann ihm aus den Haaren und tropfte in seine Augen. Er blinzelte heftig, konnte aber die Augen nicht freibekommen, da seine Hände auf dem Rücken gefesselt waren.
»Sie bringen uns um!«, schrie Tjoma wieder.
Mit Hieben und Tritten wurden Swirja und er auf eine Fabrikruine zugetrieben, die sich hinter wild wucherndem Gestrüpp und Bergen von undefinierbarem Unrat erhob. Der Boden war mit Löchern und Steinbrocken übersät, so dass Tjoma fast bei jedem Schritt ins Stolpern kam. »Wenn sie nur Lösegeld wollten, würden sie Masken tragen! Jetzt sag doch auch mal was, Swirja! Was sollen wir tun?«
Fluchend ging Swirja neben ihm zu Boden. Der Porutschik riss ihn an den gefesselten Armen wieder hoch, und Swirja schrie vor Schmerzen auf. »Halt einfach das Maul, Tjoma!«, stieß er keuchend hervor. »Wann kapierst du endlich, was hier abläuft?«
Bisher hatte Tjoma geglaubt, dass es Swirja war, der nicht kapieren wollte, in welchen Schlamassel sie geraten waren. Oder konnte es sein, dass ihm, Tjoma, etwas Wesentliches entgangen war?
Jedenfalls hielt er jetzt tatsächlich den Mund, wenn auch mehr aus Erschöpfung. Er konnte seine Hände nicht mehr spüren, umso heftiger schmerzten ihm Kopf und Rücken. Alles um ihn herum war wie in roten Nebel getaucht.
Aus den blutigen Schwaden schälte sich ein rostiges Rolltor in einer zerbröckelnden Betonmauer heraus. Das Tor war gerade so weit hochgefahren, dass ein erwachsener Mann von durchschnittlicher Größe darunter hindurchgehen konnte. Swirja und Tjoma mussten den Kopf einziehen. Als sich Tjoma im Gehen umdrehte, sah er, dass nur noch der Porutschik und Vadik hinter ihnen waren. Für einen Moment kamen ihm die beiden unwirklich vor, wie Charaktere aus einem Ego-Shooter-Spiel.
Vitali war anscheinend bei dem Transporter zurückgeblieben, um zusammen mit dem Fahrer Wache zu schieben. Dabei machte das Areal den Eindruck, als hätte sich in den letzten zwanzig Jahren kein Mensch mehr hierher verirrt.
Tjoma schüttelte so heftig den Kopf, dass Blut umherspritzte. Einen Moment lang konnte er einigermaßen klar sehen. Sie befanden sich in einer gigantischen Fabrikhalle, die mit endlosen Reihen verrosteter Maschinen vollgestellt war. Durch die schmalen, verdreckten Fenster drang nur wenig Tageslicht herein. Doch Tjoma erkannte Drehbänke und Fräsmaschinen, von älterer Bauart und offenbar seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb. Alles war mit Staub und Spinnweben überzogen.
Eine feinmechanische Fabrik aus Sowjetzeiten, dachte er.
Weiter hinten in der Halle bemerkte er einen kräftig gebauten Mann mit kahlem Kopf, der einen fast knöchellangen schwarzen Ledermantel trug. Er lehnte an einer Säule neben einem hellblauen Metallcontainer, die Arme vor der breiten Brust verschränkt.
Mit seinen blutverkrusteten Augen konnte Tjoma die Gesichtszüge des Kahlköpfigen nicht genau erkennen. Trotzdem kam ihm der Mann bekannt vor.
Er wandte den Kopf zur Seite. Swirja hatte das Kinn vorgeschoben und starrte den Glatzkopf im Ledermantel an. Offenbar kochte Swirja vor Zorn.
Angespannt beobachtete ihn Tjoma, und plötzlich durchzuckte ihn die Erkenntnis: Swirja wollte mich ans Messer liefern! Und jetzt ist er so außer sich, weil er genauso wie ich über die Klinge springen soll!
Ergab das irgendeinen Sinn? Tjoma konnte ihn nicht benennen und noch weniger mit Händen greifen. Aber er fühlte, dass er auf der richtigen Spur war.
Auf der Spur deines Verrats, Brüderchen.
Da bekam er einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf. Eben noch sah er, wie Swirja neben ihm gleichfalls zu Boden ging, dann wurde alles schwarz.
5
Berlin, Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«, Sektionssaal, Dienstag, 5. September, 09:45 Uhr
Im Sektionssaal schlug Abel der säuerliche Geruch von aufgeschnittenen Mägen entgegen. Bei Laien riefen die Gerüche, die den Leichen in vielerlei Nuancen entströmten, meist nur Ekel bis hin zum Erbrechen hervor. Erfahrene Rechtsmediziner dagegen lasen aus diesem Alphabet der Totendüfte oftmals wichtige Botschaften heraus, sei es ein Nierenversagen mit seinem stechenden, ammoniakartigen Geruch oder auch ein entgleister Diabetes mit den süßlichen Duftschwaden, die den aufgeschnittenen Organen entströmten und an überreifes Obst erinnerten.
Der Zustrom an Leichen war unerschöpflich. Im Sektionssaal gab es vier Seziertische, und nicht selten wurde an allen Arbeitsplätzen gleichzeitig seziert. An diesem Vormittag blieb allerdings einer der blitzenden Edelstahltische unbesetzt. Professor Herzfeld konferierte mit der Bundesregierung, und Murau musste als Sachverständiger in einem Mordprozess Rede und Antwort stehen.
Die Sektionsassistenten schoben die Toten des Tages auf Leichenmulden herein, speziellen Hubwagen, die zum Transport der Leichen von den Kühlfächern zu den Sektionstischen und zurück eingesetzt wurden. Sie legten jeden Körper auf einen der blanken Edelstahltische. Zuvor waren die Leichen nacheinander in den Computertomographen geschoben worden, um festzustellen, ob ihre Knochenstruktur verborgene Brüche aufwies oder sich irgendwo in den Körpern metallische Objekte befanden, beispielsweise Projektile oder die Spitzen abgebrochener Injektionsnadeln. Seit Herzfeld die Anschaffung des kostspieligen Apparats durchgesetzt hatte, hatten sie in den Körpern der Toten schon die unglaublichsten Gegenstände geortet, von verschluckten Schlüsseln über medizinische Instrumente, die bei Operationen vergessen worden waren, bis hin zu abgebrochenen Messerklingen.
»Dr. Scherz, Sie übernehmen bitte Aslewi.« Abel deutete auf den kurdischstämmigen Putzmann, der jetzt in Rückenlage auf einem der Seziertische lag und von den Schlüsselbeinen bis zum Schambein eine feine Y-förmige Naht aufwies – die Handschrift des Charité-Kollegen Horstmar, der Aslewi am Vortag bereits obduziert hatte.
Scherz machte ein überraschtes Gesicht. »Wenn ich den Chef nicht ganz falsch verstanden habe, sollten Sie persönlich …« Er unterbrach sich mitten im Satz, und sein Gesicht nahm wieder den gewohnt griesgrämigen Ausdruck an. »Ich nehm’s, wie’s kommt«, sagte er. »Und meistens kommt es knüppeldick.«
Abel war versucht, ihm ein paar gute Ratschläge mitzugeben, doch er enthielt sich jeglichen Kommentars. Scherz würde sein wie immer untadeliges rechtsmedizinisches Gutachten mit einigen haarsträubenden kriminalistischen oder gar politischen Schlussfolgerungen würzen, und Abel würde die absurdesten Sätze wie immer herausstreichen. Anschließend wäre Scherz eingeschnappt und folglich noch übellauniger als sonst, aber das überarbeitete Gutachten würde er anstandslos unterschreiben. Abel würde es gegenzeichnen, und weder er noch Scherz würden jemals wieder auf das Thema zurückkommen.
Dieses Muster hatte sich bei der Zusammenarbeit mit dem so begabten wie weltfremden Kollegen bewährt – nur musste Abel im konkreten Fall noch mehr als sonst auf der Hut sein. Ein offizielles BKA-Gutachten, in dem etwa die CIA bezichtigt wurde, in einem deutschen Parlamentsgebäude zu foltern und zu morden, konnte diplomatische Verwicklungen hervorrufen, die sich Abel lieber nicht ausmalen wollte.
Doch er würde es riskieren müssen, denn er selbst würde nicht das mutmaßliche Waterboarding-Opfer, sondern den Mann obduzieren, der angeblich an Lebermetastasen verstorben war. Abel spürte immer deutlicher, dass sich hinter dem unscheinbaren Injektionseinstich in der Kniekehle des Immobilienmaklers etwas sehr viel Größeres verbarg. Und sein Bauchgefühl führte ihn nur selten in die Irre.
»Ich übernehme den mutmaßlich falsch ausgestellten Totenschein«, sagte Abel.
Sie machten sich ans Werk. Jedem Obduzenten stand ein Assistent zur Seite. Wie das gesamte Team hatte auch Abel seine Privatkleidung gegen die übliche Arbeitsmontur eingetauscht: kurzärmliges Oberteil und lange Hose aus blauem Baumwollstoff, dazu Gummistiefel und Schürze.
Scherz scheuchte den Sektionsassistenten beiseite und beugte sich über den toten Körper, um dessen äußeren Zustand zu begutachten.
»Der nicht besonders sauber vernähte Y-Schnitt von den Schlüsselbeinen bis zum Schambein rührt von der seitens der Charité erfolgten ersten Obduktion her«, sprach er in das Diktiergerät, das über seinem Seziertisch angebracht war. »Darüber hinaus weisen die obere und untere Extremität sowie die Körpervorderseite mehrere Verletzungen auf: zirkumferente Abschürfungen und Hautunterblutungen an Hand- und Fußgelenken sowie um den Brustkorb, die vermutlich von eng sitzenden Fesselungen herrühren; außerdem kräftig ausgeprägte Hämatome, entsprechend Finger-Griffspuren, jeweils seitlich der Mundwinkel im Wangenbereich. Diese Hämatome sind nicht post mortem entstanden, sie wurden dem Mann kurz vor seinem Tode zugefügt.«
Scherz öffnete den Mund des Toten und klappte nacheinander Ober- und Unterlippe hoch, so dass er Mundschleimhaut und Zahnfleisch genau betrachten konnte.
»Die Abdrücke der Finger, die sich schraubstockartig um den Unterkiefer gelegt haben müssen, zeichnen sich noch deutlich ab. Offenbar haben der oder die Täter Aslewis Mund mit Gewalt geöffnet – ein Indiz für Waterboarding, wie es typischerweise von US-Geheimdiensten, vor allem der CIA, angewendet wird.«
Während Abel am Seziertisch nebenan den Immobilienmakler Dominik Kreisler obduzierte, hörte er mit einem Ohr mit, was Scherz in sein Diktiergerät raunzte. Als der Oberarzt die CIA erwähnte, zuckte Abel zusammen. In der Sache stimmte er Scherz durchaus zu: Das als Waterboarding bekannt gewordene simulierte Ertränken war eine Foltermethode, die von US-Geheimdienstexperten als Instrument im Kampf gegen den islamistischen Terror perfektioniert worden war. Also lag es durchaus nahe, auch in diesem Fall den oder die Täter im US-Geheimdienstmilieu zu vermuten. Nur stimmte das Bild, das sich auf den ersten Blick bot, keineswegs immer – oder sogar eher selten – mit dem tatsächlich Geschehenen überein. Doch für den einsiedlerisch lebenden Oberarzt waren Schein und Sein meist ein und dasselbe.
Wortlos nahm Scherz seinem Assistenten das bereitgehaltene Skalpell ab, um die Körpervorderseite von Moah Aslewi ein zweites Mal zu öffnen. Mit einem einzigen schnellen, von der Kinnspitze zum Schambereich gezogenen Skalpellschnitt durchtrennte er die von Horstmar angebrachte Naht. Die beiden großen Hautlappen klappten auseinander, wodurch die Bauch- und Brustorgane des Toten zugänglich wurden.
Abel beobachtete ihn noch einige Momente lang aus den Augenwinkeln. Mit einem unguten Vorgefühl, was Scherz’ mögliche Eskapaden in der Leichensache Aslewi anging, wandte er seine Aufmerksamkeit schließlich dem verstorbenen Immobilienmakler zu.
6
Transnistrien, heruntergekommene Fabrikhalle, vier Jahre zuvor
Rasselnde Ketten rissen Tjoma aus seiner Betäubung. Er wollte die Augen öffnen, aber sie waren so verklebt, dass er die Lider nicht heben konnte. Er lag auf einem rauhen, unebenen Untergrund und konnte jede kleine Delle, jeden Riss im Boden deutlich spüren.
Ich bin nackt, dachte er benommen, bis auf die Unterhose. Was ist hier los?
Seine Hände waren immer noch gefesselt, aber nicht mehr hinter seinem Rücken. Er lag der Länge nach auf dem Bauch, die Arme nach oben ausgestreckt wie ein Schwimmer vor dem Kopfsprung. Auch seine Fußknöchel waren mit Kabelbindern eng zusammengezurrt.
Plötzlich spürte er einen schmerzhaften Ruck in den Handgelenken. Wieder rasselten Ketten, eine Winde quietschte wie bei einem altertümlichen Flaschenzug.
Ohne sein Zutun wurde Tjoma an den Händen emporgezogen, bis er auf den Füßen stand, die Arme senkrecht emporgereckt.
Die Ketten rasselten noch immer. Millimeterweise wurde er weiter hochgezogen, schließlich berührte er nur noch mit den Fußzehen den Boden. Dann erstarb das Rasseln und Quietschen, und Tjoma stand zitternd da und wartete, was als Nächstes passieren würde.
Ein kalter, metallischer Gegenstand strich an seiner linken Flanke entlang, bis hoch in den Brustbereich.
»Der Dreckskerl hat sich total zugerotzt«, sagte der Porutschik, »der sieht gar nichts mehr. Polier ihm die Fresse, Vadik, sonst verpasst er seine eigene Abschiedsshow!«
Vadik schrubbte Tjoma mit einem rauhen Tuchfetzen über die Augen. Es fühlte sich an, als würden ihm Lider und Brauen weggeschmirgelt, aber danach konnte er zumindest wieder sehen.
Allerdings wünschte er sich sofort, wieder blind zu sein. Und taub und vollkommen gefühllos.
Er war tatsächlich nackt bis auf seine Boxershorts. Seine und Swirjas Kleidungsstücke lagen zusammengeknüllt neben dem Metallcontainer. Vadik stand so dicht vor ihm, dass Tjoma seinen säuerlichen Atem roch. Sein nach links verdrehtes Kinn sah aus dieser Nähe noch grotesker aus, wie bei einer Comicfigur. In der Rechten hielt Vadik eine überdimensionale Kneifzange, die er zügig einer von Tjomas Brustwarzen näherte.
Swirja stand zwei Schritte neben Tjoma, gleichfalls mit emporgereckten Armen an eine Kette gefesselt, die von der Hallendecke herabhing. Eine zweite Kette verband, genau wie bei Tjoma, die Fußfesseln mit einem Eisenring im Boden. Sein Bruder zitterte vor Anstrengung, sein Körpergewicht auf den Fußzehen zu balancieren, und höchstwahrscheinlich auch vor Schock. Swirjas Gesicht war unnatürlich bleich, jedenfalls dort, wo es nicht mit Blut verschmiert war, und glänzte vor angetrocknetem Schweiß. Er sah starr vor sich hin und schien seiner Umgebung keine Beachtung zu schenken.
»Swirja«, brachte Tjoma röchelnd hervor.
Er erschrak vor seiner eigenen Stimme. Swirja zeigte keine Reaktion. Vor ihm stand der Porutschik, eine unterarmlange Kneifzange in der Hand.
»Wir spielen ein kleines Spiel«, sagte er. »Die Regeln sind so einfach, dass sogar Spatzenhirne wie ihr sie begreifen könnt. Als Erstes kneift Vadik deinem Bruder einen Nippel ab, und du frisst ihn auf. Dann kriegt dein Bruder einen Nippel von dir zu fressen. Anschließend kommen eure Fußzehen dran. Aber die braucht ihr nicht roh zu fressen, wir kochen für euch ein Gulasch draus. Und obwohl die Zehenabschnippelei bestimmt scheißwehtut, werdet ihr euch wünschen, dass sie niemals aufhört. Denn als Nächstes kommen wir zu noch sehr viel empfindlicheren Körperteilen.«
Er ließ die scharf gezähnten Backen der Zange klackend auf- und zuschnappen.
Swirja senkte den Kopf, um den »Leutnant« nicht ansehen zu müssen. Aber der Mann mit dem grauen Anzug drückte ihm die Zange unters Kinn und zwang ihn, seinen Blick zu erwidern.
»Noch Fragen?«, wiederholte er.
Swirja zitterte am ganzen Leib. »Schaff euren General her!«, brachte er hervor. »Mit unteren Chargen wie dir rede ich nicht. Du wirst in einem Kellerloch verschimmeln, wenn der General erfährt, was du hier für eine Scheiße machst!«
»Was für ein General? Keine Ahnung, wovon du redest, Sackgesicht.«
Swirja zog geräuschvoll den Rotz in der Nase hoch und wollte den Porutschik offenbar anspucken. Aber der schlug ihm mit einer lässigen Bewegung die Zange ins Gesicht, und Swirja verschluckte sich an seiner eigenen Rotze.
»Vorhin war er hier«, stieß Swirja schließlich keuchend hervor. »Also rede keinen Scheiß, sondern hol Burkjanov her!«
Burkjanov!, durchfuhr es Tjoma. Deshalb war ihm der Mann im Ledermantel so bekannt vorgekommen! Natürlich, dachte er, das muss Burkjanov gewesen sein, den alle den »General« nennen!
Tjoma hatte ihn nur selten aus der Nähe zu sehen bekommen. Burkjanov ging zwar in Väterchens Haus ein und aus, aber er war immer durch jede Menge Bodyguards und Wichtigtuer abgeschirmt. Außerdem hielt sich niemand gern in seiner Nähe auf, wenn er es vermeiden konnte. Der Mann hatte Augen wie Brunnenlöcher und die Aura eines KZ-Kommandanten.
»Schluss jetzt mit dem Schwachsinn.« Der Porutschik stieß einen Grunzton aus und schnipste mit der Hand in Vadiks Richtung. »Los geht’s!«
Er klang fast gelangweilt, ganz im Gegensatz zu seinem Gefolgsmann, dessen Augen noch irrer zu funkeln begannen.
»Du machst nur, was ich dir sage, Vadik.« Der Porutschik beobachtete ihn so aufmerksam wie eine Bombe, die jeden Moment hochgehen konnte. »Erst die Nippel!«, kommandierte er.
Tjoma hatte die Augen geschlossen. Er zitterte unkontrollierbar.
Swirja, bitte!, wollte er flehen. Mach was, damit diese Typen uns laufen lassen! Du hast uns hier schließlich reingeritten!
Aber Tjoma hatte die Gewalt über seinen Körper verloren. Er brachte kein Wort hervor, nur ein unartikuliertes Winseln, das ihn noch mehr schockierte.
Vadik setzte die gezähnten Backen der Zange an Tjomas linker Brustwarze an und kniff zu.
7
Berlin, Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«, Sektionssaal, Dienstag, 5. September, 10:10 Uhr
Auf dem Sektionstisch vor Abel lag der entkleidete Leichnam eines mittelgroßen Mannes, der zu Lebzeiten offenbar einiges für seine Fitness getan hatte. Dominik Kreisler war schlank und wies nur wenig Unterhautfettgewebe auf. Seine Muskeln waren für einen Sechsundfünfzigjährigen bemerkenswert gut trainiert. Laut Totenschein hätte der Immobilienmakler ein körperliches Wrack sein müssen, ausgezehrt und gelbhäutig. Die Verdauungsfunktion seines Darms hätte durch den angeblichen Darmkrebs eigentlich stark eingeschränkt sein müssen und die vermeintlich von Metastasen befallene Leber außerstande, den gelblich grünlichen Gallefarbstoff abzubauen, was zwangsläufig zu der für eine solche schwere Erkrankung typischen Gelbsucht führte.
Toter und Totenschein passten so wenig zusammen, dass Abel unter anderen Umständen eine Leichenverwechslung vermutet hätte. Aber ein Irrtum war ausgeschlossen, obwohl auf dem Totenschein klar und deutlich vermerkt war:
Unmittelbare Todesursache
Leberversagen
Dies ist eine Folge von
Lebermetastasen
Hierfür ursächliches Grundleiden
Fortgeschrittenes Dickdarmkarzinom, inkurabel
Todesart
Natürlicher Tod
Die äußere Leichenschau brachte keine Hinweise auf eine mögliche Todesursache. Der Tote wies keine sichtbaren frischen oder älteren Verletzungen auf, weder Hämatome an Händen oder Unterarmen, wie sie typischerweise bei Abwehr eines Angreifers entstanden, noch Narben, die von früheren Unfällen oder länger zurückliegenden Operationen gezeugt hätten. Die Leichenstarre hatte sich bereits wieder gelöst, da der Tod des Mannes schon vor über einer Woche eingetreten war.
Zusammen mit der Assistentin Britta Gerlach drehte Abel den Toten auf den Bauch. Die kräftig ausgeprägten Leichenflecke auf der Körperrückseite waren hinsichtlich Lokalisation und Farbe unauffällig, und auch sonst gab es nichts Ungewöhnliches festzustellen. Abel vermerkte das in seinem Protokoll-Diktat, dann wandte er sich der linken Kniekehle des Toten zu. Die Kollegin vom Landesinstitut musste äußerst scharfe Augen haben, da ihr bei der Krematoriums-Leichenschau der winzige Einstich in der Kniekehle aufgefallen war.
»Geben Sie mir bitte mal die Lupenbrille«, sagte Abel.
Seine Assistentin reichte ihm ein Brillengestell, das mit wuchtigen Vergrößerungsgläsern bestückt war, ähnlich einer Operationsbrille, wie sie Chirurgen bei filigranen Eingriffen tragen. Abel setzte die Lupenbrille auf, beugte sich über den Toten und musterte den nicht einmal stecknadelkopfgroßen Einstich. Er war zentral leicht eingedellt und im Randbereich dunkelrötlich unterblutet, musste also direkt vor Eintritt des Todes zugefügt worden sein.
Abel arbeitete gern mit Britta Gerlach zusammen. Die wortkarge Assistentin war Ende dreißig und gehörte seit zwei Jahren zu ihrem Team. Sie war stets aufmerksam bei der Sache und verlor auch in Ausnahmesituationen nie die Nerven.
Routiniert fotografierte sie den Befund aus verschiedenen Perspektiven. Währenddessen sprach Abel seine Feststellungen in das Diktafon. Als Nächstes nahm er wieder das Skalpell zur Hand und schnitt die Einstichstelle sowie einen zentimeterbreiten Streifen ringsherum mitsamt Haut und Unterhautfettgewebe heraus. Er teilte das Gewebestück mit einem Parenchym-Messer in zwei gleich große Hälften, wobei er sorgsam darauf achtete, dass der Schnitt genau mittig durch die Einstichstelle und den mutmaßlichen Stichkanal verlief. Die eine Hälfte gab er in ein kleines Plastikgefäß, das zu gut zwei Dritteln mit Formalin gefüllt war, um es später unter dem Mikroskop zu untersuchen. Die zweite Hälfte legte er ohne Zugabe von Konservierungs- oder Fixierungsmitteln zu den übrigen Asservaten für die späteren Untersuchungen im Labor.
Die chemisch-toxikologischen Untersuchungen des Blutes, der inneren Organe und insbesondere des Gewebestücks mit der Einstichstelle würden zeigen, ob Dominik Kreisler tatsächlich durch eine Giftspritze in die Kniekehle getötet worden war. Falls Abels Arbeitshypothese zutraf, hatten der oder die Täter vermutlich ein starkes Analgetikum verwendet mit einem opioidhaltigen Wirkstoff, der bei entsprechender Überdosierung zum Tod durch Atemstillstand führte. Abel war sich schon jetzt ziemlich sicher, dass er bei der Obduktion keinerlei Hinweise auf eine andere Todesursache finden würde – geschweige denn von Krebs zerfressene Organe. Für die Diagnose jenes Dr. Lenski, der den Totenschein ausgestellt hatte, gab es jedenfalls bisher keinerlei Anhaltspunkte.
Trotzdem blieb Abel bis zum Ende der Obduktion hochkonzentriert. Britta Gerlach schnitt den Darm in seiner gesamten Länge von mehr als fünf Metern auf und spülte ihn anschließend unter fließendem Wasser aus. Erwartungsgemäß wies der Darm des Maklers keinerlei Krebsbefall auf. Auch seine Leber war ohne pathologischen Befund. Kreisler hatte offensichtlich nicht nur seinen Körper trainiert, sondern sich auch von Alkohol und anderen Giftstoffen ferngehalten.
»Mit seinen Gefäßen und diesem Herzen hätte er hundert werden können«, sagte Abel mehr zu sich selbst als zu Britta Gerlach.
Das massive Lungenödem des Toten ließ die Verdachtsdiagnose Atemlähmung infolge Intoxikation immer wahrscheinlicher werden. Zumal es der einzige pathologische Organbefund überhaupt war, den Abel in seinem Sektionsprotokoll dokumentieren konnte.
Die entnommenen Blut- und Gewebeproben einschließlich des Gewebestücks von der Einstichstelle ließ er von Britta Gerlach ins BKA-eigene Labor bringen.
»Richten Sie Dr. Fuchs bitte aus, dass ich die Ergebnisse bis heute siebzehn Uhr benötige«, gab er ihr mit auf den Weg. »Er kennt das ja schon mit meinen ständigen Eilfällen.«
Er nickte ihr zu, und in diesem Moment fiel ihm ein, an welchen weit zurückliegenden Fall ihn die Leichensache Dominik Kreisler erinnerte.
Damals war ich noch Student.
Aus den Tiefen seines Gedächtnisses tauchte ein Name auf: Bettina, leider ohne Nachname.
Wer war diese Bettina? Eine Kommilitonin am medizinischen Fachbereich in Hannover? Und was genau ist damals mit ihr passiert?
Aus der Tiefe des Sektionssaals kam Scherz mit seinem charakteristischen Schnaufen auf ihn zu.
»Einen Moment noch, Herr Scherz«, sagte Abel. »Gleich haben Sie meine volle Aufmerksamkeit.« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht.
Bettina Selzer. So hieß sie mit vollem Namen. Auch ihr Gesicht sah er jetzt vor sich.