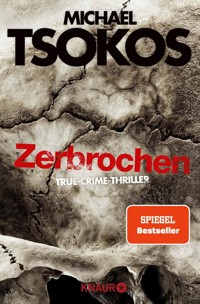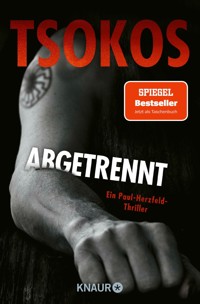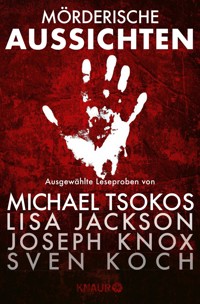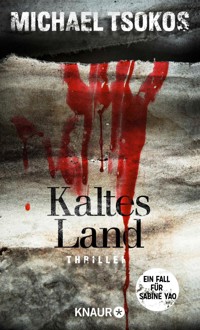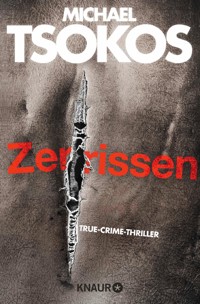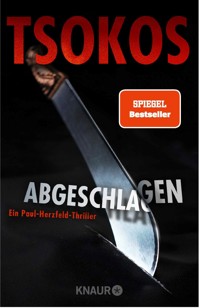
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Paul Herzfeld-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Abgeschlagen« von Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner und SPIEGEL-Bestseller-Autor Michael Tsokos ist der Auftakt einer True-Crime-Reihe um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld, bekannt aus »Abgeschnitten« von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos. Ein zerstückelter Leichenfund und eine blutverschmierte Machete führen Rechtsmediziner Paul Herzfeld auf eine gefährliche Spur ... Kiel, im Winter. Im Institut für Rechtsmedizin der Universität liegen im Sektionssaal ein toter Gewaltverbrecher, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, und eine zerstückelte Frauenleiche, deren Einzelteile in zwei Koffer verpackt wurden. Der junge Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist irritiert, als sich sein Vorgesetzter, Professor Schneider, bei der Obduktion der zerstückelten Leiche vorschnell auf eine Machete als Tatwaffe festlegt. Aber kurz darauf wird tatsächlich eine blutverschmierte Machete in einem Kieler Park gefunden. Die Medien feiern Professor Schneider als rechtsmedizinisches Genie, und sein Aufstieg zum Direktor der Kieler Rechtsmedizin scheint nur noch reine Formsache. Doch dann weiht der Hausmeister der Universität Herzfeld in ein Geheimnis ein, und auf einmal führen alle Spuren ins Institut. Als Herzfeld versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, steht nicht nur seine Karriere auf dem Spiel, sondern auch das Leben seiner Familie … In Abgeschlagen, einem fesselnden True Crime Thriller von Bestseller-Autor Michael Tsokos, ermittelt Rechtsmediziner Paul Herzfeld in einem Fall, der ihn an die Grenzen seiner Expertise bringt. »Was mich von Anfang an an Michael Tsokos' Romanen fasziniert hat, war die Detailtreue und Realitätsnähe seiner Geschichten. Der Mann weiß, wovon er schreibt. Und das merkt man auch in jeder Zeile seines Thrillers 'Abgeschlagen'.« freundin.de Entdecken Sie die alle True-Crime-Thriller von Michael Tsokos um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld: - Band 1: Abgeschlagen - Band 2: Abgefackelt - Band 3: Abgetrennt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Michael Tsokos
mit Wolf-Ulrich Schüler
ABGESCHLAGEN
Ein Paul-Herzfeld-Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist irritiert, als sich sein Vorgesetzter, Prof. Schneider, bei der Obduktion einer zerstückelten Frauenleiche überraschend schnell auf eine Machete als Tatwaffe festlegt. Auch der Sektionsassistent wirkt ungewöhnlich nervös und fahrig. Und tatsächlich taucht kurz darauf das blutverschmierte Mordwerkzeug in einer Kieler Parkanlage auf: eine kunstvoll verzierte Machete. Von den Medien wird Schneider sofort als rechtsmedizinisches Genie gefeiert, sein Aufstieg zum Direktor der Kieler Rechtsmedizin scheint reine Formsache. Doch dann gesteht der Hausmeister des Instituts Herzfeld, dass er die Machete schon einmal gesehen hat und dass die tote Frau für ihn keine Unbekannte ist …
»Abgeschlagen« basiert auf echten Fällen, authentischen Ermittlungen und der jahrelangen Erfahrung des bekanntesten deutschen Rechtsmediziners Michael Tsokos.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Prolog
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Teil 2
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
Teil 3
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Die Handlung von »Abgeschlagen« spielt zehn Jahre vor den Ereignissen in »Abgeschnitten«.
Paul Herzfeld ist sechsunddreißig Jahre alt und Assistenzarzt am Institut für Rechtsmedizin in Kiel.
Prolog
Paul Herzfeld hob den Kopf der Toten an. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund schien sie ihn überrascht anzustarren. Wie es nur so weit hatte kommen können? Eine Frage, die Herzfeld ihr auch gern gestellt hätte, doch er verdrängte den Gedanken und versuchte, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren.
Die Leichenstarre hatte sich noch nicht auf den ganzen Körper ausgebreitet, aber bereits im Kiefergelenk kräftig eingesetzt, sodass ihre vertrauten Gesichtszüge dadurch wie eingefroren wirkten.
Durch die grobe Holzkonstruktion des Schuppens schimmerten nur vereinzelt ein paar Lichtstrahlen aus einem ansonsten schneeverhangenen Himmel. Im Halbdunkel war es nicht leicht, irgendwelche Details an ihrem Körper auszumachen, der rücklings vor ihm auf dem rauen Holztisch lag. Herzfeld nahm die schemenhaften Umrisse ihrer Unterarme wahr. Sie waren in den Ellenbogengelenken, von denen die Leichenstarre auch bereits Besitz ergriffen hatte, leicht angewinkelt und ragten entgegen der Schwerkraft, wie in einer wütenden Geste erstarrt, senkrecht nach oben.
Sie kann höchstens zwei Stunden tot sein, so wie ihre Leichenstarre ausgeprägt ist. Ich muss einen Hinweis auf die Todesursache finden, und zwar schnell, überlegte Herzfeld fieberhaft und tastete den toten Körper ab. Ihm lief die Zeit davon, er brauchte irgendetwas, womit er bei der Untersuchung ansetzen konnte.
Ihr kurzes schwarzes Seidennachthemd war ihr fast bis über die Scham nach oben gerutscht.
Er konnte unmöglich den Körper hier in diesem düsteren Schuppen öffnen. Das würde zu lang dauern. Die Instrumente fehlten. Oder würde er gezwungen sein, die Obduktion mit dem einfachen Küchenmesser durchzuführen, das er neben einer altmodischen Taschenlampe oberhalb des Kopfes der Toten entdeckt hatte? »Das ist wohl mein Sektionsbesteck?«, fragte Herzfeld in die Dunkelheit hinein.
»Natürlich. Nur zu. Ich warte auf Ihre Expertise«, erwiderte eine tiefe Stimme, die aus der hinteren Ecke des Raumes kam.
Herzfeld streckte seinen Rücken durch, fuhr sich durch die dunklen Haare und griff nach der Taschenlampe. Im gelblichen Lichtkegel sah er, dass der Lippenstift der Frau, der bei ihrer Begegnung am Tag zuvor noch akkurat gezogen war, jetzt völlig verschmiert war. Speichelfäden, inzwischen gräulich-wächsern eingetrocknet, hatten sich ihren Weg aus dem geöffneten Mund über die linke Gesichtsseite gebahnt.
»Sie scheinen nicht die geringste Ahnung zu haben, womit Sie es hier zu tun haben, Herzfeld. Ich gebe Ihnen ein paar Hinweise, denn Sie stehen ja unter Zeitdruck. Wir befinden uns noch immer im frühen postmortalen Intervall. Und an einem Herzinfarkt ist die Dame schon mal nicht gestorben«, sagte die Stimme mit einem höhnischen Unterton.
Herzfeld atmete aus und mahnte sich zur Ruhe. Konzentrier dich! Wie aus zwei stumpfen Glasmurmeln starrten ihn die erweiterten Pupillen der Toten vorwurfsvoll an, als er mit seinen Fingerspitzen ihre Augenunterlider herabzog, um die Augenbindehäute zu inspizieren. Von ihrem vormals perfekten Lidstrich, dem Lidschatten und ihrer Wimperntusche war nichts mehr übrig geblieben, in schwarzen Rinnsalen war das Make-up über ihre Wangen gelaufen. Sie musste viel geweint haben, als sie begriff, dass sie sterben würde.
»Vereinzelte Punktblutungen in den Bindehäuten«, sagte Herzfeld mehr zu sich selbst als zu der Person, die sich jetzt mit langsamen Schritten näherte.
Da war er. Der erste Hinweis.
Aber es musste schneller gehen, viel schneller. Denn mit jeder Minute, die verstrich, würde das Horrorszenario näher rücken: Die Frau, die er liebte, würde sterben. Nur das Ergebnis der Untersuchung des leblosen Körpers vor ihm und seine korrekte Feststellung der Todesursache konnten ihren Tod verhindern. Im Lichtkegel der Taschenlampe untersuchte Herzfeld den Hals der Toten: keine Strangmarke, keine Drosselspuren, keine Würgemale. Eine Gewalteinwirkung gegen den Hals schied schon mal aus. Aber warum dann die punktförmigen Blutungen in ihren Bindehäuten?
Herzfeld hob den Kopf erneut an und leuchtete auf ihre Nackenregion. Dabei fielen die blonden halblangen Haare nach vorn und hingen ihr wie ein Vorhang vor dem Gesicht. Sie waren völlig trocken. Obwohl sie schon ein oder zwei Stunden tot war. Wäre sie unter einer Plastiktüte erstickt worden, wären ihre Haare durch das entstehende Kondenswasser noch immer feucht. Bei der nassen Kälte im Schuppen wären sie nicht getrocknet.
»Und? Was sagen Ihnen die Punktblutungen? Ich denke, die Toten sprechen zu Ihnen«, sagte die Stimme zynisch.
»Keine Strangulation, kein Ersticken unter einer Plastiktüte«, erwiderte Herzfeld, während er die Träger des Nachthemds über die Schultern der Toten nach unten zog und ihren Oberkörper entblößte. Keine Zeichen einer Druckstauung am Oberkörper. Tod durch Ersticken, weil jemand auf ihrem Oberkörper kniete, scheidet auch aus. Aber vielleicht war es gar kein – Herzfelds Gedankenflut wurde jäh unterbrochen.
»Herzfeld, Sie sollten sich jetzt wirklich beeilen. Gleich wird der Wind die Maschine in Bewegung setzen, die das Leben Ihrer Lebensgefährtin, der Mutter Ihrer Tochter, in wenigen Minuten auslöscht. Und wenn das passiert ist –«
Die Stimme machte eine bedeutungsschwangere Pause.
Herzfeld begann zu schwitzen, sein Puls raste. Er blickte auf das makabre Todesrätsel auf dem provisorischen Untersuchungstisch vor sich und setzte die äußere Leichenschau fort. Er untersuchte die Fingernagelränder der Toten auf frische Abbrüche oder Fremdmaterial darunter, als er die beiden kleinen blasigen Hautveränderungen an der Innenseite der Endglieder des rechten Zeigefingers und des Daumens bemerkte, die im Lichtkegel der Taschenlampe porzellanartig schimmerten. Und dann kam ihm eine Idee. Es war nur ein flüchtiger Gedanke, aber Herzfeld spürte, dass er auf der richtigen Spur war.
Der zweite Hinweis. Vielleicht der alles entscheidende Hinweis.
Herzfeld nahm das Küchenmesser und öffnete mit einem einzigen langen Schnitt den rechten Arm der Toten von der Schulter bis zum Handballen in seiner gesamten Länge. Die Klinge war schärfer, als er erwartet hatte, und glitt durch Haut und Unterhautfettgewebe wie durch ein Stück Weichkäse. Die Hautlappen beidseits des Schnitts klafften zur Seite und gaben den Blick auf das darunterliegende Unterhautfettgewebe und die Armmuskulatur der Toten frei. Als er die dunkelroten, feucht glänzenden Einblutungen in der Beugemuskulatur von Ober- und Unterarm erblickte, war ihm schlagartig klar, wie und woran die Frau gestorben war. Aber ehe er seine Gedanken ordnen und sein Ergebnis mitteilen konnte, sah er den Arm, der sich wie eine Python langsam in Richtung seines Kopfes bewegte. Er spürte die kalte Mündung der Waffe an seiner linken Schläfe.
»Und jetzt das Messer weg, sofort. Nicht schlecht. Das muss man Ihnen lassen. Sie sind noch besser, als ich dachte. Aber das nützt Ihnen nun auch nichts mehr. Morgen liegen Sie auf einem Obduktionstisch. Und ein Kollege wird sich fragen: Wie starb Paul Herzfeld?«
Teil 1
1
20. Dezember, 23.26 Uhr Kiel. Eros-Center
So fühlte es sich also an zu sterben. Eine Summe von körperlichen Reaktionen, im Gehirn zu einem schneidenden Gedanken verbunden. Sein Atem wurde flach, kroch nur noch langsam durch seine Lungen. Die verbrauchte Luft presste sich durch seine Lippen, die langsam blau wurden. Der Strick um seinen Hals zog sich mit jeder Bewegung immer fester zusammen, als wäre er eine dünne Würgeschlange, die durch die Kissen gekrochen war, um ihm den Atem abzuschnüren. Seine Halsschlagadern wurden immer weiter zusammengedrückt, und er spürte, wie sich der Blutfluss in ihnen verlangsamte.
Jetzt bist du gleich tot, blinkten die einzelnen Wörter wie bei einer Hochhausreklame in seinem Kopf. Der Gedanke überlagerte alles. Seine Körperfunktionen liefen nur noch automatisch. Seine Blicke zuckten in rascher Abfolge reflexartig durch den Raum. Irgendwo hier muss sie doch sein, dachte Marius Wagner. Doch im Halbdunkel des Raumes konnte er nur schemenhaft erkennen, dass sie überhaupt noch da war.
Eben hatte sie noch am Kopfende des abgewetzten und ordinär riechenden Bettes gestanden, um zu überprüfen, ob die Fesseln, die jetzt tief in die Haut seiner Handgelenke schnitten, auch richtig festgebunden waren.
Wagner spürte, wie seine Fingerspitzen langsam kalt und taub wurden, obwohl irgendwo im Zimmer ein Heizlüfter lief und ächzend schmutzige Wärme ausspuckte. Seine Finger streckten sich, als würden sie bis zu dem kleinen abgewetzten Tisch neben ihm wachsen. Dort lag seine Brille, doch er bekam sie nicht zu fassen. Aber das wusste sie sicherlich. Sie liebte es scheinbar, ihm auf dem Weg in den Tod kleine bösartige Steine in den Weg zu legen.
»Bitte, bitte – ich will …«, presste er stammelnd aus seiner trockenen Kehle. Obwohl er tagelang über die Sätze nachgedacht hatte, die er sagen würde, wenn dieser Moment gekommen war. Doch nichts davon fiel ihm mehr ein. Warum nur fiel ihm nichts mehr ein?
»Das ist nicht, was ich hören will«, antwortete sie mit leiser Stimme.
Ihre Stimme war nah. Ganz nah. Sie strich durch sein Haar, das an den Schläfen langsam grau zu werden begann. Dabei war er nicht einmal fünfzig.
Der Strick um seinen Hals zog noch einmal an, als er leicht den Kopf hob, um sich nach seiner Peinigerin umzusehen. Der Puls seiner Halsschlagadern pochte nun so heftig, dass er auf die Fasern des Seils überzugehen schien.
»So, mir reicht’s jetzt mit dir. Du bist nicht einmal Manns genug, um zu sterben. Nicht einmal das bringst du. Du kannst froh sein, dass Leichen von allein faulen«, fauchte sie und strich sich die langen schwarzen Haare aus dem Gesicht. Dann setzte sie ihm einen lackierten Fingernagel wie ein Skalpell fest auf die Brust und zog eine schmerzende Spur von seinem Brustbein bis zu seinem Schamhaar.
Er wimmerte kurz auf, aber sein Gehirn schien sich abgeschaltet zu haben und nur noch am Rande zu begreifen, was gerade geschah. Als hätte sein Verstand beschlossen, dass er in diesem todgeweihten Körper ohnehin nicht mehr gebraucht würde.
Dann wandte sie sich ab, die Zigarette schon in der Hand, als sei es nun wirklich Zeit für eine Pause. Er hörte das Rädchen des Feuerzeugs kratzen, in das sich das Rauschen seines Blutes mischte. Sie nahm zwei lange Züge, stand auf und ging um den Körper des schmächtigen Mannes herum, der vor ihr gefesselt auf dem Bett lag.
»Und – willst du die Worte sagen, die dich erlösen?«, verließen die letzten Rauchfäden mit dieser Frage ihre knallroten Lippen.
Wagner versuchte, den Kopf zu schütteln. Doch das Drosselwerkzeug um seinen Hals ließ ihm nicht einmal Raum dafür.
»Nein«, atmete er aus.
»Dann ist es eben so, du Pisser!«
»Aber … ich bin doch …«
»Was bist du?«
»… hab Geld, Mitarbeiter. Alles …«, kam es kratzend aus seiner Kehle.
Sie starrte ihn fassungslos an. Führte mit spitzen Fingern die glühende Zigarette gefährlich nah an seinen nackten Oberkörper. Giftspritzengleich setzte sie an und drückte die Glut fest auf seiner Brust aus. Die Asche verfing sich in seinem spärlichen Brusthaar, sengte es an, sodass es nach verbranntem Horn roch.
Aus Wagners Kehlkopf drang ein jämmerlicher Laut, vor dessen Klang er selbst erschrak. Sie kann das stundenlang so weitertreiben, aber irgendwann wird mich jemand vermissen, dachte er nervös. Meine Frau wird Nachrichten auf mein Handy senden, später vielleicht sogar anrufen.
Mit einem abfälligen Blick musterte die Frau mit den dunklen Haaren seinen bebenden Körper. »Und jetzt – jetzt wirst du sterben!«
2
20. Dezember, 23.36 Uhr Kiel-Ravensberg. Wohnung von Achim Wittfeld
Er zog an der Metallpfeife, die er sich wie den Lauf einer Pistole zwischen die Zähne geschoben hatte. Die kristalline Substanz im Pfeifenkopf verwandelte sich zu Rauch. Der leicht chemische Geruch verbreitete sich sofort in der kleinen Wohnung, nistete sich, wie schon so oft zuvor, in den abgewetzten Polstern des Sofas ein.
Die Küchenzeile mit den zwei völlig verrosteten Herdplatten sah eher aus wie eine Müllkippe. Vor lauter leeren Zigarettenschachteln, schmutzigen Tellern, auf denen sich die Asche sammelte, und zwei leeren Wodkaflaschen, war die Arbeitsplatte kaum noch zu sehen. In dieser Behausung schlief und lebte Achim Wittfeld. Vor dem Fenster hatte er ein großes Betttuch aufgehängt, und trotzdem glotzten die Scheinwerfer jedes vorbeifahrenden Autos in seine Höhle. Parterre. War einfach billiger.
Als die Wirkung des feinen Rauches einsetzte, der das Ende des Metallröhrchens in Richtung seiner Atemwege verließ, fuhr sich Wittfeld über die vernarbten Arme.
Vor ein paar Jahren hatte er eine Phase durchlebt, in der er sich mit Rasierklingen in die Arme geritzt hatte, und heute sahen sie wieder aus, als hätte sich eine tollwütige Wildkatze an ihnen ausgetobt. Vor Kurzem, als er wieder mal einen Job als Beikoch verloren und ihn wieder einmal sein ewig betrunkener Vater wüst beschimpft hatte, war er zu Crystal zurückgekommen. Und zwar richtig. Nicht zu den kleinen, gläsernen Splittern, die ihm halfen, die unmenschlich langen Abende in der Großküche des feinen Fischrestaurants zu überstehen, sondern zu den großen kristallinen Brocken, die aussahen, als hätte jemand eine Scheibe aus Sicherheitsglas zertrümmert. Das musste vor einer Woche gewesen sein. Oder war es schon zwei Wochen her? Er hatte seinen alten Herrn geschlagen. Nicht zum ersten Mal. Dann war er wieder nach Hause gefahren. In der Bahn hatte er sich an einer jungen Frau festgeguckt, die mit sich selbst zu reden schien. Als er die weißen Stöpsel in ihren Ohren entdeckt hatte, hatte er das dünne Kabel beim Aussteigen herausgerissen und war losgelaufen.
Wittfeld liebte diese Momente. Sie waren wieder häufiger geworden. Momente, in denen er den Mut aufbrachte, die unsichtbare Grenze zwischen ihm und einem anderen Menschen zu überwinden. Momente, in denen er binnen weniger Sekunden die Atmosphäre einer Situation komplett auf den Kopf stellte. Als würde er eine Blase zum Platzen bringen.
Dann, zu Hause in seinem Bau, hatte er wieder angefangen zu rauchen. Einen echten Kristall. Wäre es ein Diamant gewesen, wäre er reich gewesen. Achim, du zeichnest doch so schön. Mach da doch was draus, hatte seine Großmutter gesagt. Immer wieder. Sogar noch, als sie schon dement im Heim saß und sich niemand außer ihm um sie kümmerte, hatte sie seine Zeichenkünste gelobt. Eines Abends, nach einem weiteren niederschmetternden Besuch bei ihr im Pflegeheim, hatte er, vollkommen benebelt, wieder mit dem Zeichnen begonnen. Das Motiv: eine kauernde Frauengestalt. Mit elfenhaft dünnen, aufgeritzten Beinen. Wie seine Arme. Sie war nicht zu erkennen. Ein wüst gekritzelter Haarteppich hing vor ihrem Gesicht. Es konnte jede sein. Aber er, er würde die gesichtslose Frau erkennen. Da draußen in der feindlichen Welt. Wittfeld hatte den Kugelschreiber so fest aufgedrückt, dass sich eine Blutblase an seinem Mittelfinger gebildet hatte. Aber er musste zeichnen, was vor seinem geistigen Auge auftauchte. Eine Kombination aus innerem Drang und der kristallinen Chemie – Letztere wahrscheinlich zusammengebraut in einem Labor in Tschechien. Oder in einer Gartenlaube in Brandenburg. Oder sonst wo.
Völlig aufgedreht vom Kick der Droge hatte er sich nach langer Zeit wieder einmal geritzt. Er hatte aufgehört zu zeichnen und war kopfüber in wirre Tage aus Alkohol und Drogen gestürzt. Zigarettenglut hatte sich in den wenigen albtraumhaften Schlafminuten in seinem lockigen Haar verfangen und ganze Strähnen angesengt.
Aber heute Abend würde er seine Zeichnung vollenden. »Wo is se denn«, lispelte Wittfeld aufgeregt vor sich hin und suchte die Couch ab. Er wurde wütend, warf die Kissen vom Sofa. Nichts, außer ein paar angelaufenen Münzen, einem Feuerzeug und etwas Alufolie. Hatte wohl ein Freund vergessen. In der Zeit, als er noch Freunde hatte.
Endlich. Nachdem er auf allen vieren über den abgewetzten Teppich gekrochen war und danach sein spärliches Mobiliar durchwühlt hatte, fand er, wonach er gesucht hatte: seine Zeichnung. Sie lag in der untersten Schublade der Kommode, auf der der verstaubte Fernseher stand und rund um die Uhr ein wackeliges Bild in den Raum warf.
Wittfeld setzte sich auf die stockfleckige Couch und betrachtete das Bild: An manchen Stellen war die Mine des Stiftes durch das Papier gestoßen. Hektisch tastete er auf dem Tisch vor sich nach dem Kugelschreiber. Gierig sog er an der Drogenpfeife. Die Wirkung des Rauchs ließ mittlerweile immer schneller nach. Und er begann wieder zu zeichnen. Das Crystal leitete Kopfschmerzen in sein System, als hätte er an einem Eimer Farbverdünner geschnüffelt. Das nervte ihn. Er musste sich doch konzentrieren. Schließlich feilte er doch gerade an seiner Zeichnung. »Da fehlt noch was. Da fehlt doch noch was«, stammelte Wittfeld abwesend. Sein Mittelfinger schmerzte wieder. Ungerührt von seinen Nöten hockte das dünne Mädchen auf dem Papier. In Kugelschreiberblau. Die Beine angezogen. Wie durch Geisterhand getrieben, setzte Wittfeld an den schmächtigen Schultern seines Motivs an. Sie hatte noch keine Arme. Er kratzte sich am Kinn. Die bekommst du auch nicht, oder? Nee, die bekommst du nicht, deine Arme. Ich hab noch was viel Schöneres für dich, du hübsches Ding, du. Was viel, viel Schöneres.
Der Stift fuhr über das Papier, zeichnete einen weiten Bogen, der aus der Kugel des Schultergelenks entsprang. Bei der hohen geschwungenen Kurve begann Wittfeld wie beim oberen Teil eines Herzens. Dann ließ er mit verkrampften Händen den Schwung nach unten sausen. Das Gleiche auf der anderen Seite. Er wischte seine schwitzigen Hände an seiner Jeans ab. Fast schon liebevoll, wenn auch immer unkontrollierter, schraffierte er die neu geschaffene Fläche am Körper der elfenhaften Figur. Jetzt hatte sie, was sie seiner Meinung nach brauchte. Es waren keine Arme. Er hatte dem Mädchen auf dem Papier Flügel wachsen lassen.
3
20. Dezember, 23.42 Uhr Kiel. Eros-Center
Der Körper ihres Freiers bebte, das Bettgestell knarzte, als er an seinen Fesseln ruckelte. Doch die minimale Bewegung brachte ihm keine Erleichterung. Im Gegenteil, sofort brach dem Mann der Schweiß aus. Der Heizlüfter im Zimmer schien lediglich Sauerstoff in unbrauchbare Hitze zu verwandeln.
Ewa stolzierte mit spitz aufschlagenden Absätzen in eine der dunklen Ecken, zog an einer schwarzen Kommode die Schublade auf und nahm eine Rolle Frischhaltefolie heraus. Sie ging in Richtung des Bettes zurück. Wagner stöhnte. Mit ihren Fingernägeln suchte sie das Ende der Folie auf der Rolle, fand es nicht und grinste. Genau wie in der Küche. Der Idiot kann doch eh nichts ohne die Brille sehen. Vorsicht, das ist ein Designerstück, hatte er noch gesagt, als sie ihm sie abgenommen hatte. Solche Sorgen hätte ich auch gerne mal, hatte sie gedacht.
Schließlich hatte sie einen halben Meter Folie abgewickelt und nahm genau Maß. Sie durfte jetzt keinen Fehler machen und drückte die Folie auf sein Gesicht. Wagner nahm einen tiefen Atemzug durch den Mund. Panik breitete sich auf seinem Gesicht aus! Sofort sog er die Folie ein, so tief, dass seine Zunge dagegenschlug wie die eines gefangenen Reptils, das gegen die Glasscheibe seines Terrariums drückte. Das Plastik legte sich auf seine Zähne, kroch in seine Nasenlöcher. Sie presste die Folie gegen seine Ohren, um die Position präzise zu halten. Die aufgerissenen Augen ihres Opfers zeichneten sich ab. Verzerrt. Unmenschlich. In Todesangst erstarrt. Sein Schrei wurde vibrierend durch die Folie nach außen geleitet.
Dann kam Wagner. Eher mickrig. Was für eine armselige Veranstaltung. Ewa schüttelte sich innerlich. Gerade als sie begann, sich Sorgen zu machen, röchelte ihr Freier unter der Folie hervor.
»Mutabor.«
Da war es! Endlich! Das Codewort. Sofort riss Ewa die Folie von den Atemwegen des Mannes und blickte ihn an. Sie gab ihm Zeit für zwei tiefe Atemzüge und schielte auf die Uhr an der Wand. Das Codewort hatten sie vereinbart, um ihr gefährliches Spiel abzubrechen, bevor es heikel wurde. Sie machte das mit allen Freiern so, denen sie Schmerzen zufügen sollte oder die von ihr lebensgefährliche Praktiken verlangten. Sie empfand das Zauberwort aus dem Märchen vom Kalif Storch als sehr passend. Aus den lüsternen Wesen wurden wieder schräge Vögel. »Und, alles klar?«, fragte Ewa, immer noch skeptisch, ob ihr Kunde alles gut überstanden hatte.
»Toll. Ganz toll …«, hustete Wagner.
Sie griff hinter das Kissen, auf dem sein schwitziger Kopf lag, und löste den Schnürsenkel, mit dem sie seinen Hals direkt über seinem Kehlkopf fixiert hatte.
»Brille«, kommandierte er plötzlich mit fester Stimme und hob seinen Kopf mit den zerzausten Haaren an. Von der Weinerlichkeit des hilflosen Mannes war nichts mehr übrig.
Ewa langte hinüber auf den Nachttisch und setzte ihrem Freier das gute Designerstück wieder auf.
Während er sein Ejakulat betrachtete, das er sich auf den Bauch gespritzt hatte, löste sie die Handfesseln. Dann warf sie ihm eine Kleenex-Schachtel aufs Bett. Das war ihr schon immer unangenehm gewesen. Noch unattraktiver als Männer, die sich für sexuelle Handlungen ausziehen, sind Männer, die sich danach wieder anziehen, hatte Ewa einmal für sich beschlossen.
Sie schaute auf ihr Handy. Zwei neue Nachrichten. Eine war von ihrer Mitbewohnerin Johanna, mit der sie am nächsten Tag einen Kaffee trinken gehen wollte, bevor mittags ihre Schicht begann. Die andere Nachricht war von ihrer Mutter. Dann sah sie auf ihr Diensttelefon. »Das Nuttentelefon«, nannten es ihre Kolleginnen. Falls man mal an einen Irren geriet, war ein Telefon mit Prepaid-Karte schon mal viel wert. Auch hier eine weitere Nachricht.
»Dein Geld hast du ja schon«, hörte sie ihren Todesfetischisten flüstern.
»Natürlich, Schätzchen.«
»Es war wirklich toll.«
»Gerne doch. Wir sehen uns wieder, Süßer.«
»Wo habe ich denn die Tüte?«
Ewa sah Marius Wagner im Anzug im Zimmer stehen. Dann beugte sich ihr Freier hinunter und zog eine große Kaufhaustüte unter dem Bett hervor.
»Hab sie! Weihnachtsgeschenke – für die Kinder«, lächelte er.
Ewa nickte. War ja irgendwie klar.
»Das Geld«, sagte er erneut und deutete mit dem Kopf in Richtung des Nachttisches, auf dem die Scheine lagen.
Ewa würde gleich sicherheitshalber noch einmal nachzählen. Falls er nicht die vereinbarten zweihundert Euro auf den Nachttisch gelegt haben sollte, würde sie auf den Knopf drücken, und Miguel, der Sicherheitsmann, der heute Abend auf die Frauen vom Laufhaus aufpasste, würde ihn festhalten. Aber so waren die Perversen eigentlich nicht. Den meisten war vorher und nachher immer alles ziemlich peinlich. Und wer will schon zu Hause erklären, dass er in einem Laufhaus am Kieler Hafen verprügelt worden war, weil er die Prostituierte um Geld geprellt hatte, nachdem sie mit ihm eine Tötungsfantasie durchgespielt hatte? Eben.
Solche Spielchen hatte Ewa hin und wieder mal im Programm. Obwohl sie immer auch ein Risiko bargen. Sie musste da immer an den australischen Sänger Michael Hutchence denken. Der schien auch ein Fan von Luftnot und Strangulationsspielchen und der damit verbundenen kurzfristigen euphorischen Reaktion im Gehirn gewesen zu sein. Dann hatte er es leider etwas übertrieben und hing plötzlich nackt in einem Hotelzimmer in Sydney.
Eine Prostituierte aus Österreich war sogar vor Gericht gelandet, weil ihr Freier sich bei einer Atemreduktion – Fachbegriffe fand Ewa auch in ihrem Beruf immer faszinierend – zu Tode stranguliert hatte. Aber Ewa wusste, was sie tat. Und ein Freier, der nur gedrosselt werden wollte, war ihr allemal lieber als einer, dem sie dabei zusehen sollte, wie er aus ihrer Kloschüssel trank oder die benutzten Präservative ihrer vorherigen Freier auslutschte.
Ewa ging ins Bad. Sie würde heute Abend noch ihre Mutter in Polen anrufen. Das übliche Gespräch, mit den fast täglich gleichen Fragen: Warum arbeitest du immer so lange im Restaurant? Wie läuft das Studium? Hast du einen netten Mann getroffen? Wie immer würde sich Ewa bei den Antworten kurzhalten, weil sie sie selbst seit Monaten nicht beantworten konnte. Denn das Restaurant gab es überhaupt nicht, das Studium schon lange nicht mehr und die Männer – na ja, das war so eine Sache. Die polnische Prostituierte setzte sich auf das Bett und öffnete rauchend die Textnachricht auf ihrem Diensthandy.
Bist du frei? Komme gleich noch vorbei
4
20. Dezember, 23.57 Uhr Kiel-Ravensberg. Wohnung von Achim Wittfeld
Wittfeld hatte die Zeichnung des Flügelmädchens wütend auf den Boden geworfen. Die Droge hatte inzwischen jede einzelne Nervenbahn seines Körpers besetzt, Rausch und Realität gingen nahtlos ineinander über. »Es dauert noch was, bis du hier rauskommst«, faselte Wittfeld in Richtung des Stückes Papier, das vor ihm auf dem ranzigen Teppich lag. Das Flügelmädchen saß immer noch mit angezogenen Beinen auf dem Blatt. Die Flügel waren flugbereit aufgeschwungen, reckten sich nach oben.
»Wenn ich mein Werk vollbracht habe, werden sie dich sicher gleich finden. Dann wird mein Flügelmädchen in fremde Hände kommen, doch ich werde dich bald wiedersehen.« Und er spürte, wie wieder diese unkontrollierbare Wut in ihm aufstieg. Er begann hektisch im Zimmer hin und her zu laufen und murmelte dabei zusammenhangloses Zeug. Immer wenn er die Wand erreicht hatte, schlug er dagegen, bis seine Knöchel bluteten. Als die übermächtige Wut endlich von ihm abließ, zog er sich die abgewetzte Lederjacke, seine einzige Jacke, über das befleckte schwarze T-Shirt und öffnete den Schrank, aus dem ihm eine billige Sporttasche und ein Besen entgegenfielen. Er beugte sich weit in den Schrank hinein, um zu finden, was er suchte: die Machete.
Ihre Klinge blitzte bösartig auf.
Wittfeld umschloss den schwarzen Holzgriff, der über die ganze Fläche mit kunstvollen Schnitzereien versehen und in der Mitte beidseitig mit Intarsien aus rötlichem Metall geschmückt war, die eine Blüte darstellten. Die Waffe wirkte, als hätte sie einst ein stolzer Südsee-Häuptling getragen. Er verstaute sie in der länglichen Sporttasche.
Der Luftzug, der die Zigarettenasche im Zimmer aufwirbelte, als er die Wohnungstür aufriss, griff auch nach dem Blatt Papier, auf dem das Flügelmädchen gezeichnet war. Es wiegte sich einmal gleichgültig hin und her.
Wittfeld knallte die Wohnungstür zu, ohne sich noch einmal umzusehen. Sein Schlüsselbund lag auf dem Tisch vor der Couch, aber er wusste, dass er diese Wohnung nie mehr betreten würde.
5
21. Dezember, 0.17 Uhr Kiel. Eros-Center
Ein weiterer Freier hatte sie auf ihrem Diensthandy angefragt. So spät noch. Ewa seufzte. Tschüss Feierabend. Ihre Nummer hatte sie in der Zeitung veröffentlicht. Denn allein die Laufhauskundschaft, die spontan vorbeischaute, genügte ihr nicht. Ihre zahlungskräftigen Stammkunden bekam sie nur über Anzeigen in der Tageszeitung:
Junge Studentin für besondere Fantasien.
Alles ist erlaubt. Verleih deinen Träumen Flügel.
Triff mich im Eros-Center. Kontakt nur SMS.
Ewa
Dann folgte die Nummer ihres Diensttelefons.
Wahrscheinlich hatte der Freier die Anzeige gelesen. Nichts deutete darauf hin, dass er hier im Haus Stammkunde oder überhaupt schon einmal bei ihr gewesen war. Doch heute wollte sie eigentlich niemanden mehr empfangen.
Das Laufhaus, in dem sie monatsweise ihr Zimmer gemietet hatte, das sie sich im Schichtbetrieb mit einer Kollegin teilte, hatte zwar die ganze Nacht offen, aber ab einer gewissen Uhrzeit war es klug, sich nicht mehr auf den Hocker vor die Tür zu setzen. Die Nacht schien den armseligen Gestalten, die dann durch die Flure des mehrstöckigen Hauses huschten, vollends das Gehirn auszuschalten.
Ewa nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette und blickte auf ihr Handy. Es war bereits weit nach Mitternacht. Sie überlegte kurz. Wenn sie jetzt noch einen schnellen Job machte, dann konnte sie morgen später anfangen. Das würde bedeuten, sie hätte mehr Zeit mit ihrer Mitbewohnerin Johanna, und sie könnten durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt bummeln. Außerdem wollte sie noch unbedingt zum Friseur, bevor es für die Weihnachtstage nach Hause ging, nach Polen. Ihre Mutter sollte zumindest das Gefühl haben, ihre Tochter sei zwar eine langsame, aber immerhin eine auf ihr Äußeres bedachte Studentin.
Sie tippte:
OK. Zimmer 26.
Und schickte die SMS ab.
6
21. Dezember, 0.19 Uhr Kiel. Eros-Center
Der Raum, in dem sich die Sicherheitsleute des Laufhauses aufhielten, verfügte über zwei Bildschirme. Die Qualität war allerdings miserabel. Die Kameras auf den Stockwerken sprangen immer wieder um, zeigten sechs Einstellungen im Viersekundentakt auf jedem Monitor.
Auch Parkplatz und Eingangsbereich wurden aufgezeichnet, die Daten jedoch lediglich auf Festplatten gespeichert. Und auch nur für achtundvierzig Stunden. Für den Fall der Fälle. Aber den gab es eigentlich nie. Keiner hatte hier Interesse daran, sich mit den Behörden über Autokennzeichen zu unterhalten. Hier regelte man alles schnell. Direkt und diskret. Und mit dem Baseballschläger, wenn nötig. Oft waren es Freier, die keinen hochbekamen und ihr Geld zurückforderten, die dann wie aufgeregte Stummfilmfiguren über die Monitore huschten und von den Sicherheitsjungs zur Ordnung gerufen wurden. Oft zahlten sie dann das Doppelte.
Miguel hatte zwar die Pappschale mit chinesischem Essen bereits in den Mülleimer befördert, trotzdem stank die ganze Bude danach. Man konnte das Glutamat beinahe mit der Hand von der Tischplatte wischen.
Er wurde von den Mädchen »San Miguel« genannt, wie das Bier aus dem Spanien-Urlaub. Der heilige Miguel. Aber auch als Heiliger hat man es manchmal schwer. Zuletzt vor einem Jahr, als er bei einer Razzia im Klubheim seiner Rockerbande in Gewahrsam genommen wurde, weil eine Polizistin mit ihrem Hintern gegen seine Hand gesprungen war. Er war kein Heiliger im klassischen Sinne. Aber die Mädels mochten ihn für seine herzliche zupackende Art. Manche würden behaupten, er sei ein Schläger. Aber einer mit Humor. Als er einmal einem Albaner, der eines der Mädchen bedroht hatte, einen Schneidezahn ausgeschlagen hatte, war er auf die Idee gekommen, die Zähne seiner Kontrahenten in einem Marmeladenglas zu sammeln. Aber die Sammelleidenschaft war auf Anweisung des Präsidenten seines Klub-Chapters schnell zum Erliegen gekommen. Wir brauchen hier keinen Ärger, hatte er gesagt.
Und so bestand Miguels Zahnsammlung aus einem albanischen Einzelstück. Das jedoch stand in einem Marmeladenglas auf einem der Überwachungsmonitore wie auf einem Altar. Miguels ganzer Stolz. Konkurrenz konnte dem Zahn lediglich die dösende französische Bulldoggen-Dame machen, die unter dem Tisch döste. Die einzige Frau, die es mit ihm aushielt. »Bist eine ganz Süße, Señora«, schnurrte Miguel und kraulte der Hündin durch den wulstigen, haarigen Specknacken.
Der Überwachungsmonitor sprang gerade um, als er sich wieder nach oben beugte. Und Miguels Blick verharrte auf der neuen Einstellung, die den Flur im zweiten Stock zeigte. Er nahm den Mann mit den dunklen Locken und der braunen Lederjacke wahr, wie er mit seiner Sporttasche um die Ecke verschwand. Für eine kurze Sekunde hatte er über die Schulter nach oben geblickt – direkt in die Kamera.
7
21. Dezember, 0.22 Uhr Kiel. Eros-Center
Es klopfte. Leise, fast schüchtern. Als würde ein schmaler Knöchel unsicher an die abgewetzte Holztür pochen. Ewa fuhr sich mit der Hand durch ihre langen schwarzen Haare und erhob sich seufzend.
Showtime …
Das Erste, was Ewa an dem jungen Mann vor ihrer Zimmertür auffiel, waren seine wilden dunklen Locken. Sie fielen fast bis auf den Kragen. Er stand so nah an der Schwelle, dass sie zurückschrak. Normalerweise hielten Kunden etwas Abstand, aus Höflichkeit oder als wähnten sie ihre Schwiegermutter hinter der Tür.
Der Mann, der jetzt vor Ewa stand, schien jedoch eher ein Problem mit der richtigen Distanz zu haben. Und wohl auch mit der Temperatur. Unter der dünnen Lederjacke trug er nur ein schwarzes T-Shirt, und das im Dezember. Der Blick aus seinen grünen Augen war wie ein stumpfer Dolch, der sich mühsam, aber kraftvoll in sein Gegenüber bohrte. Auch die dunklen Schatten, die unter seinen Augen lagen, blieben Ewa nicht verborgen.
Er versuchte sich an einem Lächeln, das aber etwas zu schnell wieder verschwand. Mehr eine missglückte Geste. Dabei entblößte er eine Reihe Zähne, die unter seinem wohl ziemlich ungesunden Lebenswandel gelitten hatten.
»Ewa?«, fragte der Besucher hastig.
»Ja, da bist du richtig.«
»Ich suche etwas Besonderes. Sehr Besonderes. Aber du kannst doch mit besonderen Typen, oder?«
Ewa hob amüsiert die linke Augenbraue, machte sich auf ihren Stilettos noch etwas größer und überragte fast ihren Besucher. Ganz was Besonderes, und am Ende will er nur in Windeln in der Ecke sitzen und am Daumen lutschen, dachte sie genervt. »Komm rein. Ich hab eigentlich Schluss, aber wenn das jetzt keine Ewigkeit dauert …«
»Ja, geht schnell«, entgegnete der späte Kunde und zwängte sich an ihr vorbei ins Zimmer. Seine längliche Sporttasche streifte an ihrem Schienbein entlang.
»Also, was kann ich tun?«, fragte Ewa und beobachtete, wie er in die Mitte des Zimmers ging und sich einmal um die eigene Achse drehte. Ihn umwehte ein leicht chemischer Geruch, gemischt mit dem Duft von kaltnassem Leder, das langsam warm wird. Die Sporttasche baumelte an seinem Arm. Wohl zu Hause rausgeflogen, dachte sich Ewa und schloss die Tür. Ihr Gegenüber ließ die Tasche auf den Boden fallen.
»Ich bin Achim. Hallo. Ich hab deine Anzeige in der Zeitung gesehen und wusste, dass du die absolut Richtige für mich bist.«
»Wie schön«, entgegnete Ewa süffisant.
»Ich habe da eine Fantasie, weißt du. Nicht gerade das Alltägliche, okay? Also, mehr etwas Ungewöhnliches.«
»Hübscher, ich bin nicht erst seit gestern hier. Sag mir einfach, was du willst, und dann sage ich Ja oder Nein«, entgegnete sie und senkte dabei theatralisch den Daumen.
Der Mann wirkte gelöst. Ewa tippte auf Marihuana. Oder Ecstasy. Was für sie in Ordnung war. Sie rauchte schließlich selbst gerne hin und wieder mit Kolleginnen einen Joint, um an stressigen Tagen auf andere Gedanken zu kommen.
»Ich will Sex mit einer Toten haben.«
Ewa atmete tief ein. Jetzt war der Moment gekommen, an dem sie bereute, dass sie nicht einfach Feierabend gemacht hatte. Nachdem sie einen verklemmten Ehemann, der irgendwo in der Geschäftsführung eines mittelständischen Betriebes einiges zu sagen hatte, gefesselt, stranguliert und mit Plastikfolie fast erstickt hatte, bis er schließlich zum Höhepunkt kam, war so ein Szenario nun nicht genau das, was sie sich so spät noch vorstellte.
»Und wie soll das ablaufen?«, fragte sie.
Ihr Kunde streifte die Lederjacke ab und warf sie achtlos auf den Boden. Er lächelte erneut und musterte sie von oben bis unten. »Ich will, dass du es spielst. Du liegst einfach nur da. Ich mach auch nicht zu doll. Aber alles ohne Geräusche. Bewegungslos. Und mit Augen zu. So, als wärst du tot.«
Ewa hob skeptisch die Augenbrauen. Er schien schnell zu begreifen, dass er nun noch etwas ins Rennen werfen musste, um nicht wieder vor die Tür gesetzt zu werden.
»200 Euro?«
Ewa nickte und entkleidete sich rasch, denn ihr Gast schien kein ausschweifendes Vorspiel zu seiner Fantasie zu wünschen, und legte sich nackt aufs Bett. Ihre Brüste ragten keck nach oben. Sie hatte etwas nachhelfen lassen, aber sie hatte es mit den Implantaten nicht so übertrieben wie einige Kolleginnen. Hundert Gramm pro Seite, das war deutlich weniger als ein Erdbeerjoghurt. Sie schaute an die Decke, während sie es am Waschbecken im hinteren Bereich des Raumes plätschern hörte. Im Dämmerlicht beobachtete sie ihren Kunden und zuckte innerlich kurz zusammen. Seine Arme waren übersät mit narbig verheilten und frischeren Schnitten an der Oberfläche.
Er bemerkte, wie ihr Blick an seinem geschundenen Körper hängen blieb: »Das war mal eine wilde Zeit. Verstehst du? Es gibt auch wilde Zeiten im Leben.«
Eigentlich hätte Ewa dieser Satz gefallen, doch in Verbindung mit dem Menschen vor ihr machte er ihr Angst.
»Jetzt lass uns endlich anfangen. Dann kommst du auch schnell ins Bett. Also ins eigene …«, versuchte er die Situation aufzulockern.
Doch mit jedem Zentimeter, den er sich ihr näherte, fühlte sich Ewa unwohler. Und in ihrem Job war es immer ein schlechtes Zeichen, wenn das Bauchgefühl anschlug wie ein Hündchen, das allein in der Villa einer reichen Dame zurückgelassen wurde und bemerkte, dass sich ein ungebetener Gast Zutritt verschafft hatte. Doch sie wischte ihre Bedenken beiseite. Was soll schon passieren? Der Notrufknopf ist direkt neben meiner rechten Hand, dachte sie und rutschte unauffällig etwas zur Seite, damit ihr am Ende nicht entscheidende Zentimeter fehlten, um den Alarmmechanismus auszulösen.
Das neue Sicherheitssystem war eingerichtet worden, als die Rocker das Etablissement vor einigen Jahren vom Vorbesitzer, dem Inbegriff eines norddeutschen Luden, übernommen hatten.
»Jetzt mach mal die Augen zu und dreh dich auf den Bauch. Wir spielen jetzt tot«, flüsterte ihr Besucher mit den unzähligen Narben an seinen Armen.
Ewa schloss betont langsam die Augen, drehte sich lasziv um und spreizte gleichzeitig um wenige Zentimeter die Beine. Nur gerade so viel, um ihm einen Anreiz zu liefern, jetzt auch anzufangen.
Und sie hatte darauf geachtet, den Notrufknopf weiterhin in Reichweite zu haben. Ewa hatte sich die Position ihres Freiers genau eingeprägt, bevor sich ihre Augenlider vollends schlossen. Er stand direkt vor dem Bett und hatte seine gesamte Kleidung ausgezogen. Also konnte er kein Drosselwerkzeug oder eine Waffe bei sich tragen. Dann erstarrte sie plötzlich, als wäre ein Stromkreis in ihrem Körper unterbrochen worden. Sie hörte das leise, sirrende Geräusch eines Reißverschlusses. Er öffnete die Sporttasche!
Ewa riss die Augen auf, stützte sich bäuchlings auf und drehte ihren Oberkörper so weit herum, dass sie gerade noch erkennen konnte, was hinter ihr geschah. Sie war unfähig zu reagieren.
Der Mann blickte böse auf sie nieder. Seine Arme hingen schlaff herunter. Als er sah, dass Ewa ihn mit angsterfülltem Blick fixierte, schrie er sie an: »Tote öffnen nicht die Augen!«, und machte eine hektische Verrenkung, als wende er sich blitzartig von ihr ab. Doch tatsächlich holte er aus – mit einer glänzenden langen Klinge in der rechten Hand.
Ewa riss instinktiv die Beine an den Körper, stieß einen schrillen Schrei aus und versuchte, sich blitzschnell auf die rechte Seite zu drehen, um dem drohenden Hieb zu entgehen. Schnell, der Alarmknopf!
Aus der Kehle des Mannes drang ein bestialischer Laut, wie bei einem gefährlichen Tier, dem seine Beute zu entwischen drohte. Die Lautstärke des Schreis schien sich in pure Kraft zu verwandeln, die in seinen Arm und weiter in seine Hand schoss, die eine Machete umklammerte. Die Klinge war länger als sein Unterarm.
Da! Endlich spürte Ewa zwischen Mittelfinger und Zeigefinger der rechten Hand die runde Form des Notrufknopfes. Sie presste ihre Finger ohne Unterlass dagegen. In dieser Sekunde traf sie der erste Hieb mit einer ungeheuren Wucht. Die Klinge der Waffe zerschnitt die Haut, drang mit einem knirschenden Geräusch direkt in ihr linkes Schulterblatt und setzte ihren unbarmherzigen Weg durch das darunterliegende Fleisch fort. Als die Schneide auf harten Widerstand stieß, verzog der Mann schmerzverzerrt das Gesicht, als habe er gegen einen unnachgiebigen Laternenpfahl geschlagen.
Ewa trat auf der Seite liegend mit ihren nackten Füßen gegen die Schienbeine des Angreifers.
»Du kannst nichts machen, du bist doch tot!«, brüllte er scheinbar irritiert von der Wucht, mit der die Klinge auf den Knochen des Schulterblattes niedergefahren war.
Die Sekunden vergingen wie in Zeitlupe. Der Mann war jetzt vollkommen außer Kontrolle. Ewa drehte den Kopf, um ihre linke Schulter zu sehen, doch die Verletzung, der Schnitt, war zu weit oben. Als sie sich ruckartig bewegte, sprangen die Ränder der Wunde auseinander. Sie spürte, wie warmes Blut über ihren Oberkörper floss. Viel Blut.
8
21. Dezember, 0.35 Uhr Kiel. Eros-Center
Señora hatte leise schnaufend die Nackenmassage ihres Herrchens ohne Regung über sich ergehen lassen. Miguel hatte ihr so fest den Rücken geknetet, dass sich bei jeder Bewegung die schlaffe Haut über die wässrigen und ewig entzündeten Hundeaugen schob. Es wirkte, als würde das Tier einen drei Nummern zu großen Fellanzug tragen, der bei jeder Bewegung schlackerte.
Mit miefenden Fingern hatte sich Miguel sein Handy geschnappt, die Füße auf den Tisch mit den Monitoren gelegt und das Telefon entsperrt:
1661
ANGELS FOREVER, FOREVER ANGELS
Da war der heilige Miguel Nostalgiker. Er konnte sich nicht oft genug mit Genugtuung daran erinnern, dass die »Firma« ihm ein durchaus interessantes Leben beschert hatte. Besser als sein vorheriges Dasein als Zeitsoldat in einer Kaserne in Niedersachsen war es allemal. Zumindest gab’s mehr Frauen. Noch vier Stunden bis zum Ende seiner Schicht. Miguel gähnte unverhohlen. Da schrillte der hohe Piepton eines Zimmeralarms auf: zweiter Stock! Nummer 26! Noch ehe Señora zu einem Kläffen in Moll angesetzt hatte, war Miguel aus seinem Sitz hochgeschnellt und hatte mit einem gekonnten Griff den Teleskop-Schlagstock, der mit einem Klettverschluss unter der Tischplatte angebracht war, hervorgerissen. Dann war er aus dem Sicherheitsraum ins Treppenhaus gestürzt.
9
21. Dezember, 0.41 Uhr Kiel. Eros-Center
Für ein paar Sekunden fror die Situation in Zimmer sechsundzwanzig ein.
Ewa hatte sich wie eine Krabbe rücklings mit allen Gliedmaßen nach hinten geworfen, um so schnell wie möglich etwas Raum zwischen sich und den Wahnsinnigen zu bringen.
»Hör auf! Hör sofort auf!«, schrie Ewa panisch. Sie riss instinktiv die Arme nach oben, um ihr Gesicht zu schützen. Ihr nackter Hintern lag in der Blutpfütze, die aus der Verletzung ihres linken Schulterblattes herrührte. Das Blut stand regelrecht auf dem Laken, sickerte nicht ein. Es war einfach zu viel.
»Nicht schreien, du bist tot! Du bist doch tot. Und ich mache es besser.«
Die Stimme ihres Peinigers hatte sich in den drei Sätzen mehrmals überschlagen, als befinde er sich plötzlich wieder im Stimmbruch. Speicheltropfen spritzten aus seinem Mund. Er starrte erst auf die Machete, und dann irrte sein Blick wieder ihr zu.
Ewa konnte sich in ihrer Position nicht halten und schwankte bedenklich zur Bettkante.
Blitzartig holte er noch einmal aus. Wie ein Holzfäller, der einen nassen Eichenblock spalten wollte.
Ewa riss ihren Kopf aus der mörderischen Bahn der Klinge, die die Mitte ihres Gesichts nur knapp verfehlte und ihr, einer barbarischen Rasur gleich, einen breiten Streifen ihrer Wange abtrennte. Auf ihrer Bahn nach unten erwischte die Klinge drei Finger ihrer rechten Hand. Ewa versuchte sich aufzurichten, doch da schoss die Machete mit voller Wucht in ihre rechte Schulter – diesmal frontal. Der Stahl spaltete die Haut, zerstach das Weichgewebe und die Muskulatur und zertrümmerte ihr Schlüsselbein, das brach wie ein morsches Stück Holz. Ihr Schultergelenk knirschte unter der gewaltigen Macht der Klinge, und sie wurde zurück auf das Bett geschmettert.
Der gellende Schrei war ihr im Hals stecken geblieben.
Die Machete hing schräg in ihrer Schulter, und der Wahnsinnige ließ sie kurz los, als müsse er sich sammeln. Dann packte er mit beiden Händen den Griff der Waffe. Als er die Klinge heraushebeln wollte, zerbrach etwas Knöchernes in Ewas rechtem Schultergelenk. Ihre Augenlider flatterten, als würde sich ihr Körpersystem abschalten wollen, um ihr Weiteres zu ersparen. Ganz entfernt nahm Ewa wahr, wie plötzlich die Zimmertür aufflog und der bullige Sicherheitsmann hereinhechtete, seine massiven tätowierten Arme nach vorne gestreckt.
Miguel!
Als führe er sie an einer eisernen Leine, hielt der Irre die Machete fest, die noch immer in ihrer Schulter steckte. Doch langsam löste er seinen Griff, und es fühlte sich an, als sei die Klinge wie ein Haken an ihrem kraftlosen Körper befestigt.
Ewa versuchte, ein letztes Mal die Augen zu öffnen, und riss dabei stumm den Mund auf. Der Angreifer ließ endlich los und hob langsam die Arme. Seine Gesichtszüge entspannten sich schlagartig. »Ich wollte ihr nur Flügel machen. Dann hätte sie wegfliegen können.«
Ihre Augen hetzten hinüber zu dem Sicherheitsmann, der mit einem surrenden Geräusch den Totschläger in seiner rechten Hand ausfahren ließ. Dann konnte sie sich nicht mehr halten und kippte, blutüberströmt, ohnmächtig vom Bett. Den Aufprall auf dem harten Boden spürte sie nicht mehr.
10
7. Juni, 11.17 Uhr Kiel. Landgericht, großer Saal
Der große Saal des Landgerichts Kiel roch an diesem Donnerstagmorgen so sauber wie an einem Montagmorgen. Doch wenn er es sich recht überlegte, roch er eigentlich immer wie an einem Montag – eine Mixtur aus seit Jahrzehnten penibel gewischtem Linoleum und ungleich abgestandener Luft.
Professor Doktor Volker Schneider betrat, nachdem er von dem walrossbärtigen Justizbeamten aufgerufen worden war, den Gerichtssaal und musterte durch seine randlose Brille die Pressevertreter in der ersten Reihe, von denen einige schon sicherheitshalber dabei waren, einen Artikel zu dem »Macheten-Prozess« vorzubereiten. Die Reporter und TV-Journalisten hatten ihre bei so großen Prozessen übliche Position eingenommen, einige von ihnen mit Kaffeebechern in den Händen. Das Zeug war wässrig und untrinkbar heiß, das wusste Schneider aus eigener leidvoller Erfahrung. Aber die Kantine im Souterrain des Gebäudes war nicht gerade ein Starbucks. Aber für ein paar gute Bilder vom »Flügelmacher« würde man auch eine verbrannte Zunge in Kauf nehmen. So hatte die Presse Achim Wittfeld bereits kurz nach seiner Festnahme getauft. Das Interesse der Medien hatte dann aber etwas abgenommen, als klar wurde, dass der »Flügelmacher« nicht, wie zuerst berichtet, im Namen Satans ein Blutopfer bringen wollte, dann jedoch von einem stadtbekannten Rocker daran gehindert worden war.
Schneider war ein schlanker Mann von dreiundfünfzig Jahren, seine weißblonden Haare trug er streng nach hinten gekämmt. Nie löste sich eine Strähne. Genauso selten kam es vor, dass er laut lachte. Ein Lächeln in seinem kantigen, fast knochigen Gesicht, in dessen Mitte eine prominente Hakennase thronte, zu erhaschen war eine Seltenheit. Mit seinen langen und sehnigen Gliedmaßen bewegte er sich nahezu raubtierhaft. Die Presse war fasziniert von dem knapp ein Meter neunzig großen Mann, der vor Gericht stets mit Fliege am Kragen eines akkurat gebügelten weißen Hemdes und in einem faltenfreien schwarzen Anzug erschien.
Schneider neigte dazu, jeden Raum, den er betrat, inklusive Gerichtssäle, zu seinem Eigentum zu erklären. Dabei blieb er stets kühl und distanziert. Doch er konnte auch anders. Nämlich dann, wenn er nicht wie ein Experte, oder vielmehr der Experte, behandelt wurde. Dann veränderte sich sein distanzierter Gesichtsausdruck – sein Blick wurde zu dem eines mächtigen Greifvogels, der bereit war, auch auf Löwen einzuhacken, wenn es denn nötig wurde.
Zunächst ließ er seinen Adlerblick durch den Gerichtssaal schweifen und scannte routiniert jeden einzelnen Anwesenden. Im Zuschauerraum hatte sich die übliche Publikumsmischung zu Prozessauftakten dieser Art eingefunden: schreibende Journalisten (Reihe eins). Jura-Studenten (Reihe zwei). Schaulustige, Verrückte und fernsehmüde Rentner (Reihe drei).
Schneider ging zielstrebig zum Zeugen- und Sachverständigentisch, der dem Vorsitzenden Richter und seinen Schöffen gegenüberlag. Im Saal war es still geworden. Für jeden hörbar zog Schneider den Stuhl, auf dem er Platz nehmen wollte, mit einem Quietschen über den Linoleumboden nach hinten.
»Guten Morgen, Herr Professor«, begrüßte der Vorsitzende Richter, ein junger Mann, der so aussah, als ob er eben erst sein Jurastudium abgeschlossen hatte, Schneider mit einem dankbaren Lächeln. Der Richter schien beruhigt zu sein, dass ein so erfahrener und anerkannter Gutachter nun die Sache aufklärte. Danach würden sich sicher nicht mehr allzu viele Fragen ergeben.
Schneider war sich mehr als bewusst, dass er als absolute Koryphäe auf dem Gebiet der Rechtsmedizin galt. Sie wussten, er war redegewandt, und waren von seiner bundesweit gefragten Kompetenz als Sachverständiger beeindruckt. Doch die Journalisten und Prozessbeteiligten wussten mittlerweile auch, dass sie ihm besser nicht zu nahe traten. Schneider freute sich innerlich, dass sich der junge Jurist entsprechend nervös mit der Hand durch seinen altmodischen Scheitel fuhr.
Er persönlich hatte Wittfeld noch in der Tatnacht auf dem Kieler Polizeipräsidium eine Blutprobe entnommen, um zu überprüfen, ob der Irre zum Zeitpunkt der Tat unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Einige Tage später hatte er dann Wittfelds Opfer in der Klinik auf die Lebensgefährlichkeit der Verletzungen hin und zur Frage, wie oft mit der Machete zugestochen worden war, untersucht.
Die für den geordneten Ablauf der Gerichtsverhandlung zuständigen Justizbeamten hatten wenige Minuten vor Prozessauftakt auf dem Gerichtsflur nachgeprüft, ob auch wirklich alle für den Verhandlungstag notwendigen Protagonisten anwesend waren: die Zeugen, die am Geschehensort zuerst eingetroffenen Polizeibeamten, der Notarzt, der Vater des Angeklagten, ein hoffnungsloser Trinker, und der Sicherheitsmann des Bordells, Miguel Sandero, ein szenebekannter Soldat der örtlichen Rockerarmee. Ihn hatten sie natürlich als Sachverständigen zuerst begrüßt.
Das Opfer, die Polin Ewa Barczak, sollte erst am Nachmittag aussagen. Ihr entstelltes Gesicht hatte mehrere umfangreiche operative Gesichtsrekonstruktionen notwendig gemacht, die allerdings für die junge Frau ästhetisch nicht unbedingt befriedigend verlaufen waren. Ihr rechter Arm, an dessen Hand seit dem Vorfall im Laufhaus drei Fingerendglieder fehlten, hatte aufgrund der Zertrümmerung ihres rechten Schultergelenks operativ versteift werden müssen, was zur Folge hatte, dass er jetzt wie ein widerspenstiger Ast von ihrem Körper abstand. Sie war physisch und psychisch kaum belastbar, und es war fraglich, inwieweit sie den Strapazen der Gerichtsverhandlung überhaupt würde standhalten können.
Schneiders Blick fiel fast beiläufig auf die Bank des Angeklagten, die sich nun links von ihm befand. Wittfeld trug Handschellen, die seine Handgelenke vor seinem Körper fixierten. Zwei Justizvollzugsbeamte flankierten den »Flügelmacher« und seinen Anwalt. Ein medienfreundlicher Pflichtverteidiger, der bekannt dafür war, mit schnellen Geständnissen und Reuebekundungen ein erträgliches Strafmaß für seine Mandanten auszuhandeln.
Die Zeit in der U-Haft hatte Wittfeld offenbar schwer zugesetzt. Der Drogenentzug hatte seine Spuren nicht nur in Form von tiefen Augenringen hinterlassen.
Der »Flügelmacher« schlief scheinbar nur wenig und wenn, dann nur mit medikamentöser Unterstützung. Aber nicht, weil ihn das schlechte Gewissen plagte. Es ist wohl eher eine Reaktion seines Körpers auf den fehlenden Stoff, stellte Schneider trocken für sich fest. Mit einem routinierten Blick bemerkte er, dass man Wittfeld die Haare abrasiert hatte, auf der Kopfhaut schimmerten wunde Stellen – vielleicht hatte er versucht, sie sich auszureißen. Schneider hatte sich über die Jahrzehnte hin angewöhnt, sich nicht mit menschlichen Gedanken und menschlicher Logik den Tätern und Opfern, die ihm begegneten, zu nähern. Nur so funktionierte der medizinische Hochleistungscomputer in seinem Gehirn fehlerfrei.
Er musste es auch nicht mit eigenen Augen gesehen haben, dass die Kameras der Pressevertreter heißgelaufen waren, als Wittfeld den Gerichtssaal betreten hatte. Die Blitzlichter hatten jeden Millimeter seiner fahlen Haut abgetastet, als sei es möglich, das Böse im Menschen durch besonders grelles Licht sichtbar zu machen.
Bereits im Vorfeld hatte Schneider erfahren, dass Wittfelds Anwalt ein umfassendes Geständnis angekündigt hatte. War ja auch nicht anders zu erwarten, war Schneiders Reaktion gewesen.
»Guten Morgen Hohes Gericht.« Schneider nickte in Richtung des Vorsitzenden Richters und blickte danach kurz nach links zum Strafverteidiger und nach rechts zum Staatsanwalt, dessen Hände siegessicher auf seiner Akte ruhten.
Der Staatsanwalt hatte eine simple, aber aussagekräftige Anklageschrift wegen versuchten Mordes verfasst. Die Tathandlung, so seine Argumentation, hatte sich nicht nur in einem Bordell abgespielt, was eine sexuelle Erregung des Angeklagten und die Tatausführung zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs vermuten ließ, sondern es war auch eine Zeichnung in Wittfelds Wohnung gefunden worden. Eine Kritzelei, die eine Frau ohne Arme zeigte, und der stattdessen Flügel aus dem Körper wuchsen.
Der Angeklagte schien die Tat folglich von langer Hand geplant zu haben und hatte dabei den Tod seines arglosen Opfers, das von dem Angriff völlig überrascht wurde, billigend in Kauf genommen. Neben einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wollte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer beantragen, dass Wittfeld in eine Einrichtung des Maßregelvollzugs eingewiesen werden sollte, um dort zunächst therapiert zu werden, ehe er seine Freiheitsstrafe im regulären Vollzug antreten würde.
Durch das frühe Geständnis schien der gewiefte Strafverteidiger nun jedoch die Sache nicht nur abzukürzen, sondern ihm auch in die Parade fahren zu wollen.
Nachdem Schneider dem Gericht seine Personalien zu Protokoll gegeben hatte, leitete der Richter die Befragung des rechtsmedizinischen Sachverständigen ein, indem er kurz die wesentlichen Aspekte des bisherigen Prozessverlaufs an diesem Vormittag zusammenfasste: »Herr Professor, der Angeklagte hat durch seinen Verteidiger bereits umfänglich die Tat gestanden und bedauert diese sehr. Hier ist noch einmal hervorzuheben, dass er sich demnach von der Geschädigten bedroht fühlte und glaubte, Opfer eines Übergriffs zu werden. Die Wahrhaftigkeit dieser Aussage gilt es natürlich zu überprüfen. Fakt ist: Zum Tatzeitpunkt stand der Angeklagte unter dem Einfluss einer harten synthetischen Droge, das wissen wir aus dem toxikologischen Gutachten, das Bestandteil der Gerichtsakte ist. Aber nun sind wir auf Ihre Rekonstruktion der Ereignisse, die zu den schweren Verletzungen der Geschädigten führten, gespannt.«
Schneider räusperte sich, als könne er so seine tiefe Stimme etwas aufhellen. Mit dunklem Timbre begann er seine Ausführungen von der Inaugenscheinnahme des Opfers. Er berichtete von dem ersten Macheten-Hieb, der von hinten auf den Körper der Frau niedergegangen war. Dieser Hieb hatte den Knochen des linken Schulterblattes getroffen und musste mit einer Entschlossenheit ausgeführt worden sein, die keinesfalls als eine Verteidigungsmaßnahme gegen eine unbewaffnete nackte Frau bewertet werden konnte.
»Mit dem zweiten Schlag hat der Angeklagte den Schädel des Opfers nur um Millimeter verfehlt. Er hätte ihr ohne Weiteres die obere Hälfte des Kopfes abschlagen können. So wurde nur ein Teil des Gesichtsfleisches der linken Wange abgetrennt. Und für alle, die hier mitschreiben …«, er drehte sich kurz um und sah zu den Journalisten im Zuschauerraum, ehe er fortfuhr, »… ich sage bewusst ›nur‹, weil wir hier im wahrsten Sinne des Wortes um ein Haar in einem Prozess um ein vollendetes Tötungsdelikt sitzen würden. Denn der wirklich verheerende Schlag war der dritte, der um Haaresbreite nicht nur den rechten Arm der Geschädigten abgetrennt hätte, sondern auch die rechte Oberarmschlagader so massiv verletzt hat, dass sie um ein Haar verblutet wäre«, führte Schneider aus.
Nachdem Schneider geendet hatte und noch einige Nachfragen seitens des Staatsanwalts und der Verteidigung beantwortet hatte, war klar, dass der Angeklagte in der damaligen Situation alles gewesen war, nur nicht ein in Notwehr handelnder Mann.
Wittfelds Blick glitt fast unmerklich hinüber zum Vorsitzenden Richter und zu den Schöffen, ehe er wieder vor sich hin ins Leere starrte.
Schließlich wurde der Sachverständige entlassen. Der Richter hatte sich von Schneider in seiner Meinung scheinbar bestätigt gefühlt und nickte zufrieden. Als sich Schneider unter dem erneuten Quietschen des Stuhls auf dem Linoleumboden erhoben hatte, reckten die Zuschauer die Hälse, um noch einen Blick auf den hochgewachsenen Rechtsmediziner zu werfen, der gerade das Schicksal von Wittfeld besiegelt zu haben schien.
Teil 2
Dreieinhalb Jahre später
11
5. Januar, 16.38 Uhr Kiel-Gaarden. Mühlenstraße
Es hatte wieder zu schneien begonnen. Ein arktisches Tiefdruckgebiet machte sich von Norden über Schleswig-Holstein her. Trotzdem blieben keine Schneeflocken liegen, sondern nur Schneematsch, der sich farblich dem blassgrauen Licht der trostlos wirkenden Häuser in Kiel-Gaarden anpasste. Noch in der Sekunde, als die weißen Flocken den Asphalt berührten, nahmen sie die triste Hoffnungslosigkeit der Bewohner des Stadtteils an, der seit Jahrzehnten als sozialer Brennpunkt galt. Auch wenn kaum ein Politiker das offen aussprach. Was einst als Bezirk der Werftarbeiter zum Leben erweckt worden war, bot inzwischen in vielerlei Hinsicht die Kulisse für menschliche Dramen aller Art.
Mit seiner großen breiten Statur, die er unter einer grauen Windjacke versteckte, und seinem Pferdeschwanz, der schlaff seinen Rücken herunterhing, fiel er hier nicht weiter auf. Sein Gesicht und sein stoppeliges Kinn hatte er unter einem dunkelgrünen Armeeschal vergraben. Unbeirrt stapfte er in schweren Bikerboots durch die kalte Nässe. Sein schnelles Schritttempo ließ erahnen, dass für Oberkommissar Michael Tomforde diese Straßen wahrlich kein Neuland waren – schließlich war er hier aufgewachsen. Doch mit dem Viertel, in dem er seine gesamte Kindheit und Jugend verbracht hatte, hatte Gaarden kaum noch etwas gemein. Dennoch hatte es ihn umso mehr berührt, als er jetzt am späten Nachmittag in seiner Funktion als Todesermittler in die kleine Wohnung in der Mühlenstraße beordert worden war. Nur knapp hundert Meter vom Vinetaplatz entfernt, über den er als Junge im Sommer immer mit einem Fußball gerannt war. Eine Straße weiter hatten seine Eltern bis zu ihrem Tod gelebt. Seine Mutter war 1985 an Krebs gestorben, wenige Monate später sein Vater an Alkohol und Einsamkeit.
Als Tomforde an dem fünfstöckigen Backsteinhaus, in dem schätzungsweise zwanzig Parteien lebten, angekommen war, schaute er zunächst nach oben. Schneeflocken rieselten ihm in die Augen. Aber er wusste ohnehin gut genug, wie die Häuser in diesem Teil der Stadt aussahen. Dann schob er die Haustür des Mietshauses auf, orientierte sich kurz im Flur und stieg die Treppen in die zweite Etage hinauf. Die Kollegen der Spurensicherung waren sicherlich bereits an die Arbeit gegangen.
Alles schien auf die Selbsttötung einer verzweifelten alten Frau hinzudeuten: Edda Steen, Rentnerin. Vielleicht war sie am Ende ihres Lebens genauso auf Grund gelaufen wie unzählige andere ihres Jahrgangs: Die Rente reichte nicht bis zum Ende des Monats, ein soziales Gefüge in ihrem näheren Umfeld gab es nicht mehr, und um keinen Preis hätte sie sich bei der Essenausgabe der Wohlfahrt angestellt. Zusammen mit dem Gesocks. Dann lieber gehen. Für immer.
Nicht nur Gaarden, das ganze Scheißland hat sich verändert, ging es Tomforde durch den Kopf. Überall in Deutschland gab es laut polizeilicher Kriminalstatistik Jahr für Jahr mehr Senioren, die sich wegen Altersarmut und Einsamkeit das Leben nahmen. Es gab sogar einen Fachterminus für dieses Phänomen, so als ob man damit dem Geschehen seinen Schrecken nehmen könnte: Alterssuizid. Das hatte es nicht gegeben, als er vor knapp dreißig Jahren in den Polizeidienst eingetreten war.
Eine Nachbarin hatte gegen 15 Uhr die Polizei gerufen, weil Edda Steens kleiner Yorkshire-Terrier-Mischling unermüdlich in der Wohnung gekläfft hatte. Wie lange, wusste die Nachbarin nicht mehr. Auf jeden Fall lange. Die Streifenkollegen hatten dann die Leiche der Dreiundachtzigjährigen gefunden.
Die Wohnungstür öffnete sich plötzlich wie von allein, und vor Tomforde stand eine junge Kollegin der Spurensicherung. Sie trug einen weißen Anzug und einen Mundschutz, und der Ermittler sah lediglich ihren kurzen blonden Haaransatz und ihre freundlichen grünen Augen.
»Moin, Kollege. Wir sind hier schon fast fertig. Wenn Sie mich fragen, dürfte das einer der traurigsten Suizide des Jahres werden«, begrüßte sie ihn.
Tomforde klopfte sich die letzten Schneeflocken, die sich auf seiner Jacke festgesetzt hatten, von den Ärmeln. »Ich schau’s mir mal an«, murmelte er, als er eintrat, und die blonde Kollegin nickte und folgte ihm.
In der Wohnung lief die Heizung auf Hochtouren, und Tomforde fing sofort an zu schwitzen. Mit dem Fuß stieß er versehentlich gegen einen gut gefüllten Hundefressnapf. »Sorry, hab ich nicht gesehen …«
Die Kollegin, die sich inzwischen den Mundschutz heruntergezogen hatte, nickte verständnisvoll und führte ihn ins Bad. Er kannte die junge Frau, die er auf etwa Mitte zwanzig schätzte, zwar vom Sehen, ihr Name fiel ihm aber partout nicht mehr ein.
Im Badezimmer saß die tote Edda Steen leicht vornübergebeugt auf dem Toilettendeckel. Sie war akkurat gekleidet: dunkle Stoffhose, keine Schuhe, helle Bluse. Darüber eine weinrote Strickjacke. Alles hätte eigentlich recht friedlich ausgesehen, wenn da nicht die weihnachtliche Lichterkette gewesen wäre, die die Tote in sitzender Position auf dem Toilettendeckel fixierte. Das Stromkabel war an einem kleinen Heizkörper befestigt, der sich oberhalb der Toilette an der Wand befand. Die Lichterkette war mehrfach um ihren Hals geschlungen, und die kleinen Lämpchen an dem dünnen Kabel, das in vier Touren stramm um den Hals der Toten gewickelt war, standen fast alle waagerecht zu den Seiten ab. Das erinnerte Tomforde an das Stachelhalsband von Hector – den Hofhund seines Onkels, der einen Schrottplatz am Rande Kiels betrieben hatte. Das Gesicht der alten Frau wirkte aufgedunsen. Aus beiden Nasenlöchern war blutiges Sekret herausgetropft, das ein kleines V-förmiges Rinnsal, das krustig eingetrocknet war, bis zum Kinn gezogen hatte. Ihre Zungenspitze hatte den Weg durch die spaltbreit geöffneten Zahnreihen gefunden und hing wie der Schwanz eines toten Aals aus dem Mund heraus.
Tomforde ging in die Hocke. Auch im Bad war es unerträglich warm. Alte Menschen frieren nun mal schnell, dachte er und sah der toten Frau direkt ins Gesicht.