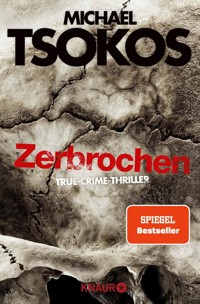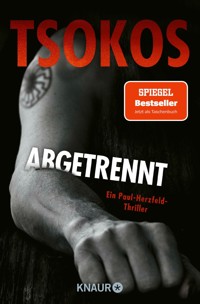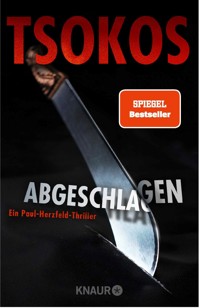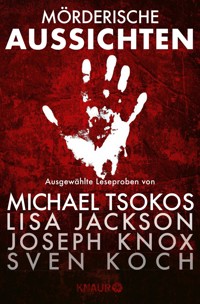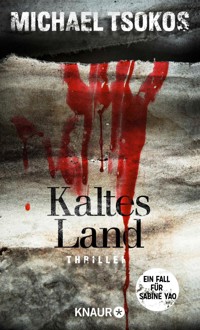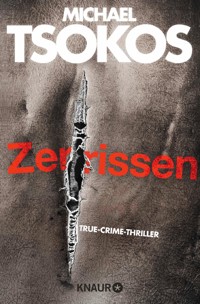
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fred Abel-Reihe
- Sprache: Deutsch
Rechtsmediziner Dr. Fred Abel ist zurück – in einer nervenzerreißenden Mischung aus True Crime, klassischer Ermittlung und hartem Thrill Dr. Fred Abel muss vor Gericht in einem besonders schweren Fall von Misshandlung aussagen. Bei dem Opfer, einem kleinen Mädchen, handelt es sich ausgerechnet um die Nichte seiner langjährigen Kollegin Sabine Yao. Das Verhältnis zwischen den beiden Rechtsmedizinern ist dadurch äußerst angespannt. Währenddessen findet Privatermittler Lars Moewig, Fred Abels alter Freund, in seinem Kickboxclub eine grausam zugerichtete Leiche in einem Boxsack. Lars muss wissen, wer in seinem Club Männer in Sandsäcke einnäht und bittet Abel um Hilfe. Schon bald führen ihre Nachforschungen sie in die Welt der libanesischen Drogen-Clans. Eine Schattenwelt, in der es weder Gefangene noch Zeugen geben darf, seien sie auch noch so jung und unschuldig … »Zerrissen« ist Band 4 der Fred Abel-Reihe von Michael Tsokos und setzt die True-Crime Bestseller-Trilogie »Zerschunden«, »Zersetzt« und »Zerbrochen« mit atemberaubender Spannung fort. Die spannenden True-Crime-Thriller um Dr. Fred Abel sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Zerschunden (Michael Tsokos & Andreas Gößling) - Zersetzt (Michael Tsokos & Andreas Gößling) - Zerbrochen (Michael Tsokos & Andreas Gößling) - Zerrissen (Michael Tsokos) - Zerteilt (Michael Tsokos)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Tsokos mit Wolf-Ulrich Schüler
Zerrissen
True-Crime-Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dr. Fred Abel muss vor Gericht in einem besonders schweren Fall von Misshandlung aussagen. Bei dem Opfer, einem kleinen Mädchen, handelt es sich ausgerechnet um die Nichte seiner langjährigen Kollegin Sabine Yao. Das Verhältnis zwischen den beiden Rechtsmedizinern ist dadurch äußerst angespannt.
Währenddessen findet Privatermittler Lars Moewig, Fred Abels alter Freund, in seinem Kickboxclub eine grausam zugerichtete Leiche in einem Boxsack. Lars muss wissen, wer in seinem Club Männer in Sandsäcke einnäht und bittet Abel um Hilfe. Schon bald führen ihre Nachforschungen sie in die Welt der libanesischen Drogen-Clans. Eine Schattenwelt, in der es weder Gefangene noch Zeugen geben darf, seien sie auch noch so jung und unschuldig …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Die Handlung in »Zerrissen« spielt
zwei Jahre nach den Ereignissen in »Zerbrochen«
Nach wahren Begebenheiten
Prolog
Sie würden alles tun, um ihn zu finden, denn er hatte sich genommen, was ihnen gehörte. Und das würden sie ihm nicht durchgehen lassen. So viel war sicher.
Jetzt musste er schnell sein. Alles erledigen. Sonst war sein Leben in höchster Gefahr.
Er drückte die schwere Stahltür von innen ins Schloss. So leise wie möglich. An der Außenseite der stählernen Tür war nur ein Knauf angebracht, das würde ihm Zeit verschaffen, falls sie ihm folgten.
Aber mir ist niemand gefolgt!, versuchte er sich selbst zu beruhigen.
Er ging in der Dunkelheit der Halle ein paar unsichere Schritte nach vorn. Im Sommer war der Geruch hier drinnen noch unerträglicher als sonst: abgestandene, stickige Luft. Eine Mischung aus getrocknetem Schweiß, altem Leder, Metall und Gummi, die man nahezu schmecken konnte.
Nervös tasteten seine Finger die raue Wand ab. Hier muss doch der verdammte Lichtschalter sein? Doch er verwarf den Gedanken sofort wieder. Kein Licht! Es würde nur auf mich aufmerksam machen.
Er griff in seine Hosentasche, holte sein Handy heraus und schaltete die Taschenlampe des Gerätes ein.
Dann bahnte er sich in dem bleichen, fahlen Lichtkegel einen Weg nach hinten, zu dem Raum mit den Schränken. Dort hatte er alles sicher verstaut. Es war lange Zeit das perfekte Versteck gewesen. Aber jetzt hatte sich die Situation grundlegend geändert. Sie waren hinter ihm her und hetzten ihn. Hetzten ihre Beute.
Aber ich werde euch entkommen.
Der Lichtschein der Handytaschenlampe hüpfte mit jedem seiner Schritte über den abgenutzten Holzfußboden.
Zum Schrank. Die Ware holen. Dann nichts wie raus aus Berlin. Untertauchen, frei sein – endlich! Die ganze Scheiße hinter mir lassen. Meinem alten Herrn wird das gefallen.
Dann hörte er das Geräusch. Ein Rütteln, dann ein Schaben.
Was ist das?
Ein Kratzen, das immer lauter wurde, und dann ein Knacken. Metall bog sich. Wieder ein Knirschen. Jemand brach die Tür auf! Dann ein lautes Krachen. Ein Lichtschein fiel durch die sich langsam öffnende Stahltür in das Innere der Halle.
Noch war er in der Dunkelheit im hinteren Teil verborgen. Hastig wollte er die Handytaschenlampe ausschalten, doch das Gerät rutschte ihm aus der schweißnassen Hand, fiel krachend zu Boden.
Scheiße. Großer Fehler!
Aber wie hatten sie ihn so schnell hier gefunden?
Er hörte Schritte, suchte mit hämmerndem Herzen nach einem Versteck.
Da sprangen schon surrend die Neonröhren an der Decke an. Grelles Licht erhellte jeden Winkel der Halle.
Drei Männer starrten ihn wütend an.
»Du denkst wirklich, es wäre so leicht, uns abzuschütteln?«, rief eine tiefe Stimme zu ihm herüber.
Er kannte die Stimme. Die Familie war da. Plötzlich bereute er, ihre Macht so unterschätzt zu haben.
Die drei Männer kamen auf ihn zu. Langsamen Schrittes, ganz ohne Eile. Wie auch das unabwendbare Schicksal keine Eile hat. Nach hinten gibt es keinen Ausgang, ich sitze in der Falle. Jetzt schlau sein. Rausreden. Abstreiten. Egal, was kommt.
Doch die Männer wollten nicht mit ihm reden.
Der erste Schlag traf ihn im Gesicht. Er hörte sein Jochbein brechen, ein Krachen wie morsches Holz. Dann der nächste Schlag. Er zwang sich, nicht zu schreien. Es fiel ihm unendlich schwer.
»Wo ist es? Sag es uns, mach schon!«, forderte die Stimme, als er schon gekrümmt am Boden lag.
Er sagte nichts, schluckte den Schmerz herunter.
Dann folgten die Tritte. In seine Flanken, von oben auf seinen Brustkorb, gegen seinen Kopf, um den er schützend die Arme gelegt hatte.
Ihm wurde schwindelig, der Boden schien nach unten wegzubrechen, als wollte er ihn in die Hölle auskippen. Wenn er das hier überlebte, wenn er hier lebend rauskam, würde er Schluss machen. Aufhören. Der Vergangenheit den Rücken zukehren, ganz neu anfangen. Das schwor er sich.
Dann schleiften sie ihn brutal über den Boden. Durchhalten. Atmen. Nichts sagen.
Das Blut lief in seine Augen, ein roter Schleier verdeckte sein Blickfeld.
Sie rissen an seiner Kleidung. Sie zerfetzten sein T-Shirt. Die Schuhe, die Hose – alles rissen sie ihm vom Körper. Er versuchte, sich das Blut aus seinen Augen zu wischen. Vergeblich.
Sie hatten ihn bis auf die Unterhose entkleidet. Er konnte nicht mehr und begann zu wimmern. »Bitte! Bitte …«, flehte er.
Als würde das etwas ändern.
Ein eiserner Griff im Nacken drückte seinen Kopf auf seine Brust, zwei Hände rissen brutal seine Fußknöchel nach oben, zogen die Füße in die Luft. Die nackte Haut seines Rückens scheuerte über den harten Holzboden. Er stöhnte.
Seine Wirbelsäule schien zu bersten, als die Knie gegen sein Gesicht schlugen. Ein verzweifelter Schmerzensschrei entfuhr ihm, und er presste die Zähne fest aufeinander, dass sie zu brechen drohten.
Der Schrei trieb seine Peiniger nur an.
Sie hoben ihn hoch, stopften ihn in ein stinkendes, dunkles Etwas. Wie Fleischabfälle in einen Müllsack. Ledergeruch. Schmerzhafte Enge. Er keuchte, das Atmen fiel ihm schwer.
»Zunähen!«, befahl die tiefe Stimme.
Und der letzte Lichtstrahl verschwand.
1
Berlin-Moabit, Institut für Rechtsmedizin der Charité, Leichenannahme, Mittwoch, 23. Juli, 23:12 Uhr
Beschwingt warf Julius Blohm den gigantischen Schlüsselbund mit der rechten Hand in die Höhe und fing ihn geschickt mit der linken wieder auf. In dieser Jahreszeit, und zumal bei der Hitze, die Berlin seit Wochen beharrlich scheinbar zum Schmelzen bringen wollte, beneideten seine Freunde ihn erstmalig um seinen studentischen Nebenjob: Nachtdienst in der Rechtsmedizin. Seine Aufgabe bestand in der Annahme der Leichen, die die Hauptstadt regelmäßig nachts ausspuckte. Sein Arbeitsplatz war das Leichenschauhaus der größten deutschen Metropole, das dem Institut für Rechtsmedizin angegliedert war.
Bei der Toten auf der metallenen Bahre vor Julius Blohm handelte es sich um eine vierundsiebzigjährige verwitwete Rentnerin, die leblos in ihrer Wohnung in Berlin-Charlottenburg aufgefunden worden war. Die Informationen entnahm Blohm dem Notarzteinsatzprotokoll, das die Leichenwagenfahrer der Rechtsmedizin ihm mitsamt der Toten am Hintereingang dieses Institutsgebäudes, der Leichenanlieferung, kurz vor 23 Uhr übergeben hatten.
Der Sohn der Toten, Ende vierzig, der seit Beginn seiner Arbeitslosigkeit vor zwei Monaten zu seiner Mutter in deren Zweizimmerwohnung eingezogen war, hatte seinen Wohnungsschlüssel vergessen und fast zwanzig Minuten vergeblich an der Wohnungstür geklingelt und geklopft. Er hatte sich zunehmend Sorgen um seine Mutter gemacht, die aufgrund einer noch nicht lange zurückliegenden Operation, bei der ihr eine künstliche Hüfte eingesetzt worden war, noch nicht mobil genug war, die Wohnung selbstständig zu verlassen. Deshalb hatte er sich schließlich nicht anders zu helfen gewusst, als den Notruf zu wählen. Kurz darauf hatten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr im Beisein der Polizei die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Nur wenige Minuten später war ein Notarzt vor Ort eingetroffen, der die Feuerwehrleute bei ihren Reanimationsmaßnahmen der auf dem Wohnzimmerboden leblos aufgefundenen Wohnungsinhaberin unterstützte. Allerdings waren auch die Bemühungen des Notarztes nicht von Erfolg gekrönt, und die Vierundsiebzigjährige war gegen 21:36 Uhr für tot erklärt worden. Todesart: ungewiss.
Das Resultat des frustran verlaufenen Rettungseinsatzes lag nun vor Julius Blohm auf der Bahre.
Der vierundzwanzigjährige Medizinstudent hatte das Einchecken, wie er die Aufnahme von Leichen im Institut bezeichnete, schnell hinter sich gebracht. Zuerst die Übergabe und Dokumentation von eventuellen Wertsachen, Schmuck und Bekleidung der Toten durch die Leichenwagenfahrer sowie die anschließende Feststellung von Körpergewicht und Körperlänge der Toten. Dann die obligatorische Befestigung des Leichenfußzettels – darauf die Personalien der Toten – mit grobem Bindfaden am linken großen Zeh der Toten. Die erforderlichen Unterlagen zur Übergabe an das Personal des Leichenschauhauses am nächsten Morgen hatte Blohm ebenfalls ausgefüllt und dann die tote Charlottenburger Witwe in einen der weißen Plastikleichensäcke verfrachtet.
Jetzt löste er mit der Spitze seines rechten weißen Turnschuhs die Bremse an den Rädern des Untergestells der Bahre. Sogar in der Leichenanlieferung war die Hitze des vergangenen Tages noch allgegenwärtig, und feine Schweißperlen lösten sich von seiner Stirn und tropften auf den weißen Leichensack. Umso mehr freute er sich auf die Kühle, die ihn erwartete. Und tatsächlich, genau in dem Moment, als Blohm die Tür zwischen dem Kellertrakt der Rechtsmedizin und der Leichenanlieferung mit einem der Schlüssel von seinem gewaltigen Bund wieder hinter sich zuschloss, löste sich die Sommerhitze in der mechanischen Kühle auf, die in diesem Teil des Gebäudes herrschte. Hier mischte sich der Geruch von scharfen Putzmitteln mit dem süßlichen Duft der Gase, die aus den Toten austraten und von ihrem verflüchtigten Leben zeugten. So roch der Tod. Zumindest hier. Süßlich, aber auch irgendwie sauber. Der Duft der Forensik.
Er schob das mit vier Rollen versehene Untergestell der Bahre mitsamt der Toten weiter in Richtung des geräumigen Kühlraumes und spürte die kühlen Metallgriffe unter den dünnen Latexhandschuhen. Laut Protokoll wog die Tote 52 Kilogramm. Im Gegensatz zu anderen Verstorbenen, bei denen es ihm manchmal schwerfiel, die Bahre durch die verwinkelten Kellergänge hier unten zu schieben, war sie ein echtes Leichtgewicht. Die Menschen wurden immer dicker, also wurden nicht nur die Toten, sondern auch sein Job in der Rechtsmedizin zunehmend schwerer.
Die kleinen Räder quietschten leise auf dem Linoleumboden, als hätte sich hier im Untergeschoss der Rechtsmedizin eine Mäusefamilie versteckt. Das Licht der Neonröhren ließ den grünen Boden glänzen. Aus seinem Aufenthaltsraum drang Radiogedudel zu ihm herüber. Dort würde er es sich gleich wieder bequem machen. Bis zum nächsten Anruf. Bis zur nächsten Leichenanlieferung. Zwölf Stunden unter Toten, das ist eine sehr stille Angelegenheit, ging ihm durch den Sinn. Insofern schätzte er das Hintergrundgedudel des Radios von Zeit zu Zeit bei seiner Arbeit.
Der Medizinstudent hatte den riesigen Kühlraum am Ende des langen Flurs fast erreicht. Dort war für bis zu achtzig Tote in offenen Regalfächern Platz, bei konstanten vier Grad Celsius. Die unsichtbare Mäusefamilie begann lauter zu quietschen.
An der Metalltür des Kühlraums angekommen, fischte Blohm erneut den Schlüsselbund aus seiner Kitteltasche und warf ihn pfeifend in die Luft. Er wollte ihn abermals lässig wieder auffangen, doch er rutschte ihm klirrend durch die Finger. Mit einem dumpfen Geräusch landete der schwere Schlüsselbund auf der festen, gummiartigen Außenhaut des weißen Leichensacks vor ihm, ungefähr dort, wo sich der Kopf der Toten befinden musste, und blieb dort liegen. Allerdings nur für einen kurzen Moment, denn als Blohm danach greifen wollte, rutschte er, noch bevor seine Finger ihn zu fassen bekamen, plötzlich herunter und landete laut rasselnd auf dem grünen Linoleumboden. Blohm zuckte zusammen. Verdutzt starrte er auf den Leichensack. Was war denn das?, dachte er. Er hatte die Schlüssel gerade wieder an sich genommen, richtete sich aus seiner gebückten Haltung auf und befand sich auf Augenhöhe mit der Leiche, als er es sah: eine Bewegung, im Inneren des Leichensacks!
Auch wenn das feste, starre Material der Säcke nur wenig über den Inhalt und die Konturen ihres Inhalts preisgab – im Leichensack hatte sich etwas bewegt. Da war er sich absolut sicher.
Die Augen des Studenten weiteten sich, starr vor Schreck.
Da! Schon wieder!
Blohms Atem ging schneller, kam jetzt keuchend und stoßweise. Abermals wurde seine Stirn schweißnass, trotz der ihn umgebenden Kühlschranktemperaturen. Blohm verharrte vor der Bahre, unfähig, sich zu bewegen. Aber jetzt war da – nichts! Es war keine weitere Bewegung im Inneren des Sacks auszumachen.
Er gab sich einen Ruck, streckte die behandschuhte rechte Hand vorsichtig aus und drückte zaghaft auf die Außenwand des Leichensacks, der im Licht der Neonröhren wie die cremeweiße Haut eines Belugawals glänzte.
Und dann kam der erste Schlag gegen die Innenwand. Noch zaghaft. Dann der zweite. Diesmal deutlich kräftiger. Blohm sah, wie sich mit jedem Schlag ganz deutlich eine Ausbeulung abzeichnete.
Ihm entfuhr ein Schrei. Ein viel zu hoher Schrei, der ihm so gar nicht wie sein eigener vorkam und ihn noch mehr erschreckte. Schweißperlen lösten sich von seiner Stirn und fielen auf die Spitzen seiner weißen Turnschuhe.
Sein Blick verharrte auf einer erneuten Ausbeulung, ohne dass sein Gehirn zu verstehen schien, was dort, direkt vor ihm, gerade passierte. Er konnte nicht glauben, was er jetzt, bei noch genauerem Hinsehen, erblickte: Der Leichensack hob und senkte sich im Brustbereich.
Die Tote! Sie atmet!
Blohm rannte los, seine trampelnden Schritte knallten wie Schüsse auf dem Linoleumboden des langen Flurs.
Im Hintergrund spielte das Radio gerade eine düstere Ballade von Nick Cave.
2
Berlin-Mitte, Kinderintensivstation der Charité, Donnerstag, 24. Juli, 11:10 Uhr
Der Tod hatte diesmal eine Ausnahme gemacht. Warum auch immer. Wahrscheinlich waren es nur ein paar wenige Faktoren gewesen, die verhindert hatten, dass das kleine Mädchen an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb. Vielleicht war es aber auch nur purer Zufall. An so etwas wie einen Schutzengel glaubte Dr. Fred Abel jedenfalls nicht.
Der Rechtsmediziner von der rechtsmedizinischen Abteilung der BKA-Einheit »Extremdelikte« hatte sein zerknittertes Leinenjackett in der Umkleide der Intensivstation abgelegt und gegen einen sterilen Kittel getauscht, der am Rücken geschlossen wurde und ihm bis zu den Unterschenkeln reichte. Er saß jetzt auf einem Hocker, der einzigen Sitzgelegenheit in dem kleinen Intensivzimmer, den er nah an das Krankenhausbett herangeschoben hatte, und betrachtete das knapp zwei Jahre alte Kind. Das Krankenzimmer war erfüllt von dem sonoren Brummen der Beatmungsmaschine, die dem Kind kontinuierlich Sauerstoff über einen Beatmungstubus zuführte. Die schwarzen Haare des kleinen Mädchens, die an Ebenholz erinnerten, lugten hier und da unter dem Kopfverband hervor. Das Kabel einer Hirndrucksonde ragte ebenfalls heraus. Die blasse Haut war weiß wie Schnee und ließ Abel unwillkürlich an Schneewittchen denken.
Wie Schneewittchen, zwischen Leben und Tod.
Allerdings lag die Kleine nicht in einem Glassarg, sondern in einem Klinikbett, umgeben von Gerätetürmen modernster Medizintechnik. Geräte mit daran angeschlossenen Infusionsschläuchen und elektronischen Kabeln, die den Kreislauf stabilisierten und die Vitalfunktionen überwachten.
Es war nicht klar, ob das Mädchen überhaupt jemals wieder aufwachen, jemals wieder zu sich kommen würde.
Abel beugte sich nach vorn, stützte die Ellbogen auf seine Oberschenkel und faltete die Hände.
Das EKG piepste ruhig und gleichmäßig. Die Herzkurve auf dem Monitor zeigte stabile Wellen, die sich vor- und zurückzogen, wie die Brandung im Meer. Die Geräusche der medizinischen Geräte waren das einzige Lebenszeichen des Kindes. Surren. Piepsen. Und das bedrohliche Brummen der Beatmungsmaschine.
Abel beugte sich noch etwas weiter vor, bis er jedes Detail auf den dünnen Unterärmchen erkennen konnte: Unter der papierdünnen Haut zeichneten sich ihre zarten, venösen Blutgefäße ab.
Abels Augen scannten jeden Millimeter der blassen, fahlen Haut des Kindes ab. Frische Abschürfungen oder Blutergüsse? Verschorfungen oder Narben als Zeichen länger zurückliegender äußerer Gewalteinwirkung?
Er konnte nichts dergleichen entdecken.
Besonders an der Innenseite der zarten Oberarme oder an den schmalen Handgelenken von Kindern fanden sich oftmals Griffspuren – Abdrücke der Fingerkuppen, die sich durch festes Zupacken tief in Haut und Unterhautgewebe eingegraben hatten und entsprechende Hämatome zurückließen. Von erwachsenen, starken Händen, die ihre Spuren als stumme Zeugen hinterließen. Wenn sich der Zorn, die Überforderung und die Hilflosigkeit der Großen mit brachialer Gewalt an den Körpern der Kleinsten entluden.
Abels Blick wanderte gerade höher, über das kurzärmelige Nachthemd aus steifer Baumwolle zum Hals des Mädchens, als er jäh aus seinen Überlegungen gerissen wurde.
»Noch mal danke, Herr Dr. Abel, dass Sie gekommen sind und wir auf Ihre Expertise zurückgreifen können. Ich habe die Krankenunterlagen jetzt hier«, sagte der junge Mann leise, der sich geräuschlos hinter dem Rechtsmediziner postiert und dort still verharrt hatte, um den Experten nicht zu stören.
Er hatte sich Abel bei dessen Ankunft als Assistenzarzt Dr. Marco Weise, einer der Stationsärzte der Kinderintensivstation, vorgestellt. Schmales Gesicht. Blonder Seitenscheitel. Anfang bis Mitte dreißig. Hände, die permanent aneinanderrieben.
Ein nervöser Tic, wahrscheinlich ein kleiner Waschzwang inklusive, hatte Abel gedacht, als er vorhin einen kurzen Blick auf die geröteten und schuppenden Hände des Mannes geworfen hatte. Oft war es aber auch das ständige Desinfizieren von Händen und Unterarmen, das Ärzten, die in operativen Fächern oder auf Intensivstationen arbeiteten, diese juckenden, zum Teil allergischen Hautirritationen verschaffte.
Weise war dann, nachdem er Abel das Intensivzimmer mit dem Mädchen gezeigt hatte, im Stationszimmer verschwunden, um die Krankenunterlagen des Kindes zu holen.
»Kein Problem. So funktioniert ein gemeinsamer rechtsmedizinischer Bereitschaftsdienst in der Hauptstadt. Mal sind die Kollegen von der Charité dran, mal die Damen und Herren vom Landesinstitut, und ab und zu sind wir vom BKA an der Reihe«, erwiderte Abel etwas schroffer als beabsichtigt.
Der junge Arzt schien verunsichert.
Abel wusste durchaus um das Spannungsfeld, in dem sich Klinikärzte bei Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung befanden. Einerseits unterlagen die behandelnden Ärzte ihrer Schweigepflicht und waren an einem vertrauensvollen Arzt-Patient-Verhältnis interessiert, was eine enge Zusammenarbeit und offene Kommunikation mit den Eltern der betroffenen Kinder erforderte. Andererseits waren sie ihrem hippokratischen Eid, alles zum Wohle ihrer Patienten zu tun und weiteren Schaden von ihnen abzuwenden, verpflichtet – was wiederum eine Einbeziehung der Rechtsmedizin bei solchen Verdachtsfällen unerlässlich machte. Aus alldem resultierte nicht selten eine spürbare Zurückhaltung, manchmal sogar Aversion der Ärzte gegen die hinzugerufenen Rechtsmediziner.
Abel kratzte sich an seinem stoppeligen Kinn und wartete, was Weise zu diesem Fall zu berichten hatte.
»Ich weiß, dass Sie sonst andere Fälle bearbeiten. Größere Sachen. Brutaler. Komplexer. Und komplizierter. Wir wissen, wofür Ihre Abteilung ›Extremdelikte‹ beim BKA sonst zuständig ist«, sagte Weise in entschuldigendem Ton.
Abel blickte flüchtig über die Schulter zu dem Assistenzarzt und erwiderte leise: »Jedes Opfer, egal wie alt oder was ihm zugestoßen ist, hat eine Untersuchung und objektive Einschätzung seiner Verletzungen verdient. Aber Sie ahnen nicht, wie schnell die Dinge kompliziert werden können.« Er sprach mehr zu sich selbst, in der Hoffnung, der Mediziner würde verstehen, dass er nicht hierhergekommen war, um sich zu unterhalten, sondern um Fakten zu erfahren, die er dann in ein Gesamtbild einordnen konnte. Als Weise daraufhin schwieg und keinerlei Anstalten machte, Abel irgendetwas über seine kleine Patientin zu berichten, erhob sich der Rechtsmediziner und beugte sich über das Mädchen. Behutsam schob er das Nachthemd des Kindes über Beine, Bauch und Brust und inspizierte die Körperoberfläche. Doch auch hier: Nichts. Keinerlei Auffälligkeiten.
Abel betrachtete den Hals und das Gesicht der Kleinen und registrierte erst da, dass sie augenscheinlich asiatischer Herkunft war. Für einen kurzen Moment flatterten ihre geschlossenen Lider, und Abel meinte ein leises Stöhnen zu vernehmen. Aber dann lag sie wieder still da.
Wie Schneewittchen in ihrem Glassarg, ging es Abel erneut durch den Kopf.
Der Blick des Rechtsmediziners blieb an der rechten Ohrmuschel hängen. Reste von getrocknetem Blut waren dort noch zu erkennen. Die kleine dunkelbraune, fast schwarze Kruste lag wie eine dünne, fossile Steinschicht auf dem Ohrläppchen des Mädchens. Schädelbasisbruch, ging es Abel durch den Kopf, während er sich zu dem Stationsarzt umdrehte. »Also gut, warum bin ich hier? Warum benötigen Sie in diesem Fall meine rechtsmedizinische Einschätzung?«
Weise begann in der Krankenakte zu blättern, ehe er in monotonem Tonfall daraus referierte: »Siara Zhou, zweiundzwanzig Monate alt. Vor zwei Tagen hier bei uns stationär aufgenommen. Die von der Mutter informierten Rettungskräfte haben sie bewusstlos im Wohnzimmer der elterlichen Wohnung vorgefunden. Sie konnte reanimiert und stabilisiert werden und ist wegen ihres Zustandes gar nicht erst in die Rettungsstelle, sondern direkt mit dem Notarztwagen in die Neurochirurgie hier im Hause gebracht worden. Gestern Verlegung des Kindes aus der Neurochirurgie zu uns auf Intensiv.«
»Was genau ist passiert? Ich meine, was wissen Sie zum jetzigen Zeitpunkt?«, wollte Abel wissen.
»Die Mutter hat der Notärztin gegenüber erklärt, Siara sei ein sehr lebhaftes Kind und sie, also die Mutter, sei zum Zeitpunkt des Vorfalls der Verletzungen nicht im Zimmer gewesen. Sie wurde am nächsten Tag von der Polizei vernommen und hat dort ausgesagt, dass sie für etwa zwanzig, höchstens dreißig Minuten in der Küche war und die Tür zum Wohnzimmer, in dem sich Siara und ihre Zwillingsschwester aufhielten, geschlossen hatte. Die beiden Mädchen toben manchmal wild, ziehen sich überall hoch und klettern auf dem Mobiliar herum, wenn sie allein sind, meinte sie. Als sie aus der Küche zurück ins Wohnzimmer kam, lag Siara vor der Couch, eine Blutlache unter ihrem Kopf. Die Mutter vermutet, sie könnte auf die Couch geklettert und dann heruntergefallen sein. Das Mädchen muss wohl ungebremst auf den Fliesenboden im Wohnzimmer aufgeschlagen sein. Wie gesagt, ein offensichtlich sehr lebhaftes Kind …«
»Fliesenboden im Wohnzimmer?«, unterbrach Abel ihn irritiert.
»Ja. Es fand sich vor der Couch, wo sie lag, eine größere Blutlache, das hat jedenfalls die Notärztin bei der Aufnahme der Kleinen den Kollegen berichtet. Wenn das Verletzungsmuster mit den Angaben der Mutter übereinstimmen würde, dann wäre es ein Unfall im häuslichen Milieu. Aber …«
»Zu dem Aber kommen wir gleich«, unterbrach Abel den Assistenzarzt erneut. »Immer der Reihe nach. Zunächst sind folgende Punkte zu klären: Erstens, war das Blut, in dem Siara lag, bereits geronnen, als die Notärztin eintraf? Zweitens, was ist mit der Zwillingsschwester, hat sie auch Verletzungen? Wie steht es um die Sprachentwicklung der Kinder, konnte die Schwester irgendetwas dazu sagen, was Siara passiert ist? Und was für ein Verletzungsmuster, von dem Sie sprachen, haben Sie genau festgestellt?«
»Ob das Blut geronnen oder noch flüssig war, weiß ich nicht, das müssen Sie die Notärztin fragen. Die Zwillingsschwester wurde noch am selben Tag einem Kinderarzt vorgestellt, sie ist unverletzt. Allerdings ist ihre Sprachentwicklung noch nicht sehr weit. Insofern – nein, sie konnte nichts dazu sagen, was passiert ist. Das Jugendamt hat sie noch am selben Tag vorübergehend, bis zur Klärung des Vorfalls, in Obhut genommen. Sie ist zurzeit in einer Kriseneinrichtung untergebracht. Unser Sozialdienst steht mit denen in Kontakt. Was das Verletzungsmuster anbelangt: Im Computertomogramm zeigte sich bei Siara eine Kalottenfraktur rechts parietal und eine Fraktur der Schädelbasis. Sie ist dann sofort in den OP gekommen. Dort wurden knapp dreißig Milliliter Epiduralhämatom entfernt. Es zeigten sich im CT auch massive Rindenprellungsherde am Gehirn im Bereich der Konvexität der rechten Großhirnhemisphäre.«
Ein Bruch des Schädeldaches in der Scheitelregion, einhergehend mit schweren Verletzungen des Hirngewebes. Bruchausläufer vom knöchernen Schädeldach bis in die Schädelbasis. Die Schädelbasis ist ein potenzieller Schwachpunkt bei schweren Schädel-Hirn-Traumata. Wer weiß das besser als ich, dachte Abel. Einerseits können Frakturen bei einer massiven Gewalteinwirkung gegen das Schädeldach auch weiter entfernt von der eigentlichen Aufschlagstelle entstehen – durch die massiven Kräfte, die dabei auf den Schädel einwirken. Andererseits … Vielleicht sind es auch zwei getrennte Bruchsysteme, die gar nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Was bedeuten würde, dass sie zwei massive Schädel-Hirn-Traumata hintereinander erlitten haben muss. Damit würde die Schilderung der Mutter, dass ein einfaches Sturzgeschehen dafür verantwortlich ist, definitiv ausscheiden. Ich muss nachher unbedingt einen Blick auf die CT-Bilder werfen.
»Was wissen wir über die Familien- und Wohnverhältnisse?«
»Die Familie scheint in relativ geordneten Verhältnissen in Marzahn zu leben«, antwortete Weise. »Wer außer der Mutter und den knapp zweijährigen Zwillingen noch in der Wohnung wohnt – keine Ahnung. Aber das sind sowieso nur Infos aus zweiter Hand, von der Notärztin. Mehr weiß ich leider nicht.«
»Welchen kulturellen Hintergrund hat die Familie, beziehungsweise welcher Ethnie entstammen sie? Das Mädchen hat auf den ersten Blick asiatische Züge«, wollte Abel wissen.
»Die Mutter ist Halbchinesin, soweit ich weiß. Über den Vater ist mir nichts bekannt.«
»War die Mutter hier? Oder andere Verwandte?«
»Ja, gestern Nachmittag ist die Mutter gekommen, in Begleitung ihrer Schwester. Das weiß ich aber nur von meiner Kollegin, die gestern Dienst hatte, ich selbst habe bisher noch nicht mit ihr gesprochen. Übrigens sagte die Schwester der Mutter, Siaras Tante, zu meiner Kollegin, sie sei Ärztin. Sie hat uns ihre Telefonnummer gegeben, für alle Fälle«, erwiderte Weise.
»Ärztin hin oder her, sie wird uns auch nicht mehr dazu sagen können, was genau passiert ist. Schließlich war sie nicht dabei. Aber jetzt mal Klartext, Herr Weise. Ihre Klinik hat nicht die Rechtsmedizin informiert, weil ein Kind von der Couch gefallen ist. Was glauben Sie, was passiert ist?«, fragte Abel.
Der Assistenzarzt wischte sich, als ihn der Blick des Rechtsmediziners traf, nervös eine blonde Strähne aus der Stirn, trat einen halben Schritt näher an das Bett des Mädchens heran und senkte bedeutungsschwanger die Stimme. »Herr Abel, wir haben Sie hinzugezogen, weil es aus unserer Sicht äußerst unwahrscheinlich ist, dass diese Kopfverletzung von einem Sturz von einer Couch herrührt.«
»Da gebe ich Ihnen recht. Wenn solch ein Sturz zu so gravierenden Verletzungen führen würde, wären unsere Kliniken mit schwer verletzten Kindern überfüllt. Auch bei heftigem Toben – und dabei ist es völlig egal, ob das Kind auf Parkett, Teppich oder Fliesenboden stürzt – sind Kopfverletzungen nie so gravierend. Andernfalls wären die entsprechenden Pflegeeinrichtungen in Deutschland voll mit schwerstbehinderten Kindern, denn …« – Abel deutete mit einer Kopfbewegung in Richtung des Krankenbettes – »… so ein Schädel-Hirn-Trauma geht mit schwersten Spätfolgen einher. Siara wird niemals wieder richtig laufen können, wenn eine Halbseitenlähmung zurückbleibt. Sehr wahrscheinlich wird sie ihr weiteres Leben lang unter epileptischen Anfällen leiden. Von Sprachstörungen und kognitiven Defiziten ganz zu schweigen, die verhindern werden, dass sie jemals eine normale Schule besuchen wird. Sie wird immer auf fremde Hilfe angewiesen sein.«
Weise bedachte Abel, der anscheinend das ausgesprochen hatte, was dem jungen Assistenzarzt ebenfalls schon durch den Kopf gegangen war, mit einem langsamen Nicken und beugte sich dann ebenfalls über das im künstlichen Koma liegende Mädchen. Vorsichtig drehte er ihren Kopf auf die linke Seite und schob dann den Kopfverband im rechtsseitigen Nackenbereich behutsam wenige Zentimeter hoch, sodass die Region hinter Siaras rechtem Ohr sichtbar wurde. Dort zeichnete sich ein dunkelvioletter Bluterguss ab. In der Mitte des Hämatoms war die dünne Haut auf einer Länge von etwa einem Zentimeter leicht eingerissen und im Randbereich geschürft. Die Schürfungszone war nur etwa drei Millimeter breit und oberflächlich mit Schorf belegt.
Abel pfiff hörbar durch die Zähne. Ich hatte ja gesagt, es wird schnell kompliziert in unserem Beruf, dachte er.
»Nicht eben eine sturztypische Verletzung …«, begann Weise.
»Und fernab der primären Aufschlagstelle am Scheitelknochen. Sehr gut, Herr Kollege«, fuhr Abel fort, griff unter dem Kittel in die rechte Gesäßtasche seiner Jeans, zog sein Blackberry heraus und machte mehrere Fotos von der Verletzung. Während er das Blackberry wieder in seiner Hosentasche verschwinden ließ, wandte er sich an Weise: »Diese Verletzung könnte von einem Schlag mit einem Gegenstand herrühren. Möglicherweise von einer Hand, oder vielmehr einer Faust, die einen Ring trug. Schlagrichtung von seitlich oben nach schräg unten. Das zeigen mir die Epithelmoränen, die Richtung der feinen Oberhautabschürfungen. Dieser feine Riss in der Haut könnte sehr gut von der erhabenen Verzierung eines Ringes herrühren.«
Weise bettete den Kopf der kleinen Siara behutsam zurück in seine ursprüngliche Position und zog das Nachthemd wieder herunter. Das Mädchen schluckte und bewegte dabei fast unmerklich die feinen blassen Lippen.
Fast, als würde sie uns etwas sagen wollen, ging es Abel durch den Kopf. »Ich würde jetzt gern noch einen Blick auf die CT-Bilder werfen, ist das möglich?«, fragte er.
»Ja, kommen Sie, wir gehen ins Stationszimmer«, antwortete der Stationsarzt.
Abel warf, während sie das Intensivzimmer verließen, einen letzten Blick auf das von piepsenden und surrenden Gerätetürmen modernster Medizintechnik umgebene Mädchen und merkte, dass in ihm eine Wut aufstieg, die er nur schwer herunterschlucken konnte. Wut, die immer dann lavaähnlich emporschoss, wenn er lebensgefährlich misshandelte oder getötete Kinder untersuchte. Er war sich bewusst, dass seine Professionalität und Objektivität – unverzichtbare Voraussetzungen für seine Arbeit als rechtsmedizinischer Sachverständiger – nicht von dieser Wut weggewischt werden durften, wie ein Tafelbild, das von einem nassen Schwamm einfach ausgelöscht wurde. Aber er wusste auch, wie kostbar jedes gesunde Kind war. Diese jungen und unbeschwerten Kinder, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten. Das wurde ihm in solchen Momenten immer wieder klar. Aber klar war nun mal auch, dass in jeder Woche in Deutschland drei Kinder an den Folgen tödlicher Misshandlungen starben. Das waren nicht die Kinder, die bei Verkehrsunfällen getötet wurden oder ertranken, weil sie nicht schwimmen konnten und niemand auf sie aufgepasst hatte, oder Kinder, die an Leukämie oder einer sonstigen schweren Erkrankung starben. Nein, es ging um drei Kinder pro Woche, die durch rohe Gewalt von Erwachsenen getötet wurden. Das war die genauso nüchterne wie traurige polizeiliche Kriminalstatistik des BKA.
Abel hatte selbst Kinder, aber nie erlebt, was es im täglichen Leben bedeutete, Vaterpflichten zu haben, oder wie es sich überhaupt anfühlte, Vater zu sein. Seine beiden Kinder waren mittlerweile junge Erwachsene, von deren Existenz er allerdings erst vor vier Jahren erfahren und die er vor zwei Jahren erst kennengelernt hatte. Und in deren Leben er nach wie vor nur eine kleine Rolle spielte. Mit Lisa, seiner Lebensgefährtin, mit der er bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen war und mit der er gemeinsam alt werden wollte, hatte er bisher vergeblich auf Nachwuchs gewartet. Inzwischen war Lisa über vierzig und er fast fünfzig. Der Traum von gemeinsamen Kindern würde für sie wohl ein Traum bleiben. Damit hatte er sich mittlerweile arrangiert. Was ihm aber blieb, war, den Kindern, denen Gewalt angetan worden war, eine Stimme zu geben.
Wenn er sie denn schon nicht beschützen konnte.
Zehn Minuten später, nachdem Abel die CT-Bilder der kleinen Siara, die Weise an einem der PC-Arbeitsplätze im Stationszimmer aufgerufen hatte, sorgfältig studiert hatte, sagte er zu dem Assistenzarzt: »Es war richtig, dass Sie die Rechtsmedizin eingeschaltet haben. Wir haben es hier mit mindestens zwei schweren Gewalteinwirkungen gegen Siaras Schädel zu tun. Ein Epizentrum der Gewalteinwirkung findet sich, wie Sie vorhin schon sagten, am knöchernen Schädeldach im Bereich des rechten Scheitelbeins. Wenn ich mir diese Fraktur auf den CT-Bildern ansehe, kann ich sicher ausschließen, dass sie durch einen Sturz von einer Couch oder durch irgendein anderes Sturzgeschehen im häuslichen Umfeld entstanden ist. Dazu ist die Energie, die auf Siaras Schädel eingewirkt haben muss, viel zu massiv gewesen. Bei Kindern besteht, im Gegensatz zu Erwachsenen, noch eine hohe Verformbarkeit des Schädels durch die geringe Schichtdicke des Schädelknochens, die offenen Fontanellen und die damit gegebene hohe Elastizität des knöchernen Schädeldaches. Hinzu kommt, dass wir es mit zwei Fraktursystemen zu tun haben, die wir getrennt betrachten müssen, da sie nicht durch eine einmalige Gewalteinwirkung erklärt werden können. Zum einen der Bruch des Schädeldaches und zum anderen die Schädelbasisfraktur, genau genommen ein Trümmerbruch der mittleren Schädelgrube rechts. Ich weiß nicht, ob Sie sich aus dem Studium noch an die Frakturlehre in der Rechtsmedizin erinnern. Stichwort: Puppe’sche Regel.«
Weise nickte zwar stumm, aber er schien nicht wirklich zu wissen, worauf der Rechtsmediziner hinauswollte.
»Diese Regel besagt, dass bei zeitlich nacheinander entstandenen Schädelbrüchen die Bruchlinien der zuerst entstandenen Fraktur nie von neuen Bruchlinien, die aus danach entstandenen Frakturen resultieren, überkreuzt werden. Oder andersherum: Neuere Frakturlinien enden immer an bereits bestehenden Frakturlinien.
Deshalb handelt es sich in Siaras Fall bei der Schädeldachfraktur und der Fraktur der Schädelbasis um zwei getrennte Bruchsysteme, die zeitlich hintereinander entstanden sind. Zuerst der Bruch des Schädeldaches und dann der Schädelbasisbruch. Das kann ich aus dem Verlauf und der Beziehung der Fraktursysteme und Frakturlinien zueinander ableiten. Und das wiederum sagt mir, die Kleine hat zwei massive Schädel-Hirn-Traumata hintereinander erlitten. Ein einfaches Sturzgeschehen scheidet definitiv aus.«
»Sie meinen, die Mutter lügt?«, fragte Weise.
»Nein. So einfach ist es leider nicht. Aber das von der Mutter geschilderte Geschehen, das sie als Unfall darstellt, kann sich unmöglich so zugetragen haben.«
»Was ist Ihrer Meinung nach passiert?«
»Möglich wäre, dass Siara heftig geschubst wurde, sie stürzte dann vielleicht von der Couch, aber vielleicht knallte sie auch aus dem Stand, nachdem ihr Körper durch einen heftigen Stoß beschleunigt wurde, auf den Kopf und zog sich die erste Fraktur am Schädeldach rechts zu. Dann, als sie auf dem Boden lag und ihr Köpfchen auf dem Fliesenboden quasi fixiert war, erlitt sie einen heftigen Schlag, vielleicht mit der Faust, oder einen Tritt. Gegen ihre rechte Nackenregion, in dem Bereich, wo Sie das Hämatom festgestellt haben. Die im Hämatom gelegene schmale Schürfungszone könnte von einem Ring oder der Kante einer Schuhsohle herrühren. Das ist meine derzeitige Arbeitshypothese.«
Einen Moment lang schien Weise das Gehörte erst einmal sacken zu lassen, dann sagte er: »Danke für Ihre Einschätzung, Herr Abel. Dann war es richtig, dass wir Sie …«
»Ich weiß«, fiel Abel ihm ins Wort, »dass es Ihnen als behandelnde Ärzte schwerfällt, Angehörige beziehungsweise Eltern mit solchen Vorwürfen zu konfrontieren. Aber dafür sind wir Rechtsmediziner ja da, wir fungieren als so etwas wie ein Rammbock. Wir sind diejenigen, denen bei den Kindesmisshandlungsfällen die Rolle des Buhmannes zukommt. Aber das ist in Ordnung. Sie behandeln Ihre kleine Patientin weiter, und den unangenehmen Part übernehme ich. Ich werde das Ganze in einem Gutachten zusammenfassen und mit dem zuständigen Mitarbeiter des Jugendamts telefonieren. Sehr wahrscheinlich wird sich dann in den nächsten Tagen ein Kinderschutzteam auch noch hier vor Ort bei Ihnen über die Schwere der Verletzungen informieren. Und so nimmt alles seinen Gang. Basierend auf meiner Rekonstruktion der möglichen Entstehung der Verletzungen, werden sich Polizei und Staatsanwaltschaft ein eigenes Bild machen und dann sicherlich die Mutter vorladen und erneut vernehmen. Und dann sehen wir mal, ob ihr nicht doch noch einfällt, was genau passiert ist. Und das Familiengericht wird ebenfalls ein Wörtchen mitreden, wenn es um das weitere Sorgerecht für Siara und ihre Zwillingsschwester geht. Aber jetzt …« – Abel sah auf seine Armbanduhr – »… lassen Sie mich noch schnell selbst einen Blick in die Krankenakte werfen. Ich werde ein paar Dokumente, wie das Notarzteinsatzprotokoll, die Laborwerte und den CT-Befund Ihrer Radiologen, für meine Unterlagen abfotografieren, wenn Sie einverstanden sind.«
»Nur zu, bedienen Sie sich«, sagte Weise, spürbar erleichtert, dass Abel ihm und seinen Kollegen das unangenehme Prozedere abnahm, das nun mit den verschiedenen Institutionen wie Jugendamt, Familiengericht und Ermittlungsbehörden anstand.
Abel blätterte in der dünnen Krankenakte und fotografierte einige Seiten, aber dann blieb sein Blick an einem kleinen gelben Post-it-Zettel ganz hinten hängen, auf einer der letzten Seiten der Akte. Dort stand ein Name mit einer Handynummer und der Hinweis, dass die betreffende Person nicht nur Siaras Tante, sondern auch Ärztin sei. Es war der Name der Frau, die mit Siaras Mutter am Vortag die Intensivstation besucht hatte.
Sie ist Siaras Tante!
Abels Mund wurde trocken, und sein Puls schien Hammerschläge in seinem Hals zu vollführen, als er sich wie in Trance von dem Stationsarzt verabschiedete.
Dann ging er, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, in die Umkleide der Intensivstation.
3
Berlin, Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«, Besprechungsraum, Montag, 28. Juli, 7:36 Uhr
Die Fotos der beiden mumifizierten Toten wurden von dem Beamer übergroß an die Leinwand in dem grau möblierten Besprechungsraum im Untergeschoss der Treptowers geworfen. In dem 125 Meter hohen Gebäudekomplex im Berliner Ortsteil Alt-Treptow waren verschiedene Abteilungen des BKA untergebracht, unter anderem die rechtsmedizinische Sonderabteilung »Extremdelikte«. Mit zwei Ausnahmen waren alle Mitarbeiter der rechtsmedizinischen Abteilung zur täglichen Frühbesprechung um 7:30 Uhr in dem großen, mit einem Konferenztisch und zehn Stühlen, PC, Leinwand und Beamer ausgestatteten Besprechungsraum anwesend: Dr. Fred Abel, der die Besprechung als stellvertretender Leiter der »Extremdelikte«, mit einem Stapel Ermittlungsakten vor sich, leitete, Oberarzt Dr. Martin Scherz und die Assistenzärzte Dr. Alfons Murau, Dr. Wiebke Rath, Dr. Tomas Tomski, Dr. Alexandra Roth sowie die Sekretärin Renate Hübner. Nur ihr Chef, Professor Paul Herzfeld, und die Assistenzärztin Dr. Sabine Yao fehlten an diesem Morgen.
Das Geschlecht der Mumien auf den Fotos, die Abel hintereinander auf die Leinwand projizierte und die den Leichenfundort und die Körper aus verschiedenen Perspektiven zeigten – mal versehen mit einem Maßstab der Spurensicherung, mal ohne –, war zwar aufgrund ihres Aussehens nicht mehr sicher bestimmbar, aber die Kleidung, die sie trugen, lieferte einige Informationen. Aufgrund ihrer Austrocknung und der damit einhergehenden Schrumpfung der Weichteile ihrer Körper und dem Ausfall der Kopfhaare erinnerten sie weniger an Menschen als vielmehr an grob geschnitzte, überdimensionierte Holzpuppen, die mit rissigem braunem Leder überzogen waren. Sie starrten den Betrachter aus leeren Augenhöhlen an. Die eine Mumie war mit einem Rock und etwas, was vermutlich einmal eine Bluse oder ein Hemd gewesen war, bekleidet. Die andere trug Shorts und ein kurzärmeliges Hemd. Die ursprüngliche Farbe der Kleidung war allenfalls noch zu erahnen, da literweise Fäulnisflüssigkeit – die, als der Fäulnisgasdruck im Körperinneren zu groß geworden war, durch alle Körperöffnungen aus den Körpern hinausgepresst worden war – die Kleidung verschmutzt und verfärbt hatte. Die Fäulnisflüssigkeit war dann eingetrocknet und hatte nun einen unschönen bräunlichen Farbton hinterlassen. Im Anschluss war es, mit weiterem Fortschreiten des postmortalen Intervalls, zur Vertrocknung der Körper und damit zur Mumifizierung gekommen.
Die Beine der beiden Mumien steckten wie graue, borkige Äste eines abgestorbenen Baumes in Halbschuhen. Ihre Köpfe erinnerten an raue, staubige Kugeln, in denen sich Käfer und andere Insekten eine trockene Heimstätte gesucht hatten. Da bei beiden Mumien Ober- und Unterkieferzahnprothesen aus den Mündern herausragten, die durch die lederartige Verhärtung der umgebenden Gesichtshaut weit offen gehalten wurden, handelte es sich augenscheinlich um die sterblichen Überreste von Menschen in höherem Lebensalter.
Abel fuhr sich mit der Hand über seine frisch rasierte Wange. Das neue Aftershave, das Lisa ihm geschenkt hatte – angeblich sanft und hautschonend –, brannte immer noch.
»Der erste Fall für heute«, setzte er an. »Was wir hier sehen, sind zwei noch nicht identifizierte Tote, vermutlich ein Mann und eine Frau. Und, wie unschwer zu erkennen, sind beide bereits mumifiziert. Bauarbeiter, die den alten Hindutempel in der Hasenheide in Kreuzberg abgerissen haben, entdeckten die Leichen gestern Vormittag. Die beiden Körper befanden sich unter dem Holzboden in einem hinteren Bereich des Tempels, der hier …« – er deutete mit einem Laserpointer auf das auf die Leinwand projizierte Bild – »… zum Teil schon aufgestemmt worden ist.«
Murau räusperte sich geräuschvoll.
Abel blickte zu dem aus Wien stammenden Assistenzarzt hinüber, der beim Anblick der beiden Mumien begonnen hatte, unruhig auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis er sich zu Wort meldet, dachte Abel.
Murau hatte sich in diesem Sommer einen neuen, eigenwilligen Kleidungsstil zugelegt: Sein stämmiger Oberkörper, der etwas zu kurz geraten schien, steckte auch heute in einem äußerst eng sitzenden kakifarbenen Hemd, das ihn wie einen Tropenforscher aus dem letzten Jahrhundert erscheinen ließ.
Abel hatte bereits beim Betreten des Besprechungszimmers bemerkt, dass Murau eine farblich passende Hose dazu trug, als würde er nach Feierabend noch die letzten weißen Flecken auf der Landkarte des Amazonas oder eines anderen Urwaldgebietes erkunden wollen.
Murau wischte sich mit einem weißen Taschentuch den Schweiß von der Stirn und begann in seiner unverwechselbaren Wienerischen Mundart zu sprechen. »Das ist ja hier wie bei Howard Carter. Der Fluch der Mumie!« Er lachte begeistert über seine eigene Bemerkung.
Es hatte dem Österreicher noch nie etwas ausgemacht, im Kollegenkreis allein zu lachen – was fast immer der Fall war. Denn seine Kollegen fanden das, was Murau an bissigen und spöttischen Kommentaren zu den in der Frühbesprechung referierten Fällen beisteuerte, in der Regel meistens fragwürdig, wenn nicht sogar pietät- und geschmacklos. Allerdings hatten fast alle es längst aufgegeben, gegen seine Wortbeiträge zu opponieren, bis auf Oberarzt Dr. Martin Scherz, der wie üblich missmutig dreinschauend mit einem Teelöffel in seinem Kaffeebecher rührte. Das dienstälteste Mitglied der rechtsmedizinischen Sonderabteilung, dessen grauer Bart in den vergangenen zwei Jahren zunehmend weiß geworden und zu ein paar wenigen Fusseln verkommen war, schaute gelangweilt zu Murau hinüber.
»Na, Kollege – Sie meinen wohl auch, dass Sie auf Carters Spuren im Tal der Könige wandeln, oder was soll Ihr Afrikacorps-Outfit, in dem Sie hier neuerdings aufkreuzen, bedeuten? Die Hitze steigt Ihnen wohl langsam zu Kopf«, sagte Scherz. Er und Murau waren noch nie Freunde gewesen und würden es sicher in diesem Leben auch nicht mehr werden.
Murau ließ das weiße Taschentuch in der Brusttasche seines Expeditionshemdes verschwinden. Wenn ihn Scherz’ bissiger Kommentar getroffen hatte, so war das seinem runden, rosigen Gesicht nicht anzusehen.
»Ich meine die Graböffnung, Herr Kollege«, erwiderte er. »Als es zur Mumie ging. Im Grab des Tutanchamun. Keiner konnte etwas sehen – nur Carter. Der schob nämlich eine Kerze durch die kleine Öffnung in der Grabkammer.«
Abel strich sich genervt durch seine grauen Haare. Die Belesenheit von Murau und seine aufdringliche Eigenschaft, aus seinem unendlichen Wissensschatz kein Geheimnis zu machen, sondern bei jeder Gelegenheit eine historische Anekdote in den Raum zu werfen oder Texte bekannter oder weniger bekannter Dichter zu rezitieren, hatte bereits so manche Frühbesprechung in die Länge gezogen.
Aber Murau sprach unbeirrt weiter: »Als Lord Carnarvon, der Finanzier und Förderer Carters, daraufhin Carter fragte: ›Können Sie etwas sehen?‹, antwortete Carter mit den historischen Worten: ›Ich sehe wunderbare Dinge!‹ Und wussten Sie, dass Carter damals …«
Plötzlich flog die Tür des Besprechungsraumes auf.
Bis auf Murau blickten die anwesenden Mitarbeiter der Abteilung »Extremdelikte« alle erleichtert auf, denn nun war klar, dass Murau seine Anekdoten von Carters Heldentaten im Tal der Könige nicht weiter würde ausführen können.
»Guten Morgen, Herrschaften! Oder, wie wir früher in Kiel immer gesagt haben: Moin! Moin! Bitte entschuldigen Sie die Verspätung, ich wurde durch einen Anruf aus dem Büro unseres Innenministers aufgehalten«, begrüßte Professor Paul Herzfeld die Anwesenden und nickte ihnen kurz freundschaftlich zu.
Herzfeld war im Gesicht gebräunt, sein weißes und perfekt gebügeltes Oberhemd unter dem dunkelblauen Sakko verstärkte seine Gesichtsfarbe. Der zweiwöchige Urlaub auf den Kapverdischen Inseln hatte ihm sichtlich gutgetan, und heute übernahm er von Abel, seinem Stellvertreter, wieder den Staffelstab der Abteilung.
Abel und Herzfeld hatten auch während seines Urlaubs immer wieder telefonisch Kontakt gehabt, meist wenn es auf den Kapverden Abend war, denn Herzfeld hatte tagsüber Wassersportaktivitäten gefrönt. Doch auch im Urlaub konnte er nicht ganz loslassen. Die Rechtsmedizin war für ihn nicht nur sein Beruf, es war seine Berufung. Was ihn schließlich vor zehn Jahren die Ehe mit seiner damaligen Frau Petra gekostet hatte. Und was oftmals für seine Mitarbeiter eine echte Herausforderung darstellte, denn Herzfeld arbeitete quasi rund um die Uhr und rief manchmal spätabends oder zu nachtschlafender Zeit von seinem Bürotelefon aus seine Mitarbeiter mit Nachfragen zu Sektionsfällen oder Leichenfundortberichten an. Was aber seiner Beliebtheit in der Abteilung keinen Abbruch tat. Es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass er nie ohne seinen kleinen Koffer mit Sektionsbesteck in den Urlaub fuhr. Abel stand seinem Chef in dieser Beziehung aber kaum nach. Auch er war Workaholic und vergaß alles um sich herum, wenn er sich erst einmal in einen Fall verbissen hatte.
Herzfeld stützte sich mit beiden Fäusten auf dem wuchtigen Konferenztisch mit der auf Hochglanz polierten grauen Tischplatte ab und schaute die Kollegen herausfordernd an, was Abel kurz an ein Gorillamännchen erinnerte, das mit bestimmten Gesten seine Dominanz zur Geltung brachte.
»Haben Sie mich auch schön vermisst?«, fragte Herzfeld mit einem breiten Grinsen und einem Blitzen in den Augen. Abel musste lächeln. Er bewunderte seinen Chef, er schaffte es sogar, dass sich alle freuten, auch wenn er zu spät kam.
Alfons Murau hob süffisant in seinem breiten Wienerisch an: »Herr Professor, es ist uns natürlich eine Freude. Auch wenn Dr. Abel viele Leitungsqualitäten hat, die wir bis zu Ihrem nächsten Urlaub wieder vermissen werden …«
Herzfeld lächelte den Assistenzarzt an.
Muraus Art war zwar nicht jedermanns Sache, aber an seinem fachlichen Können hatte niemand im Raum, auch nicht Oberarzt Dr. Martin Scherz, den geringsten Zweifel. Deshalb sah Herzfeld dem Österreicher fast alle auch noch so überflüssigen Kommentare nach.
Herzfeld schaute in die Runde. »So, wie ich sehe, hast du schon mal angefangen, Fred. Danke. Aber wir sind nicht ganz vollzählig. Frau Yao?« Er hob fragend die Augenbrauen.
Abel schluckte trocken und blickte kurz auf den leeren Platz.
»Frau Dr. Yao kommt etwas später, sie findet sich dann direkt im Sektionssaal ein. Sie hat einen wichtigen privaten Termin, der sich nicht verschieben ließ. Habe ich vorhin vergessen zu sagen«, meldete sich Renate Hübner.
Die kurz vor ihrer Rente stehende Hübner hatte als gute Seele der Abteilung und als Sekretärin eine Doppelfunktion inne. Man konnte sie guten Gewissens als Urgestein bezeichnen, denn sie war seit Gründung der »Extremdelikte« vor etwas mehr als fünfzehn Jahren mit von der Partie. Manchmal schien es Abel, dass Hübner eher für die ganzheitliche Betreuung der unterschiedlichen Charaktere ihrer Abteilung als für Schreibarbeiten oder Terminvereinbarungen zuständig war. Wer krank war, wurde aus ihrer immer bestens sortierten Schreibtischapotheke versorgt, oft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und wer an einem Freitagabend zu lange über seinen Sektionsakten saß, wurde mit einem kalten Bier aus ihrem Kühlschrank in den Feierabend entlassen.
»Alles klar. Dann übernehme ich jetzt«, sagte Herzfeld und ließ sich von Abel die Fernsteuerung des PCs geben.
Leise surrend warf der Beamer ein weiteres Bild der Mumien aus dem Hindutempel an die Wand.
4
Berlin, Marzahn-Hellersdorf, Wohnung von Mailin Zhou, Wohnzimmer, Montag, 28. Juli, 7:41 Uhr
Ihr Blick fiel auf die quadratischen, hellgrauen Fliesen, in deren rauem Fugenmaterial immer noch dünne Streifen blassbräunlicher Verfärbungen zu sehen waren. Als sei dort vor langer Zeit eine Flasche Rotwein zu Bruch gegangen, deren Inhalt sich dann über den Fußboden verteilt hatte. Doch Sabine Yao wusste, dass sich hier vor sechs Tagen, genau an dieser Stelle vor der Wohnzimmercouch, etwas Schreckliches ereignet hatte. Dass das Leben ihrer knapp zwei Jahre alten Nichte Siara, der Tochter ihrer Schwester Mailin, hier an einen Wendepunkt gekommen war, von dem aus es kein Zurück mehr gab.
Sabine Yao beugte sich ein Stück nach vorn und schob den wackeligen Couchtisch, auf dem ihre Handtasche lag, zur Seite. Sie zog den Sisalteppich, den sie vor zwei Tagen bei einem Möbeldiscounter gekauft hatte, vor die Couch, sodass die von dem Blut ihrer Nichte herrührenden Verfärbungen verdeckt wurden – als könnte sie, indem sie die Spuren des furchtbaren Vorfalls verbarg, auch das, was passiert war, ungeschehen machen. Dann zerrte sie den schweren Kunstledersessel, den sie zuvor unter Aufbietung all ihrer Kräfte zur Seite gewuchtet hatte, auf die der Couch gegenüberliegende Seite des Teppichs. Den Couchtisch stellte sie zurück an seinen ursprünglichen Platz zwischen Couch und Sessel und ließ sich, leicht außer Atem, auf die Couch fallen.
Ihre Schwester Mailin hatte die ganze Zeit unbeteiligt danebengestanden. Jetzt setzte sie sich Sabine Yao gegenüber.
»Ich kann dir doch nichts anderes sagen«, flüsterte Mailin und strich sich mit der Handfläche die schwarzen, ungewaschenen Haare aus der Stirn.
Mailin wirkte in den Polstern des riesigen Sessels noch zierlicher als sonst. Verloren. »Verdammt, Bine!« Ihre Augen huschten über den Boden, als würde sie nach weiteren Blutspuren Ausschau halten.
In den vergangenen Monaten ist es mit Mailin noch weiter bergab gegangen, dachte Sabine Yao, und es schnürte ihr den Brustkorb zusammen, ihre sechs Jahre jüngere Schwester so zu sehen. Es würde immer einen Unterschied zwischen ihnen geben.
Mailin war bereits als kleines Mädchen anders gewesen, trug eine gewisse Instabilität in sich. Aber auch etwas Zorniges. Schon früh war es offensichtlich gewesen: Sabine spielte mit ihren Puppen, sprach wie eine Ärztin mit ihnen, Mailin riss ihnen die Arme ab. Später hatte Sabine freiwillig Praktika im Krankenhaus gemacht, während Mailin die Schule vernachlässigte, sich heimlich ritzte, Alkohol trank und wer weiß was konsumierte. So erhielt jede auf ihre Weise die Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Seit jeher war Sabine Yao mit einem Gefühl der Sorge erfüllt, wenn sie an ihre jüngere Schwester dachte.
Doch dann hatte es den Anschein gehabt, dass Mailins Dämonen besänftigt wurden. Die Gründung einer Familie hatte ihr gutgetan, ihr eine nie da gewesene Stabilität gegeben. Die Ehe, die Kinder – Mailin hatte die Verantwortung angenommen. Und war aufgeblüht.
Sabine Yao war erleichtert gewesen, hatte sich mit ihrer Schwester gefreut und war stolz auf sie. Die Zeit der Frustration, der Zerstörungswut, der Unberechenbarkeit, der Suchtgefährdung schien Mailin endgültig hinter sich gelassen zu haben.
Doch nun schien Mailins früheres Ich wieder zurückzukehren. Als hätte es nur jahrelang auf einen solchen Moment gewartet. Mailin verließ das Haus kaum noch. Sie hatte wieder angefangen zu trinken. Ihr Gesicht hatte eine gräuliche Farbe – ein Nachtgesicht, das trotz der hochsommerlichen Tage seit langer Zeit kaum noch Sonnenlicht gesehen hatte. Mailins Mundwinkel waren trocken und eingerissen, außerdem hatte sie merklich abgenommen. Sie war zwar erst Anfang dreißig, aber ihre Bewegungen waren innerhalb weniger Tage zu denen einer alten Frau geworden. Die junge Frau, die sie einmal gewesen war, war scheinbar mit ihrer Tochter auf dem harten Fliesenboden des Wohnzimmers aufgeschlagen und dabei in tausend kleine Stücke zersprungen.
Die Wohnung, drei Zimmer in einem anonymen zwanzigstöckigen Wohnblock in Marzahn, war übersät mit unsortierter Wäsche. Auf dem Esstisch im Wohnzimmer stapelten sich Unterlagen und einige ungeöffnete Briefe.
Sabine Yao, die einen bis kurz über ihre Knie reichenden dunkelroten Rock und eine cremefarbene Bluse trug, passend zu ihren ebenfalls cremefarbenen Pumps, lehnte sich auf der Couch zurück. Ihre sorgfältig manikürten Finger ruhten auf ihren Oberschenkeln. Die Rechtsmedizinerin blickte zu Mailin, die sich, wie immer bei den Besuchen ihrer älteren Schwester in den letzten Tagen, augenscheinlich wand. Sabine Yao musste eigentlich dringend zur Arbeit. Die Frühbesprechung war schon in vollem Gange. Aber sie brachte es nicht übers Herz, Mailin jetzt allein zu lassen. Ihre kleine Schwester brauchte sie. Sie hatte doch sonst niemanden mehr.
»Hast du was von Sina gehört? Hat sich einer der Sozialarbeiter aus der Kriseneinrichtung bei dir gemeldet?«, fragte Sabine Yao. Wie zu erwarten, schüttelte ihre Schwester den Kopf.
Noch am selben Tag, an dem sich das Drama im Wohnzimmer der kleinen Familie ereignet hatte, war Siaras Zwillingsschwester Sina vom Jugendamt in Obhut genommen und in einer Kriseneinrichtung untergebracht worden. Dort kümmerten sich Sozialarbeiter mit ihren Familien um die Kinder, die als Akutfälle sofort aus ihrem Elternhaus genommen werden mussten – sei es wegen körperlicher Gewalt oder wegen Verwahrlosung, weil sich niemand für sie verantwortlich fühlte. Seit sechs Tagen war Sina nun schon in Neukölln mit vier anderen Kindern in der Wohngruppe blau. Und so waren die beiden Zwillingsschwestern nicht nur das erste Mal voneinander, sondern auch von ihrer Mutter getrennt.
»Hast du denn eine Nachricht vom Familiengericht? Also, haben die sich in irgendeiner Form schon bei dir gemeldet?«
»Nein, wieso?«, fragte Mailin ängstlich. »Was genau meinst du?«
Sabine Yao wusste, dass es nur noch ein bis zwei Tage dauern würde, bis Mailin Post vom Familiengericht erhielt.
Ein Richter würde sich in einer Anhörung ein Bild von ihrer Schwester und dem Geschehenen machen und dann entscheiden, wie es mit Sina weiterging. Ob Siaras Zwillingsschwester zu ihrer Mutter zurückkehren konnte, oder ob auch ihr Leben in ihrem häuslichen Umfeld möglicherweise in Gefahr war und das Sorgerecht für Sina dem zuständigen Jugendamt übertragen wurde.
Aber dieses Wissen behielt Sabine Yao jetzt besser für sich. Warum sollte sie Mailin noch weiter verunsichern und beunruhigen? Deshalb sagte sie ausweichend: »War nur so ein Gedanke, aber eigentlich nicht wichtig.«
Und wohlweislich verzichtete sie auch darauf, ihrer Schwester ihre weiteren Überlegungen mitzuteilen. Denn Mailin würde von der Staatsanwaltschaft eine Vorladung bekommen, die die Ermittlungen bereits aufgenommen hatte, wie die Rechtsmedizinerin wusste. Ermittlungen zur Klärung, ob eine Straftat die Ursache von Siaras schweren Verletzungen war. Von Verletzungen, für die die Mutter des Kindes, ihre Schwester Mailin, keine plausible Erklärung hatte. Aber trotzdem glaubte Sabine Yao jedes Wort von dem, was Mailin ihr über das tragische Unglück berichtet hatte.
Oder will ich es vielleicht einfach nur glauben? Doch diesen Gedanken wischte sie schnell beiseite und schämte sich sogar ein wenig, ihn überhaupt gedacht zu haben. Keiner kannte ihre Schwester so gut wie sie. Mailin würde niemals ihre Aggression gegen ihre Kinder richten. Dafür würde sie, Sabine, ihre Hand ins Feuer legen.
Sabine Yao hatte sich einen Tag nach dem Unfall auf der Kinderintensivstation der Charité selbst ein Bild vom immer noch kritischen Zustand ihrer kleinen Nichte gemacht. Sie wusste, dass Siaras Kopfverletzungen so schwerwiegend waren, dass eine völlige Wiederherstellung ihrer Gesundheit so gut wie ausgeschlossen war. Ob Siara jemals wieder in einem normalen häuslichen Umfeld würde leben können, war zum jetzigen Zeitpunkt ebenso offen wie die Frage, ob sie überhaupt überleben würde. Als Rechtsmedizinerin kannte Sabine Yao nur zu gut die möglichen Komplikationen – Lungenentzündung, Blutgerinnselbildungen in den Hirnschlagadern, Lungenembolie –, nicht nur infolge des Traumas selbst, sondern auch als Konsequenz der notwendig gewordenen Operationen, die ihre Nichte über sich hatte ergehen lassen müssen und die vielleicht noch folgen würden.
Aber das alles wusste ihre Schwester nicht. Mailin ahnte es vielleicht. Aber Sabine Yao konnte ihr momentan unmöglich sagen, wie es wirklich um ihre Tochter stand. Denn dafür war die Bürde, die ihre Schwester aus der jüngeren Vergangenheit mit sich herumtrug, viel zu groß. Das tragische Schicksal der Familie Zhou hatte bereits vor sechs Monaten seinen Lauf genommen, als Mailins Mann bei einem Unfall ums Leben kam.
Mailin starrte abwesend aus dem Fenster, während sich ihre Augen langsam mit Tränen füllten. Die Wohnung lag im zwölften Stock, sodass man, bei wolkenloser Sicht wie heute, den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz sehen konnte, das ehemalige Wahrzeichen Ostberlins. Sabine Yaos Blick folgte dem ihrer Schwester. In der Ferne, ganz am Horizont über dem unendlichen Häusermeer und dem Straßengewirr Berlins, konnte sie am Horizont einen blassgrünen Schimmer als schmalen Streifen unter dem azurblauen Himmel ausmachen.
Es würde auch heute in der deutschen Hauptstadt wieder ein heißer Tag werden.
5
Berlin, Treptowers, BKA-Einheit »Extremdelikte«, Besprechungsraum, Montag, 28. Juli, 7:45 Uhr
Also, Herrschaften«, setzte Herzfeld an. »Der erste Fall des Tages. Oder eher – zwei Fälle in einem. Die beiden mumifizierten Leichen aus dem alten Hindutempel in Kreuzberg. Laut erster Einschätzung der zuständigen Ermittler der Mordkommission beim LKA liegen die beiden dort schon länger unter dem Dielenboden versteckt und stammen wohl aus der Zeit, als der Tempel noch in Betrieb war. Die Tempelanlage wurde vor gut zwei Jahren geschlossen.« Herzfeld ließ den kleinen roten Punkt des Laserpointers einem Glühwürmchen gleich über ein weiteres Foto der beiden Tempel-Toten huschen.
Scherz räusperte sich. »Es war ja schon auf den ersten Blick zu sehen, dass die nicht erst seit gestern dort liegen. Aber vor der Mumifizierung kommt nun mal die Fäulnis. Hat denn niemand in der Gemeinde Verwesungsgerüche wahrgenommen, als der Tempel noch von Gläubigen frequentiert wurde? Wissen wir irgendetwas dazu?«, fragte der Oberarzt brummend in die Runde.
Aber noch bevor Herzfeld etwas antworten konnte, schaltete sich Murau ein.
»Kollege Scherz, da sieht man mal wieder, dass Ihre Reisen Sie höchstens bis in die Mark Brandenburg oder allenfalls bis zu den Fischköpfen an die heimische deutsche Küste führen. Schauen S’, in einem Hindutempel riecht es nach allem Möglichen: Räucherstäbchen, Früchte, andere Dinge, die als Opfergaben dargebracht werden. Ich habe mal einen Tempel in Mumbai besucht, in dem …«
»Ausgezeichnet, Murau, dann sind Sie ja genau der richtige Mann«, unterbrach Herzfeld ihn. »Sie und Frau Dr. Roth übernehmen das. Dr. Fuchs und sein Laborteam sind auf Stand-by, die wissen Bescheid, dass nachher Untersuchungsmaterial aus dem Sektionssaal kommt. Die Identifizierung der beiden Toten hat oberste Priorität. Die Kollegen von der Mordkommission machen sich nämlich keine Hoffnungen auf irgendwelche Zeugenaussagen, die uns weiterhelfen könnten. Die Gemeinde des Tempels ist ohnehin nicht sehr zugänglich, die Leute fürchten wohl, dass der Vorfall den Neubau der Tempelanlage verhindern könnte.«
Herzfeld schob jeweils einen hellroten DIN-A4-Schnellhefter zu Murau und Roth über die Tischplatte des Konferenztisches, was beide mit einem stummen Nicken quittierten.
»Gut. Machen wir weiter. Der nächste Fall«, sagte Herzfeld, der nach seinem Urlaub wieder vollkommen in seinem Element zu sein schien. Er klickte kurz mit der Fernbedienung, und die Mumien wichen der Nahaufnahme eines menschlichen Körpers. Oder vielmehr dem, was die Flammen von ihm übrig gelassen hatten. Der schwarz verkohlte Tote lag in der sogenannten Fechterstellung – mit in den Ellbogen angewinkelten Armen, die Beine in den Kniegelenken gebeugt – neben einer Parkbank, von der große Teile ebenfalls verbrannt waren. Aus der verkohlten Bauchwand des Toten wanden sich seine Darmschlingen hervor, der Anblick erinnerte an Rubens’ Gemälde vom Haupt der Medusa.
»Noch nicht identifizierte Person, auch das Geschlecht konnte noch nicht bestimmt werden. Warum, erübrigt sich zu sagen, wenn Sie die massiven Folgen der Brandzehrung betrachten«, führte Herzfeld aus. »Vielleicht ein Obdachloser. Fakt ist, die Person, die wir hier sehen, wurde nach ersten Untersuchungsergebnissen von der KT mit Benzin oder einer anderen leicht entflammbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Möglich, dass diese Tat in Zusammenhang steht mit den beiden Obdachlosenverbrennungen im Mai und Juni.« Damit spielte Herzfeld auf die feigen Attacken auf zwei Obdachlose an, die wenige Wochen zuvor in kurzen Abständen in Berlin-Reinickendorf und Berlin-Niederschönhausen von einem oder mehreren unbekannten Tätern mit Benzin übergossen und angezündet worden waren. Eines der beiden Opfer hatte noch wenige Tage auf einer Intensivstation für Brandverletzte im Berliner Unfallkrankenhaus überlebt, war dann aber auch seinen schweren Verletzungen erlegen.
Das nächste Foto erschien auf der Leinwand. Diesmal war es der Kopf der Brandleiche in Nahaufnahme. Der rote Punkt des Laserpointers hüpfte über das schwarz verkohlte Gesicht mit den aufgequollenen Lippen und der zwischen den Zahnreihen hervorquellenden Zunge – was der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Person fast grimassenhafte Züge gab – und kam dann schließlich auf dem Hals zum Stillstand.
»Unschwer zu erkennen ist hier die Strangulationsfurche, die aufgrund des eng anliegenden Drosselwerkzeugs noch gut zu sehen ist«, fuhr Herzfeld fort und ließ den roten Punkt des Laserpointers über einen schmalen, gelblich-rötlichen Streifen wandern, der horizontal über die Halsvorderseite des Toten verlief und sich gut von dem umgebenden, verkohlten Gewebe abhob. »Was uns zu der Frage bringt, ob diese Person nicht anders getötet wurde als die beiden Obdachlosen in Reinickendorf respektive Niederschönhausen. Wenn es so ist, wie es hier prima vista scheint, dann wurde sie oder er hier zunächst stranguliert und dann erst angezündet, vielleicht sogar postmortal. Das wäre ein anderer Modus Operandi, was bedeuten würde, dass der Täter, falls es derselbe ist, eine Entwicklung durchläuft.« Herzfeld machte eine kurze Pause und sah in die Runde seiner Mitarbeiter, ehe er weitersprach. »Oder es ist gar nicht derselbe Täter. Vielleicht ein Nachahmer, oder wir haben es in diesem Fall mit einem persönlichen Motiv zu tun, und der Täter will die Kollegen von den ›Delikten am Menschen‹ von seiner eigenen Fährte abbringen und eine falsche Spur zum ›Berber-Zündler‹ legen.« So war der noch unbekannte Mörder der beiden bei lebendigem Leibe verbrannten Obdachlosen von der Berliner Boulevardpresse getauft worden.
»Wie dem auch sei, Sie, Herr Dr. Scherz, und Sie, Frau Dr. Rath, werden mir heute Nachmittag sicherlich mehr dazu sagen können.« Mit diesen Worten schob der Chef der Abteilung »Extremdelikte« einen weiteren hellroten Schnellhefter über die Tischplatte des Konferenztisches zu den beiden Angesprochenen hinüber.
»Ein echtes Schmankerl«, kommentierte Murau das eben Gehörte und zwinkerte Scherz und Rath zu.
»Warten Sie es ab, Murau. Es wird noch besser. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Aber beim letzten Fall des Tages wird es kompliziert«, sagte Herzfeld und drückte erneut auf der Fernbedienung herum.