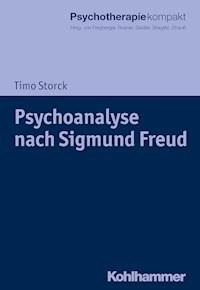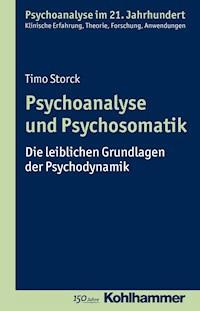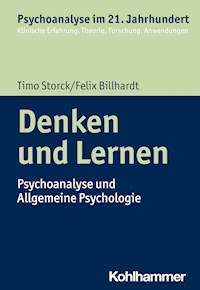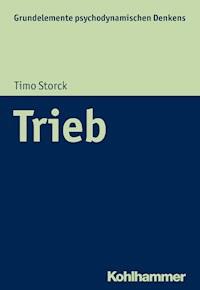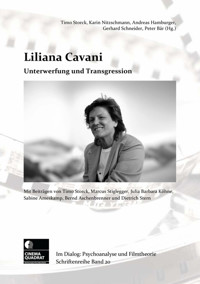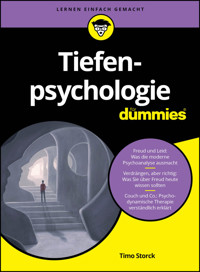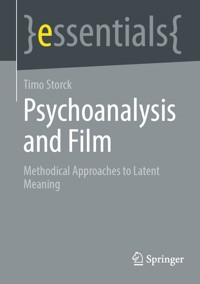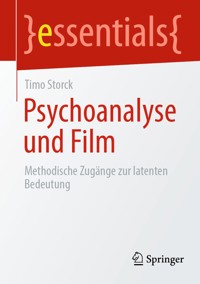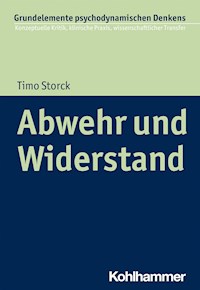
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dem Grundgedanken des (unbewussten) psychischen Konflikts folgend wird beleuchtet, welche Rolle Abwehrprozesse hierbei spielen. Es wird etwas vom Bewusstsein ferngehalten und zugleich umgearbeitet, sodass es im Erleben auftauchen kann, wenn auch in veränderter Form. Dabei lassen sich unterschiedliche Formen von Abwehrmechanismen unterscheiden sowie Abwehrformationen oder interpersonell strukturiertes Abwehrverhalten. Zu beachten bleibt, wann ein Umgang mit Konflikten als eine Abwehr und wann als eine gelingende Bewältigung zu bewerten ist. Hinzu treten Überlegungen zum Widerstand als Form, in der sich Abwehrvorgänge in Behandlungen zeigen und sich gegen Veränderung richten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Timo Storck, Prof. Dr. phil., Jahrgang 1980, ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, Psychoanalytiker (DPV/IPA) und Psychologischer Psychotherapeut (AP/TP). Studium der Psychologie, Religionswissenschaften und Philosophie an der Universität Bremen, Diplom 2005. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Bremen (2006–2007), Kassel (2009–2015) sowie an der Medizinischen Universität Wien (2014–2016). Promotion an der Universität Bremen 2010 mit einer Arbeit zu künstlerischen Arbeitsprozessen, Habilitation an der Universität Kassel 2016 zum psychoanalytischen Verstehen in der teilstationären Behandlung psychosomatisch Erkrankter. Mitherausgeber der Zeitschriften Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung und Forum der Psychoanalyse sowie der Buchreihe Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie, Mitglied des Herausgeberbeirats der Buchreihe Internationale Psychoanalyse. Forschungsschwerpunkte: psychoanalytische Theorie und Methodologie, psychosomatische Erkrankungen, Fallbesprechungen in der stationären Psychotherapie, Kulturpsychoanalyse, konzeptvergleichende Psychotherapieforschung.
Timo Storck
Abwehr und Widerstand
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-037930-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-037931-2
epub: ISBN 978-3-17-037932-9
mobi: ISBN 978-3-17-037933-6
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Die Konzeption von Abwehr und Widerstand bei Freud
2.1 Die Grundidee der psychischen Abwehr
2.2 Abwehr in Freuds Modellen der Seele
2.2.1 Abwehr im topischen Modell
2.2.2 Abwehr im Instanzen-Modell
2.3 Zur Differenzierung von Abwehr und Widerstand
2.3.1 Widerstand als die Äußerung von Abwehrmechanismen in Behandlungen
2.3.2 Widerstand gegen die Gefahr der Veränderung
2.3.3 Widerstandsphänomene
2.4 Agieren und Enactment
2.5 Fallbeispiel Herr A., Teil I
3 Unterschiedliche Formen von Abwehr und Widerstand
3.1 Die unterschiedlichen Abwehrmechanismen
3.1.1 (Ich-) Spaltung
3.1.2 Verwerfung
3.1.3 Verleugnung
3.1.4 Verdrängung
3.1.5 Ungeschehenmachen
3.1.6 Reaktionsbildung
3.1.7 Verkehrung ins Gegenteil
3.1.8 Intellektualisierung/Rationalisierung
3.1.9 Affektualisierung
3.1.10 Isolierung und Affektisolierung
3.1.11 Verschiebung
3.1.12 Wendung gegen das Selbst
3.1.13 Altruistische Abtretung eigener Triebregungen
3.1.14 Identifizierung/Introjektion
3.1.15 Projektion
3.1.16 Projektive Identifizierung
3.2 Versuche der Gruppierung von Abwehrmechanismen nach Reifegrad
3.3 Abwehrformationen
3.4 Formen von Widerstand in Behandlungen
3.5 Fallbeispiel Herr A., Teil 2
4 Die Arbeit mit Abwehr und Widerstand in psychoanalytischen Behandlungen
4.1 Abwehr und Körperlichkeit
4.2 Abwehr und Widerstand in unterschiedlichen psychoanalytischen Richtungen
4.2.1 Abwehr und Widerstand bei Melanie Klein und John Steiner: Paranoid-schizoide und depressive Abwehr, pathologische Organisation
4.2.2 Abwehr und Widerstand bei Jacques Lacan: Der Widerstand des Analytikers
4.2.3 Abwehr und Widerstand bei Heinz Kohut: Erhalt der Selbstkohärenz
4.2.4 Abwehr und Widerstand bei Otto F. Kernberg
4.3 Die negative therapeutische Reaktion
4.4 Umgang mit Widerstand in analytischen Behandlungen
4.4.1 Übertragungswiderstände
4.4.2 Durcharbeiten
4.4.3 Gegenübertragungswiderstände
4.5 Fallbeispiel Herr A., Teil 3
5 Abwehr im interpersonellen und gesellschaftlichen Kontext
5.1 Interpersonale Abwehr
5.1.1 Abwehr in Paar- und Familiendynamiken
5.2 Kultur(in)varianz von Abwehr
5.3 Institutionelle Abwehr
5.4 Widerstände gegen die Psychoanalyse
5.5 Fallbeispiel Herr A., Teil 4
6 Abwehr und Widerstand interdisziplinär
6.1 Abwehr als Bewältigung
6.1.1 Anpassung
6.1.2 Abwehr und Coping
6.1.3 Sublimierung
6.2 Rupture/Repair als allgemeine Konzeption der Arbeit mit Behandlungswiderständen
6.3 Abwehr in Forschung und psychologischer Theorie
6.3.1 Forschungszugänge
6.3.2 Allgemeine Psychologie von Abwehr und Widerstand
6.4 Abwehr und Widerstand in anderen psychotherapeutischen Verfahren
6.4.1 Behandlungshindernisse in der (kognitiven) Verhaltenstherapie
6.4.2 Abwehr und Widerstand in der Gesprächspsychotherapie
6.4.3 Abwehr und Widerstand in der systemischen Therapie
6.4.4 Zusammenfassung
6.5 Fallbeispiel
7 Zusammenfassung und Ausblick
Verzeichnis der zitierten Medien
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Beim vorliegenden Band handelt es sich um eine bearbeitete Mitschrift von fünf öffentlichen Vorlesungen, die ich im Sommersemester 2019 an der Psychologischen Hochschule Berlin gehalten habe. Die Vorlesungsreihe ist Teil eines Projekts zu den Grundelementen psychodynamischen Denkens, in dem es unter der dreifachen Perspektive »Konzeptuelle Kritik, klinische Praxis, wissenschaftlicher Transfer« darum geht, sich mit psychoanalytischen Konzepten auseinanderzusetzen: Trieb (Band I), Sexualität und Konflikt (Band II), dynamisch Unbewusstes (Band III), Objekte (Band IV), Übertragung (Band V), Abwehr und Widerstand (Band VI), Ich/Selbst (Band VII) und Deutung (Band VIII). Ziel ist dabei, sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch im vorliegenden Format einer Reihe von Buchpublikationen eine Art kritisches Kompendium psychoanalytischer Konzepte zu entwickeln, ohne dabei den Anschluss an das Behandlungssetting oder den wissenschaftlichen Austausch zu vernachlässigen. Wenn es um Grundelemente psychodynamischen Denkens gehen soll, dann soll damit auch der Hinweis darauf gegeben werden, dass aus Sicht der Psychoanalyse jedes, also auch das wissenschaftliche, Denken selbstreflexiv ist: Das Denken über Psychodynamik ist unweigerlich selbst psychodynamisch, d. h. es erkundet die Struktur der Konzeptzusammenhänge auch auf der Ebene der Bedeutung von Konzeptbildung selbst.
Für ein solches Vorgehen ist das Werk Freuds der Ausgangs- und ein kontinuierlicher Bezugspunkt. Mir geht es um eine genaue Prüfung dessen, was Freud mit seinen Konzepten »vorhat«, d. h. welche Funktion diese haben und welches ihr argumentativer Status ist. Dabei soll nicht eine bloße Freud-Exegese geschehen, sondern eher ein Lesen Freuds »mit Freud gegen Freud«. Es wird deutlich werden, dass der grundlegende konzeptuelle Rahmen, den Freud seiner Psychoanalyse gibt, es auch erlaubt aufzuzeigen, wo er hinter den Möglichkeiten seiner Konzeptbildung zurückbleibt.
Über den Ausgangspunkt der Vorlesungen erklärt sich die Form des vorliegenden Textes, der nah an der gesprochenen Darstellung bleibt. Auch sind, wie in jeder Vorlesung, eine Reihe von inhaltlichen Bezugnahmen auf Arbeiten anderer Autoren eingeflossen, die mein Denken grundlegend beeinflussen, ohne dass dazu durchgängig im Detail eine Referenz erfolgen kann.
Bedanken möchte ich mich bei den Teilnehmenden an den öffentlichen Vorlesungen für ihr Interesse (insbesondere bei Julia Sieg, die mich beim Rollenspiel unterstützt hat, welches in Kapitel 6 zu finden ist), sowie beim Kohlhammer Verlag, namentlich Ruprecht Poensgen, Annika Grupp und Kathrin Kastl, für die Unterstützung bei der Vorlesung und der Veröffentlichung. Außerdem danke ich Caroline Huss für die Anfertigung von Transkripten zur Audio-Aufzeichnung der Vorlesung. Cornelia Weinberger, Mona Brettschneider und Marko Walther gebührt Dank für die planerische und technische Unterstützung bei der Durchführung der Vorlesungen. Der Psychologischen Hochschule Berlin danke ich schließlich für die Möglichkeit, eine solche Vorlesungsreihe durchzuführen.
Heidelberg, August 2020
Timo Storck
1 Einleitung
Der hier vorliegende sechste Band der Reihe »Grundelemente psychodynamischen Denkens« baut auf einigen Überlegungen auf, die in den vorangegangenen Bänden entwickelt worden sind; ich fasse einige der Annahmen knapp zusammen. Dazu gehört auch die Darlegung meines grundlegenden Verständnisses psychoanalytischer Konzepte. Wie jedes andere wissenschaftliche Konzept beruht ein Konzept auch in der Psychoanalyse auf dem Anliegen, Phänomene der in irgendeiner Weise erfahrbaren inneren und äußeren Welt auf den Begriff zu bringen. Konzepte sind dabei Abstrakta, sie sind nicht gegenständlich in der Welt zu finden; so ist das Über-Ich oder die Verdrängung eine konzeptuelle, hoffentlich explikative Bezeichnung für etwas, dessen Wirkungen sich in der Erfahrung (= Empirie, in einem weit gefassten Sinn) zeigen, so etwa das Erleben von Schuldgefühlen oder das Nicht-Erinnern-Können affektiv bedeutsamer Erlebnisanteile. Jeder forscherische Zugang beispielsweise, der etwas messen zu können meint, braucht daher Operationalisierungen der Konzepte, die auf konzeptueller Ebene daher hinreichend genau beschrieben sein sollten (ohne dass dabei auf Spannungsverhältnisse innerhalb des Konzeptverständnisses verzichtet werden sollte). Konzepte sind ferner Teil eines Konzeptzusammenhangs (was zum Beispiel zur Folge hat, dass sich einzelne Konzepte nicht vermittlungslos herauslösen und in einen anderen Kontext setzen lassen) und das in ihnen Gefasste sollte so »sparsam« wie möglich (aber auch so differenziert wie erforderlich) formuliert sein. Bezüglich der psychoanalytischen Konzepte im Besonderen ist hinzuzufügen, dass durch den psychoanalytisch-konzeptbildenden Zugang zum (klinischen) Einzelfall eine Situation entsteht, in der psychoanalytische Konzepte allgemein etwas darüber sagen sollen, wie sich Besonderes darstellt (einen ähnlichen Gedanken äußert z. B. Zepf, 2006a, S. 263), zum Beispiel eine einzelne Behandlung, deren Elemente unter Rückgriff (und Fortentwicklung) allgemeiner Konzepte beschrieben werden. Die Psychoanalyse findet daher ihren Schritt in die Verallgemeinerung in erster Linie in der Konzeptbildung.
Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses ist zunächst das Triebkonzept beleuchtet worden (Storck, 2018a). Ein wichtiger zeitgenössischer Nutzen der psychoanalytischen Theorie des Triebes liegt darin, den Übergang von Physiologie in Psychisches zu beschreiben. Es dient dazu, auf den Begriff zu bringen, wie sich physiologienahe Erregungszustände in psychisches Erleben vermitteln, uns dieses sogar aufnötigen. In diesem Sinn beschreibt das Triebkonzept eine Theorie der allgemeinen Motivation: Wie ist Psychisches als solches motiviert? Dabei ist, anders als bei Freud, eine monistische Auffassung des Triebes leitend, es geht weniger um verschiedene Triebarten und spezielle Motivationen, die sich dann als sexuelle oder aggressive enttarnen ließen, sondern in allgemeiner Hinsicht um etwas von der psychosomatischen Grundstruktur des Menschen, was bei Freud (1915c, S. 214) in seiner Formulierung zum Trieb als »Grenzbegriff« zwischen Psyche und Soma angelegt ist. Darüber hinaus handelt es sich nicht um biologische oder ethologische Überlegungen, sondern es lässt sich zeigen, dass sich das Triebkonzept auf ein sozialisatorisches Geschehen bezieht: Erregungszustände finden nicht »a-sozial« statt, sondern treten im Rahmen von Interaktionen bzw. Beziehungen mit anderen auf, in Momenten von Berührung und Nicht-Berührung. Das gibt dem Anderen unweigerlich einen Platz in der Triebtheorie. Das umstrittene Freud’sche Konzept des Todestriebs (vgl. Storck, 2020b) lässt sich als »untertriebener« Aspekt der Triebtheorie verstehen: Während die Sexualität für sich genommen exzessiv und unreglementiert ist (»übertrieben«), wird durch ihre Verschränkung mit dem, was Freud »Todestrieb« nennt, also ein Streben nach Ruhe und Spannungslosigkeit, Befriedigung erst möglich.
Während »Trieb« Teil einer Theorie der allgemeinen Motivation ist, findet die Psychoanalyse ihre Theorie der speziellen Motivation im Konfliktbegriff (Storck, 2018b). Hier wird beschreibbar, wie die Strukturierung des Psychischen mit einem grundlegenden Spannungsfeld in Zusammenhang steht. Es wird dabei deutlich, dass es zum einen um unbewusste psychische Konflikte geht, zum anderen um solche, die mit Lust und Unlust und deren psychischer Dynamik zu tun haben. Der psychoanalytische Begriff der Sexualität ist ein erweiterter: Sexualität beschreibt in ihrer infantilen Form unreglementierte, noch nicht vereinheitlichte leibliche Empfindungen, die in ihrer Grundstruktur mit Lust und Unlust, deren Ansteigen und Absinken zu tun haben. Vor diesem Hintergrund (Sexualität als Lust/Befriedigung, leibliche Interaktion mit Anderen) ist die Freud‘sche Konzeption der psychosexuellen Entwicklungsphasen zu verstehen: Oralität, Analität und das Phallisch-Ödipale sind in ihrer Grundstruktur zwar körpernah konzipiert, in ihrer Vermittlung in Psychisches werden sie allerdings auch zu etwas, das sich »thematisch« begreifen lässt, so dass es dann beispielsweise bei »oralen Themen« um Themen von Versorgung und Bedürfnissen gehen kann. Erst mit Beginn der »reifen«, genitalen Sexualität findet sich das fragmentiert infantil Sexuelle (von Freud daher als »polymorph-pervers« bezeichnet) »gebändigt«. Konflikthaft ist das Geschehen, weil Luststreben und Unlustvermeidung einander in die Quere kommen können; im weiteren Verlauf des vorliegenden Bandes wird dies unter der Perspektive der Abwehr genauer in den Blick kommen (auch im Hinblick darauf, dass sich Konflikte unterschiedlicher psychischer »Reife« unterscheiden lassen). Die Psychoanalyse beschreibt den Menschen grundlegend als konflikthaft, weil sich mit diesen Überlegungen zur Struktur des Psychischen zeigen lässt, in welcher Weise der Umgang mit Motivationen, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, als Motor der Entwicklung des Psychischen gesehen werden kann – in besonderer Weise der ödipale Konflikt, der sich im hier vorgeschlagenen Verständnis als etwas darstellt, das sich um die Auseinandersetzung mit Geschlechter- und Generationenunterschieden sowie um die grundlegende Möglichkeit des (passageren) Ausgeschlossenseins aus Beziehungen zwischen anderen dreht. Mit dem Hinweis auf den Konflikt als Motor des Psychischen ist auch gesagt, dass es unbewusste Aspekte des konflikthaften Erlebens sind, um die es der Psychoanalyse geht.
Daher ist es in einem nächsten Schritt der Argumentation um die Konzeption des dynamisch Unbewussten in der Psychoanalyse gegangen (Storck, 2019b). Freuds Anliegen ist es gewesen, mit der von ihm so genannten Metapsychologie eine Theorie des Psychischen zu entwickeln, die ein psychisch Unbewusstes einbezieht – anders als die Psychologie seiner Zeit es tat, etwa sein akademischer Lehrer Franz Brentano, in dessen Intentionalitäts- und Aktlehre es widersinnig erscheinen muss, dass es Unbewusstheit von etwas geben soll. Freud geht es dabei nicht einfach nur um etwas, das nicht im psychischen Erleben auftaucht, sondern um ein dynamisch Unbewusstes, das heißt um etwas, das funktionell, aus guten psychoökonomischen Gründen dem bewussten Erleben nicht (mehr) zugänglich ist, dieses aber umso stärker leitet. Es ist das Zusammentreffen drängender und verdrängender Kräfte, das psychische Mechanismen mobilisiert, die dafür sorgen, dass etwas aus dem Bewusstsein ausgeschlossen wird bzw. dort nur in entstellter Form auftauchen kann. Dass auf diese Weise etwas unbewusst wird, hat mit dem (unbewussten) Ziel der Vermeidung unlustvoller Affekte zu tun. Es zeigt sich auch, dass »unbewusst« keine Substanz oder Essenz beschreibt und sich nicht an einer psychischen Örtlichkeit finden lässt, sondern ein Merkmal von Teilen der Vorstellungswelt ist. »Unbewusst« wird dann zu etwas, das Verhältnisse zwischen Vorstellungen und Affekten beschreibt. In diesem Kontext sind Freuds Modelle des psychischen Apparates wichtig, besonders die sog. erste Topik (bzw. das topische Modell) aus den Systemen Bewusst, Vorbewusst und Unbewusst sowie die sog. zweite Topik (bzw. das Struktur- oder Instanzen-Modell) aus Ich, Es und Über-Ich.
Bei den Überlegungen zu Motivation und Bewusstheit/Unbewusstem sind bis dahin Konzeptionen psychischer Repräsentation implizit geblieben, was darauf folgend in der Untersuchung des Objektbegriffs in der Psychoanalyse genauer ausgearbeitet worden ist (Storck, 2019c). Das Konzept des psychischen Objekts wurzelt terminologisch in der Triebtheorie (als eines der vier Elemente des Triebes, neben Ziel, Quelle und Drang), gemeint ist das Objekt psychischer »Besetzung« (mit Libido oder Aggression, oder einfacher gesagt: mit Affekt), es ist also das Objekt der Vorstellung gemeint. Dabei hat es sich als nützlich erwiesen, vom »Objekt« als Element der subjektiven psychischen Welt zu sprechen und das konkrete Gegenüber in einer interpersonalen Situation nicht als »äußeres Objekt« oder ähnlich zu bezeichnen, sondern als »Gegenüber« oder »andere Person«. Psychoanalytisch lassen sich Mechanismen beschreiben, mittels derer das Objekt psychisch gebildet und verändert wird, nämlich Introjektion (verwoben mit Projektion), Identifizierung oder die Fantasie von Inkorporation, also, etwas vom anderen in sich hineingenommen zu haben. Das macht zum einen das Wechselspiel zwischen Hineinnehmen und Hinaushalten deutlich, zum anderen weist es darauf hin, dass ein »Objekt« immer Teil der subjektiven Innenwelt ist – nicht nur weil die Repräsentanzen der eigenen Person und die von anderen Personen miteinander verbunden sind (als Beziehungsvorstellungen), sondern auch weil es um die Repräsentanzen geht, die das Individuum von sich in Beziehung zu anderen hat. Eine grundlegente Auffassung in der Psychoanalyse (meistens im Zusammenhang von Theorien der Symbolisierung gefasst) besteht darin, sich psychische Entwicklung als etwas vorzustellen, in dem sich Interaktionen in Beziehungsvorstellungen niederschlagen, aus denen sich Vorstellungen (= Repräsentanzen) vom Selbst (vgl. dazu Storck in Vorb. a) und von Anderen (und deren Verbindung durch Affekte) herauslösen lassen und die weitere Interaktionen zwar nicht determinieren, so aber doch unweigerlich bewusst und unbewusst leiten. Es wird deutlich, dass solche Repräsentanzen und der (symbolisierende) Prozess ihrer Bildung und Wirkung unterschiedlich integriert oder psychisch ausgearbeitet sein können, was eine Rolle spielt, wenn auf die »Reife« von Abwehrmechanismen geblickt wird. Außerdem wird im Rekurs auf die Objektkonzeption beschreibbar, wie sich psychische Konflikte nicht allein auf motivationaler, sondern auch auf repräsentationaler Ebene zeigen.
Die zentrale Überlegung, dass Beziehungsvorstellungen dafür leitend sind, wie wir aktuelle Interaktionen erleben und gestalten, taucht auch im Konzept der Übertragung auf (Storck, 2020a). Meistens als ein behandlungstechnischer Begriff verstanden, der sich darauf bezieht, was sich in der analytischen Beziehung aus vorangegangenen Beziehungen wiederholt, somit zeigt und verändert werden kann, beschreibt »Übertragung« zunächst einmal einen Weg des Bewusstwerdens von mit unlustvollen Affekten verbundenen Elementen der inneren Welt. Damit ist gemeint, dass Affekte oder Fantasien sich an Vorstellungen knüpfen, die weniger ängstigend, peinlich oder mit Schuldgefühlen verbunden sind, so dass etwas in ihrem Umfeld bewusst werden »darf«. Freud hat dies für den Behandlungsprozess genutzt, indem er Übertragungsphänomene darin konzipierte und dies ins Zentrum der psychoanalytischen Technik und Veränderungstheorie rückte (verbunden mit anderen Konzepten wie Regression, Wiederholung, Deutung oder Durcharbeiten; vgl. dazu auch Storck in Vorb. b). Es lassen sich also eine weite Begriffsfassung (Übertragung bedeutet, dass Affekte oder Fantasien im Umfeld einer anderen Vorstellung bewusst erlebbar werden) und eine enge Begriffsfassung (Übertragung bedeutet, dass eine Beziehung davon geprägt wird, was in anderen Beziehungen erlebt wurde) unterscheiden. Für unterschiedliche psychische Störungen lassen sich unterschiedliche charakteristische Übertragungsformen und -phänomene beschreiben, zudem wird das Konzept in verschiedenen psychoanalytischen Richtungen unterschiedlich verstanden und führt auch zu unterschiedlichen Handhabungen in der Technik. Zugleich zeigt sich darin, dass Übertragungsphänomene weder auf die klinische Situation, noch auf psychisch kranke Menschen beschränkt sind. Erkennt man an, dass das Konzept sich vor allen Dingen darauf bezieht, dass und wie aktuelle Beziehungen im Licht der vergangenen erlebt und gestaltet werden, dann hat dies auch eine Relevanz dafür, wie Psychoanalytiker ihre Patienten erleben1. Es kann zwischen Gegenübertragung (als zunächst erlebnismäßiger »Beantwortung« der Übertragung des Patienten durch den Analytiker) und Eigenübertragung (als eigene, d. h. patientenunabhängige Anteile, die der Analytiker einbringt) unterschieden werden, wobei wichtig ist, dass es sich um eine konzeptuelle und somit abstrakte Unterscheidung handelt, was die Herausforderung mit sich bringt, in konkreten Situationen das Zusammenwirken beider reflektieren zu können. Die Konzepte Übertragung und Gegenübertragung sollten dabei nicht als etwas missverstanden werden, das sich auf konkret trennbare, womöglich aufeinander folgende Prozesse bezieht – vielmehr geht es um die gemeinsam gestaltete Szene in der analytischen Situation, die demzufolge auch szenisch verstanden wird, um so zu erkennen, was im »Hier-und-Jetzt« der konkreten Begegnung hinsichtlich der Modi des Erlebens von Beziehung und Affekt leitend ist (neben dem methodologischen Konzept des szenischen Verstehens ist hier auch der Begriff der projektiven Identifizierung in seiner behandlungstechnischen Bedeutung wichtig; weiter unten wird er in der Bedeutung als Abwehrmechanismus erläutert, Kap. 3.1.16).
Einige Fragen sind dabei bislang offen geblieben, in erster Linie solche, die sich darauf beziehen, wie nun etwas unbewusst wird oder wie die (Abwehr-!) Prozesse, die für Unbewusstheit sorgen, ihrerseits motiviert sind. Wie lässt es sich auf den Begriff bringen, dass es in irgendeiner Weise zielgerichtete Prozesse gibt, die allerdings, um überhaupt etwas unbewusst werden oder bleiben lassen zu können, ihrerseits unbewusst sind? Ein weiteres Feld, das genauer beleuchtet werden muss, ergibt sich aus der Erkenntnis, dass es in analytisch-therapeutischen Veränderungsprozessen nicht damit getan ist, Patienten darauf hinzuweisen, dass ihnen etwas unbewusst ist, und was – und sei es noch so sehr in der aktuellen Beziehung spürbar. Denn der Annahme folgend, dass bewusste Erlebensweisen, und insbesondere psychopathologische Symptome, Versuche sind, mit psychischen Konflikten umzugehen, muss auch angenommen werden, dass einmal gefundene psychische Kompromissbildungen (aus unterschiedlichen Motiven, zur Bewältigung motivationaler und repräsentationaler Konflikte) nicht so leicht aufgegeben werden. Der Behandlungsprozess muss also einen Umgang damit finden, dass sich Widerstandsphänomene zeigen, die sich gegen die Veränderung, die in erster Linie auch als Verunsicherung erlebt wird, richten.
1 Ich werde im Folgenden kapitelweise zwischen einer durchgängigen Verwendung des generischen Maskulinums und des generischen Femininums wechseln (außer in Zitaten). Sofern nicht explizit ausgewiesen, etwa in einem Fallbeispiel, sind dabei jeweils alle Geschlechter gemeint.
2 Die Konzeption von Abwehr und Widerstand bei Freud
In der TV-Serie Futurama wird die einigermaßen ferne Zukunft der Menschheit thematisiert, in der Menschen, Wesen von anderen Planeten und Roboter zusammenleben und Zeitreisen und allerlei andere Errungenschaften verfügbar sind – darüber hinaus zeigen sich aber Themen menschlicher Gefühle, Konflikte und Handlungen, die alles andere als fern sind. Im Zentrum steht das Leben der Besatzung eines interplanetaren Paketzustelldienstes (»Planet Express Inc.«). In einer Folge (»Lethal inspection«, 2010) geht es darum, dass der Roboter Bender, trotz vermeintlich perfekter Produktion und Wartung, Öl verliert. Er weist dies zunächst ab, muss dann aber erkennen, dass ein starker Strahl Öl aus seiner Seite herausschießt. Der Schiffsarzt Dr. Zoidberg, ein hummer-ähnlicher Außerirdischer, ruft daraufhin: »Das nennst du eine Tinten-Abwehr!?«, reißt sich die Kleider vom Leib, versprüht im ganzen Raum Unmengen von Tinte und rennt aus dem Raum…
Anders als die Tinten-Abwehr haben psychische Abwehrmechanismen in grundlegender Betrachtung mit einer Abwehr gegen innere »Reize« zu tun, auch wenn anerkannt werden muss, dass diese nicht losgelöst von vorangegangener Erfahrung und auch nicht von ihren Folgen auch für soziale Situationen betrachtet werden können. Es ist eines der wichtigsten Anliegen Freuds gewesen, in der Auseinandersetzung vor allem mit Träumen und psychischen Störungen etwas über die »Allgemeine Psychologie« des Menschen zu erforschen (vgl. Billhardt & Storck, 2021; Storck & Billhardt, 2021). Dabei stehen für ihn die Annahmen zu psychischen Konflikten, der Rolle der Abwehr darin und die Folge der Unbewusstheit von Elementen der psychischen Welt im Zentrum, die er als allgemein menschliche Merkmale auffasst, nicht allein als psychopathologische Konzepte. Entsprechend formuliert auch König (1995a, S. 11): »Ein Leben ohne Abwehrmechanismen ist nicht denkbar.« Abwehr ist nicht einfach nur etwas, das Symptome produziert, sondern bedeutet immer auch die zumindest versuchte Bewältigung schwieriger Erlebnisse, Affekte oder innerer Konflikte.
2.1 Die Grundidee der psychischen Abwehr
In Freuds Auffassung der Abwehr in allgemeiner Hinsicht (um einzelne Abwehrmechanismen wird es in Kapitel 3.1 gehen, Kap. 3.1) lassen sich drei Merkmale erkennen:
Erstens richtet sie sich auf einen inneren Reiz. Freud schreibt, der »Abwehrvorgang« sei »analog der Flucht«, er stelle »einen Fluchtversuch vor einer Triebgefahr dar« (Freud, 1926d, S. 176). Zieht man allerdings hinzu, dass Freud den Trieb als etwas begreift, das »nicht von außen, sondern vom Körperinnern her angreift«, und daher »auch keine Flucht gegen ihn nützen« kann (Freud, 1915c, S. 212 f.), wird deutlich, dass die hier beschriebene Flucht sozusagen eine Flucht im Erleben ist. Gegen einen unangenehmen äußeren Reiz, etwa ein blendendes Licht, kann ich mich schützen, indem ich mich wegdrehe, eine Hand vor die Augen halte oder schlicht den Raum verlasse. Gegen die »Triebgefahr« kann ich mich nicht derart schützen, allerdings hilft das Bild der Flucht dabei weiter, sich vorzustellen, dass es um ein ähnliches Ausweichen vor Unangenehmen geht, das allerdings die innere Welt umarbeitet: »Die Abwehrvorgänge«, so Freud (1905c, S. 266), »sind die psychischen Korrelate des Fluchtreflexes und verfolgen die Aufgabe, die Entstehung von Unlust aus inneren Quellen zu verhüten«. Es ist jedoch zu beachten, dass die Konzeption von Triebgefahr und Abwehr nicht in a-sozialer, von der Außenwelt unabhängige Weise entsteht und sich vollzieht. Freud meint nämlich, dass die »Triebregungen zu Bedingungen der äußeren Gefahr und damit selbst gefährlich« (1926d, S. 177) werden, insofern die triebbestimmten Handlungen in der Außenwelt bestimmte Folgen haben. Damit ist die Abwehr immer dadurch motiviert, wie sich Triebregung und Realitätsprinzip vereinbaren lassen. Im Kern richtet sie sich dabei auf einen inneren Reiz: Das Bewusstwerden der Triebregung würde Angst, Scham oder Schuldgefühle nach sich ziehen, hätte unangenehme Folgen in der inneren und äußeren Welt.
Damit ist bereits das zweite Merkmal der Abwehr angesprochen: Sie dient der Unlustvermeidung. In der Konflikttheorie ist beschrieben, dass sich ein Gegeneinander aus dem Streben nach Lust bzw. Befriedigung und dem Vermeiden von Unlust ergeben kann. Die Befriedigung eines »Triebes« (besser: Triebwunsches) wäre »an sich lustvoll […], aber sie wäre mit anderen Ansprüchen und Vorsätzen unvereinbar; sie würde also Lust an der einen, Unlust an der anderen Seite erzeugen. Zur Bedingung der Verdrängung ist dann geworden, daß das Unlustmotiv eine stärkere Macht gewinnt als die Befriedigungslust.« (Freud, 1915d, S. 249) Freud entwirft hier ein einfaches Modell dessen, was man Lust-Unlust-Bilanz nennen könnte: Die Abwehr setzt dann ein, wenn das Bewusstwerden einer Vorstellung mehr Unlust als Lust nach sich ziehen würde ( Kap. 2.2 zu einer systemisch-topischen und einer strukturell-instanzenbezogenen Sicht darauf). Unlustvermeidung bedeutet das Vermeiden von unerträglichen Affekten und das Ziel der Abwehr ist es, diese unerträglichen Affekte nicht erleben zu müssen – allerdings im Kontext von etwas, das zugleich auch Lust verspricht. Dazu richtet sie sich auf Triebrepräsentanzen, auf solche psychischen Elemente also, in die sich Triebhaftes hineinvermittelt, das sind bei Freud Vorstellungen und Affekte. Das bedeutet auch, dass nicht »der« Trieb abgewehrt wird – zum einen wäre das widersinnig, weil es sich bei »Trieb« nicht um ein Etwas der biologischen oder repräsentatorischen Welt handelt, sondern um ein Konzept, und zum anderen weil das Konzept sich auf Prozesse der Vermittlung von Physiologie in Erleben bezieht. Dieser Prozess könnte zwar abwehrbedingt unterbrochen sein (das spielt eine Rolle in der Psychodynamik psychosomatischer Erkrankungen), aber die psychische Abwehr richtet sich in der Grundstruktur auf Repräsentanzen, also auf das, was durch die Triebgeschehen genannten Prozesse der psychosomatischen Vermittlung im Erleben entsteht, psychische, durch das Triebgeschehen bewirkte Repräsentanzen in Form von Vorstellungen und Affekten.
Das dritte Merkmal der Abwehr ist, dass es sich bei ihr um unbewusste Vorgänge handelt, die allerdings der Instanz des Ichs zugehörig sind. Dieser Gedanke ist leitend für die Einführung des Instanzenmodells durch Freud und bildet einen von dessen Grundpfeilern. In der Tat führt die Annahme von Abwehrvorgängen gegenüber etwas, das nicht bewusst werden darf, in Schwierigkeiten: Kann es einen bewussten Vorgang geben, dessen Gegenstand unbewusst ist und bleibt? Wäre das nicht so unmöglich, wie auf Aufforderung nicht an einen rosafarbenen Elefanten zu denken? Anders aber: Kann es einen unbewussten Vorgang geben, der genau »weiß«, was sein Ziel ist? Wie unten deutlicher werden wird, gibt Freuds topisches Modell des psychischen Apparates es nicht her, solche zielgerichteten Vorgänge des Systems Ubw zu beschreiben, so dass er ab 1923 die Instanz des Ichs, die in Teilen unbewusst ist, genauer ausformuliert. Zunächst beschreibt er im topischen Modell das Wirken einer »Zensur« zwischen den psychischen »Systemen«, die den Übertritt einer Vorstellung von einem ins andere verhindert – im Instanzenmodell übt diese Funktion das Über-Ich aus, das entscheidet, was für das Bewusstsein annehmbar ist und so mittelbar Abwehrvorgänge motiviert. Als solche ist die Abwehr für Freud ein unbewusster Vorgang »im« Ich (= eine Ich-Funktion) zum »Schutz des Ichs gegen Triebansprüche« (1926d, S. 197).
Die Abwehr zeichnet sich also durch drei Merkmale aus: Sie richtet sich gegen »innere Reize«, dient dem Zweck des Vermeidens unlustvoller Affekte und wirkt unbewusst.
2.2 Abwehr in Freuds Modellen der Seele
Der Gedanke einer psychischen Abwehr beschäftigt Freud über die Dauer seines gesamten Werks hinweg. In ersten psychoanalytischen Arbeiten taucht sie in Termini wie »Abwehrneuropsychosen« oder »Abwehrhysterie« auf. Sie spielt als eine Art psychisches Prinzip in seinem neuropsychologischen Modell der Assoziativität bzw. der »Bahnungen« im 1895 entstandenen Entwurf einer Psychologie eine Rolle: Darin nimmt Freud an, dass ein sog. initiales Befriedigungserlebnis neuropsychologisch betrachtet Bahnungen schafft, gleichsam Verbindungen zwischen psychischen Elementen, die in einer lustvollen, befriedigenden Erfahrung gegeben gewesen sind. Diese Bahnungen sind nun die Grundlage für das Streben nach Wiederholung dieser lustvollen Erfahrung und nach dem Wiederherstellen der Bedingungen dafür. Neue Wahrnehmungen erfahren, sofern sie genügend ähnlich sind, eine »Wunschanziehung« und geraten sozusagen auf die Bahn vorangegangener lustvoller Erlebnisse. Ein »Schmerzerlebnis« (verbunden mit Unlust), das auf einer solchen Bahnung liegt (auch hier taucht der Gedanke auf, dass lustvolle Strebungen zugleich Unlustvolles mit sich bringen können), führt zur Hemmung beziehungsweise zu »Seitenbesetzungen«: Eine neuropsychologische Bahnung wird gleichsam zur Seite abgelenkt, weil sie nicht nur mit Lust, sondern auch mit Unlust verbunden ist. Freud beschreibt hier neuropsychologisch den Gedanken einer Kompromissbildung: Abläufe werden gehemmt und umgelenkt, so dass sie weniger Unlust, aber noch genügend Lust mit sich bringen. Hier ist nicht nur das Konzept der Abwehr angelegt, sondern auch eine frühe Form des Ichs als hemmender psychischer Instanz beschrieben.
In der Folge, im sog. Affekt-Trauma-Modell bis etwa 1897 (vgl. Sandler et al., 1997) taucht die Abwehr vor allem als Trennung zwischen Vorstellung und Affekt auf, also als eine Art von Spaltung, mit dem impliziten Ziel, den einer Vorstellung zugehörigen Affekt nicht dort (sondern anderswo) zu erleben bzw. die Vorstellung nicht »erinnern« zu können. In der weiteren Entwicklung des Freud‘schen Werkes lassen sich zwei Phasen bzw. Einbettungen des Abwehrkonzepts in zwei Modellen des Psychischen unterscheiden (vgl. zur genaueren Differenzierung Ehlers, 2014, S. 15 ff.): das topische Modell (etwa 1897 bis 1923) und das strukturelle oder Instanzen-Modell (ab 1923).
2.2.1 Abwehr im topischen Modell
Im topischen Modell (gelegentlich als erste Topik bezeichnet) konzipiert Freud das Psychische als in Systemen organisiert und unterscheidet dabei die Systeme Bewusst (Bw), Unbewusst (Ubw) und Vorbewusst (Vbw). Dabei geht es ihm auch um eine Unterscheidung zwischen einem deskriptiv Unbewussten (in systematischer Sicht das Vorbewusste), das bewusstseinsfähig, aber aktuell nicht mit Aufmerksamkeit besetzt ist) und einem dynamisch Unbewusstem (funktionell dem Bewusstsein nicht als solches zugänglich).
Zwischen den Systemen wirkt, wie schon angedeutet, eine Zensur bzw. besser gesagt: Es wirken zwei Zensuren (Freud, 1915e, S. 290): »Wir tun […] gut daran, […] anzunehmen, daß jedem Übergang von einem System zum nächst höheren, also jedem Fortschritt zu einer höheren Stufe psychischer Organisation eine neue Zensur entspreche«. Zum einen gibt es also die Annahme einer Zensur zwischen Ubw und Vbw, welche zum Beispiel die Verdrängung und die Aufrechterhaltung von deren Wirkung plausibel macht, zum anderen aber auch die einer Zensur zwischen Vbw und Bw: Im System Vbw gibt es, so Freuds Annahme, »Abkömmlinge« des Unbewussten, die aber noch auf ihren Eintritt ins Bewusstsein geprüft werden müssen. Während die erstgenannte Zensur darüber entscheidet, was bewusstseinsfähig ist, entscheidet die zweitgenannte darüber, was bewusst wird und als was es das wird.
Der Gedanke einer psychischen Zensur spielt bereits in der Traumdeutung eine Rolle, wenn Freud annimmt, dass im Traum die psychische Zensur herabgesetzt sei, mit der Folge, dass eine größere Offenheit des bewussten Erlebens auch demgegenüber herrscht, was verpönt ist: »Die Erfahrung lehrt uns, daß den Traumgedanken tagsüber d[..]er Weg, der durch das Vorbewußte zum Bewußtsein führt, durch die Widerstandszensur verlegt ist. In der Nacht schaffen sie sich den Zugang zum Bewußtsein«, nachts sinke der »Widerstand ab […], der an der Grenze zwischen Unbewußtem und Vorbewußtem wacht« (Freud, 1900a, S. 547). Es ist weniger an Entstellung erforderlich. Die Zensur wird dabei allerdings »niemals aufgehoben, sondern bloß herabgesetzt« (Freud, 1901a, S. 690), sie bleibt zuständig für eine Entstellung, die Freud als »Zensurveränderung« (1900a, S. 620) bezeichnet. Die Untersuchung der Mechanismen der Traumarbeit (Verdichtung, Verschiebung, sekundäre Bearbeitung) sind ein weiteres Beispiel für Freuds Auseinandersetzung mit Abwehrprozessen als etwas, das bewusstseinsfähige Formen sucht und findet, um die eigene psychische Welt zu erleben. Freud unterscheidet zwischen manifestem Trauminhalt und latenten Traumgedanken, die Traumarbeit produziert aus diesen jenen. Bewusstseinsfähigkeit, Zensur und Entstellung stehen in einem anderen Verhältnis zueinander als im Wachbewusstsein, die Umsetzung in Traumbilder folgt außerdem dem Umstand, dass im Traum/Schlaf der Zugang zur Motilität versperrt ist (a. a. O., S. 573) und sich daher eine leichtere Umsetzung in innere Bilder ergibt.
Die frühe Annahme einer Zensur, insbesondere der zwischen Ubw und Vbw, entsteht also aus der Untersuchung des Traumes, in ihr, so Freud (a. a. O., S. 573), »haben wir […] den Wächter unserer geistigen Gesundheit zu erkennen und zu ehren.« Insbesondere im Wachzustand hilft uns die psychische Zensur dabei, unlustvollen Bedingungen zu entgehen, sozial verträglich zu sein u. a. Die Zensur als »Wächter zwischen dem Unbewußten und dem Vorbewußten« (Freud, 1916/17, S. 307) ist »eine prüfende Instanz […], welche darüber entscheidet, ob eine auftauchende Vorstellung zum Bewußtsein gelangen darf, und unerbittlich ausschließt, […] was Unlust erzeugen oder wiedererwecken könnte« (Freud, 1913j, S. 397).
Wie Freud sich allgemein die Abwehr vorstellt, verdeutlich am besten ein von ihm gezogener Vergleich zu einem öffentlichen Vortrag, den er im Zuge eigener Vorlesungen über die Psychoanalyse verwendet: »Nehmen Sie an, hier in diesem Saale und in diesem Auditorium, dessen musterhafte Ruhe und Aufmerksamkeit ich nicht genug zu preisen weiß, befände sich doch ein Individuum, welches sich störend benimmt und durch sein ungezogenes Lachen, Schwätzen, Scharren mit den Füßen meine Aufmerksamkeit von meiner Aufgabe abzieht. Ich erkläre, daß ich so nicht weiter vortragen kann, und daraufhin erheben sich einige kräftige Männer unter Ihnen und setzen den Störenfried nach kurzem Kampfe vor die Tür. Er ist also jetzt ›verdrängt‹ und ich kann meinen Vortrag fortsetzen. Damit aber die Störung sich nicht wiederhole, wenn der Herausgeworfene versucht, wieder in den Saal einzudringen, rücken die Herren, welchen meinen Willen zur Ausführung gebracht haben, ihre Stühle an die Türe an und etablieren sich so als ›Widerstand‹ nach vollzogener Verdrängung.« (Freud, 1910a, S. 22 f.)
Deutlich wird hier, dass es etwas Störendes (im »Innenraum«) gibt. Die Verdrängung als Form der Abwehr ist das, was den Störenfried nach draußen (also außerhalb des bewussten Erlebens) verfrachtet. Die Dynamik des Psychischen (und der Umstand, dass der Störenfried niemals einfach nur stört, sondern auch Amüsement verspricht) sorgt dafür, dass die Verdrängung/Abwehr (hier weitgehend noch gleichbedeutend verwendet) kein einmaliger Vorgang eines Hausverweises ist: Der Störenfried drängt von draußen wieder hinein und es muss etwas aufgerichtet werden (hier in etwas anderer Weise als später, nämlich in behandlungstechnischer Hinsicht, verwendet: ein Widerstand), das die Wirkung der Verdrängung aufrecht erhält. Abwehr bedeutet nun auch, dass etwas den Störenfried gleichsam neu einkleidet (eine psychische Entstellung bzw. Kompromissbildung) und er in diesem Aufzug unerkannt (d. h. nicht als der erkennbar, der zuvor gestört hat) wieder in den Saal gelassen wird.
Im Freud‘schen Werk ist die terminologische Differenzierung zwischen Abwehr und Verdrängung zunächst unklar beziehungsweise wird beides gleichbedeutend verwendet: Etwas wird vom Bewusstsein ferngehalten. Da das Abgewehrte in Freuds Sicht immer Lust und Unlust nach sich zöge, entsteht ein Dynamismus aus drängenden und verdrängenden Kräften und wie in der Traumarbeit werden auch im Wachbewusstsein beständig Umarbeitungen nötig. Eine solche Konzeption von Ersatz- oder Kompromissbildungen, die dem Motiv des Luststrebens und dem der Unlustvermeidung zugleich gerecht zu werden versuchen, kennzeichnet die Abwehrlehre und dies äußert sich in verschiedenen Abwehrmechanismen in unterschiedlicher Weise. Das führt zum Beispiel zur Konzeption, dass bei der Abwehr in der Regel die Verdrängung und ein weiterer Abwehrvorgang, der für eine Umarbeitung mit dem Ziel der entstellten Bewusstwerdung sorgt, zusammenkommen ( Kap. 3.1).