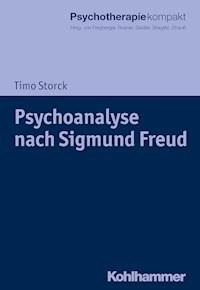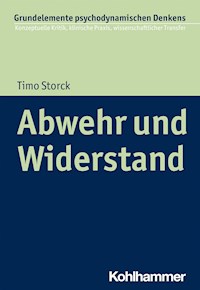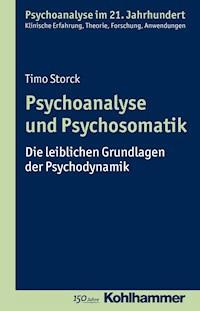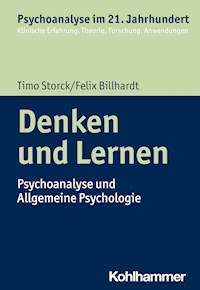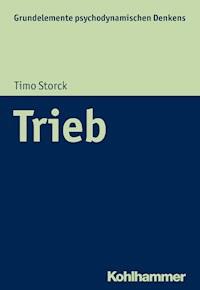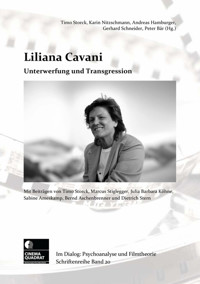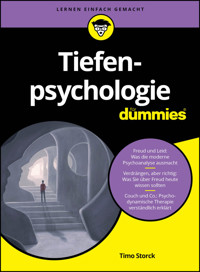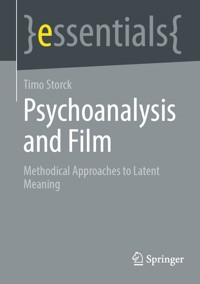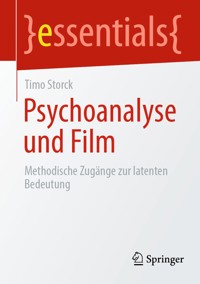Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Psychoanalyse ist die Betrachtung, wie "ich" "mich selbst" erlebe, von besonderer Bedeutung. Dazu ist zu untersuchen, wie unter dem Begriff des Ich psychische Funktionen oder Fähigkeiten gefasst werden und unter dem Begriff des Selbst die Vorstellungen, die sich jemand von sich selbst macht. Damit verbunden sind verschiedene Akzente in unterschiedlichen psychoanalytischen Richtungen, v.a. in der Ich-Psychologie oder der Selbstpsychologie. Zudem sind u.a. Konzepte psychischer Struktur oder struktureller Fähigkeiten relevant. Im vorliegenden Band wird eine kritische Prüfung dieser Konzepte und Richtungen vorgenommen, illustriert an der Untersuchung eines Fallbeispiels in verschiedenen Betrachtungsweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Timo Storck, Prof. Dr. phil., Jahrgang 1980, ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, Psychoanalytiker (DPV/IPA) und Psychologischer Psychotherapeut (AP/TP). Studium der Psychologie, Religionswissenschaften und Philosophie an der Universität Bremen, Diplom 2005. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Bremen (2006–2007), Kassel (2009–2015) sowie an der Medizinischen Universität Wien (2014–2016). Promotion an der Universität Bremen 2010 mit einer Arbeit zu künstlerischen Arbeitsprozessen, Habilitation an der Universität Kassel 2016 zum psychoanalytischen Verstehen in der teilstationären Behandlung psychosomatisch Erkrankter. Mitherausgeber der Zeitschriften Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung und Forum der Psychoanalyse sowie der Buchreihe Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie, Mitglied des Herausgeberbeirats der Buchreihe Internationale Psychoanalyse. Forschungsschwerpunkte: psychoanalytische Theorie und Methodologie, psychosomatische Erkrankungen, Fallbesprechungen in der stationären Psychotherapie, Kulturpsychoanalyse, konzeptvergleichende Psychotherapieforschung.
Timo Storck
Ich und Selbst
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-041206-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-041207-1
epub: ISBN 978-3-17-041208-8
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Die Grundlagen von Ich und Selbst bei Freud
2.1 Hemmung und Ich-Spaltung
2.1.1 Die hemmende Funktion des Ichs
2.1.2 Ich und Spaltung
2.2 Exkurs: Freuds »Selbstanalyse«
2.3 Freuds Narzissmustheorie: Bildung und Besetzung des Selbst
2.4 Das Ich als psychische Instanz
2.5 Ich-Analyse
2.6 Zusammenfassung und behandlungstechnische Folgerungen
2.7 Fallbeispiel Herr P., Teil I
3 Die psychoanalytische Ich-Psychologie
3.1 Anknüpfungen und Schwerpunktsetzungen bei Anna Freud
3.2 Die Ich-Psychologie als psychoanalytische Richtung bei Heinz Hartmann
3.2.1 Primäre und sekundäre Autonomie des Ichs
3.2.2 Exkurs: Das Prinzip der mehrfachen Funktion
3.2.3 Anpassungsmechanismen
3.2.4 Weiterführungen
3.3 Zur Kritik an der Ich-Psychologie
3.3.1 Aus der Sicht Jacques Lacans
3.3.2 Aus »beziehungsorientierter« Sicht
3.4 Zusammenfassung und behandlungstechnische Folgerungen
3.5 Fallbeispiel Herr P., Teil 2
4 Die psychoanalytische Selbstpsychologie
4.1 Das Konzept des Ich-Ideals
4.2 Die Selbstpsychologie bei Heinz Kohut
4.2.1 Narzissmus und Entwicklung
4.2.2 Selbstobjekte
4.2.3 Übertragungsformen
4.2.4 Empathie
4.3 Weiterentwicklungen der Selbstpsychologie
4.3.1 Therapeutischer Dialog
4.3.2 Motivationale Systeme und Modellszenen
4.3.3 Generalisierte Interaktionsrepräsentationen
4.4 Zur Kritik an der Selbstpsychologie
4.5 Zusammenfassung und behandlungstechnische Folgerungen
4.6 Fallbeispiel Herr P., Teil 3
5 Strukturkonzeptionen in der Psychoanalyse
5.1 Unterschiedliche Auffassungen von Struktur
5.1.1 S. Freud: Instanzen-Modell
5.1.2 W.R.D. Fairbairn: Endopsychische Struktur
5.1.3 J. Lacan: Strukturale Psychoanalyse
5.1.4 O.F. Kernberg: Persönlichkeitsorganisation
5.1.5 Struktur in der OPD
5.1.6
personality functioning
im AMPD
5.2 Strukturdiagnostik
5.3 Strukturelle Störungen am Beispiel des pathologischen Narzissmus
5.3.1 Im Ansatz O.F. Kernbergs
5.3.2 Zur Therapie struktureller Störungen
5.4 Fallbeispiel Herr P., Teil 4
6 Ich und Selbst interdisziplinär
6.1 Ich und Selbst in anderen wissenschaftlichen Denkrichtungen
6.1.1 Ich und Selbst in der Neurobiologie
6.1.2 Selbsttäuschung in der Philosophie
6.1.3 Ich und Selbst in der Psychologie
6.2 Ich und Selbst in anderen psychotherapeutischen Verfahren
6.2.1 Das falsche Selbst
6.2.2 Selbstschädigendes Verhalten
6.2.3 Dissoziative Identitätsstörung
6.2.4 Ich und Selbst in der (Kognitiven) Verhaltenstherapie
6.2.5 Ich und Selbst in der Systemischen Therapie
6.2.6 Ich und Selbst in der Gesprächspsychotherapie
6.2.7 Zusammenfassender Vergleich
6.3 Fallbeispiel Herr P., Teil 5
7 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Verzeichnis der zitierten Medien
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Beim vorliegenden Band handelt es sich um eine bearbeitete Mitschrift von fünf öffentlichen Vorlesungen, die ich im Wintersemester 2019/2020 an der Psychologischen Hochschule Berlin gehalten habe. Die Vorlesungsreihe ist Teil eines Projekts zu den Grundelementen psychodynamischen Denkens, in dem es unter der dreifachen Perspektive »Konzeptuelle Kritik, klinische Praxis, wissenschaftlicher Transfer« darum geht, sich mit psychoanalytischen Konzepten auseinander zu setzen: Trieb (Band I), Sexualität und Konflikt (Band II), dynamisch Unbewusstes (Band III), Objekte (Band IV), Übertragung (Band V), Abwehr und Widerstand (Band VI), Ich/Selbst (Band VII) und Deutung (Band VIII). Ziel ist dabei, sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch im vorliegenden Format einer Reihe von Buchpublikationen eine Art kritisches Kompendium psychoanalytischer Konzepte zu entwickeln, ohne dabei den Anschluss an das Behandlungssetting oder den wissenschaftlichen Austausch zu vernachlässigen. Wenn es um Grundelemente psychodynamischen Denkens geht, dann soll damit auch der Hinweis darauf gegeben werden, dass aus Sicht der Psychoanalyse jedes, also auch das wissenschaftliche, Denken selbstreflexiv ist: Das Denken über Psychodynamik ist unweigerlich selbst psychodynamisch, d. h. es erkundet die Struktur der Konzeptzusammenhänge auch auf der Ebene der Bedeutung von Konzeptbildung selbst.
Für ein solches Vorgehen ist das Werk Freuds der Ausgangs- und ein kontinuierlicher Bezugspunkt. Mir geht es um eine genaue Prüfung dessen, was Freud mit seinen Konzepten »vorhat«, d. h. welche Funktion diese haben und welches ihr argumentativer Status ist. Dabei soll nicht eine bloße Freud-Exegese geschehen, sondern eher ein Lesen Freuds »mit Freud gegen Freud«. – Es wird deutlich werden, dass der grundlegende konzeptuelle Rahmen, den Freud seiner Psychoanalyse gibt, es auch erlaubt aufzuzeigen, wo er hinter den Möglichkeiten seiner Konzeptbildung zurückbleibt.
Über den Ausgangspunkt der Vorlesungen erklärt sich die Form des vorliegenden Textes, der nah an der gesprochenen Darstellung verbleibt. Auch sind, wie in jeder Vorlesung, eine Reihe von inhaltlichen Bezugnahmen auf Arbeiten anderer Autorinnen und Autoren eingeflossen, die mein Denken grundlegend beeinflussen, ohne dass dazu durchgängig im Detail eine Referenz erfolgen kann.
Bedanken möchte ich mich bei den Teilnehmenden an den öffentlichen Vorlesungen für ihr Interesse, sowie beim Kohlhammer Verlag, namentlich Ruprecht Poensgen und Kathrin Kastl, für die Unterstützung bei der Vorlesung und der Veröffentlichung. Außerdem danke ich Caroline Huss für die Anfertigung von Transkripten zur Audio-Aufzeichnung der Vorlesung. Cornelia Weinberger, Mona Brettschneider und Marko Walther gebührt Dank für die planerische und technische Unterstützung bei der Durchführung der Vorlesungen. Der Psychologischen Hochschule Berlin danke ich schließlich für die Möglichkeit, eine solche Vorlesungsreihe durchzuführen.
Heidelberg, im Sommer 2021Timo Storck
1 Einleitung
In jeder Theorie des Psychischen spielen Konzeptionen von Ich oder Selbst eine zentrale Rolle, in deren Entwicklung, im Verhältnis zum anderen oder als Teile von »Persönlichkeit«. Psychoanalytisch betrachtet lassen sich entlang dieser beiden, manchmal deutlich unterschiedlich verwendeten Konzepte (Überblick und Einordnung zuletzt bei Althoff, 2019), viele der wichtigsten Positionen unterschiedlicher Schulrichtungen kennzeichnen.
Psychoanalytische Konzepte haben (zurecht) den Anspruch, wissenschaftliche zu sein. Das muss bedeuten, dass sie sich in bedeutsamer Weise auf Phänomene der inneren und äußeren Erfahrung richten. Somit sind sie nicht etwas, das man so in der Welt finden oder beobachten könnte (z. B. das Über-Ich), sondern es handelt sich bei ihnen um konzeptuelle Abstrakta, die etwas auf den Begriff bringen sollen (z. B. wiederkehrende Selbstanklage). Als wissenschaftliche Konzepte werden sie auf dem Weg eines methodisch geleiteten Zugangs zur Erfahrungswelt gewonnen; »empirisch« im grundlegenden Sinn bedeutet zunächst einmal nur »erfahrungsbezogen« (im Gegensatz zu »rationalistisch«), erst in einem engeren Begriffssinn ist damit dann ein apparativ, experimentell o. ä. geleiteter wissenschaftlicher Zugang gemeint. Für einen solchen bedarf es Operationalisierungen der psychoanalytischen Konzepte, die methodisch auf der Ebene der klinischen Behandlung gebildet und verändert werden (vgl. z. B. Kaluzeviciute & Willemsen, 2020). Diese stehen überdies in einem konzeptuellen Zusammenhang zu einander, denn nur auf diese Weise lässt sich ihr argumentativer Gehalt prüfen. Ferner sind sie »sparsam«, also gerade so komplex wie nötig, um etwas darüber zu sagen, worauf sie sich beziehen. Vor diesem Hintergrund sind in den vorgegangenen Bänden der vorliegenden Reihe verschiedene Konzepte in den Blick geraten.
Besonders deutlich wird der Gedanke, dass Konzepte sich nicht auf Dinge in der Welt beziehen, in Auseinandersetzung mit dem psychoanalytischen Triebkonzept (Storck, 2018a). »Trieb« ist nicht mess- oder beobachtbar, es handelt sich um ein Konzept, das etwas über Vermittlungsprozesse zwischen physiologischer Erregung und psychischem Erleben sagen soll. Deshalb bezeichnet Freud (1915c, S. 214) den Trieb als »Grenzbegriff zwischen Psychischem und Somatischem«, es wird bezeichnet, dass uns etwas in die psychische Repräsentation treibt. »Trieb« ist in diesem Sinn ein psychosomatisches Konzept, es bezieht sich auf Wirkungen von Psyche und Soma aufeinander. Noch aus einem anderen Grund unterscheidet es sich vom Instinkt oder biologischen Zusammenhängen: Triebhaftes erwächst aus der Interaktion, die körperlichen/leiblichen Zustände, die ins Psychische drängen (um dort reguliert zu werden). Statt dass das triebhafte Individuum losgelöst von sozialen Bezügen und Interaktion betrachtet werden könnte, handelt es sich beim Trieb auch um ein sozialisatorisches Konzept. Indem darin nun gefasst ist, dass sich Erregung in Erleben vermittelt (Freud meint, der Triebdrang stelle das Maß an Arbeitsanforderung für das Psychische dar; 1915c, S. 214ff.), kann man davon sprechen, dass es sich bei der Triebtheorie der Psychoanalyse um eine Theorie der allgemeinen Motivation des Psychischen handelt, insofern sie nämlich etwas darüber sagt, wie Psychisches als solches motiviert ist.
Eine Theorie der speziellen Motivation hingegeben findet die Psychoanalyse in ihrer Konzeption des unbewussten Konflikts (Storck, 2018b). Dort also, wo es konkret darum geht, welche Motive hinter einer Erlebnisweise oder Handlung verborgen sind, rekurriert die Psychoanalyse vor dem Hintergrund der Theorie der infantilen Psychosexualität, der Aggressionsentwicklung oder des Narzissmus auf Motivkonflikte. Die Psychoanalyse verwendet einen erweiterten Begriff von Sexualität und zwar dahingehend, dass sich Sexualität über Lust/Befriedigung und Erregung auch jenseits der primären Geschlechtsorgane bestimmt. Auch andere lustvolle körperliche Empfindungen gelten dann als sexuell. Als infantile Sexualität ist dies noch unintegrierter und unregulierter als später, wenn, so Freud, eine Vereinigung unter dem Genitalprimat (1905d, S. 109ff.) erfolgt ist. In der infantilen Sexualität sind die verschiedenen lustvollen Empfindungen noch unverbunden. Nachfolgende Autoren1, etwa Laplanche (1988), akzentuieren auch besonders den Bruch in der zweizeitigen Sexualentwicklung des Menschen, wie die Psychoanalyse sie beschreibt: Es wird nicht von einer schlichten Entwicklungsreihe aus infantiler Sexualität, Latenz-Zeit und genitaler Sexualität ausgegangen, in der das Frühere im Späteren aufgehoben ist. Vielmehr bleibt die infantile Sexualität, also die ungebändigte Form, beim Erwachsenen eine Art Fremdkörper.
Lust und Unlust liefern die Grundlage für die Konzeption des Menschen als konflikthaft. Freud versteht Lust als das, was wir empfinden, wenn ein Reiz an Intensität abnimmt, und Unlust als das, was wir erleben, wenn die Intensität eines Reizes ansteigt beziehungsweise gleichbleibend hoch ist. Dabei sind es die Momente, wo dieselbe Handlung oder Handlungsvorstellung sowohl mit Lust als auch mit Unlust verbunden ist, die psychische Konflikte darstellen. Prototypisch kann dafür der Stillvorgang genommen werden (oder allgemein der Vorgang der Nahrungsaufnahme durch den Säugling): Hier geht es um eine Interaktion, die sowohl mit Beruhigung als auch mit Stimulierung verbunden ist, denn natürlich ist das Stillen eingebunden in eine sinnvolle Interaktionsszene. Andere Beispiele wären verschiedene Formen von Ambivalenz, wo es darum geht, sowohl positive als auch negative Gefühle einer Person beziehungsweise der Vorstellung von ihr gegenüber zu empfinden. Einer der Kontexte der Konflikttheorie ist die Theorie der psychosexuellen Entwicklungsphasen. Diese beziehen sich zwar auf Körperlichkeit und körperliche Entwicklung und ihre Konflikthaftigkeit hat damit zu tun, welche Entwicklungsaufgaben sich stellen: In der oralen Phase geht es um die Erkundung der Welt mit dem Mund (einschließlich der Lautproduktion), um lustvolle Empfindungen an Zunge, Lippen oder Mundschleimhäuten, in der analen Phase geht es um die Kontrolle der Ausscheidungsfunktion, die Sauberkeitserziehung und die Auseinandersetzung mit den eigenen »Produkten« und in der phallisch-ödipalen Phase tritt der Geschlechter- und Generationenunterschied ins Zentrum sowie die Auseinandersetzung mit Rivalität, Verlust und Wirkmacht. Neben stärker körperbezogenen Lesarten lassen sich für die Entwicklungsphasen allerdings auch stärker »thematische« Lesarten verfolgen, in denen es bei der Oralität insgesamt um Fragen der Versorgung geht, bei der Analität um Kontrolle und beim Phallisch-Ödipalen um Begrenzung und deren Anerkennung.
Im Hinblick auf die Strukturkonzeptionen in der Psychoanalyse (Kap. 5) ist noch zu erwähnen, dass sich psychische Konflikte aus psychoanalytischer Perspektive auf unterschiedlichen Stufen der Reife beziehungsweise strukturellen Integration bewegen können. Es lassen sich eher reifere Formen eng umgrenzter innerpsychischer Konflikte zwischen Wunsch und Verbot beziehungsweise zwischen widerstreitenden Wünschen beschreiben, aber auch viel basalere Konflikte beziehungsweise Konfliktschemata, zum Beispiel solche aus Nähesehnsüchten und Verschmelzungsängsten.
Eine besonders zentrale Rolle im Hinblick auf Konflikt und Sexualität kommt dabei der Ödipalität zu. Bei Freud wird diese noch eher konkret verstanden, z. B. als die Angst des Jungen, durch den Vater für seine sexuellen Wünsche gegenüber der Mutter mit Kastration bestraft zu werden (allerdings benennt Freud durchaus auch eine Rivalität des Jungen mit der Mutter um die Nähe zum Vater, ebenso wie beide Formen für das Mädchen). In einem zeitgenössischen Verständnis lässt sich über den weiteren Verlauf der Konzeptentwicklung, etwa in Form der von Melanie Klein beschriebenen »Frühstadien des Ödipuskonfliktes«, davon sprechen, dass sich ödipale Konflikte um die Auseinandersetzung damit drehen, dass die Personen, zu denen jemand in Beziehung steht, auch prinzipiell zueinander in Beziehung stehen können, und man selbst aus deren Beziehung zumindest relativ und passager ausgeschlossen sein kann. Dann werden ödipale Konflikte zu etwas, das mit der Anerkennung von Begrenzung zu tun hat, die Kastration ist dann keine gefürchtete anatomische Handlung, sondern bezieht sich als »symbolische Kastration« darauf, in seiner Potenz eingeschränkt zu sein, d. h. Grenzen und Begrenzungen anerkennen zu müssen. In einer solchen Lesart bleiben ödipale Konflikte nicht auf klassische Familienkonstellationen beschränkt: Die Auseinandersetzung damit, dass Bezugspersonen aufeinander bezogen sind oder dass man selbst auf Begrenzungen stößt, stellt sich als Aufgabe auch dem Kind, das mit gleichgeschlechtlichen Eltern, bei einem alleinerziehenden Elternteil oder in einer sozialen Gruppe mit wechselnden Rollen und Aufgaben aufwächst.
In einem nächsten Schritt ist es um die Auseinandersetzung mit dem dynamisch Unbewussten gegangen (Storck, 2019a). Das zentrale Anliegen Freuds ist es gewesen, eine »Metapsychologie« zu formulieren, also eine Psychologie, welche die Konzeption eines psychischen Unbewussten einbezieht, statt eines Unbewussten, das außerhalb der Sphäre des Psychischen stünde. Entsprechend geht es ihm um eine Psychodynamik, also ein Gegeneinanderwirken drängender und verdrängender psychischer Kräfte. Im sogenannten topischen Modell stellt Freud dies in den drei psychischen Systemen Bewusst, Unbewusst und Vorbewusst dar und beschreibt Zustandsänderungen an Vorstellungen, je nachdem, ob sie bewusst sind, bewusstseinsfähig, aber nicht aktuell mit Aufmerksamkeit besetzt (vorbewusst) oder dynamisch unbewusst, d. h. aus »psychoökonomischen« Gründen dem bewussten Erleben nicht zugänglich sind. Im Verlauf der weiteren Entwicklung seines Werks stößt Freud an die Grenzen des topischen Modells, in erster Linie, weil er mit der Abwehr einen Bereich des Psychischen annehmen muss, der unbewusst, aber trotzdem zielgerichtet und im Dienste der Unlustvermeidung arbeitet, und weil ihn Konzeptionen der psychischen Zensur dazu bringen, andere psychische Strukturen zu konzeptualisieren. So entwickelt er das sogenannte Instanzen-Modell aus Ich, Über-Ich und Es. Darin kann die Abwehr dem Ich zugerechnet werden (ein Teil des Ichs ist also unbewusst) und die psychische Zensurfunktion übernimmt das Über-Ich. In der postfreudianischen konzeptuellen Weiterentwicklung liegt der Akzent dann auf verschiedenen Formen des Unbewussten; im vorliegenden Rahmen wurde der Vorschlag gemacht, unter »unbewusst« ein bestimmtes Verhältnis zwischen Vorstellungen und Affekten anzunehmen, eine Art der Unterbrechung mit dem Ergebnis, dass etwas nicht zueinander in Relation gesetzt werden kann.
Das Konfliktgeschehen besteht psychoanalytisch betrachtet nun nicht allein in motivationalen Konflikten, sondern es lassen sich auch repräsentationale beschreiben, weshalb als nächstes die Konzeption des Objekts erörtert worden ist (Storck, 2019b). Terminologisch stammt die Rede vom »Objekt« aus der Triebtheorie, es geht um das Objekt psychischer Besetzung beziehungsweise das Objekt der Vorstellung, also: die Objektrepräsentanz. Die Grundidee der psychoanalytischen Entwicklungstheorie hinsichtlich dieser besteht darin, dass sich Interaktionen mit anderen psychisch in Form von Beziehungsvorstellungen niederschlagen, die wiederum weitere Interaktionen färben. Aus Beziehungsvorstellungen werden sukzessive Vorstellungen/Repräsentanzen vom Selbst und den Objekten herausgelöst, wobei sich beides auch auf der Ebene der Repräsentation nur als miteinander verbunden begreifen lässt. Psychoanalytisch ist damit die Fähigkeit zur Symbolisierung berührt, also die Möglichkeit, etwas in der Wahrnehmung Abwesendes in der Vorstellung anwesend zu machen. Das ist die Grundlage für Erwartung, Erinnerung, Fantasie, Probehandeln und einiges mehr. Ein wichtiger Entwicklungsschritt besteht dabei darin, zu »ganzen« Vorstellungen von Selbst und Objekten zu gelangen. Gemeint ist, dass sich in der Entwicklung zunächst eine Logik der Spaltung zwischen »gut« und »schlecht« ergibt: Alles Schlechte soll aus dem Selbst herausgehalten werden und die Welt der Beziehungen wird als nur gut oder nur schlecht erlebt. Erst im Zuge haltender Beziehungserfahrungen können positive und negative Affekte derselben Person gegenüber oder unterschiedliche Bilder dieser zusammengebracht, also integriert werden. Die Idee repräsentationaler Konflikte berührt dann auch die Frage, ob Selbst- und Objektrepräsentanzen innere Spannungen aushalten können oder ob es zu Fragmentierungen kommt, indem Spaltungsprozesse aus der frühen Entwicklungszeit aufrechterhalten werden müssen und, mit Kernberg gesprochen, Teil-Selbst- und Teil-Objekt-Bilder vorherrschen (Kap. 5.1.4).
Die Überlegungen zu Internalisierung und zum Wirken von Selbst- und Objektrepräsentanzen haben eine hohe Relevanz für das klinische Arbeiten der Psychoanalyse, denn sie münden in das Konzept der Übertragung (Storck, 2020a). In Freuds Bemerkungen dazu lassen sich eine weite und eine enge Begriffsfassung unterscheiden. In der weiten Fassung ist mit »Übertragung« basal gemeint, dass die »Intensität« einer Vorstellung auf eine andere, weniger gefährliche übertragen wird. Übertragung ist allgemein ein Mittel des entstellten Bewusstwerdens. Die engere Begriffsfassung bezieht sich konkret auf die analytische Beziehung in der Behandlung, dahingehend dass etwas, das aus früheren Beziehungen (einschließlich der Fantasien darüber) stammt, sich in der Beziehung zum Analytiker zeigt. Auch hier ist es ein Mittel des entstellten Bewusstwerdens, wenngleich Freud (1905e, S. 281) den Doppelcharakter der Übertragung als »größtes Hindernis« und »mächtigstes Hilfsmittel« erst erkennen musste. So wird über das Übertragungskonzept (einschließlich der Gegenübertragung auf Seiten des Analytikers) ein wichtiger Bestandteil der Erkenntnistheorie der Psychoanalyse, denn es wird begründbar, wie unbewusste Aspekte des Erlebens in Behandlungen zugänglich werden. Über die nötige Intensivierung von Übertragungsprozessen begründet sich das analytische Behandlungssetting unter Einsatz der Couch, mit hoher Frequenz von Wochenstunden und einer abwartend-zuhörenden Haltung des Analytikers. Das soll der Regressionsförderung dienen, die wiederum Übertragungsaspekte deutlicher zutage treten lassen beziehungsweise die Übertragung in Richtung einer Übertragungsneurose hin vertiefen soll, das heißt, die Zentrierung der (neurotischen, aber auch sonstigen) Symptome auf die analytische Beziehung, wo sie verstanden und verändert werden können. Über die Reflexion des Geschehens in Übertragung und Gegenübertragung, in Form des szenischen Verstehens, lassen sich nicht-triviale Verstehenshypothesen entwickeln, die verbalisiert als Deutung einen Prozess (der Veränderung) möglich machen.
Diesen Veränderungsprozessen stehen psychodynamisch betrachtet Widerstände entgegen, das heißt, dass sich in Behandlungen diejenigen Abwehrmechanismen zeigen, die zur Unlustvermeidung mobilisiert wurden und nun auch bezüglich des analytischen Prozesses vor Angst schützen sollen. Die Betrachtung von Abwehr und Widerstand (Storck, 2021) hat als Grundidee der psychischen Abwehr unterstrichen, dass diese eingesetzt wird, wenn eine Vorstellung mehr Unlust als Lust nach sich ziehen würde. Die Abwehr (die unbewusst wirkt und sich gegen einen »inneren« Reiz richtet) dient allgemein der Vermeidung unlustvoller Affekte. Dabei lassen sich verschiedene Abwehrmechanismen differenzieren, am wichtigsten ist das Zusammenwirken von Verdrängung und einem weiteren Mechanismus der Ersatzbildung, so dass sich abwehrbedingte Kompromissbildungen im Psychischen ergeben. Etwas muss umgearbeitet werden, damit es bewusst werden darf. Weniger reife Abwehrformen, so etwa die projektive Identifizierung, weisen bereits darauf hin, dass bei schweren psychischen Störungen weniger eng umgrenzte Abwehrmechanismen differenziert werden können, sondern Abwehrformationen (z. B. die von Steiner, 1993, eingeführte »pathologische Organisation«) vorliegen, die eng mit Struktur und Persönlichkeit verwoben sind (Kap. 5). Darüber hinaus sind psychosoziale Abwehrformen, die nicht nur innerpsychisch, sondern auch »interaktionell« Unlust zu vermeiden versuchen, diskutiert worden. Widerstandsphänomene werden auf das Wirken der Abwehr in der Behandlung zurückgeführt und können sich in vielerlei Weise zeigen; zeitgenössisch entscheidend ist, dass der Analytiker etwas dazu beiträgt. Ein Widerstand muss als kokreativ und als Beziehungsphänomen begriffen werden (einschließlich der Beachtung möglicher Gegenübertragungswiderstände). Eine Brücke zwischen verschiedenen therapeutischen Richtungen findet sich in der Konzeption der Reparatur von Beziehungskrisen, wie Safran und Muran (2000) sie vorlegen.
Bei der Diskussion der Konzepte sind einige Fragen genauer zutage getreten, etwa danach, wann und wie interveniert, genauer gefragt: gedeutet werden soll, insbesondere wenn sich die Deutung doch auf unbewusste Aspekte des Erlebens richten soll. Damit ist auch die Frage danach verbunden, was psychische Veränderung möglich macht (Storck, in Vorb). Im vorliegenden Band soll es ferner um eine Untersuchung der Konzepte »Ich« und »Selbst« gehen, die insbesondere bei Freud nicht immer scharf getrennt werden. Damit verbunden sind Erörterungen dazu, was unter Ich-Funktionen verstanden werden soll (auch im Sinne struktureller Fähigkeiten) und wie sich die Selbstrepräsentanz davon unterscheidet beziehungsweise dazu im Verhältnis steht. Ferner werden die psychoanalytischen Richtungen der Ich-Psychologie und der Selbstpsychologie betrachtet sowie die Fortsetzung der Konzeption der Ich-Funktionen in Strukturkonzepte in der Psychoanalyse beleuchtet. Schließlich erfolgt eine Betrachtung von Ich und Selbst in anderen Wissenschaften sowie anderen psychotherapeutischen Verfahren.
1 Ich verwende im vorliegenden Band im kapitelweisen Wechsel außerhalb von Zitaten durchgängig das generische Maskulinum und das generische Femininum. Damit sind jeweils alle anderen Geschlechter mitgemeint.
2 Die Grundlagen von Ich und Selbst bei Freud
Zunächst soll es um einen Blick auf »Ich« und »Selbst« bei Freud gehen. Zu den bekanntesten Zitaten oder Denkfiguren Freuds gehört die Bemerkung, dass das »Ich nicht Herr im eigenen Haus« sei (Freud, 1917a, S. 11). In seinem Selbstverständnis stellt er sich damit in eine Reihe mit Kopernikus und Darwin, insofern er mit der Psychoanalyse dem Menschen eine dritte Kränkung zugefügt habe: Die Erde ist nicht das Zentrum des Universums, der Mensch stammt vom Affen ab und noch dazu wird er von ihm selbst nicht immer ersichtlichen Motiven angetrieben. Das ist eng verbunden mit der Annahme eines dynamisch Unbewussten. Es gibt verdrängte, nicht zugängliche Teile, die sich auch nicht über Anstrengung oder Aufmerksamkeit ins Bewusstsein heben lassen, sondern unzugänglich sind – und den Menschen umso stärker antreiben. Während in frühen Arbeiten Freuds das Ich in unterschiedlicher Weise, u. a. allgemein eher synonym mit »Persönlichkeit«, gebraucht wird (auch in der realitätsgerechten Hemmung primärprozesshafter Abläufe), formuliert er die Überlegungen später (v. a. Freud, 1923b) als psychische Instanz des Ichs aus, das sich über seine Funktionen bestimmt, in erster Linie die Möglichkeiten einer Vermittlung der »inneren« Ansprüche (Trieb, Gewissen) und der »äußeren«, also den Regeln des sozialen Zusammenlebens beziehungsweise der konkreten Folgen von Handlungen. Das Selbst hingegen wird von Freud sehr viel seltener und ungenauer gebraucht. Der Ausdruck taucht einerseits, aber nicht konzeptuell, prominent in Freuds »Selbstanalyse« auf (Kap. 2.2), ansonsten als Besetzung der psychischen Repräsentanz der eigenen Person mit »Ichlibido« (Freud, 1914c, S. 141). Hier zeigen sich schon die wichtigsten terminologischen Schwierigkeiten: Das Selbst ist das, was mit Ichlibido besetzt wird, die allerdings nur so genannt werden kann, weil es um eine Besetzung der eigenen Person statt der Objekte geht (Kap. 2.3 zur Narzissmuskonzeption bei Freud).
In der einleitenden Zusammenfassung (Kap. 1) hat sich die zentrale Stellung des Ichs in der psychoanalytischen Konflikttheorie bereits angedeutet. Gemäß dem Lustprinzip, das vollständig betrachtet aus dem Streben nach Lust und dem Vermeiden von Unlust besteht, setzt die Abwehr dann ein, wenn eine Vorstellung mehr Unlust als Lust nach sich ziehen würde. Das wiederum bedeutet, dass eine Tätigkeit des Ichs eintritt, denn zu deren Funktionen gehört die Abwehr. Das Ich ist es also, das zum einen in irgendeiner Weise einen Konflikt aus Lust-Aufsuchen und Unlust-Vermeiden erkennen muss; gemäß dem Instanzen-Modell zwischen Es, Über-Ich und Außenwelt. Auch triebtheoretisch lassen sich Konflikte beschreiben, so etwa zwischen Sexual- und Selbsterhaltungstrieb, zwischen Trieb und Narzissmus oder zwischen Eros und Todestrieb). So heißt es auch, die Verdrängung gehe »von der Selbstachtung des Ichs« aus (Freud, 1914c, S. 160), es ist »die eigentliche Angststätte« (1923b, S. 287) – Zum anderen wird ebenfalls durch das Ich dann mittels der Abwehr eine kompromisshafte Bewältigung eingeleitet. Schon früh spricht Freud vom »abwehrlustige[n] Ich« (1895d, S. 280) und meint zu dieser Zeit vor allem die hemmende Funktion, die das Ich auf den Primärprozess ausübt (vgl. Storck & Billhardt, 2021). Etwas am Ich ist also unbewusst (andernfalls könnte eine psychische Abwehr nicht erfolgreich sein), aber zugleich gibt es eine Selbstbeobachtung und zielgerichtete Konfliktabwehr.
Ein weiteres häufig wiedergegebenes Zitat Freuds betrifft die Folgerungen für die Zielsetzung analytischer Behandlungen. Die Absicht der »therapeutischen Bemühungen der Psychoanalyse« sei, »das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unabhängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation auszubauen, so daß es sich neue Stücke des Es aneignen kann. Wo Es war, soll Ich werden.« (Freud, 1933a, S. 86) Eine erfolgreiche Behandlung zieht es im Verständnis Freuds nach sich, dass das Ich mehr oder andere Bereiche der inneren Welt in den Blick nehmen kann als zuvor.
Auch in der Geistesgeschichte überhaupt hat die Auseinandersetzung mit Ich und Selbst eine lange Tradition, sie taucht in Descartes’ »Ich denke, also bin ich« auf, dessen Hauptgedanke darin besteht, dass es der Zweifel ist, der durch seine Möglichkeit die Existenz des Ichs belegt: Nur wer infrage stellen kann, ob es ihn gibt, kann sich, und zwar darin, seiner selbst gewahr und gewiss sein. Ferner spielen Figuren des (transzendentalen) Ichs oder des Selbstbewusstseins im Deutschen Idealismus oder in der Romantik (das Ich in seiner Naturhaftigkeit oder potenziellen Entgrenzung) eine Rolle. Auch in der, vergleichsweise jungen, Psychologie finden sich leitende Gedanken dazu, allen voran die Unterscheidung zwischen »I« und »me« bei William James. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts werden vermehrt Figuren eines dezentrierten oder flüchtigen Ich (bzw. Selbst) oder Figuren der grundlegenden Selbstentzogenheit oder Selbsttäuschung zum Thema. Für die Psychoanalyse sind besonders diejenigen Aspekte oder Spannungen im Begriff wichtig, die sich gleichsam zwischen den Sprachen zeigen, so etwa das »I« und »me«, das sich nur bedingt in »Ich« und »Mich« (= Ich als Objekt meines Erlebens) übersetzen lässt, aber auch, dass im Englischen Freuds Ich im Instanzen-Modell als »Ego« auftaucht und damit deutlicher vom »Ich« als einer subjektiven Erlebnisperspektive unterschieden ist. Im Französischen schließlich, das wird sich in der Darstellung der Theorie Lacans besonders deutlich zeigen (Kap. 3.3.1 u. Kap. 5.1.3), taucht die Unterscheidung James’ in anderer Form wieder auf, nämlich als »Je« und »moi«, als Subjekt der Aussage und Subjekt des Aussagens.
Wie häufig beim Anliegen einer konzeptuellen Klärung, so ist auch für die Untersuchung von Ich und Selbst eine kurze Skizze über die wichtigsten psychoanalytischen Schulen nützlich. Von Pine (1988) sind vier »Psychologien« der Psychoanalyse unterschieden worden, die Triebtheorie, die Ich-Psychologie, die Selbstpsychologie und die Objektbeziehungstheorie. Darin finden sich bereits terminologisch Ich und Selbst, dabei werden in der Regel Hartmann mit dem Ich und Kohut mit dem Selbst verbunden. Hinzu kommt, dass sich die Richtungen weiter differenziert haben, so ist die strukturale Psychoanalyse Lacans mit ihrer vehementen Kritik am Ich-Begriff der nordamerikanischen Ich-Psychologie zu nennen oder die ebenfalls in Gegenbewegung zur Ich-Psychologie entstandene relationale Psychoanalyse. Die Selbstpsychologie wiederum steht historisch der Säuglings-, Kleinkind- und Bindungsforschung näher. Die Mentalisierungstheorie knüpft dort, wo sie psychodynamisches Denken weiterführt, neben der Theory of Mind, der Bindungsforschung oder der akademischen Entwicklungspsychologie, an verschiedene Richtungen der Psychoanalyse an, am deutlichsten an die Objektbeziehungstheorie.
Im Folgenden geht es um eine kurze Skizze der Entwicklung von Ich und Selbst im Werk Freuds (vgl. zur Begriffsentwicklung z. B. Hartmann, 1956; Laplanche & Pontalis , 1967, S. 184ff.), und zwar in drei Schritten: Erstens geht es um das Ich in seiner hemmenden Funktion, zweitens um die Narzissmustheorie und die Stellung des Selbst darin, sowie drittens um das Ich im Instanzen-Modell.
2.1 Hemmung und Ich-Spaltung
In einer ersten Phase, zwischen 1895 und 1900, erfährt der Ausdruck »Ich« bei Freud eine häufige Verwendung in teils unterschiedlicher Bedeutung, mal im Zusammenhang der Behandlungstheorie, mal in der Abwehrlehre und mal als Teil des psychischen Apparates. Das Ich ist für Freud (1895d, S. 280) hier ein »abwehrlustiges Ich« und taucht als »Stätte des Konflikts« (Laplanche & Pontalis, 1967, S. 188) auf. Ein Konflikt aus Lust und Unlust (auf der Grundlage entsprechender neuropsychologischer Bahnungen) wird »am« Ich deutlich und dieses ist es zugleich, das eine hemmende Wirkung auf Erregungsabläufe ausübt, es steht für den Sekundärprozess und das das Denken. Das Ich ist dafür zuständig, dass auf Erinnerung oder Antizipation und vor diesem Hintergrund auf Regulation zurückgegriffen werden kann, es weiß um vorangegangene Abläufe von Befriedigung oder Frustration. Hartmann (1956, S. 265) spricht vom Ich als einer »Organisation mit konstanter Besetzung«: Statt einem primärprozesshaften Ablauf kann hier auf Dauerspuren zurückgegriffen werden, es kann gleichsam daran »gedacht« werden, unter welchen Bedingungen Befriedigung möglich ist, ohne dass Unlust entsteht.
2.1.1 Die hemmende Funktion des Ichs
Im »Frühwerk«, also im Wesentlichen im zu jenem Zeitpunkt unveröffentlichten Entwurf einer Psychologie sowie in der Traumdeutung stehen Hemmung und Dissoziation bezüglich des Ichs im Zentrum. Freud entwirft hier ein Modell des Bewusstseins als »Sinnesorgan[.] zur Wahrnehmung psychischer Qualitäten« (1900a, S. 620; Sperrung aufgeh., TS). Bewusstsein bedeutet die Wahrnehmung innerer oder äußerer Reize (vgl. zum Folgenden auch Storck & Billhardt, 2021). Freud unterscheidet ferner zwischen Wahrnehmungszellen (ohne Gedächtnis) und Erinnerungszellen (ohne Bewusstsein): Aktuelle Wahrnehmungen hinterlassen Erinnerungsspuren; werden diese erneut als Erinnerung innerlich »wahrgenommen«, dann wird etwas bewusst. Freuds Modell des Psychischen ist dem Reflexapparat nachgebildet (Abb. 2.1), das bedeutet, dass im Ablauf zwischen Wahrnehmung und Motorik prinzipiell die innere Wahrnehmung von Erinnerungsspuren als Er-innerung im ganz eigentlichen Sinn eingeschaltet werden kann – vor dem Hintergrund vorangegangener Erfahrungen lustvoller oder unlustvoller Art. Dabei ist die Differenzierung zwischen zwei »Ablaufsarten der Erregung« (1900a, S. 614) bedeutsam. Während der Primärprozess sich darauf bezieht, dass Erregung unmittelbar in die Motorik überführt wird (also ein unmittelbares Streben nach Befriedigung), besteht im sekundärprozesshaften Denken die Möglichkeit, Abläufe zu hemmen oder umzulenken (unter Berücksichtigung des Realitätsprinzips, der Antizipation etc.). Diese hemmende Wirkung, in welcher der Sekundärprozess dann im Grunde einzig besteht, wird durch das Ich vollzogen: »Wenn ein Ich existiert, muss es psychische Primärvorgänge hemmen.« (Freud, 1950a, S.417)
Das Ich »weiß« um mögliche unlustvolle Folgen vor dem Hintergrund des bei Freud auch neuropsychologischen Systems aus Bahnungen, Wunschanziehungen und Seitenbesetzungen. Lustvolle und unlustvolle Erlebnisse hinterlassen ihre Spuren und im Verlauf der psychischen Entwicklung kommt es zur Bildung einer »Organisation« im Psychischen, »deren Vorhandensein [Quantitäts-]Abläufe stört, die sich zum ersten Mal in bestimmter Weise [d.i. begleitet von Befriedigung oder Schmerz] vollzogen haben.« (1950a, S. 416) Diese Organisation ist das Ich als System konstanter (Seiten-)Besetzungen. Freud beschreibt es auch als »ein Netz besetzter, gegeneinander gut gebahnter Neurone« (a. a. O., S. 417).
Abb. 2.1: Freuds (1900a, S. 546) Modell des psychischen »Reflexapparates« zwischen Wahrnehmung und Motilität unter Einschaltung von Erinnerungsspuren
Denken (als wesentliche Leistung des Ichs) ist für Freud ein Umweg (1900a, S. 609), es soll die »ungefährliche« Befriedigung ermöglichen. Das Ich ist zuständig für die Hemmung des Primärprozesses. Auf dem Weg zwischen Wahrnehmung und Motorik (Ablauf der Erregung) werden – in Gestalt von Erinnerungsspuren – potenziell Hemmungen »zwischengeschaltet«. Das heißt, es erfolgt eine Prüfung, ob »befriedigende« Bedingungen aktuell in der Wahrnehmung der äußeren Realität gegeben sind. Das Ich ist zuständig für den Einbezug von Gedächtnisfunktion und Realitätsprüfung, es leistet potenziell den Triebaufschub.
2.1.2 Ich und Spaltung
Im selben Zeitraum wird neben der hemmenden Funktion des Ichs noch eine weitere begriffliche Komponente benutzt, nämlich die Spaltung des Ichs beziehungsweise im Ich. Mit dieser Phase der Freud’schen Theorieentwicklung wird, zumindest bis 1897, das sogenannte Affekt-Trauma-Modell verbunden (vgl. Sandler et al., 1997), in dem bezüglich der Konzeption neurotischer Störungen der Gedanke zentral ist, dass Affekt und Vorstellung voneinander dissoziiert sind, also voneinander getrennt gehalten werden. Ein Beispiel dafür wäre ein diffuses Angsterleben, ohne dass dies mit Vorstellungen und damit einem Gegenstandder Angst verbunden ist, oder – dann sekundär – mit einem verschobenen Angst-Objekt. Wenn Freud hier von einer Ich-Spaltung spricht, ist keine Spaltung der Persönlichkeit o. ä. gemeint, sondern eine Spaltung zwischen einzelnen Elementen der Vorstellungswelt (Affekt und Vorstellung) beziehungsweise, anders ausgedrückt, die Dissoziation einer Vorstellung oder eines Affekts vom Rest des bewussten Erlebens. Unter den verschiedenen Bedeutungen von Spaltung in der Psychoanalyse (Blass, 2013) geht es hier um die Spaltung als Dissoziation (a. a. O., S: 100ff.), also um die Abtrennung eines Bereichs des Erlebens, worauf sich im frühen Verständnis Freuds die Trennung zwischen bewusst und unbewusst gründet. Er spricht von einer »Spaltung des Bewußtseins« (Freud, 1895d, S. 91; Hervorh. aufgeh. TS) sowie, später, von »durch den Einfluß des Traumas abgespaltenen Anteile[n] des Ichs« (Freud, 1939a, S. 183).
Gegen Ende seines Werks thematisiert Freud (1940e) ferner die »Ich-Spaltung im Abwehrvorgang« im Zusammenhang des Fetischismus, und zwar dahingehend, dass ein Aspekt der wahrgenommenen Realität anerkannt und zugleich verleugnet wird (am Beispiel der Penislosigkeit der Frau dargestellt). Da geht es dann weniger um eine Abspaltung vom Ich o. ä., sondern um ein Auseinanderhalten der an sich widersprüchlichen Ergebnisse der Tätigkeit des Ichs (also zum Beispiel Wahrnehmung und Fantasie). Außerdem spielt das Spaltungskonzept im Hinblick auf das Ich noch eine Rolle im Gedanken einer »therapeutischen Ich-Spaltung« (Sterba, 1934). Damit ist gemeint, dass sowohl Analysandin als auch Analytikerin im Prozess eine Haltung einnehmen (und einzunehmen lernen), in der über dasjenige Beziehungsgeschehen reflektiert werden kann, dessen Teil man unmittelbar ist. »Spaltung« heißt hier, zugleich Teil einer Szene zu sein und auf diese Szene blicken zu können.
2.2 Exkurs: Freuds »Selbstanalyse«
Die ersten Meilensteine in Freuds Werk sind die 1895 mit Breuer veröffentlichten Studien über Hysterie sowie der 1895 niedergeschriebene Entwurf einer Psychologie, außerdem entwirft Freud viele seiner Gedanken in Manuskripten, die er an seinen Freund Wilhelm Fließ schickt (Freud, 1985). Insbesondere im Anschluss an den Tod seines Vaters im Herbst 1896 unternimmt Freud seine von ihm so genannte »Selbstanalyse«. Der Tod hinterlässt bei ihm »ein recht entwurzeltes Gefühl« (Freud, 1985, S. 212f.; Brief an Fließ vom 2.10.1896). Die Zeit zwischen Juni und November 1897 gilt als die Zeit der Selbstanalyse, in der Freud sich unter anderem mit eigenen Träumen auseinandersetzt (viele davon sind in der Traumdeutung publiziert; Freud, 1900a), beispielsweise mit dem »Traum von Irmas Injektion«, der in Freuds Assoziationen dazu einiges von seinen Unsicherheiten über den Wert seiner Arbeit zeigen.
Es ist eine Zeit des Umbruchs, an deren Ende mit der Traumdeutung und der Grundlegung der infantilen Psychosexualität wichtige Werke und konzeptuelle Bestandteile der psychoanalytischen Theorie stehen. Freud geht dazu durch eine persönliche Krise, die mit dem Verlust seines Vaters zu tun hat, sowie mit Überlegungen dazu, wie es mit seiner wissenschaftlichen und nervenärztlichen Karriere weitergehen wird. An Fließ schreibt er: »Ich habe übrigens etwas Neurotisches durchgemacht, komische Zustände, die dem Bewußtsein nicht faßbar sind. Dämmergedanken, Schleierzweifel […] Ich glaube, ich bin in einer Puppenhülle, weiß Gott, was für [ein] Vieh da herauskriecht« (Freud, 1985, S. 271f.; 22.6.1897). Im selben Brief heißt es auch: »Was in mir vorgegangen ist, weiß ich noch immer nicht; irgend etwas aus den tiefsten Tiefen meiner eigenen Neurose hat sich einem Fortschritt im Verständnis der Neurosen entgegengestellt« (a. a. O., S. 272). Freud nutzt diese an sich selbst beobachteten Phänomene zu einem Verständnis dessen, was sich dem Bewusstsein und der Reflexion entgegenstellt, indem er Überlegungen zum Verhältnis von Abwehr und Traum anschließt.
Freud meint wenig später weiterhin: »Der Hauptpatient, der mich beschäftigt, bin ich selbst. […] Die Analyse ist schwerer als irgendeine andere. […] Doch glaube ich, es muß gemacht werden und ist ein notwendiges Zwischenstück in meinen Arbeiten.« (a. a. O., S. 281; 14.8.1897) Die Auseinandersetzung mit der eigenen Innenwelt führt zum konzeptuellen Wandel. Am 21.9.1897 fällt der berühmte Satz: »Ich glaube an meine Neurotica nicht mehr« (a. a. O., S. 283), der die Revision der Verführungstheorie einleitet. Freud meint, seine Theorie, nach der in jedem Fall einer hysterischen Neurose eine konkrete sexuell-übergriffige »Verführung« vorgelegen hat, erweitern zu müssen, indem nun auch der Einfluss von Wunsch, Verbot und Fantasie Berücksichtigung findet (es wird also nicht die Realität von Missbrauchserfahrungen geleugnet, sondern eine weitere Perspektive hinzugefügt). Eine besondere Rolle spielt dabei die Konzeption ödipaler Wünsche und Konflikte, die Freud seiner Selbstanalyse sowie dem Umstand entnimmt, dass die menschliche Kulturgeschichte, namentlich Sophokles’ Drama Ödipus Rex, sich wiederholt mit dem Mord am Vater und dem Hingezogensein zur Mutter beschäftigt hat. In einem Brief vom 15.10.1897 schreibt Freud an Fließ, er habe die »Verliebtheit in die Mutter« und die »Eifersucht gegen den Vater« »auch bei mir gefunden« (Freud, 1985, S. 293). Auch in Auseinandersetzung mit dem, was Freud als seine eigene Neurose bezeichnet, kommen ihm Zweifel am übergriffigen Einfluss des Vaters auf die Neurosengenese. Er reflektiert die Bedeutung eigener Träume und Erinnerungen an das Hingezogensein zur Mutter und gerät so auf den Weg einer Konzeption der Gefühle und Fantasien gegenüber Vater und Mutter. Wiederholt ist eine Art der Selbstbeobachtung die Grundlage für beginnende theoretische Konzeptualisierungen.