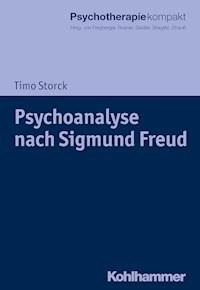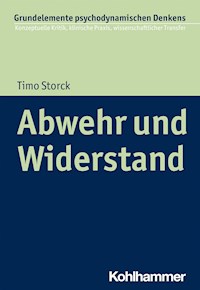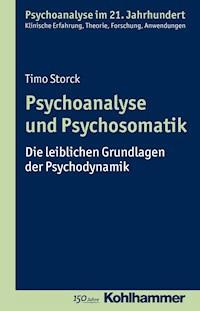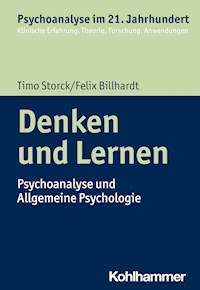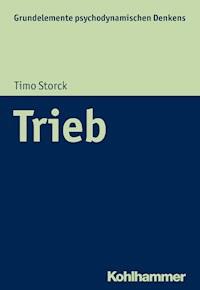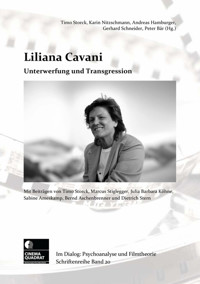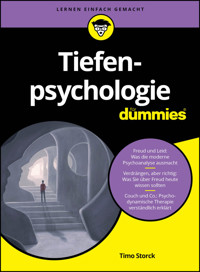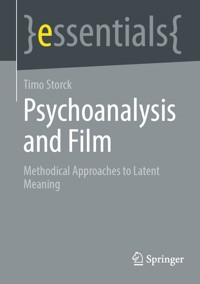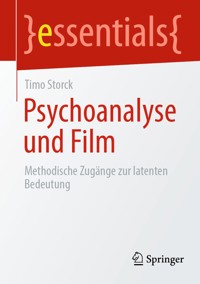Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im vierten Band der Reihe wird das konzeptuelle Feld der psychischen Repräsentanzen erörtert: Was bedeutet es, über sich und andere nachzudenken und mit inneren Bildern von Selbst und Nicht-Selbst umzugehen? Wie entwickelt sich diese Fähigkeit und welche Beeinträchtigungen können auftreten? Das Verhältnis "innerer" und "äußerer" Objekte wird diskutiert, ebenso wie die Frage nach dessen unbewussten Aspekten. Es geht hierbei um einen Blick auf die Entwicklungspsychologie psychischer Repräsentanzen sowie um die Frage nach Veränderungsprozessen. Der therapeutische Schulenvergleich findet genauso Berücksichtigung wie kognitionspsychologische Modelle von Vorstellungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Timo Storck, Prof. Dr. phil., Jahrgang 1980, ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, Psychoanalytiker (DPV/IPA) und Psychologischer Psychotherapeut (AP/TP). Studium der Psychologie, Religionswissenschaften und Philosophie an der Universität Bremen, Diplom 2005. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Bremen (2006–2007), Kassel (2009–2015) sowie an der Medizinischen Universität Wien (2014–2016). Promotion an der Universität Bremen 2010 mit einer Arbeit zu künstlerischen Arbeitsprozessen, Habilitation an der Universität Kassel 2015 zum psychoanalytischen Verstehen in der teilstationären Behandlung psychosomatisch Erkrankter. Mitherausgeber der Zeitschriften Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung und Forum der Psychoanalyse sowie der Buchreihe Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie, Mitglied des Herausgeberbeirats der Buchreihe Internationale Psychoanalyse. Forschungsschwerpunkte: psychoanalytische Theorie und Methodologie, psychosomatische Erkrankungen, Fallbesprechungen in der stationären Psychotherapie, Kulturpsychoanalyse, konzeptvergleichende Psychotherapieforschung.
Timo Storck
Objekte
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036004-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036005-1
epub: ISBN 978-3-17-036006-8
mobi: ISBN 978-3-17-036007-5
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Freuds Theorie einer inneren Welt der Beziehungen
2.1
Trauer und Melancholie
als Ausgangspunkt
2.2 Formen der Internalisierung
2.2.1 Konzeptgeschichtliche Wegmarken der Einverleibung
2.2.2 Hysterische und narzisstische Identifizierung
2.2.3 Begriffliche Unterscheidungen
2.3 Fallbeispiel Linda
3 Die psychoanalytische Entwicklungstheorie der Symbolisierung
3.1 Das Fort-Da-Spiel in Freuds
Jenseits des Lustprinzips
3.1.1 In der Perspektive Jacques Lacans
3.1.2 In der Perspektive Alfred Lorenzers
3.1.3 In der Perspektive einer doppelten psychischen Verneinung
3.2 Die Bedeutung der Verneinung für die Symbolisierung
3.3 Ausgewählte Ansätze zur psychoanalytischen Symbolisierungstheorie
3.3.1 Der Ansatz Melanie Kleins: Introjektion und Projektion
3.3.2 Der Ansatz Alfred Lorenzers: Interaktionsformen
3.3.3 Der Ansatz Jacques Lacans: Das Symbolische
3.4 Fallbeispiel Edward
4 Innere Objekte in Gesundheit und Krankheit
4.1 Der Ansatz Ronald Fairbairns
4.2 Der Ansatz Donald W. Winnicotts
4.3 Der Ansatz Michael Balints
4.4 Der Ansatz Edith Jacobsons
4.5 Entwicklungspsychopathologie der inneren Objekte im Ansatz Otto F. Kernbergs
4.6 Zusammenfassung
4.7 Fallbeispiel Jasmin
5 Das Objekt in psychoanalytischen Behandlungen
5.1 Fallbeispiel Frau A., Teil I
5.2 Die Übertragungsbeziehung als Mittel des Erlebens
5.2.1 Die Bereitschaft zur Rollenübernahme
5.2.2 Formbildung in der analytischen Beziehung
5.3 Fallbeispiel Frau A., Teil II
5.4 Ebenen der analytischen Beziehung
5.5 Fallbeispiel Frau A., Teil III
6 Objekte interdisziplinär
6.1 Der Ansatz Joseph Sandlers
6.2 Die Diagnostik psychischer Objekte
6.2.1 Der Thematische Apperzeptionstest
6.2.2 Die Beziehungsachse der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik
6.3 Mentale Repräsentation aus Sicht der Kognitionspsychologie
6.4 Repräsentation und Repräsentanzen in anderen psychotherapeutischen Verfahren
6.4.1 Systemische Therapie
6.4.2 Gesprächspsychotherapie
6.4.3 Kognitive Verhaltenstherapie
6.4.4 Zur Spezifität psychodynamischer Konzeptionen
6.5 Fallbeispiel Herr T.
7 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Verzeichnis der zitierten Medien
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Beim vorliegenden Band handelt es sich um eine bearbeitete Mitschrift von fünf öffentlichen Vorlesungen, die ich im Sommersemester 2018 an der Psychologischen Hochschule Berlin gehalten habe. Die Vorlesungsreihe ist Teil eines langfristig angelegten Projekts zu den Grundelementen psychodynamischen Denkens, in dem es unter der dreifachen Perspektive »Konzeptuelle Kritik, klinische Praxis, wissenschaftlicher Transfer« darum geht, sich mit psychoanalytischen Konzepten auseinanderzusetzen: Trieb (Band I), Sexualität und Konflikt (Band II), dynamisch Unbewusstes (Band III), Objekte (Band IV), Übertragung (Band V), Abwehr und Widerstand (Band VI) und einige weitere. Ziel ist dabei, sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch im vorliegenden Format einer Reihe von Buchpublikationen eine Art kritisches Kompendium psychoanalytischer Konzepte zu entwickeln, ohne dabei den Anschluss an das Behandlungssetting oder den wissenschaftlichen Austausch zu vernachlässigen. Dazu liegt hiermit der vierte Band vor. Wenn es um Grundelemente psychodynamischen Denkens gehen soll, dann soll damit auch der Hinweis darauf gegeben werden, dass aus Sicht der Psychoanalyse jedes, also auch das wissenschaftliche Denken selbstreflexiv ist: Das Denken über Psychodynamik ist unweigerlich selbst psychodynamisch, d. h. es erkundet die Struktur der Konzeptzusammenhänge auch auf der Ebene der Bedeutung von Konzeptbildung selbst.
Für ein solches Vorgehen ist das Werk Freuds der Ausgangs- und ein kontinuierlicher Bezugspunkt (vgl. a. Storck, 2018c; 2019a). Mir geht es um eine genaue Prüfung dessen, was Freud mit seinen Konzepten »vorhat«, d. h. welche Funktion diese haben und welches ihr argumentativer Status ist. Dabei soll nicht eine bloße Freud-Exegese geschehen, sondern eher ein Lesen Freuds »mit Freud gegen Freud«. Es wird deutlich werden, dass der grundlegende konzeptuelle Rahmen, den Freud seiner Psychoanalyse gibt, es auch erlaubt aufzuzeigen, wo er hinter den Möglichkeiten seiner Konzeptbildung zurück bleibt.
Über den Ausgangspunkt der Vorlesungen erklärt sich die Form des vorliegenden Textes, der nah an der gesprochenen Darstellung verbleibt. Auch sind, wie in jeder Vorlesung, eine Reihe von inhaltlichen Bezugnahmen auf Arbeiten anderer Autoren eingeflossen, die mein Denken grundlegend beeinflussen, ohne dass dazu durchgängig im Detail eine Referenz erfolgen kann.
Bedanken möchte ich mich bei den Teilnehmenden an den öffentlichen Vorlesungen für ihr Interesse, sowie beim Kohlhammer Verlag, namentlich Ruprecht Poensgen, Elisabeth Selch und Annika Grupp, für die Unterstützung bei der Vorlesung und der Veröffentlichung. Außerdem danke ich Caroline Huss für die Anfertigung von Transkripten zur Audio-Aufzeichnung der Vorlesung. Katharina Schmatolla gebührt Dank für die planerische, emotionale und technische Unterstützung bei der Durchführung der Vorlesungen. Der Psychologischen Hochschule Berlin danke ich schließlich für die Möglichkeit, eine solche Vorlesungsreihe durchzuführen.
Heidelberg, Juli 2019Timo Storck
1 Einleitung
In den vorangegangenen Bänden der vorliegenden Buchreihe wurde der Ausgangspunkt vom psychoanalytischen Triebkonzept genommen. Dazu war es erforderlich zu klären, was unter einem (psychoanalytischen, wissenschaftlichen) Konzept verstanden werden soll. Als ein solches soll es dazu dienen, auf der Grundlage eines methodisch geleiteten Zugangs zur Welt der Erfahrung etwas von deren Phänomenen begreifbar zu machen. Das ist zunächst eine ganz allgemeine Definition, die in dieser Form für die Formulierung des Schwerkraftgesetzes genauso gilt wie für die Formulierung eines Konzeptes wie Verdrängung oder Übertragung. Ich stoße auf verschiedene Phänomene in der Welt (oder diese auf mich!), auch in der klinischen Psychoanalyse, und Konzepte sind sozusagen abstrakte Begriffe dafür, die das erhellen sollen, was ich beobachte: dass die Dinge zu Boden fallen, dass ein Patient sich an wichtige emotionale Dinge nicht erinnern kann usw. Konzepte sind so etwas wie die theoretischen Namen dafür, und dies auf der Grundlage eines Zugangs zur Erfahrungswelt, die man in ganz allgemeiner Weise als »Empirie« bezeichnen kann. Erst einmal meint Empirie daher also die Welt der Erfahrung, erst in einem spezifischeren und etwas engeren Sinn das, was meist unter »empirischer Forschung« verstanden wird. Für die Psychologie ist dabei von Bedeutung, dass auch die Welt der inneren Erfahrung einbegriffen wird: »Beobachtung« bedeutet hier dann nicht nur, visuell wahrzunehmen, dass irgendwelche Dinge zu Boden fallen, sondern kann auch eine innere Erfahrung meinen, etwa dahingehend, was für eine gefühlshafte Färbung damit einhergeht. Konzepte sind daher also keine Dinge in der Welt; wir finden sie dort nicht vor, wir sehen nicht die Schwerkraft, sondern wir führen das, was wir sehen, zurück auf das Wirken von etwas, das wir Schwerkraft nennen, d. h. es in dieser Weise konzeptualisieren bzw. in diesem Fall auf eine Formel bringen. Das heißt nicht, dass wir die Schwerkraft als solche beobachten. Genauso wenig beobachten wir theoretische Konzepte der Psychoanalyse in der klinischen Situation. Wir beobachten nicht das Über-Ich oder die Verdrängung, sondern wir stoßen auf etwas, das uns vielleicht irritiert, und die Konzepte machen es begreifbar. Sie liegen auf einer anderen Ebene als das, was wir beobachten – sonst bräuchten wir sie nicht und eine ausschließlich deskriptive Beobachtungssprache würde der Wissenschaft genügen.
Nun kann man Konzepte und ihre Nützlichkeit auf unterschiedliche Weise überprüfen. Zur Schwerkraft und ihrer Wirkung kann ich mir ein Experiment überlegen und angeben, unter welchen Bedingungen bezüglich dessen Ausgangs ich mein Gesetz verändern müsste, wann es also in seiner Gültigkeit (teilweise) widerlegt wäre. Die Prüfung psychoanalytischer Konzepte geschieht auf eine etwas andere Weise, nämlich zum einen angesichts der Einzelfallorientierung, welche die Psychoanalyse im klinischen Zugang wählt. Selbstverständlich werden auch in der psychoanalytischen/psychodynamischen Psychotherapieforschung große Fallzahlen in Untersuchungen einbezogen, aber gerade in der Entwicklung der psychoanalytischen Theorie liegt der Schritt der Verallgemeinerung auf der Ebene der Konzeptbildung und nicht (direkt) auf der Ebene der Vorhersagbarkeit. Damit ist gemeint, dass sich aus dem Einzelfall auch in der Psychoanalyse etwas entwickeln lassen soll, das über diesen Einzelfall hinausgeht – hier allerdings die Konzeptbildung und nicht die Prognose, dass genügend ähnliche Fälle in derselben Weise verlaufen werden. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass die Psychoanalyse so ganz anders wäre als alle anderen, solch eine Herangehensweise an Einzelfallforschung oder Konzeptbildung lässt sich mit anderen methodischen Zugängen verbinden, was zum Beispiel in der empirischen Psychotherapieforschung der Fall ist.
Unter dieser Perspektive auf Konzeptbildung wurde auf das Trieb-Konzept geblickt (Storck, 2018a). »Trieb« sollte als psychosomatisches und sozialisatorisches Konzept verstanden werden, statt als ethologisches oder biologisches. Mit dem Psychosomatischen ist gemeint, dass das Triebkonzept als der Versuch einer psychoanalytischen Antwort auf das Leib-Seele-Problem zu sehen ist. In Freuds Verständnis ist das, was konzeptuell unter »Trieb« firmiert, dafür zuständig, dass wir uns etwas vorstellen können, in ihm ist konzeptualisiert, wie sich Erregung dem psychischen Erleben vermittelt: Was erleben wir von unserer Physiologie, von vegetativen Prozessen, von Berührungserfahrungen? Mit den Berührungserfahrungen ist zudem bereits das Sozialisatorische des Triebes angesprochen: »Triebhaftes« hat natürlich mit Anatomie und somit auch mit unserer biologischen Ausstattung zu tun, aber in erster Linie wird darin auf Phänomene Bezug genommen, die in Interaktionen gründen. Das bedeutet, Berührung durch eine andere Person fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise an und das Triebkonzept versucht, etwas darüber zu sagen, warum wir etwas davon psychisch erleben, warum wir nicht auf der Ebene von Körperlichkeit stehen bleiben, sondern etwas als lustvoll oder unlustvoll erleben können. Vorgänge, welche die Psychoanalyse als triebhaft bezeichnet, gründen immer in zwischenleiblicher Interaktion und somit in Beziehungen.
Der konzeptuelle Gedanke, dass der Trieb physiologische Erregung dem Erleben vermittelt, hat dazu geführt, die psychoanalytische Triebtheorie als eine allgemeine Motivationstheorie zu kennzeichnen. Sie beschreibt nicht spezielle Motive, auch wenn es in Darstellungen der Triebtheorie manchmal so scheint, etwa dergestalt, dass aus psychoanalytischer Sicht hinter jedem Gedanken oder Gefühl ein sexuelles Motiv stecken würde. Die Triebtheorie ist jedoch insofern eine Theorie der allgemeinen Motivation, als in ihr gefasst ist, warum wir überhaupt psychische Erlebnisse oder Repräsentationen haben können. In diesem Sinn kann auch, mit Freud über Freud hinausgehend, von einer monistischen Konzeption des Triebes gesprochen werden: Statt von einem Triebdualismus, einer Gegenüberstellung zweier Triebarten zu sprechen, wäre es geeigneter, Trieb als eine ins Psychische drängende Kraft zu begreifen, wobei Erlebnisqualitäten erst auf einer nächsten Ebene hinzutreten. Die spezielle Theorie der Motivation ist in der psychoanalytischen Konfliktkonzeption zu sehen (Storck, 2018b). Mit der Abwendung von einer dualistischen Konzeption des Triebes ist nun allerdings nicht gemeint, Triebhaftigkeit als etwas Harmonisches oder Einheitliches zu sehen. Freuds Annahme von etwas Partialem am Trieb behält Gültigkeit. Er beschreibt gerade in der kindlichen, also der prägenitalen Sexualität unterschiedliche Arten von Lust- und Unlusterfahrungen in der oralen, analen oder phallisch-ödipalen Phase. Es geht ihm dabei um eine Beschreibung verschiedener Körperbereiche und Lust- und Befriedigungserfahrungen, die in den ersten Lebensjahren noch nicht unter einem großen Ganzen vereinheitlicht sind.
In der Auseinandersetzung mit dem psychoanalytischen Verständnis ist besonders wichtig, die erweiterte Auffassung von Sexualität zu beachten, erst dann ist die Rede von einer kindlichen/infantilen Sexualität plausibel und gewinnt ihre argumentative Stärke. In den ersten Lebensjahren wünschen sich Kinder – außer im Fall überaus gravierender Entwicklungsbelastungen! – nicht genitalen Verkehr mit den Eltern, sondern zärtliche Nähe zu ihnen. Im Rahmen des erweiterten Begriffs von Sexualität in der Psychoanalyse lässt sich beschreiben, warum frühe Berührungserfahrungen, beispielsweise der Stillvorgang, sexuelle Erfahrungen sind, nämlich insofern sie mit Lust und u. U. auch mit Unlust zu tun haben. Das ist mit infantiler Psychosexualität in der Psychoanalyse gemeint: »prägenitale« Lust als Organisatorin psychischer Strukturen. In diesem Zusammenhang habe ich ferner den Vorschlag gemacht, die berühmt-berüchtigten psychosexuellen Entwicklungsphasen in der Psychoanalyse nicht nur konkret körpernah zu verstehen. Darin hat die orale Phase damit zu tun, dass erste Laute gebildet werden, dass man Bauklötze und alles andere in den Mund steckt, um die Welt zu erkunden. In der weiteren psychischen Entwicklung meint Oralität allerdings eher etwas, das sich in einer thematischen Auffassung beschreiben lässt. Eine »orale Fixierung« bei erwachsenen Menschen meint ja nicht, dass jemand sich alles Neue, was er in der Welt findet, in den Mund steckt und prüft, wie es schmeckt oder sich im Mund anfühlt, sondern es dreht sich eher um ein Thema von Oralität, also von Versorgung: Was brauche ich, wieviel brauche ich davon und von wem, kann ich davon genug bekommen? Diese thematische Lesart gründet sich auf der frühen körpernahen Ebene von Oralität. Ähnliches lässt sich für die anderen psychosexuellen Entwicklungsphasen darstellen.
Bezogen auf die psychoanalytische Konflikttheorie ist es um das Verhältnis von Lust und Erregung zueinander gegangen, um das Verhältnis zwischen Absinken und Ansteigen einer Reizintensität. Bei absinkender Intensität erleben wir Lust, bei ansteigender Intensität Erregung. Dieser Antagonismus aus Lust und Erregung liefert die Grundlage der psychoanalytischen Konflikttheorie, er zeigt die allgemeine Konflikthaftigkeit der menschlichen Psyche, nicht zuletzt deshalb, weil sich in frühen Interaktionen Momente zeigen, in denen dieselbe Interaktion lustvoll/befriedigende und stimulierende Wirkung hat. Ein zweites wichtiges Moment des Konflikthaften betrifft die Vereinbarkeit der Gefühle von Liebe und Hass oder von Wünschen nach Trennung und Verbindung in nahen Beziehungen. Ein großer Bereich psychoanalytischer Konflikttheorie ist außerdem in der Konzeption ödipaler Konflikte beschrieben. Dabei ist der Hinweis wichtig, dass es sich hier in einer zeitgenössischen Lesart (Storck, 2018b) um Überlegungen dazu handelt, wie die Auseinandersetzung mit Generationen- und Geschlechtsunterschieden sowie der unausweichlichen Erfahrung, aus Beziehungen auch passager und relativ ausgeschlossen sein zu können, als ein Entwicklungsmotor für das Psychische fungiert (in erster Linie im Hinblick auf Symbolisierung und die psychische Toleranz von Trennung und Getrenntheit).
Im dritten Teil der Buchreihe schließlich ist es um das dynamisch Unbewusste gegangen (Storck, 2019b). In Auseinandersetzung mit verschiedenen Entwicklungslinien, die sich über die psychoanalytischen Schulrichtungen zeigen, hat sich der Vorschlag ergeben, das dynamisch Unbewusste in der Psychoanalyse als ein Verhältnis innerhalb der Vorstellungswelt zu verstehen, ein Verhältnis der Vorstellungen (und Affekte) zueinander, das bestehen oder unterbrochen sein kann. Dabei handelt es sich um ein Argument gegen die Annahme psychischer Örtlichkeiten und Verortung psychischer Instanzen oder Prozesse. Das Entscheidende ist das Verhältnis von bewussten zu unbewussten Prozessen oder zugänglichen und nicht zugänglichen Elementen unserer Vorstellungswelt. »Unbewusst« ist dann etwas, das sich zwischen den Vorstellungen zeigt, Verbindungen die erlebbar sind oder es nicht sind.
Der bisherige Gang der Darstellung hat die Frage berührt, aber noch nicht genauer behandelt, wie genau das Drängende des Triebes, das Spannungsreiche psychischer Konflikthaftigkeit oder die Verhältnishaftigkeit der Vorstellungen im Sinne eines dynamisch Unbewussten in eine Repräsentation von Beziehung, Selbst und Anderem führt. Hier schließt der vorliegende Band an. Dazu werde ich zunächst Freuds Bemerkungen nachzeichnen, in denen es um Internalisierungsprozesse im Sinne der Aufrichtung des Objekts im Psychischen geht (im Anschluss an die Arbeit Trauer und Melancholie) (Kap. 2) und ferner um die Grundzüge einer Symbolisierungstheorie, wie sie in Freuds Jenseits des Lustprinzips und Die Verneinung angelegt ist. Ich werde ausgewählte weitere psychoanalytische Symbolisierungstheorien (Klein, Lorenzer, Lacan) vorstellen (Kap. 3). Im Anschluss daran werde ich einige psychoanalytische Objektbeziehungstheorien erörtern (Fairbairn, Winnicott, Jacobson, Balint) sowie auf die mögliche »Pathologie« der Objektwelt am Beispiel des Ansatzes Kernbergs eingehen (Kap. 4). Schließlich geht es um die Arbeit »mit« Objektrepräsentanzen in psychoanalytischen Behandlungen (Kap. 5) und – anschließend an eine Darstellung des Ansatzes von Sandler – um einen vergleichenden Blick auf die Kognitionspsychologie und andere psychotherapeutische Verfahren (Kap. 6). Ich schließe mit einem Ausblick auf diejenigen weiteren Fragen, die sich aus dem Gang der Argumentation ergeben haben werden.
2 Freuds Theorie einer inneren Welt der Beziehungen
In der Auseinandersetzung in den vorangegangenen Bänden war der Begriff des »Objekts« im Freudschen Sinn im Rahmen der Triebtheorie aufgetaucht, als eines der vier Elemente des Triebes, neben Drang, Quelle und Ziel (Freud, 1915c, S. 214ff.). »Objekt« meint also zunächst einmal »Triebobjekt«, aus diesem Grund spricht man in der Psychoanalyse auch von personalen Elementen der Vorstellungswelt als Objekten, also Objekten triebhafter Besetzung bzw. Objekten der Vorstellungswelt. Das löst eine Irritation auf, die leicht entsteht, wenn in der Psychoanalyse Sätze wie »Der Patient hat feindselige Objekte« o. ä. fallen, damit sind also nicht Gegenstände gemeint, an denen er sich leicht verletzen kann, sondern die innere Repräsentation anderer Menschen in sogenannten Objektrepräsentanzen. Daher geben auch Laplanche und Pontalis (1967, S. 341) den Hinweis: »Es ist bekannt, daß eine Person, soweit die Triebe auf sie gerichtet sind, als Objekt bezeichnet wird; es liegt nichts Negatives darin, nichts, aus dem sich ergäbe, daß der Person die Qualität als Subjekt verweigert wird.«
Das Triebobjekt ist bei Freud (1915c, S. 215) »das variabelste am Triebe«. In gängiger Lesart soll damit darauf verwiesen werden, dass Triebenergie verschiebbar ist, und dies vor allem »zwischen« verschiedenen Objekten, die jeweils besetzt werden können (das zeigt sich etwa im Traum). Es lässt sich allerdings auch argumentieren, dass das Objekt dasjenige Element des Triebes ist, das am stärksten von der Erfahrung abhängig und insofern der variabelste Teil der menschlichen »Triebausstattung« ist, anders zum Beispiel als die Triebquelle, die viel stärker mit Anatomie zu tun hat, mit körperlichen Gegebenheiten (vgl. zur Rolle des Objekts in der Sexualität auch Blass, 2016). Im Zusammenhang der Triebtheorie taucht der Terminus »Objekt« außerdem noch in etwas anderer Verwendung bei Laplanche (1984, S. 143) auf, wenn dieser vom »Quell-Objekt« des Triebs spricht: »Der Trieb […] ist die Wirkung der konstanten Erregung, die die verdrängten Sach-Vorstellungen, die man als Quell-Objekte des Triebes bezeichnen kann, auf das Individuum und auf das Ich ausüben. Was die Beziehungen des Triebes zum Körper und zu den erogenen Zonen betrifft, so würde man fehlgehen, sie vom Körper her zu verstehen; sie sind die Wirkung der verdrängten Quell-Objekte auf den Körper, und zwar über und durch das Ich«. Laplanche verbindet hier zwei Elemente des Freudschen Triebverständnisses: Quelle und Objekt, indem er darauf hinweist, dass sich die Triebquelle über Objektvorstellungen konstituiert: Etwas kann, zumindest in diesem Verständnis, nur dann zum körperlichen »Ort« werden, an dem Erregung ins Erleben drängt, wenn es Fantasien dazu gibt.
Eine der unklarsten Fragen in der psychoanalytischen Auseinandersetzung mit Objekten besteht darin, ob (und wann) das Konzept ein »inneres« Objekt der Vorstellungswelt meint oder ein »äußeres« Objekt, also eine konkrete andere Person, mit der jemand gerade interagiert. Ein Beispiel soll das erläutern.
In der TV-Serie Wilfred (in der US-amerikanischen Version, nach einem australischen Vorbild) geht es um das Leben von Ryan, einem jungen Mann mit einer Reihe inneren und äußeren Konflikten, der zu Beginn der Pilotfolge (»Happiness«, 2011) seinem Leben ein Ende setzen will. Er leidet an depressiven Zuständen und hat sich von seiner Schwester, einer Ärztin, Medikamente besorgen lassen, von denen er sich nun eine Überdosis verabreicht. Da es sich aber nicht um die Tabletten handelt, die er einzunehmen meinte, sondern einen Placebo, überlebt er und am nächsten Morgen klingelt seine Nachbarin Jenna an der Tür, um ihn zu bitten, auf ihren Hund Wilfred aufzupassen, während sie zur Arbeit fährt. Ryan sieht, anders als alle anderen, Wilfred nicht als Hund, sondern als einen Mann im Hundekostüm – und kann sich auch mit ihm unterhalten. Wilfred verkörpert dabei das, was Ryan wenig zur Verfügung steht bzw. wenig in sein unsicheres und zweifelndes Selbstkonzept integriert ist: Wilfred macht sich sofort breit in Ryans Wohnung, verlangt nach Wasser und DVDs – und beteuert, nicht zu beißen. In einer weiteren Szene gräbt Wilfred (mit einem Spaten) Löcher in Ryans Garten. Er tut es eigenen Angaben zufolge, um seinen Stress angesichts der Abwesenheit Jennas abzubauen. Er und Ryan unterhalten sich und Wilfred sagt schließlich, Ryan sollte aufhören, der Spielball der anderen zu sein und stattdessen mit ihm, Wilfred, Ball spielen gehen. Beide gehen eine Straße entlang (Wilfred raucht, aufrecht gehend, eine Zigarette) und Wilfred sagt Ryan, er wisse, was er letzte Nacht versucht habe, und zitiert einige Zeilen aus dem Abschiedsbrief, den Ryan verfasst hatte. Als Ryan nachfragt, woher Wilfred das wisse, sagt dieser: »Weil ich Du bin!« – löst es allerdings sofort auf und meint, er habe den Brief herumliegen sehen.
Die Serie veranschaulicht gut die Ausgangslage der Auseinandersetzung mit den Objekten. Hier geht es um einen Mann, der in einer emotionalen Krise ist und die Welt anders erlebt als andere sie erleben, hier indem er einen Hund als Mann im Hundekostüm sieht. Wilfred, so kann man anschließen, lässt sich als inneres Objekt in Ryans Welt beschreiben, weil es um Aspekte des Selbst geht, die nur wenig integriert sind, jedoch nichtsdestoweniger zu Ryan gehören und im Verlauf der Serie zunehmend dem Bewusstsein nahe gebracht werden. So etwas wird nicht erst dann thematisch, wenn wir den Nachbarshund als Menschen erleben, sondern auf einer viel grundlegenderen Ebene. Dann geht es um Fragen danach, wie unsere innere Welt organisiert ist, welche Figuren darin auftauchen etc. Das bringt das Konzept des (inneren) Objekts ins Spiel.
Greenberg und Mitchell (1983, S. 9; Übers. TS) geben den folgenden Hinweis: »Psychoanalytische Zugänge zu Objektbeziehungen werden unendlich kompliziert durch die Tatsache, dass die ›Leute‹, über die ein Patient spricht, sich nicht unbedingt in einer Weise verhalten, die ein anderer Beobachter bestätigen würde.« Unsere inneren Bilder, so wird sich zeigen, entstehen aus der Interaktion mit anderen, aber die Art, in der sie psychisch für uns repräsentiert sind, zeigt, dass es unsere inneren Bilder sind statt bloße Abbilder. Worüber Einigkeit herrsche sei, dass die inneren Bilder »im Psychischen einen Niederschlag der Beziehungen zu wichtigen Personen im Leben des Individuums [konstituieren]« (a. a. O., S.11; Übers. TS). Natürlich sind unsere inneren Bilder (Objekte) meist sehr eng an die Erfahrungen angebunden, die wir in Interaktion mit anderen gemacht haben. Wir stellen uns die Figuren, denen wir begegnen, nicht als komplett anders vor, aber wir machen uns eben unsere Bilder davon. Meistens sind mit »Objekt« andere Menschen gemeint, aber eben unsere Repräsentanz von ihnen. Kernberg etwa schreibt: »Der Begriff ›Objekt‹ in ›Objektbeziehungstheorie‹ müßte genauer ›menschliches Objekt‹ heißen […] Um den gelegentlichen Mißverständnissen in der psychoanalytischen Literatur entgegenzutreten, denen zufolge die Objektbeziehungstheorie nur zwischenmenschliche Beziehungen erforscht, müssen wir darauf hinweisen, daß [… sie] sich besonders mit dem intrapsychischen Bereich, den intrapsychischen Strukturen beschäftigt« (Kernberg, 1976, S. 57). Der Bereich der psychischen Repräsentation der nicht-menschlichen Umwelt hingegen ist ein stark vernachlässigter Bereich, es findet sich allerdings eine dezidierte Auseinandersetzung bei Searles (1960).
Ich versuche eine knappe Arbeitsdefinition zu geben, in welcher Weise im Weiteren auf »Objekte« geblickt werden soll. Das berührt die allgemeine Theorie der Entwicklung der inneren Welt, in der ganz allgemein davon gesprochen werden kann, dass Interaktionen mit anderen sich in Beziehungsvorstellungen niederschlagen. Wir können uns natürlich etwas dazu vorstellen, was zwischen uns und anderen geschehen ist (und auch das, was wir nicht »abrufen« können, hat einen Einfluss auf die Struktur unserer inneren Welt!), und das ist die Basis für Erinnerungsprozesse, Fantasie und Denken. Solche Muster von Beziehungsvorstellungen setzen sich zusammen aus Vorstellungen von uns selbst und anderen in (affektiv gefärbten) Interaktionen. Neben dieser »Richtung« (Interaktionen schlagen sich nieder in Beziehungsvorstellungen) lässt sich nun natürlich ebenso auch die andere Richtung beschreiben, nämlich derart, dass Beziehungsvorstellungen unsere Interaktionen färben. Wir erleben die Welt, und insbesondere die Welt der Beziehungen, auf eine bestimmte Weise, die damit zu tun hat, welcher Erfahrungen wir gemacht haben und welche Vorstellungen von Beziehung uns leitet. Eine wichtige Folgerung daraus ist, dass Analysanden in psychoanalytischen Behandlungen ein Bild ihrer (inneren) Objekte entwerfen, keinen sachlichen Bericht über Figuren in ihrem Leben geben, wie es andere in mehr oder minder der gleichen Weise täten. Wir erhalten einen Einblick in das Erleben der Analysanden. Das hat meist viel mit der interpersonalen Situation zu tun und selbstverständlich liegt eine der Aufgaben einer analytischen Behandlung auch darin, Menschen dazu zu befähigen, sich in interpersonalen Situationen anders geben zu können und dies adäquater bewerten zu können – aber die Arbeit findet in Auseinandersetzung mit den (inneren) Objekten, mit Teilen der Beziehungsvorstellungen statt. Analysanden sprechen über ihre Objektwelt bzw. ihnen wird behandlungstechnisch unter dieser Perspektive zugehört.
Der Begriff der »Vorstellung« wird im Folgenden gleichbedeutend mit »Repräsentanz« verwendet (während ich unter »Repräsentation« den Vorgang des Repräsentierens verstehe). Unter einer Repräsentanz versteht Schneider (1995, S. 13) den »jeweilige[n] affektiv-kognitive[n] Vorstellungskomplex im Hinblick auf das Subjekt selbst (Selbst-Repräsentanz) oder ein Objekt (Objekt-Repräsentanz) als Niederschlag entsprechender phantasie- oder erfahrungsgeleiteter Selbst- und Interaktionserfahrungen«. Weiter heißt es: »Psychische Repräsentanzen können gleichsam als in Internalisierungsprozessen gebildete ›Bausteine‹ der inneren Welt angesehen werden« (a. a. O., S. 13). Repräsentanz meint also, dass wir mit Beziehungsvorstellungen umgehen und aus diesen wiederum Vorstellungen von uns selbst und Vorstellungen von anderen »herauslösen«. Allerdings: Leichter gesagt als getan. Es ist eine große entwicklungspsychologische Aufgabe, zwischen dem, was wir als Teil von uns selbst erleben, und dem, was wir als Teil von anderen erleben, trennen zu können.
2.1 Trauer und Melancholie als Ausgangspunkt
Als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung sollen Arbeiten Freuds dienen (vgl. für einen Überblick und eine »Lese-Anleitung« zu den Freudschen Werken Quinodoz, 2004), von dem üblicherweise gesagt wird, dass er selbst noch keine dezidierte psychoanalytische Objektbeziehungstheorie formuliert habe, allerdings deren Grundzüge. Hier sind zwei Arbeiten besonders wichtig, Trauer und Melancholie (1917e) und Jenseits des Lustprinzips (1920g). Auch davor finden sich Aspekte der Freudschen Theorie, die für eine psychoanalytische Objektbeziehungstheorie relevant sind, beginnend mit dem Konzept der unbewussten Fantasie, ebenso in der Traumdeutung oder in einigen Bemerkungen in den Drei Abhandlungen zurSexualtheorie, wo es zur oralen Phase heißt: »[D]as Sexualziel besteht in der Einverleibung des Objektes, dem Vorbild dessen, was späterhin als Identifizierung eine so bedeutsame psychische Rolle spielen wird.« (1905e, S. 98) Das Aufnehmen von an anderen wahrgenommenen Eigenschaften, so Freud hier, folgt einem konkreten Vorbild des Hineinnehmens. Ich werde in Abschnitt 2.2 genauer darauf eingehen (Kap. 2.2). Ebenso ist in den Drei Abhandlungen die allgemeine Konzeption einer »zweizeitigen Objektwahl« (a. a. O., S. 100f.) von Bedeutung, in der Freud beschreibt, in welcher Weise sich die infantile und die erwachsene Sexualität unterscheidet. Direktere Anknüpfungspunkte finden sich in den beiden genannten späteren Arbeiten.
Ferner ist zu den Vorformen einer Objektbeziehungstheorie bei Freud der Übergang »vom Autoerotismus zur Objektliebe« (Freud, 1908d, S. 151) wichtig. Beide Konzepte und ihr Zusammenhang sind kritisiert worden. Was Freud damit zu sagen versucht, ist, dass in einem frühen Zustand der psychischen Entwicklung noch keine Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst zur Verfügung steht, sondern erst im Stadium der Objektliebe. Erst dann können wir uns Vorstellungen von anderen machen und diese libidinös oder aggressiv besetzen. Freud widmet sich diesem Übergang: Der Autoerotismus, in dem der eigene Körper psychisch besetzt wird, gilt als eine Art Übergangsstadium zwischen einer »primären Identifizierung« (vereinfacht gesprochen: ein Zustand des Identifiziertseins mit der Umwelt, in einem Zustand, in dem »alles eins« bzw. »alles Ich« ist, ohne Grenze zwischen Selbst und Nicht-Selbst) und dem psychischen Besetzen von Objektvorstellungen, also den Vorstellungen Anderer. Ein solches konzeptuelles Problem (wie und wodurch ergibt sich das Vermögen, zwischen Selbst und Nicht-Selbst unterscheiden zu können?) wird im Verlauf noch in anderen Ansätzen thematisch werden.
Freuds dezidierteste Auseinandersetzung mit dem Triebkonzept (und diejenige, auf die ich vornehmlich Bezug genommen habe; Storck, 2018a), die Arbeit Trieb und Triebschicksale, stammt von 1915 und damit in etwa aus derselben Zeit wie Trauer und Melancholie, in der sich die Züge dessen finden, das später Objektbeziehungstheorie genannt wurde. Es wäre dabei irreführend, zwischen einer triebtheoretischen und einer objektbeziehungstheoretischen Sicht allzu strikt zu trennen; nicht nur deshalb, weil »Objekt« terminologisch in der Triebtheorie verankert ist, lohnt es sich, hier den eher psychosomatischen Aspekt der Triebtheorie und den eher repräsentatorischen Aspekt der Objektbeziehungstheorie gemeinsam zu beachten. Trauer und Melancholie ist 1917 erschienen, wurde aber zwei Jahre zuvor verfasst, und steht zeitlich am Vorabend der Entwicklung der »zweiten Topik« des psychischen Apparates (auch Instanzen-Modell genannt; vgl. Storck, 2019b, S. 63ff.), das 1923 ausformuliert wurde und die Strukturen Ich, Über-Ich und Es definiert. Die Themen, mit denen sich Freud in dieser Zeit beschäftigt, sind u. a. Überlegungen zur Bildung des Über-Ichs (Wie werden Gebote und Verbote internalisiert?), also mit der Genese des schlechten Gewissens oder von Schuldgefühlen (auch ausformuliert in Totem und Tabu; Freud 1912/13), und die Frage nach unbewussten Anteilen des Ichs, also Überlegungen dazu, was (dynamisch) unbewusst ist, aber nicht verdrängt – sondern vielmehr für die Verdrängung und andere Abwehrmechanismen verantwortlich zeichnet.
Bergmann (2009, S. 3; Übers. TS) bezeichnet Trauer und Melancholie als die Schrift, »in der Freud die Psychoanalyse in eine Objektbeziehungstheorie transformierte«. Zentral ist darin die Unterscheidung zwischen (gelingender) Trauer und Melancholie (als pathologischer Trauer in Form einer schweren Depression), die sich im Kern auf den Umgang mit Verlusterfahrungen bezieht. Bei der Melancholie ist Freud zufolge »eine außerordentliche Herabsetzung des Ichgefühls« spezifisch, eine »großartige Ichverarmung« (Freud, 1917e, S. 431) bzw. »Störung des Selbstgefühls« (a. a. O., S. 429)1. Außerdem erwähnt Freud ein hohes Maß an Selbstkritik des melancholischen Menschen bzw. »Anklagen gegen sein Ich« (a. a. O., S. 432). Statt nun die Grundlage von Selbstanklagen in Zweifel zu ziehen (es ist ja nicht etwas am Selbst beeinträchtigt, sondern ein Verlust in der Objektwelt erfolgt), betrachtet Freud sie aus einer Art von Binnenlogik und meint: »Er muß wohl irgendwie recht haben.« (a. a. O.) Allerdings gibt der Melancholiker Freud ein »Rätsel« auf: »Nach der Analogie mit der Trauer müßten wir schließen, daß er einen Verlust am Objekte erlitten hat; aus seinen Aussagen geht ein Verlust an seinem Ich hervor.« (a. a. O., S. 433) Es wäre zu erwarten, dass im Anschluss an ein Verlusterleben eine »Leere« im Hinblick auf die Objekte maßgeblich ist, der Melancholiker präsentiert, Freud zufolge, aber eine Leere im Hinblick auf das Selbst. Freuds zentrale Annahme dazu ist, dass dies sich darauf zurückführen lässt, dass »sich ein Teil des Ichs dem anderen gegenüberstellt, es kritisch wertet, es gleichsam zum Objekt nimmt« (a. a. O.). Das steht im Zusammenhang mit seiner Konzeption der Gewissensinstanz, einer »vom Ich abgespaltene[n] kritische[n] Instanz«, das »Gewissen« oder, wie er es später nennen wird, das Über-Ich (Freud, 1923b). Das ist die Erklärung für die Selbstanklage und die Selbstentwertung: »ihre Klagen sind Anklagen« (1917e, S. 434). In der Melancholie sind dies Anklagen, die eigentlich dem verlorenen Anderen gelten: Das Ich nimmt sich die »im Außen« verlorene Person zum inneren Objekt und klagt so gleichsam innerlich sich selbst statt des Objektes an. So wird die Selbstentwertung in ihren Wurzeln in einer aggressiven Regung dem Objekt gegenüber verständlich, vom dem jemand sich im Stich gelassen fühlt.
Als »Schlüssel des Krankheitsbildes« bezeichnet es Freud, dass »man die Selbstvorwürfe als Vorwürfe gegen ein Liebesobjekt erkennt, die von diesem weg auf das eigene Ich gewälzt sind.« (a. a. O.) Freuds Konzeption lautet also folgendermaßen: »Es hat eine Objektwahl, eine Bindung der Libido an eine bestimmte Person bestanden; durch den Einfluß einer realen Kränkung oder Erschütterung von seiten der geliebten Person trat eine Erschütterung dieser Objektbeziehung ein.« Deutlich wird also auch, dass es nicht schlicht um einen konkreten Verlust gehen muss, sondern auch um einen Verlust der Liebe und Zuwendung des Objekts oder der liebevollen Gefühle in einer Beziehung. Das führt zum Abzug der Libido: »Die Objektbesetzung erwies sich als wenig resistent, sie wurde aufgehoben, aber die freie Libido nicht auf ein anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zurückgezogen. Dort fand sie aber nicht eine beliebige Verwendung, sondern diente dazu, eine Identifizierung des Ichs mit dem aufgegebenen Objekt herzustellen.« (a. a. O., S. 435) Der Unterschied zur gelingenden Trauer ist folgendermaßen zu sehen: In dieser würde, nach einiger Zeit, die zunächst vom Objekt abgezogene und ins Ich zurückgenommene Libido, wieder auf ein neues Objekt gerichtet, eine neue Beziehung aufgenommen o. ä. In der Melancholie jedoch bleibt jemand auf der Stufe der zurückgezogenen Libido »stehen«, z. B. die Anhedonie der Depression wird so verstehbar.
Es zeigt sich also auch ein allgemeines Entwicklungsmodell, das in der Melancholie eine Abweichung erfährt. In diesem Zusammenhang fällt eine vielzitierte Wendung Freuds, nämlich: »Der Schatten des Objekts fiel so auf das Ich« (a. a. O., S. 435), was als eine Art von Aphorismus dafür zu nehmen ist, dass die Entwicklung eines Selbst mit der Auseinandersetzung mit »Verlusten« am Objekt zu tun hat, sich also letztlich über die dosierte Erfahrung der Getrenntheit von ihm vollzieht. Das wäre eine Grundform auch von späteren »gesunden« Trauerprozessen. Jemand betrauert einen Verlust und gelangt darüber schließlich zu einem neuen Zugang zur Welt, kann sich anderen zuwenden – in der Freudschen Terminologie: die zwischenzeitlich ins Ich zurückgezogene Libido auf neue Objekte richten statt sie im Selbst einzulagern.
Ein solches Modell »melancholischer« Verarbeitung von Verlusten spielt auch eine wichtige Rolle in zeitgenössischen Modellen zur Psychodynamik der Depression (vgl. zuletzt Huber & Klug, 2016; Böker, 2017; Küchenhoff, 2017), in der diese als pathologische Trauerreaktion verstanden wird, eine aus der man nicht wieder den Weg heraus findet. Dabei wird von der auslösenden Situation eines realen oder fantasierten Verlust des Objektes oder der Liebe des Objektes ausgegangen. Libidinöse Besetzungen werden ins Ich zurückgezogen und die Gefühlsambivalenz, also die widerstreitenden Gefühle gegenüber dem geliebten Objekt, von dem man sich alleine gelassen fühlt, führen zu Anklagen des Objekt. Weil aber infolge des »äußeren« Verlusts das Objekt innerlich aufgerichtet ist, äußern sich diese Anklagen als Selbstanklagen. In einem gelingenden Trauerprozess würden Verluste irgendwann anerkannt und neue Besetzungen möglich, Ambivalenz (positive und negative Gefühle gegenüber dem verlorenen Objekt) durcharbeitbar und ein Weg aus einem Durchgangsstadium gefunden, das sich andernfalls als Depression manifestiert.
Auch wenn der Film Melancholia