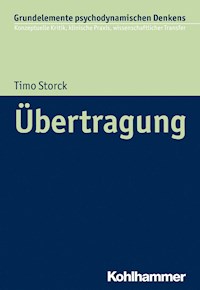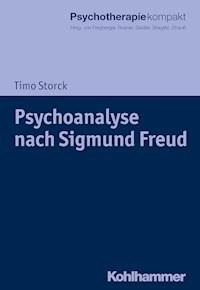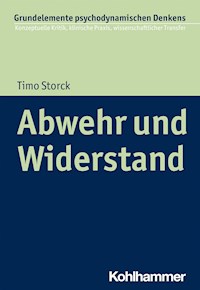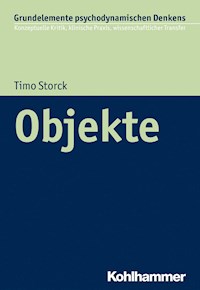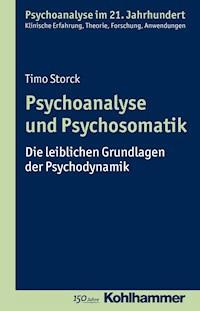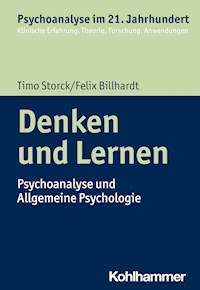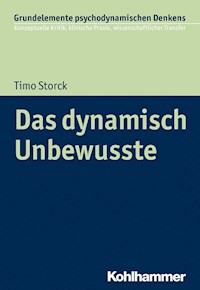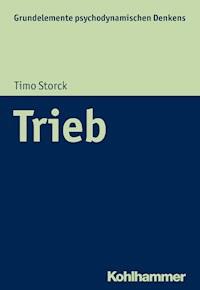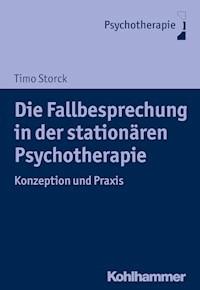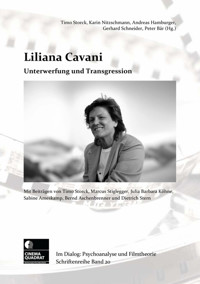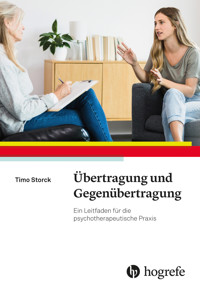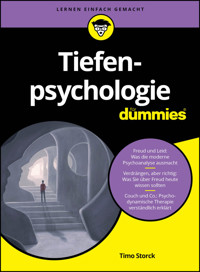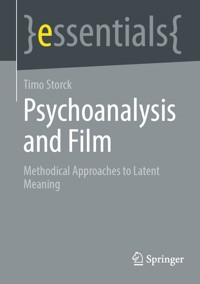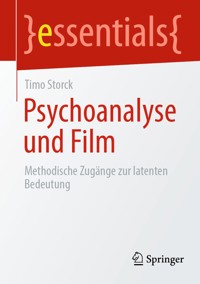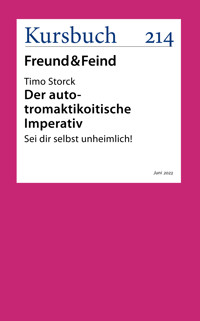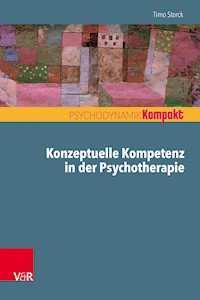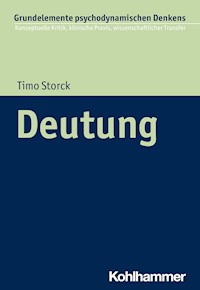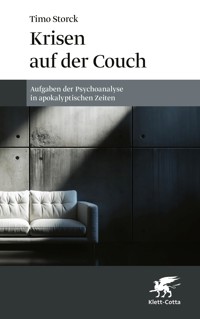
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Analyse kriegt die Krise! Oder? Kann die Psychoanalyse dazu beitragen, allgegenwärtigen Krisen zu begegnen? Klimawandel, Kriege und der Verlust biodiverser Lebensräume sind heute allgegenwärtig und können existenzielle Krisen bei den Menschen auslösen. Denn Verunsicherungen, die mit einem Verlust der Welt, wie wir sie kannten, zu tun haben, mobilisieren Ängste. Wie können wir mit diesen umgehen, ohne dass Erstarrung, Entwürdigung oder Ausgrenzung anderer sich Bahn brechen? Timo Storck nutzt die Methode der Psychoanalyse und das Bild eines (post-)apokalyptischen Denkens dazu, das Erleben des Menschen angesichts von Zeitlichkeit und grundlegender Veränderungen in der individuellen und sozialen Welt in den Blick zu nehmen. Dabei spielen psychische Erkrankungen des Individuums ebenso eine Rolle wie eine Untersuchung der großen Krisen unserer Zeit. Was hilft? Der Weg zur Möglichkeit eines inneren und äußeren Dialogs und ein emotionales Gehaltensein angesichts grundlegender Verunsicherung. Dann wird Zukunft vorstellbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Timo Storck
Krisen auf der Couch
Aufgaben der Psychoanalyse in apokalyptischen Zeiten
Klett-Cotta
Impressum
Prof. Dr. Timo Storck
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart, unter Verwendung einer Abbildung von dango / Adobe Stock
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Maren Klingelhöfer
Projektmanagement: Ulrike Albrecht
ISBN 978-3-608-98877-2
E-Book ISBN 978-3-608-12429-3
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20709-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Kapitel 1
Einleitung: Kriegt die Psychoanalyse die Krise?
1.1 Problematische Zustände
1.1.1 (Mit) Verunsicherung umgehen
1.1.2 Verunsicherung: Wege des Verstehens und der Veränderung
1.1.3 Die Psychoanalyse als Zugangsweise: Gesundheitsbegriff und emanzipatorischer Zugang
1.2 Was ist Psychoanalyse?
1.2.1 Das Unbewusste und seine Schicksale
1.2.2 Beziehungsweise: Psychoanalytische Zugänge
1.2.3 Die Psychoanalyse in der Krise
1.3 Was ist (Post-)Apokalypse?
1.3.1 Apokalyptisches und Postapokalyptisches
1.3.2 Dystopie und Utopie
1.3.3 Aufgaben der Psychoanalyse in postapokalyptischen Zeiten
Kapitel 2
Zugänge zu Krisenzuständen und krisenhaften Prozessen
2.1 Die klinische Methode der Psychoanalyse
2.1.1 Zerlegen
2.1.2 Die analytische Beziehung
2.1.3 Die analytische Haltung
2.1.4 Deuten
2.2 Was ist »Angewandte Psychoanalyse«?
2.2.1 Drei Probleme im Methodentransfer
2.2.2 Das gesellschaftlich Unbewusste und die Frage der Deutung
2.2.3 Reichweite und Grenzen der Psychoanalyse
2.3 Bewegte Zeiten: Zeitlichkeit als Kategorie des Denkens auf individueller und kollektiver Ebene
2.3.1 Zeit als Zustandsverhältnis
2.3.2 Zeitrichtungen
2.3.3 Implizites und explizites Zeiterleben
2.3.4 Fear of Breakdown
2.3.5 Fallen und Gehaltenwerden als Momente der Subjektwerdung
2.3.6 Nachträglichkeit
2.4 Umgang mit Endlichkeit
2.5 Die Psychodynamik des Wartens
2.6 Was ist »Zeitgeschehen«?
Kapitel 3
Subjektive Zeit und Weltuntergang in psychischen Erkrankungen
3.1 Psychische Gesundheit
3.2 Störungsmodelle und Veränderungsmodelle
3.2.1 Psychische Störungen und (unbewusste) Konflikte
3.2.2 Psychische Störungen und Struktur
3.2.3 Veränderungsmodelle in der Psychoanalyse
3.3 Das Vermögen, sich selbst auf die Couch zu legen
3.4 Zeiterleben und psychische Erkrankung
3.5 Schizophrenie
3.5.1 Zeitlichkeit und Schizophrenie
3.5.2 Untergangsvorstellungen und Schizophrenie
3.6 Depression
3.6.1 Zeitlichkeit und Depression
3.6.2 Untergangsvorstellungen und Depression
3.7 Angststörungen
3.7.1 Zeitlichkeit und Angststörungen
3.7.2 Untergangsvorstellungen und Angststörungen
3.8 Traumafolgestörungen
3.8.1 Zeitlichkeit und Traumafolgen
3.8.2 Untergangsvorstellungen und Traumafolgen
3.9 Demenz
3.9.1 Zeitlichkeit und Demenz
3.9.2 Untergangsvorstellungen und Demenz
3.10 Bemerkungen zur Methode I: Klinische Modellbildungen
Kapitel 4
Das Ende des Menschen: Posthumanismus oder Postinhumanismus?
4.1 Der bedeutungslose Mensch von heute
4.1.1 Zum Verhältnis von Mensch, Welt und Planet
4.1.2 Posthumanismus
4.1.3 Bemerkungen zur Methode II: Gesellschaftsbezogene Modellbildungen
4.2 Klimawandel
4.3 Politische Radikalisierung und Gewaltausübung
4.4 Geopolitische und klimabedingte Migration
4.5 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Kapitel 5
Zeitenwenden: Über den emanzipatorischen Auftrag der Psychoanalyse
5.1 Was ist Veränderung?
5.2 Die »gesunde« Gesellschaft und die vier Aufgaben der Psychoanalyse
5.3 Katastrophische Veränderung und dialogisch-differente Resonanz
5.4 Zeiterleben und Verunsicherungstoleranz in postapokalyptischer Gesundheit
5.4.1 Grenzen der Psychoanalyse und interdisziplinäre Räume
5.4.2 Das dynamisch Ungewusste: Psychoanalyse und
Futures Literacy
Kapitel 6
Postapokalyptische Folgerungen: Vorträglichkeit
Literatur
Stichwortverzeichnis
Zum Autor
Kapitel 1
Einleitung: Kriegt die Psychoanalyse die Krise?
Der Eindruck einer gegenwärtigen Krisenzeit, den man leicht gewinnen kann, wenn man Entwicklungen in (Welt-)Politik, Klimawandel und anderen Bereichen in den Blick nimmt, entsteht nicht ohne Grund: Es herrscht ein Gewahrsein ganz unterschiedlicher Problembereiche, die eine verunsichernde Aussicht auf die Zukunft in sich tragen. Dabei sollte nicht übergangen werden, dass, frei nach Adorno (Interview mit dem SPIEGEL vom 4. 5. 1969, zit. n. Kirchhoff, 2023, S. 41), auch »gestern« die Welt schon nicht in Ordnung schien. Und auch wenn wohl zu sagen ist, dass vor allem im Globalen Norden ein Gewahrsein dessen, in einer Krisenzeit zu leben, stärker aufgekommen ist als zuvor, während es doch zu anderen Zeiten und in anderen Teilen der Welt nicht erst seit kurzem krisenhaft, verunsichernd und lebensbedrohlich gewesen ist, so sind doch ein bestimmtes »Krisennarrativ(1)« und dessen ganz reale Grundlagen ins Zentrum des allgemeinen Bewusstseins gerückt.
1.1 Problematische Zustände
Es fällt nicht leicht, Kriege auf der Welt, radikalisierte politische oder religiös-fundamentalistische Systeme, den Klimawandel samt dem Verlust an Biodiversität(1), erzwungene Migrationsbewegungen(1) (aufgrund von Krieg, Armut oder den Folgen des Klimawandels) sowie verschiedene Phänomene dessen, was »gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit(1)(1)« genannt worden ist (und damit Rassismus, Misogynie, (1)(1)(1)Homo- oder Transphobie, Antisemitismus(1) oder Antiislamismus(1), Xenophobie(1) u. a. vereint; vgl. die von Heitmayer herausgegebene Buchreihe »Deutsche Zustände«, in deren Umfeld das Konzept erstmals auftaucht), in ein gemeinsames Erklärungsmodell zu bringen bzw. deren Gründe und Folgen auf dieselben Aspekte zu zentrieren. Versucht man es dennoch, so entsteht auf einer sehr allgemeinen Ebene doch der Eindruck einer den Phänomenen und Dynamiken zugrundeliegenden massiven Verunsicherung und einer Art des Umgangs damit, der immer wieder in Richtung von Ausgrenzung und Spaltung zu entgleiten droht, die in konkreter Entwürdigung, Gewalt oder Vernichtung resultieren.
1.1.1 (Mit) Verunsicherung umgehen
Manche der genannten Phänomene scheinen dabei eher als »primär« gekennzeichnet zu sein als andere. Dazu gehören der Klimawandel(1) (und mit ihm die Folgen für menschliche und nichtmenschliche Lebensräume auf dem Planeten, einschließlich Migrationsbewegungen(2) oder drohender Pandemien(1)) oder verschiedene Dynamiken, die sich aus Prozessen der Globalisierung ergeben, das heißt der ungleichen Verteilung von Gütern und finanziellen Erträgen oder der »Inbesitznahme« von Regionen des Planeten mit dem Ziel wirtschaftlichen Gewinns. Andere der genannten Phänomene könnten eher als »sekundär«, also als deren Folgen, charakterisiert werden, wie politische und religiöse Radikalisierung (samt erzwungener Migration), das Führen von Kriegen oder die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Damit soll zwar nicht behauptet sein, die hier als »primär« gekennzeichneten Phänomene und Prozesse (Klimawandel und Globalisierung(1)) wären nicht selbst auch die Folgen anderer Prozesse und würden nicht durch manche Elemente der hier als »sekundär« bezeichneten Prozesse intensiviert. Vielmehr geht es mir darum, dass Klimawandel und Folgen der Globalisierung(1) einen starken und zunehmenden Einfluss auf gesellschaftliche Spannungslagen haben; ihnen wiederum zugrundeliegend kann etwas gesehen werden, das Weintrobe (2021) als »Exzeptionalismus(1)« bezeichnet und ich unter das Schlagwort der (menschlichen) »Inbesitznahme« des Planeten gesetzt habe.
Ein zunächst einmal davon unterschiedenes Feld, das gleichwohl in seinen Folgen in die anderen Krisenbereiche hineinwirkt und manche der Dynamiken intensiviert, ist die Bedeutung Künstlicher Intelligenz. Dies stellt zwar nicht für sich genommen einen krisenhaften Zustand oder Prozess dar, bringt aber durchaus Verunsicherungen mit sich – hierin bemisst sich das Ausmaß und nicht zuletzt auch das Tempo gegenwärtiger Wandlungsprozesse. Vieles am Leben, wie wir es gewohnt waren, verändert sich dadurch – bis hin zu ganz konkreten Folgen im Hinblick auf Arbeiten und damit Arbeitsplätze, die nicht länger von Menschen ausgeübt werden müssen bzw. eingenommen werden können. Eine psychoanalytische Betrachtung der Dynamik Künstlicher Intelligenz (1)im Hinblick auf psychische und soziale Prozesse wird im vorliegenden Rahmen allerdings nur am Rande stehen – entscheidend ist für diesen Zusammenhang hier der Beitrag dieser Entwicklung für das Gewahrsein von Wandlungsprozessen und ungewissen Zukunftsentwürfen.
Die Beschreibung einer Vorrangigkeit von Klimawandel- und Globalisierungsfolgen vor anderen Krisenzuständen oder -prozessen soll nicht bedeuten, dass es zwischen der einen und der anderen Gruppe von Krisen keine Wechselwirkungen gäbe oder die eine oder andere ernster oder schwerer zu bewältigen wäre. In Kap. 4 werde ich einen Versuch unternehmen, die verschiedenen Krisenzustände(1), ihre Ursachen und Folgen, in systemischer Betrachtung in ein Modell zu bringen, das zeigt, wie die Elemente aufeinander wirken.
Es geht an dieser Stelle darum, eine Dynamik aufzuzeigen, in der bestimmte Entwicklungen (die natürlich auch in sich als »menschengemacht« verstanden werden sollten) andere Prozesse intensivieren, radikalisieren und ihnen eine bestimmte Form geben. Das Bindeglied zwischen den in dieser Hinsicht primär und sekundär genannten Phänomenen ist, so die These der vorliegenden Untersuchung, die Verunsicherung(1). Prozesse, denen der Mensch unterworfen ist und die er zugleich selbst verantwortet oder lenkt, führen zu Verunsicherung angesichts von Prozessen der Veränderung und diese führt zu bestimmten Prozessen, die (direkt oder indirekt) dem Ziel dienen, Verunsicherung und Ängste zu mindern – meist auf Kosten anderer Gruppen.
Verunsicherung und Angst(1) angesichts von Veränderungsprozessen(1) (die immer auch einen Verlust des Vertrauten und Bisherigen bedeuten und somit Trauerarbeit(1) erforderlich machen) haben mit einer ungewissen Zukunft zu tun und führen in Versuche einer Bewältigung. Diese kann gut oder weniger gut gelingen, sie kann auf Kosten anderer gehen oder nicht, sie kann fragil bleiben, sie kann den Erlebnisspielraum einschränken oder nicht, kurz gesagt: Sie kann in einer Angstvermeidung oder in einer Angstbewältigung bestehen. Sie kann (ganz oder zumindest zu einem großen Teil) kontraphobisch motiviert sein, also vom Drängen, eine Angst nicht länger erleben zu müssen, was in eine bestimmte Form der Kanalisierung von Ängsten führen kann, die mit dem Schaffen und Bekämpfen eines Feindbildes zu tun hat. Sie kann aber auch in einer Art von anerkennendem, spannungstolerantem Umgang bestehen, der sowohl in seiner Auseinandersetzung als auch in seinen Folgen insofern »freiheitlich« ist, als er Offenheit ermöglicht. Dies Form steht mit Hoffnung und Vertrauen im Zusammenhang und ist zugleich etwas, das von der Idee einer Dialogizität getragen wird, und auch etwas, das den Weg in eine Dialogizität(1) mit einem(1) Anderen (also vom Selbst(1) unterschiedenen) ebnet – wie ich am Beispiel des psychoanalytischen Gesprächs und dessen Transfer zu zeigen versuchen werde.
1.1.2 Verunsicherung: Wege des Verstehens und der Veränderung
Was braucht es, um mit Verunsicherung(2) bewältigend umzugehen? Dabei soll »Bewältigung« nicht im Sinne eines erfolgreichen Kampfes gegen etwas verstanden werden, nicht als aktive Überwältigung von etwas, das uns andernfalls passiv überwältigt. Vielmehr soll »Bewältigung« heißen: einen Umgang finden, der mit Anerkennung und potenzieller Gestaltung zu tun hat. Dieser Umgang ist sowohl als psychischer als auch als sozialer nicht auf Aktivität oder Agency reduziert. In einer Untersuchung des Wartens (Baraitser, 2017; Storck, 2024a, b) kann gezeigt werden, dass sowohl Aktivität(1) als auch Passivität(1) eine kontraphobische wie eine freiheitliche Bedeutung haben können (Kap. 2.5).
Der Umgang mit Verunsicherung besteht auf einer ersten Ebene in einem Verstehen. Dabei ist weniger entscheidend, dass das, was verunsichernd ist, in sich bereits bedeutungshaft und damit verstehbar ist (wie im Resilienz-Diskurs zentral). Die Herausforderung besteht ja gerade darin, eine Verunsicherung anzuerkennen, die entsteht, weil – neben den Bewältigungsmöglichkeiten – etwas die Grenzen des Verstehens und Verstehbaren berührt (vgl. Angehrn, 2010). Das Verstehen ist also nicht die Grundlage der Bewältigung – und auch nicht der Bewältigbarkeit. Sondern damit ist eine erste Aufgabe, eine Zielrichtung bestimmt, mit Verunsicherungen einen Umgang zu finden. Ein Verstehen kann der Weg sein, von etwas nicht überflutet zu werden. Es ist dann allerdings ein von Einfühlung in die eigene Affektlage getragenes Verstehen und keines, das zulasten einer solchen Anerkennung die Rationalität und Steuerung absolut setzt (vgl. zu differenzierten Modellen eines Verstehens, das um seine Grenzen weiß z. B. Angehrn, 2010; Küchenhoff, 2013; Warsitz, 1990).
Auf einer zweiten Ebene besteht der Umgang mit Verunsicherung im Hinblick auf konkrete Prozesse der Veränderung und aktiven Gestaltung. Auch hier ist zu betonen, dass es mitnichten um einen Aktionismus geht, der die aktiv-beherrschende Bewältigung absolut setzt. Ebenso ist die Bewältigbarkeit(1) auch auf dieser Ebene nicht die Voraussetzung der Resilienz, sondern diese besteht in einer solchen. »Verändern« soll hier meinen: vom einfühlenden Verstehen der eigenen (nicht zuletzt emotionalen) Lage ausgehend einen Gestaltungsspielraum zu erhalten oder zu gewinnen, in der etwas vieldeutig und offen dahingehend sein kann, wie jemand sich dazu stellt (in Aktivität wie Passivität). Diese Art des Veränderns (des Verändern-Könnens) kann der Weg sein, angesichts von etwas nicht zu resignieren (was ja eine deutlich andere Umgangsweise ist als eine passive). Veränderung-Können wird sich im Verlauf der vorliegenden Untersuchung dabei psychoanalytisch als mit(1) einer »Vorträglichkeit« (avant-coup) in Verbindung stehend kennzeichnen lassen.
Diese beiden Ebenen, Verstehen und Verändern, samt ihren Möglichkeiten und Folgen dahingehend, von verunsichernden Zuständen und Prozessen und deren Wegen in die Zukunft nicht überwältigt zu werden (bzw. überwältigt zu bleiben) und nicht zu resignieren, kennzeichnen einen »freiheitlichen«, potenziellen dialogisch-differenten statt kontraphobischen Weg des Umgangs mit Verunsicherung(1). Sie können einen Schutz vor »Entgleisungen« liefern, das heißt vor eskalativen Wechselwirkungen der unterschiedlichen Krisenzustände und -prozesse aufeinander, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Formen politischer, kollektiver oder individueller Gewalt und Ausgrenzung.
1.1.3 Die Psychoanalyse als Zugangsweise: Gesundheitsbegriff und emanzipatorischer Zugang
Der Zugang dazu, der im vorliegenden Buch gewählt wird, ist ein psychoanalytischer. Die Psychoanalyse(1) kriegt die Krise. Das ist zunächst einmal ein Statement, das ausdrücken soll, dass die Psychoanalyse etwas dazu zu sagen hat, wie der so skizzierte Umgang mit Verunsicherung aussehen kann. Unter Rückgriff auf einen psychoanalytischen Zugang im Hinblick auf Verstehen und Verändern kann die Krise in den Blick genommen und ein Umgang gefunden werden … Oder?
Hat die Psychoanalyse in der Angelegenheit etwas zu sagen? Immerhin war der von ihr behauptete Geltungsbereich von Beginn an weiter als »nur« das Behandlungszimmer und die sich darin zeigenden Aufgaben und Veränderungsmöglichkeiten (etwa in Freuds Blick auf Kulturentwicklung oder Kunst; vgl. z. B. Freud, 1930a).
Zudem war auch ein kritischer Gesellschaftsbezug(1) bei vielen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern bereits früh ein wichtiger Bestandteil (etwa bei Bernfeld, Fenichel, Reich; vgl. z. B. Brunner et al., 2012).
Ein solcher erweiterter Geltungsbereich oder (möglicher wie erforderlicher) kritischer Gesellschaftsbezug begründet sich nun allerdings nicht aus sich selbst heraus. Er ist nicht dadurch methodisch und in seinen Ergebnissen legitimiert, dass es ihn gibt. Für den Gesellschaftsbezug der Psychoanalyse und seine Begründung lassen sich zwei Aspekte benennen:
Erstens sind gesellschaftliche Prozesse relevant für individuelles Erleben, für das Entstehen von psychischen (oder psychosomatischen) Erkrankungen und für das Entwickeln, Beibehalten und Wiedererlangen psychischer Gesundheit. Zweitens, aber darauf werde ich erst später zurückkommen (s. a. Kap. 5), gibt sich die Psychoanalyse (zu Recht) den Auftrag einer auch gesellschaftlichen Veränderung.
Ich beginne mit dem ersten Punkt, der Relevanz gesellschaftlicher Prozesse und Zuschreibungen für Gesundheit(1)(1) und Krankheit.
Als kleiner Einschub sollte hier angemerkt werden, dass gerade unter einem gesellschaftlichen Aspekt die Begriffe Krankheit(1) und Gesundheit(1) sorgsam zu prüfen sind. Erkennt man an, dass individuelles psychisches Erleben (in Glück wie Unglück, Freiheit wie Unfreiheit) nicht von mikro- wie makrosozialen Prozessen losgelöst betrachtet werden kann, dann kann zum einen »die Gesellschaft« krank machen, Gesundung erschweren oder befördern etc. Gesellschaftliche Bedingungen(1) können nicht nur »Stress« ausüben, sie fordern vom Individuum auch Abwehr(1)- und Anpassungsleistungen(1), die nicht nur eine Sozialisierung(1) bedeuten, sondern auch als einengend erlebt werden können.
Zum anderen ist es aber auch eine Frage des gesellschaftlichen Kontextes, was als krank und was als gesund gilt (z. B. im Hinblick auf Teilhabe oder psychosoziales(1) »Funktionsniveau(1)«). Das ist soweit trivial, aber es setzt sich fort in die Frage, was in individuelles Leid führt oder zumindest dazu beiträgt. Wie stellt sich jemand in gesellschaftlich vorgegebenen Positionen dazu, was – in psychischer und psychosozialer Sicht – »peinlich« oder »verboten« ist? Wie geht das Individuum damit um, dass eine Balance zwischen »egoistischer(1)« und »sozialer« Orientierung(1)(1) des individuellen Erlebens und Entscheidens erforderlich ist?
Dies lässt sich besonders gut am Beispiel des Begriffs der Anpassung(1) demonstrieren, der in der Geschichte der Psychoanalyse unterschiedlich diskutiert worden ist. Am prominentesten taucht er bei Hartmann (1939) auf, wenn dieser den Mechanismen der Abwehr(1) die Mechanismen der Anpassung zur Seite stellt. Auch wenn es Hartmann hier eher um einen erweiterten Blick darauf geht, wie das Individuum(1) sich zur sozialen Umwelt stellt (nämlich nicht nur im Sinne einer psychischen Abwehr, sondern auch im Sinne einer durch das Ich vermittelten Weise einer sozialen Orientierung(2), die nicht nur in der Verdrängung besteht), so ist ihm doch vorgeworfen worden, dass gerade zu Zeiten des Nationalsozialismus (und in Zeiten von dessen Aufarbeitung) der Begriff der »Anpassung(2)« nicht zu einer kritischen Reflexion des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft genutzt wurde (vgl. z. B. Lampl-de Groot, 1964). Dies wiederum findet sich am prominentesten bei Erich Fromm (aber natürlich auch beispielsweise in Reichs »Massenpsychologie des Faschismus« von 1933), der einen Begriff der Anpassung gebraucht, der mehr vom Sozialen als vom Individualpsychischen her gedacht wird (vgl. Fromm, 1954).
Damit ist gesagt: Anpassung kann gesundheitsförderlich sein oder krankmachend. Sie kann darin bestehen, auf die Forderungen im Sinn gesellschaftlicher Stimmungslagen oder Normen mittels einer Unterwerfung einzugehen. Sie kann aber auch darin bestehen, Individuelles in einen größeren Rahmen gleichsam einzufädeln. Ebenso kann »Widerstand« ((1)hier vorerst nicht im psychoanalytischen Sinn verstanden, sondern als eine Art des Sichwidersetzens gegenüber einem Anpassungsdruck im Denken und/oder Handeln) einerseits den Charakter eines schlechten, kontraphobischen und auf Bewahrung des Bekannten und Eigenen beruhenden Egoismus haben (auch im Sinne einer Verweigerung), andererseits aber durch einen freiheitlich-gestaltenden Impuls gekennzeichnet sein. Anders gesprochen: Anpassung wie Widerstand können etwas Schließendes oder etwas Öffnendes haben und damit sowohl im Zusammenhang mit Gesundheit als auch mit Krankheit stehen.
Ich komme zurück zur Frage nach dem gesellschaftlichen Einfluss auf Krankheit(2) und Gesundheit(2) bzw. die Zuschreibung des einen oder des anderen an das Individuum. Das Individuum steht in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Prozessen(1). Diese sind kein statischer Fremdkörper, der schlicht in eine Richtung seine Wirkung ausübt. Ebenso wenig ist das Individuum für sich genommen eine Monade, die sich dann aufmacht, Gesellschaftliches zu erzeugen bzw. sich diesem zu widmen. Von daher kann eben auch gesagt werden, dass psychische Gesundheit(1) oder Krankheit(3) nicht schlicht darin bestehen, subjektiv Leidensdruck oder Einschränkungen des Erlebens und Handelns zu spüren: Das wäre eine individualistische Auffassung von Krankheit(1)/Gesundheit(1), in der sich jemand schlicht für gesund oder krank erklären könnte. Und sie bestehen auch nicht schlicht darin, dass eine von außen betrachtende Entscheidung über die Erfüllung bestimmter Kriterien erfolgt: Das wäre eine objektivistische Auffassung von Krankheit(1)(1)/Gesundheit, in der jemand gesund oder krank sein könnte, ohne es zu wissen oder diese Einschätzung zu teilen. Statt einer individualistischen oder einer objektivistischen Verkürzung erkennt der Blick auf die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft an, dass keine der beiden eine statische, dem anderen womöglich vorgängige Größe sein kann, sondern dass das Individuum nirgendwo anders als in seinen sozialen Bezügen entstehen und existieren kann und die Gesellschaft nichts anderes sein kann als das, was durch das Handeln und die Interaktion der Menschen besteht und eine Form erhält. Das löst manche Probleme gleichwohl nur zum Teil: Was genau »die Gesellschaft« ist oder was mehrere Individuen zu einer Gruppe zusammenzufassen erlaubt, bedürfte einer ausführlicheren Diskussion als sie an dieser Stelle geführt werden kann.
Damit ist auch gesagt: Verunsicherung(1) kann an die Gesellschaft(1) herangetragen werden, ebenso wie sie durch diese hergerufen wird. Ich werde auch noch darauf zurückkommen, dass auch die Frage der Angsttoleranz sich in einem sozialen Rahmen bewegt, etwa entlang der Frage, ob jemand seine Angst auf Kosten anderer oder im Rückgriff auf andere zu bewältigen versucht.
Der zweite große Bereich des Gesellschaftsbezugs der Psychoanalyse(1) liegt in ihrem emanzipatorischen Anspruch bzw. Auftrag. Der Psychoanalyse geht es im Behandlungszimmer um Verstehen und Verändern, auf diesem Weg war ja begründet worden, weshalb es sich lohnen könnte, den Umgang mit Verunsicherung unter einer psychoanalytischen Perspektive in den Blick zu nehmen. In ihrem Zugang zu unbewussten Konflikten(1) und Bedeutungen will die Psychoanalyse klinisch Einsicht fördern. Damit ist die Auffassung verbunden, dass Einsicht nehmen zu können, etwas verändert – zum Beispiel es möglich macht, andere Umgangsweisen mit Konflikten(1) zu finden, das heißt psychischen Spielraum zu erlangen. Das Individuum soll befähigt werden (bzw. eigentlich: sich selbst dazu befähigen können), anders als starr, am Bewährten, aber Symptomatischen festhaltend, zu erleben und zu handeln. Bewegt sich die Psychoanalyse dann auf dem Feld von Gesellschaft, dann wäre dieser emanzipatorische Anspruch darin zu sehen, die (latente) Bedeutung gesellschaftlicher Prozesse verstehend freizulegen, damit diese sich nicht länger unerkannt durchsetzen, sondern dort verändert werden können, wo Menschen unter ihnen systematisch zu leiden haben.
Gerade mit diesem letzten Punkt ist allerdings etwas Wichtiges berührt: Es ist nämlich zunächst zu klären, was »Psychoanalyse« im vorliegenden Rahmen eigentlich heißen soll, sowohl in theoretischer als auch in methodischer Hinsicht.
1.2 Was ist Psychoanalyse?
Was unter Psychoanalyse(1) zu verstehen ist, soll hier in zweierlei Weise entwickelt werden, in einem ersten Schritt auf der Ebene der Theorie, in einem zweiten Schritt auf der Ebene der Methode. Beides ist für den Bezug zu Gesellschaftlichem von hoher Bedeutung, es folgt der oft zitierten dreifachen Charakterisierung der Psychoanalyse durch Freud (1923a, S. 211) als einer Behandlungsmethode, einer (allgemeinen) Theorie des Psychischen und einer Methodologie zur Untersuchung psychischer Phänomene und Prozesse.
1.2.1 Das Unbewusste und seine Schicksale
Oft wird zu Recht das (dynamisch) Unbewusste als der spezifische Gegenstand der Psychoanalyse ausgewiesen. Freud (1985, S. 329) benennt die Psychoanalyse deshalb explizit als »Metapsychologie(1)(1)«, weil es ihm um den Einbezug eines psychischen Unbewussten(1) (gegenüber einem naturhaften Unbewussten) geht, genauer gesagt: um den Aufweis, dass es etwas Unbewusstes(1) gibt, das aus psychischen Gründen vom bewussten Erleben ferngehalten wird. Aus diesem Grund ist es auch ein dynamisch Unbewusstes: Es gibt psychische Kräfte, die etwas vom bewussten Erleben(1) fernhalten (die Verdrängung(1)), und psychische Kräfte, die dafür verantwortlich sind, dass es zugleich zurück ins Bewusstsein(1) drängt – da eine Vorstellung einerseits Unlust hervorruft (etwa Scham oder Angst), andererseits aber eben auch Lust, weil sie mit Wünschen verbunden ist.
Im Unterschied also zu einem bloß deskriptiven Unbewussten(1) (wie es auch die Kognitions- oder Neurowissenschaften beschreiben), dessen Unbewusstheit darin besteht, dass es (momentan oder permanent) nicht mit Aufmerksamkeit(1) besetzt ist (oder sein kann), ist das entscheidende Merkmal des psychoanalytischen Unbewussten(1) der Dynamismus widerstreitender psychischer Kräfte(1): Wunsch und Abwehr.
Die psychische Abwehr(1) wiederum wird psychoanalytisch beschrieben als das Einsetzen von Mechanismen, die dafür sorgen, dass etwas nicht oder nur in anderer (entstellter) Form ins bewusste Erleben eintritt. Der Verdrängung(2) kommt dabei eine Sonderrolle zu, weil sie etwas »nur« vom Bewusstsein(1) fernhält, während andere Abwehrmechanismen für eine Umarbeitung(1) einer Vorstellung(1) (bzw. deren Verhältnis zu einem Affekt) verantwortlich sind. Die Verschiebung(1) etwa schafft insofern eine psychische Ersatzbildung(1), als das, was nicht bewusst werden darf, zum Beispiel eine Wut auf die Mutter, in der Folge im Zusammenhang mit einer anderen Person erlebt wird. Die Abwehr setzt ein, wenn etwas mehr Unlust als Lust mit sich bringen würde – die abwehrbedingte Umarbeitung(1) sorgt dafür, dass weniger Unlust erlebt werden muss (z. B. indem etwas weniger peinlich ist oder weniger schuldhaft erlebt wird), so dass es bewusst werden darf, nur eben in entstellter Form. Etwas wird dann als etwas Anderes bewusst, Verbindungen in der Vorstellungswelt(1) bleiben unterbrochen bzw. der Reflexion(1) unzugänglich. Ein Teil der Abwehr hat mit verinnerlichten Geboten und Verboten zu tun, wie man sein oder nicht sein, was man tun oder nicht tun sollte.
Dem liegt ein psychischer Konflikt(1) zugrunde, der letztlich aus der Form besteht, dass das Motiv,(1) zu vermeiden, und das Motiv, Lust(1) zu erlangen (zusammengenommen psychoanalytisch als Lustprinzip(1) formuliert), gegeneinander stehen. In seiner grundlegenden Form bedeutet das, dass Lust beim Absinken der Intensität eines Reizes erlebt wird, Unlust beim Ansteigen (Freud, 1915c, S. 214). Dies lässt sich zu einer Affekttheorie(1) weiterführen, in der es dann primär lustvolle und primär unlustvolle Affekte gibt. Die Abwehr setzt ein, um unlustvolle Affekte(1) (Scham(1), Schuldgefühle(1), Angst(2) u. a.) nicht oder weniger intensiv erleben zu müssen. Konflikte können dabei eher motivationaler Art sein (etwas wollen, aber es nicht dürfen), nämlich wenn Wunsch und Verbot oder widerstreitende Wünsche aufeinanderprallen. Sie können aber auch eher repräsentationaler Art sein. Das ist der Fall, wenn Aspekte des Erlebens(1)(1) des Selbst(1) oder Anderer(1) (»Objekte(1)«) und die damit verbundenen Gefühle im Widerstreit stehen und nicht integriert werden können, etwa wenn liebevolle Gefühle zu einem Gegenüber sich nicht mit ärgerlichen Gefühlen zu vertragen scheinen. Auch dann setzen Abwehrprozesse(1) ein (etwa Spaltung(1)), um unaushaltbare Gefühle(1) in den Griff zu bekommen. Auch Projektion(1) als ein Abwehrmechanismus kann eine wichtige Rolle spielen, nämlich dann, wenn Aspekte des Selbst derart unaushaltbar erscheinen, dass sie nur »am Anderen« erlebt werden können, beispielsweise eine Zuschreibung von Minderwertigkeit(1).
Für die Psychoanalyse ist die (individuelle) psychische Welt(1) »zusammengesetzt« aus Beziehungsvorstellungen(1), aus denen Vorstellungen vom Selbst(1)(1) und Anderen herausgelöst werden können. Es wird von Objektrepräsentanzen(1) gesprochen, wenn es um die inneren Bilder anderer Personen geht, also um die Objekte einer psychischen Besetzung. Interaktionen mit Anderen schlagen sich nieder in solchen Beziehungsrepräsentanzen(1)/-vorstellungen und diese färben wiederum das Erleben und die Gestaltung aktueller Interaktionen. Dabei wird das innere Objekt(1) psychischer Besetzung aufgrund seiner Genese aus Interaktionen mit personalen Anderen auch als Introjekt(1) bezeichnet.
Der Begriff der (Objekt-)Besetzung(1) stammt dabei ursprünglich aus der psychoanalytischen Triebtheorie(1), es geht um die Besetzung mit Libido(1). Dieser Bereich der Triebtheorie wird heute vielfach in Form einer Affekttheorie reformuliert, denn diese erlaubt es, die psychische »Bezugnahme« auf eine Selbst-(1) oder Objektrepräsentanz(2) im Hinblick auf unterschiedliche (Affekt-)Qualitäten(1) zu beschreiben (etwa Liebe, Hass, Ekel …). Das bedeutet jedoch nicht, den psychoanalytischen Triebbegriff(1) in Gänze aufzugeben oder zu ersetzen. Vielmehr kann mit Freuds (1915c, S. 214) Kennzeichnung von »Trieb« als einem »Grenzbegriff« zwischen Psyche und Soma dafür argumentiert werden, dass das Konzept sich gerade auf diejenige (psychosomatische) Vermittlungsfunktion bezieht, die dafür sorgt, dass sich physische Reize dem psychischen Erleben vermitteln. »Trieb« ist eine Bezeichnung dafür, dass das Individuum sich psychisch einen Reim auf seine Empfindungen macht (Storck, 2018a).
Aufgrund des hohen Stellenwerts der Körperlichkeit(1)/Leiblichkeit(1) in der Psychoanalyse behält auch deren Theorie der psychosexuellen Entwicklungsphasen(1) bzw. insgesamt die Konzeption von Sexualität(1) in der Psychoanalyse bis heute eine hohe Relevanz. Dabei wird ein erweiterter Begriff von Sexualität verwendet (Freud, 1905d, S. 32), der diese nicht auf die primären Geschlechtsorgane bzw. auf die genitale Sexualität und deren Erleben beschränkt. Dabei bezieht sich die infantile Sexualität(1) auf lustvolle und unlustvolle Empfindungen im Zusammenhang mit unterschiedlichen Körperregionen oder Organen, und diese Empfindungen werden zunächst noch nicht als integriert erlebt, sondern als fragmentiert. Sexuelle Wünsche(1) bleiben also nicht auf den Wunsch nach Geschlechtsverkehr reduziert.
Das lässt auch die Theorie ödipaler Konflikte(1)(1) in einem genauen Licht erscheinen. Hier geht es in Freuds (z. B. in Freud, 1900a) grundlegendem Modell um die Wünsche des Kindes nach zärtlicher körperlicher Nähe zum einen Elternteil und um die Rivalitätsimpulse gegenüber dem anderen Elternteil. Konflikthaft ist dieses aus Gründen der inneren Struktur der Wünsche(1): Sollte sich beispielsweise der Wunsch erfüllen, der Vater möge von der Welt verschwinden, dann ist dies nicht einfach nur eine Wunscherfüllung oder etwas, für das eine Strafe erwartet wird, sondern immer auch ein schmerzhafter Verlust, denn zum einen ist ein Liebesobjekt verloren, zum anderen geht die Möglichkeit verloren, die Nähe zur Mutter zu regulieren und in dieser Weise letztlich zu vertiefen.
Ohne hierauf an dieser Stelle genauer eingehen zu können (vgl. Storck, 2018b), kann als der Kern ödipaler Konflikte und deren Bewältigung gekennzeichnet werden, dass es um die Herausforderung geht, mit Unterschieden zwischen den Geschlechtern und den Generationen umzugehen, sowie damit, dass es in der Welt Beziehungen zwischen mehr als zweien gibt – also nicht nur diejenigen Zweierbeziehungen, an denen man selbst teilhat. Das Individuum findet in der Welt nicht nur Objekte(2)(2)(1)(1), sondern deren Beziehungen. Das unterstreicht auch, dass die Theorie ödipaler Konflikte sehr wohl auch dort Geltung beanspruchen kann, wo es nicht um die »klassische«, heteronormative Familie geht, sondern ganz allgemein darum, dass das Kind damit konfrontiert ist, dass es mehr als eine Bezugsperson in der Welt gibt und dass Personen, zu denen es in Beziehung steht, auch zueinander in Beziehung stehen können.
Die Linie der Sexualität(2) als motivationale Struktur, aber auch als Aspekt dessen, wie die innere Welt strukturiert ist (im Hinblick auf die Objekte und das Lustprinzip(2)), wird ergänzt durch die Linie der Aggression(1) und die des Narzissmus(1), jeweils auch in einer entwicklungspsychologischen Perspektive. Wünsche und Motive können auch mit aversiven Gefühlen(1) zu tun haben, ebenso mit einer »Besetzung« des Selbst(1)(1) im Sinne des Erhalts oder Wiederherstellens eines positiven Selbstwerts(1).
Psychische Prozesse der Regulierung (von Affekten(1), des Selbstwerts(1) oder der Nähe zu Anderen) spielen aus psychoanalytischer Perspektive eine wichtige Rolle. Zunächst ist dies psychoanalytisch unter dem Begriff des(1) Ichs beschrieben worden, den Hartmann (1956, S. 281) als »System von Funktionen«, also als Bezeichnung für die Summe seiner Funktionen, definiert hat (während die psychischen Vorstellungen der eigenen Person in der Regel als »Selbst(2)« bezeichnet werden). »Ich« ist eine Gruppe von psychischen Fähigkeiten(1), etwa die Realitätsprüfung(1), die Kontrolle der Motilität(1), die Abwehr und andere Fähigkeiten, die letztlich mit Regulierung(1), Differenzierung(1) und Integration(1) zu tun haben. In neueren psychoanalytischen Konzepten ist dies unter Begriffen wie Persönlichkeitsorganisation(1)(1)oder -struktur gefasst (vgl. z. B. Arbeitskreis OPD, 2023).
Eine den Ich-Funktionen etwas übergeordnete Funktion ist die Fähigkeit zur Symbolisierung(1) (bzw. Mentalisierung(1)). Sie beschreibt grundlegend das Vermögen, in einer Welt der Vorstellung leben zu können (ohne dass dies von der Welt der – geteilten – Wahrnehmungen getrennt wäre). Anders als in der Anfangszeit der Psychoanalyse manchmal der Fall, in der es so wirkte, als gäbe es feste Zuordnungen symbolhafter Bedeutungen im Psychischen(1), wird heute in der Psychoanalyse der Prozess der Symbolisierung(1) akzentuiert. Damit ist gemeint, wie jemand sich innere Bilder von etwas (einschließlich der eigenen Affekte) machen kann, und welche. Zu symbolisieren heißt wesentlich, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was (vorübergehend) in der Wahrnehmung abwesend ist, es also solcherart psychisch anwesend zu machen, zu re-präsentieren.
Wie psychoanalytisch auf der Grundlage dieser Konzepte psychische Krankheit(1)(2) oder Gesundheit beschrieben werden können, wird in Kap. 3.2 zum Thema werden. Zunächst geht es um allgemeine Überlegungen zur psychoanalytischen Methode als eine Grundlage für eine Betrachtung, wie diese Methode auf außerklinische Bereiche transferiert werden kann.
1.2.2 Beziehungsweise: Psychoanalytische Zugänge
Die psychoanalytische (Behandlungs-)Methode kann (1)gekennzeichnet werden als ein reflektiertes In-Beziehung-Stehen(1). Daraus ergibt sich die Frage, wie denn dem dynamisch Unbewussten(1) als ihrem Erkenntnisgegenstand (der eine wichtige Rolle bei psychischen Erkrankungen spielt) überhaupt gefolgt werden kann, wenn es doch um ein Unbewusstes geht, das dem bewussten Erleben(2) aus guten affektiven Gründen entzogen bleiben soll. Dynamisch Unbewusstes(2) kann nicht erfragt werden, es zeigt sich nicht, es kann sich aber auch zugleich nicht nicht zeigen. Die entstellte Form, die es in einer psychoanalytischen Behandlung bekommen kann, besteht in der analytischen Beziehung(1).
Die Psychoanalyse nimmt an, dass verinnerlichte Beziehungsmuster(1), also das durch Affekte getragene Verhältnis zwischen Selbst(3)(2) und Objekt, sich in aktuellen Beziehungen reinszenieren. Bestimmte Bedingungen einer psychoanalytischen Behandlung, nämlich vor allem das Couch-Setting(1), die hohe Frequenz an Wochenstunden oder die abwartend-zuhörende Haltung des Analytikers oder der Analytikerin, intensivieren diese Prozesse einer Reinszenierung(1). Das ist in der Psychoanalyse mit dem Begriff der Übertragung(1) gemeint (vgl. Storck, 2025a; Rugenstein, 2024). In der Beziehung zum Analytiker oder zur Analytikerin werden diese Prozesse der Aktualisierung verinnerlichter Beziehungsmuster(2) besonders vertieft, das heißt auch: Die Art der Entstellung, in der das Unbewusste(2) eine Form findet, in der es sich dem bewussten Erleben(3) zeigt, wird hier besonders deutlich und intensiv. Ferner wird davon ausgegangen, dass diese Prozesse der Übertragung(2) charakteristisch für die innere Strukturiertheit des Psychischen(1) bei einem Patienten oder einer Patientin sind – dass also auf diese Weise insbesondere die unbewussten Aspekte des Erlebens von Selbst(1)(1)(1), Objekten oder Motiven erkennbar werden können. Man spricht vom szenischen Verstehen(1), wenn es darum geht, anhand der Szene zwischen Analytiker:in und Patient:in dasjenige in den Blick zu nehmen, was auch andere Szenen zu denen macht, als die sie sich dem individuellen Erleben zeigen (Storck, 2025b). Szenisches Verstehen bedeutet mit Lorenzer (1970), verschiedene einzelne Szenen (berichtete oder in der therapeutischen Beziehung auftauchende) auf eine ihnen zugrundeliegende gemeinsame Struktur (»Situation«) zu befragen.
Mit der Übertragung(3) eines Patienten oder einer Patientin korrespondiert die Gegenübertragung(1), auf Seiten des Analytikers oder der Analytikerin. Neben dem Umstand, dass auch eigene Übertragungsprozesse des Analytikers oder der Analytikerin eine Rolle spielen (aber vor dem Hintergrund von dessen bzw. deren zurückliegender Selbst-Erfahrung leichter erkannt werden sollten als die Übertragungsprozesse auf Seiten eines Patientin oder einer Patientin), ist auch die Rede davon, dass der Analytiker bzw. die Analytikerin in Form der Gegenübertragung auf das »antwortet«, was seitens eines Patienten oder einer Patientin in der Beziehung aktualisiert wird, wie Gefühle und Fantasien. Diese werden analytisch anerkannt und reflektiert, ohne dass sie sich in einem sogenannten Agieren der Gegenübertragung in Handlungen zeigen. Sie sind ein wichtiges Mittel, unbewusste Beziehungsdynamiken zu verstehen. Psychoanalytisch spricht man von einer »therapeutischen Ich-Spaltung(1)« (zuerst: Sterba, 1934), die darin besteht, zugleich ein Beziehungsangebot(1) zu machen (Freud, 1900a